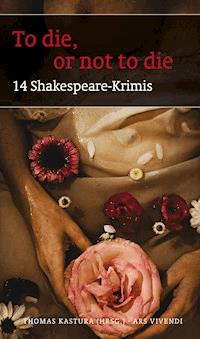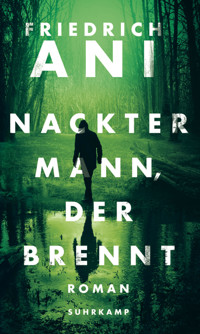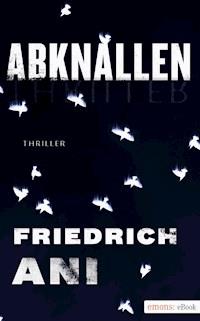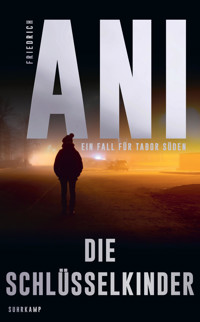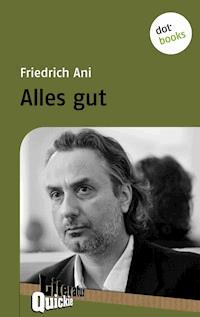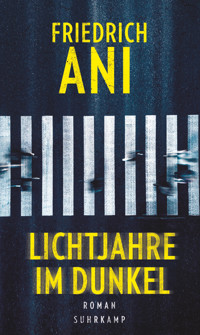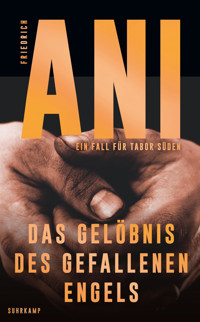Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am 8. April 2002 wird die achtjährige Scarlett Peters zum letzten Mal gesehen. Drei Jahre danach wird Jonathan Krumbholz, ein 24-jähriger, geistig zurückgebliebener Mann, wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Sechs Jahre später bekommt Polonius Fischer, Kommissar bei der Mordkommission in München, von einem Schulfreund der Verschwundenen einen Brief. Er will Scarlett auf der Straße erkannt haben. Ist dem Zeugen zu trauen? Ist Scarlett gar nicht tot - obwohl ihre Mutter für sie ein Grab auf dem Neuen Südfriedhof gekauft hat? Hat die Polizei sich geirrt? Friedrich Ani erzählt in seinem Kriminalroman mit atemloser Spannung die Geschichte eines realen Falles, der alle Sicherheiten in Frage stellt. Polonius Fischer ist zutiefst irritiert: Haben seine Kollegen wissentlich nach einem Sündenbock für einen Mord gesucht, um einen Fall abzuschließen, der die Öffentlichkeit bewegt hat wie kein zweiter?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich Ani
Totsein verjährt nicht
R O M A N
Paul Zsolnay Verlag
eBook ISBN 978-3-552-05484-4
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2009
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
www.friedrich-ani.de
www.hanser-literaturverlage.de
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Nicht alle werden geboren,
welche doch sterben.
Friedrich Nietzsche
Prolog
Am 8. April vor sechs Jahren winkt die Schülerin Scarlett Peters auf der Berger-Kreuz-Straße im Münchner Stadtteil Ramersdorf einem Busfahrer.
Sie trägt eine schwarze Windjacke und einen pinkfarbenen Schulranzen mit gelben Streifen. Es ist Montag, 12.50 Uhr. Die Sonne scheint. Von der Stelle, an der Scarlett innehält, um etwas zu tun, das sie noch nie vegessen hat – der Busfahrer sieht die Neunjährige fast täglich auf ihrem Heimweg von der Schule –, nämlich mit hoch erhobenem Arm und lachendem Gesichtsausdruck zu winken, bis zur Wohnung in der Lukasstraße sind es keine fünf Minuten.
In dieser Zeit muss etwas geschehen sein, für das es keine Zeugen, keine stichhaltigen Beweise gibt.
Natürlich meldeten sich bald Personen, deren Aussagen den Verlauf der Ermittlungen beeinflussten und die Urteilsbegründung mit prägten. Das gerichtsverwertbare Material, das zwei Sonderkommissionen innerhalb von eineinhalb Jahren zusammentrugen, basierte auf Belegen, die als Fakten und damit Beweise für etwas tatsächlich Geschehenes gewertet wurden.
Drei Jahre, nachdem Kurt Hochfellner, Angestellter eines für die Stadt tätigen Busunternehmens, die Grundschülerin Scarlett Peters zum letzten Mal gesehen hatte, wurde ein vierundzwanzigjähriger, geistig zurückgebliebener Mann aus Ramersdorf wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte ein Geständnis abgelegt, das er kurz darauf zwar widerrief, das jedoch nach der Beurteilung eines psychiatrischen Sachverständigen »tatsächlichen Handlungen« entsprochen habe.
Seine Strafe verbüßt Jonathan Krumbholz, genannt Jockel, im Isar-Amper-Klinikum in Haar. Hier war er früher schon einmal vorübergehend untergebracht. Angeblich hatte er mehrere Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren sexuell belästigt, sich vor ihnen entblößt und zu masturbieren versucht. Allerdings hatten die Eltern auf eine Anzeige verzichtet, so dass die Behörden keine Möglichkeit sahen, Jockel dauerhaft in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Nach eigener Aussage habe er auch Scarlett bedrängt, und zwar vier Tage vor ihrem Verschwinden.
Sie sei, sagte er zu Hauptkommissar Micha Schell von der Sonderkommission II, zu ihm gekommen, weil sie Playstation spielen wollte. Er habe dann die Tür seines Zimmers abgesperrt und sich an ihr vergangen. Weder gegenüber ihrer Mutter noch ihren Freundinnen erwähnte das Mädchen in den darauffolgenden Tagen den Vorfall. Als Michaela Peters von der Aussage des Angeklagten erfuhr, erklärte sie, ihre Tochter habe vor einigen Monaten Andeutungen gemacht, wonach Jockel sich »komisch und ekelhaft« benommen habe. Was genau Scarlett damit meinte, konnte ihre Mutter nicht sagen. Am Montag, 8. April – so Jonathan Krumbholz in seinem Geständnis –, lauerte er dem Mädchen auf. Sie drohte, ihn anzuzeigen. Daraufhin habe er sich entschuldigt und sie auf ein Stück Kuchen eingeladen, den seine Mutter frisch gebacken hatte. Scarlett sei »sofort« einverstanden gewesen, weil: »Luisas Schokokuchen ist der leckerste von der Welt.«
Jockel wohnte mit seinen Eltern in der Auflegerstraße, unweit der Lukasstraße.
Niemand hatte Jockel und Scarlett an diesem Tag zusammen gesehen.
In Jockels Zimmer sowie in der gesamten Dreizimmerwohnung fanden die Spurensucher der Kripo keine Hinweise auf Scarletts Ermordung.
Jockel behauptete, er habe mit Scarlett schlafen wollen und sie habe sich gewehrt. Da habe er ihr Mund und Nase zugehalten, so lange, bis sie reglos dalag »und ganz tot war«. Er sei aus dem Haus gelaufen, zum nahen Gasthaus seiner Eltern, und habe seinem Vater alles erzählt. Dieser sei mit ihm zurück in die Wohnung gegangen und habe die Leiche mit dem Auto weggebracht. Wohin, das wisse er nicht.
In dem anthrazitfarbenen Opel Astra wurden weder Fingerabdrücke noch Haar- oder Faserreste, auch keinerlei Blutspuren gefunden.
Von Anfang an bestritt Eberhard Krumbholz, Jockels Vater, die Version seines Sohnes.
Krumbholz hätte nichts zu befürchten gehabt, Strafvereitelung zugunsten eines Angehörigen ist nicht strafbar.
Inwieweit Luisa Krumbholz, die Mutter, in die vermeintlichen Vorgänge eingeweiht war, blieb ungeklärt, sie verweigerte die Aussage.
Mehrere Zeugen wollen Jockel an jenem Montag in Ramersdorf gesehen haben, auch in der Gegend um die Aufleger- und Lukasstraße, jedoch nicht in Gegenwart der Schülerin.
Nach den von den Ermittlern mehrmals korrigierten Zeitfenstern hielt sich Eberhard Krumbholz zwischen 13.30 und 16.30 Uhr nicht im »Akropolis« in der Jäcklinstraße, Ecke Berger-Kreuz-Straße, auf. Nach eigener Aussage und den Erklärungen seiner Frau sowie einiger Gäste war er mit dem Opel zum Tanken gefahren, hatte Einkäufe erledigt und sich danach zu Hause eine Stunde hingelegt.
Er hätte Zeit gehabt, die Leiche des Mädchens wegzuschaffen.
Niemand im Restaurant erinnerte sich an Jockels Auftauchen. Der dickliche junge Mann widersprach sich bei seinen Schilderungen, wie und wo er seinem Vater von dem Verbrechen erzählt hatte.
Der damalige Leiter der Sonderkommission hielt den nach einer frühkindlichen Hirnhautentzündung auf der Entwicklungsstufe eines Zehnjährigen stehen gebliebenen Jockel nicht für einen potenziellen Verbrecher, sondern für einen Sprücheklopfer und Geschichtenerzähler, der alles bestätigen würde, wenn man ihn nur geschickt genug manipulierte. So war es später für den erfahrenen Hauptkommissar aus der Mordkommission keine Überraschung, als Jockel nach nur zwei Tagen sein Geständnis ausgerechnet gegenüber einem Gutachter widerrief. Dieser hatte den vollkommen Erschöpften nach siebenundzwanzig Vernehmungen – protokolliert auf fünfhundertvierunddreißig Seiten – erneut zum Tathergang befragt.
Nach einem Jahr härtester Ermittlungsarbeit im Team mit siebzig Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern, nach der akribischen Auswertung von mehr als fünftausend Hinweisen und der weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinausreichenden Suche nach der Leiche des Mädchens musste der Chef der Soko aufgrund einer bis dahin einmaligen Intervention des Innenministers seinen Platz räumen.
Sein Nachfolger präsentierte innerhalb weniger Tage der Öffentlichkeit den vorher längst befragten Jockel Krumbholz zunächst als Hauptverdächtigen, dann als mutmaßlichen Täter. Trotz einer Unmenge widersprüchlicher und undurchsichtiger Aussagen, trotz der Tatsache, dass weder Scarletts Leiche gefunden werden noch der exakte Ablauf ihrer Ermordung und der Beseitigung ihrer Leiche rekonstruiert werden konnte, trotz zwielichtiger Vernehmungsmethoden, bei denen ein geistig zurückgebliebener Mann ohne Anwalt stundenlang ins Kreuzverhör genommen worden war, trotz des Widerrufs seines Geständnisses und des völligen Fehlens eindeutiger DNA- und Fingerspuren wurde Jockel Krumbholz als Mörder verurteilt.
Scarletts getrennt lebende Eltern zeigten sich vor der Presse erleichtert.
Eberhard und Luisa Krumbholz mussten nach der Verurteilung ihres Sohnes ihr griechisches Restaurant aufgeben. Sie übernahmen ein Pilsstüberl in der Nähe des Michaelibads in Ramersdorf.
Der Leiter der ersten Soko »Scarlett«, der auf Anweisung seines obersten Vorgesetzten abgelöst worden war, arbeitete weiter im Kommissariat III. Sein Name: Polonius Fischer.
Sechs Jahre nach dem Verschwinden von Scarlett Peters und drei Jahre nach der Verurteilung von Jonathan Krumbholz schrieb ein Schüler einen Brief an die Kripo. Er habe eine Beobachtung gemacht, die ihn so erschütterte, dass er keine Nacht mehr schlafen könne. Und obwohl er nach allem, was im Fall Scarlett passiert sei, das Vertrauen in die Arbeit der Mordkommission »eigentlich verloren« habe, wende er sich an den einzigen Kommissar, von dem er überzeugt sei, er werde ihm, Marcel Thalheim, glauben und sich von niemandem einschüchtern lassen.
»Ich habe«, schrieb der Jugendliche am Ende seines Briefes, »Scarlett Peters gesehen, mitten auf dem Marienplatz, unter lauter Leuten. Sie drehte sich sogar zu mir um. Sie hat mich erkannt. Ich wollte sofort zu ihr hinlaufen. Dann habe ich aus Versehen einen Polizisten angerempelt, und der wollte meinen Ausweis sehen. Als ich wieder nach Scarlett Ausschau gehalten habe, war sie verschwunden. Ich bin total sicher, dass sie es war. Sie lebt also, und Sie, Herr Fischer, sind der Allereinzige, der sie finden kann.«
ERSTER TEIL
1 »Auf dem Schulweg und im richtigen Leben«
Sehr geehrter Herr Fischer,
bestimmt wissen Sie nicht mehr, wer ich bin, das macht nichts. Ich heiße Marcel Thalheim, bin sechzehn Jahre alt und gehe in die Wilhelm-Röntgen-Realschule. Vor über sechs Jahren haben Sie mal kurz mit mir gesprochen, und dann habe ich noch bei einem Ihrer Kollegen eine Aussage gemacht, ich glaube, sein Name war Schell, aber sicher bin ich mir nicht. Er hat das, was ich gesagt habe, in seinen Computer geschrieben und ausgedruckt, und ich habe alles unterschrieben. Es ging um Scarlett Peters, die verschwunden war, und niemand wusste, wohin und was überhaupt passiert war. Das war sehr schlimm.
Ich war mit Scarlett gut befreundet. Wir sind fast jeden Tag zusammen in die Grundschule gegangen, wir wohnten in derselben Straße (Lukasstraße). Manchmal hat sie mir von ihrer Mama erzählt, die in einem Krankenhaus arbeitet. Ihren Vater hat sie fast nicht gekannt, weil der ihre Mama bald schon verlassen hat. Wenn ich Scarlett was gefragt habe, hat sie nicht gern geantwortet, sie war immer sehr still. Aber das hat mir nichts ausgemacht, ich bin gern mit ihr zur Schule gegangen. Oft sind wir auch gemeinsam von der Schule nach Hause gegangen.
Wenn irgendwo ein Ball rumgelegen ist, hat sie ihn durch die Gegend geschossen. Fußball spielen fand sie super. Ich habe noch nie ein Mädchen gesehen, das lieber Fußball spielt, als irgendwas anderes zu tun. So war die Scarlett.
Und dann war sie verschwunden, und wir haben alle in der Schule beim Suchen geholfen. Sie ist nicht wiedergekommen. Ich habe sie sehr vermisst. Das Vermissen hat gar nicht mehr aufgehört. Sie sind der erste Mensch, dem ich das sage.
Ich habe alle Zeitungsartikel über Scarlett ausgeschnitten und in einer Schachtel gesammelt. Das weiß niemand. Das Vertrauen in die Mordkommission habe ich eigentlich verloren, in Sie aber noch nicht, Herr Fischer. Sie glauben mir, das weiß ich, und Sie werden jetzt, wenn Sie lesen, was ich erlebt habe, handeln und sich von Ihren Kollegen und Vorgesetzten nicht einschüchtern lassen. Das hoffe ich jedenfalls.
Ich habe Scarlett Peters erkannt …
Zum vierten Mal las er den Brief, den er von zu Hause mitgebracht hatte, und wieder verschwammen die Zeilen vor seinen Augen. Wieder trank er erst einen Schluck Wasser, bevor er über das nachdachte, was da stand und was er längst wusste. Er hatte begriffen, dass er, wenn er immer wieder über die Sätze des Schülers nachdachte, eine Weile von allem anderen verschont wurde, das ihn seit Tagen um den Verstand brachte.
Nie hatte Polonius Fischer so sehr an seinem Verstand gezweifelt wie seit dem Moment, als ein Streifenpolizist ihm die Nachricht von Ann-Kristins Auffindung überbracht hatte. Wir haben sie aufgefunden, sagte der Kollege. In dieser Sekunde glaubte Fischer zu ersticken.
Wie damals in der Zelle. Als er nach endlosem Schreien keine Luft mehr bekam und ohnmächtig wurde.
Geschrien hatte er noch nicht. Auch hatte er nicht das Bewusstsein verloren. Vielmehr hatte er einen Grad von Wachheit erreicht, der ihn umso mehr quälte, je länger er andauerte.
Ann-Kristins Auffindung.
Am selben Abend, gestern, hatte er seine schwarze Reisetasche gepackt und war von seiner Wohnung in der Sonnenstraße in östlicher Richtung gegangen, durch die Fraunhoferstraße den Nockherberg hinauf, mit ausladenden Schritten, in seinem dunkelblauen Wollmantel, den Stetson tief in die Stirn gezogen. Er brauchte nur eine halbe Stunde. Das Zimmer kostete fünfundsiebzig Euro. Den Namen der Pension hatte Ann-Kristin vor Kurzem erwähnt, sie hatte nachts einen Gast dort abgesetzt und ein paar Worte mit der Wirtin gewechselt. Tatsächlich hatte Fischer dieses Gespräch erwähnt, als er im Hotel Brecherspitze anrief.
Warum er das getan hatte, wusste er nicht. Ein Sonderpreis, sagte Anita Berggruen. Vermutlich hätte er auch jeden anderen Preis bezahlt. Das Zimmer ging auf die St.-Martinstraße und die Mauer des Ostfriedhofs, es roch nach Farbe und Politur. Möbel aus hellem Holz, das Bad weiß gefliest, die Wände waren neu gestrichen worden, genau wie unten in der Gaststube.
Von seinem Platz bei der Eingangstür schaute Fischer zu einem langen Tisch, in dessen Mitte fünf Kerzen auf einem pyramidenförmigen Ständer brannten. Die sechzehn Gäste trugen dunkle Kleidung. An Fischers Nebentisch unterhielten sich zwei ältere Frauen über die Krankheiten ihrer Männer, sie lachten viel hinter vorgehaltenen Händen. Auch über Fischer tuschelten sie, und er tat, als bemerke er es nicht.
Er sah auf die Uhr. Eine halbe Stunde war vergangen, und er dachte, wie gern er noch länger warten würde. So hätte er eine Aufgabe. Er strich über das karierte Blatt Papier, lauter krumme, aber gut lesbare Buchstaben, geschrieben mit schwarzem Kugelschreiber.
Sein Wasserglas war leer. Wie für ein offizielles Gespräch hatte er eine Krawatte umgebunden, sorgfältig, vor dem Spiegel, oben in Zimmer 105. Als müsse er gleich ins Dezernat zu einer Vernehmung aufbrechen.
Im P-F-Raum saß kein Verdächtiger. Da war nichts als die zwei kleinen Tische, die Stühle und das Kruzifix an der Wand. In der Schublade des Nachtkästchens in Zimmer 105, fiel Fischer jetzt ein, lag keine Bibel.
Sekundenlang dachte er an das Nachtkästchen und die leere Schublade und an sonst nichts.
Als jemand die Eingangstür öffnete, flackerten die Kerzen am Trauertisch. Fischer nahm das Flackern wahr wie eine sturmvolle Welle in seinem Kopf. Das war es doch, worauf er die ganze Zeit geduldig und unbändig zugleich wartete: dass Ann-Kristin hereinkam und sagte: »Entschuldigung für die Verspätung.«
»Entschuldigung für die Verspätung.«
Hinter der Garderobenwand tauchte ein groß gewachsener Junge mit langen, dünnen schwarzen Haaren auf. Er trug einen abgeschabten schwarzen Ledermantel und hatte Ringe an den Fingern. Sein Gesicht war weiß wie die frisch gestrichenen Wände im Zimmer 105, und er verströmte den Geruch nach ungelüfteten Kneipen.
»Sie sind der Herr Fischer«, sagte er.
Die Trauergäste, die beiden Frauen am Nebentisch, die Bedienung und ein Mann am letzten Tisch in der Ecke, den Fischer erst jetzt bemerkte, sahen den Jungen an. Regungslos ragte er ins kühle Licht der Tropfenlampen. Er blinzelte. Vielleicht hatte er sich geschminkt, vielleicht waren die Schatten unter seinen Augen Zeugnisse eines aufreibenden Lebenswandels.
»Setzen Sie sich«, sagte Fischer.
»Wohin?«
Am Tisch waren fünf Stühle frei. Fischer zeigte auf den Stuhl an der Längsseite.
»Okay.« Ohne den Mantel auszuziehen, nahm der Jugendliche Platz, gekrümmt. Er wusste nicht wohin mit den Händen. Erst legte er die eine Hand, dann die andere auf den Tisch. Er rieb sich über die Oberschenkel und zuckte zusammen, als die Bedienung ihn ansprach.
»Was willst du trinken?«
»Nichts.«
»Ich lade Sie ein, Marcel«, sagte Fischer.
Er zögerte. »Haben Sie Bionade?«
»Nein«, sagte die Bedienung.
»Eine Cola, bitte.«
Die übrigen Gäste wandten sich ab, das Schnuppern der beiden Frauen am Nebentisch blieb unüberhörbar.
»Ich hab gewusst, dass Sie kommen«, sagte Marcel. »Danke für die Mail.«
In dem Brief hatte er seine Adresse angegeben, und Fischer hatte ihm vom Dezernat aus geantwortet – ohne Wissen seines Vorgesetzten, ohne Wissen des Polizeipräsidenten, die den Brief ebenfalls gelesen hatten, ohne Wissen eines einzigen Kollegen. Der Fall war abgeschlossen und Fischer schon am Tag der Urteilsverkündung nicht mehr zuständig gewesen.
Die Bedienung brachte die Cola. »Möchten Sie noch ein Wasser?«
»Später«, sagte Fischer.
Vor ihm lag Marcels Brief in einem braunen Umschlag. Marcel hatte schon mehrmals hingesehen, aber nichts gesagt. Jetzt trank er einen Schluck und warf dem Kommissar einen schnellen Blick zu. Sprich, dachte Fischer, weil er selbst kein Wort hervorbrachte, sprich mit mir, sprich einfach immer weiter.
Nach einer Weile sagte Marcel: »Sind Sie sauer auf mich?«
»Wieso denn?« Fischer beugte sich vor, faltete die Hände im Schoß. Die Stimme des Jungen klang heiser. Aber es war eine Stimme, die Stimme eines anwesenden Menschen.
Wieder musste Marcel zum Weitersprechen Mut fassen. »Sie waren zuständig für die Scarlett. Und Sie hätten sie auch gefunden, wenn Sie sie weiter hätten suchen dürfen, da bin ich total sicher.«
»Ich hätte Scarlett auch nicht gefunden.« Wieso er das gesagt hatte, begriff Fischer nicht.
»Doch. Die anderen haben überhaupt nicht richtig nach ihr gesucht. Die haben gesagt, sie ist tot, und damit war alles klar. Aber ich hab sie gesehen, und sie lebt. Und deswegen sind Sie hier, weil Sie immer gespürt haben, dass sie noch lebt.« Hastig trank Marcel zwei Schluck Cola. »Ich hab sie erkannt und sie mich auch. Wieso ist der Brief in so einem Umschlag? Das ist nicht meiner. Wieso haben Sie einen anderen genommen?«
Fischer zog den Brief aus dem DIN-A5-Kuvert. »Du hast ans Polizeipräsidium geschrieben, meine Kollegen haben den Brief dann an mich weitergeleitet.«
»Haben die den Brief gelesen?«
»Ja.«
»Das ist verboten. Es gibt ein Briefgeheimnis.«
Fischer faltete das beschriebene Blatt auseinander. »Sie sind zu spät gekommen.« Er hörte sich reden wie ein Polizist, der nach einem Alibi fragte. Wieso saß er dann hier, in einem Gasthaus, ohne Protokollantin, ohne Aufnahmegerät? Er hatte keine Befugnis. Sprich, dachte er, sprich doch weiter, Marcel.
Der Schüler blinzelte verwirrt. Unter seiner Antwort schien er sich zu krümmen. »Sie können Du zu mir sagen. Hab nachsitzen müssen, im Sport, zwei Stunden extra Basketball, ich hasse Basketball. Ich mag Sport nicht.« Er griff zum Glas, ließ es aber stehen. »Entschuldigung. Das war wieder so eine fiese Nummer vom Reisinger.«
»Du gehst in die neunte Klasse«, sagte Fischer. Er bildete sich ein, dass die Frauen am Nebentisch wieder über ihn tuschelten.
»Bin in der Achten durchgefallen. Wegen Chemie und Physik. Das war auch so eine Gemeinheit. Eigentlich hätt ich in Physik eine Vier kriegen müssen, aber der Lehrer hat mir im Mündlichen eine Fünf gegeben, weil ich mich nie meld und mitmach. Was soll ich mich melden, wenn ich nichts check?«
»Jetzt in der Neunten hast du bessere Noten.«
»Geht so. Darf ich Sie was fragen?«
Fischer reagierte nicht. Er hatte nicht zugehört, auch nicht den Frauen am Nebentisch. Er hatte wieder das stumme Gesicht gesehen, die Teile des stummen Gesichts, die noch zu sehen waren.
»Sie sehen echt blass aus.« Marcel erhielt keine Antwort. »Sie schauen aus, als hätten Sie ewig nicht geschlafen.« Nach einem Moment fügte er hinzu: »Entschuldigung.« Aus Verlegenheit trank er sein Glas leer. Endlich sah Fischer ihn an.
»Deine Freundin Scarlett wäre heute fünfzehn. Du bist sechzehn, und du warst zehn und sie neun, als ihr euch zum letzten Mal gesehen habt. Du glaubst, sie hat dich wiedererkannt. Du hast dich bestimmt sehr verändert.«
»Nicht so sehr«, sagte Marcel schnell. »Und sie auch nicht. Wenn der Bulle … der Polizist nicht gekommen wär, hätten wir miteinander gesprochen, ganz sicher.«
Fischer richtete sich auf. Ich bin, dachte er, Hauptkommissar, ich führe ein Gespräch mit einem Zeugen, ein informelles Vorgespräch.
»Warum, glaubst du, hat sie nicht auf dich gewartet?«, sagte er.
Anscheinend hatte Marcel sich diese Frage auch schon oft gestellt. »Weil, sie wollt nicht erkannt werden«, sagte er aufgeregt. »Sie hat ein Geheimnis. Sie lebt doch jetzt ein anderes Leben. Sie ist erschrocken, als sie mich plötzlich gesehen hat.«
»Sie ist so erschrocken wie du.«
»Genau. Und dann war da auch noch der Bulle, der hat sie vielleicht auch gesehen. Der hat sie nicht wiedererkannt, ist ja klar.«
»Scarlett führt kein anderes Leben«, sagte Fischer. »Sie hätte keinen Grund dazu.«
»Sie haben überhaupt keine Ahnung.« Marcel schwitzte, rückte mit dem Stuhl, der Ledermantel gab ein Geräusch von sich, seine schwarzen Augen glänzten. »Die Scarlett wollt immer schon ein anderes Leben, die wollt nicht mit ihrer Mutter und der ihren blöden Liebhabern leben, sie wollt weg aus Ramersdorf, sie wollt Fußballspielerin werden, Profi werden. So war die.«
»Sie war neun Jahre alt.«
»Glauben Sie, Neunjährige haben keine Wünsche und Ziele? Glauben Sie, Kinder haben nichts im Hirn, bloß weil sie noch klein sind? Haben Sie Kinder?«
»Nein.« Nein, dachte Fischer, keine Kinder, wir haben keine Kinder. Das stumme Gesicht. Kinderlos.
»Kinder wissen genau, was sie wollen«, sagte Marcel. »Und Scarlett wär sofort mit jemand mitgegangen, der ihr ehrlich versprochen hätt, dass er ein anderes Leben für sie macht. Da wär sie weg gewesen.«
An solche Aussagen – weder von Marcel noch von jemand anderem – konnte Fischer sich nicht erinnern.
»Wahrscheinlich hat sie jemand getroffen, der ihr das versprochen hat. Sonst hätt ich sie ja nicht sehen können. Sie lebt, und sie schaut gut aus. Ich hab sie nur kurz gesehen, zehn Sekunden ungefähr, das hat gereicht.«
»Meinen Kollegen hast du von Scarletts Träumen vor sechs Jahren nichts erzählt.« Wie leicht Fischer dieser Satz gefallen war. Ohne es zu bemerken, verzog er den Mund.
»Sie brauchen gar nicht so zu grinsen, ich verrat doch ihre Träume nicht.«
»Das verstehe ich«, sagte Fischer, verwundert darüber, dass er angeblich gegrinst hatte. Dann dachte er, wie automatisch, als Polizist: Soeben hat Marcel zugegeben, ihn, Fischer, und die Fahndung manipuliert zu haben. Sowohl Marcel als auch Scarletts Mutter hatten behauptet, das Mädchen sei schüchtern gewesen, gegenüber Fremden zurückhaltend und in Gegenwart von Erwachsenen eher abweisend als zutraulich. Diese Einschätzung teilte auch die Grundschullehrerin. Niemand in der Sonderkommission hatte Marcels Taktik durchschaut.
»Scarlett lebt«, sagte der Junge.
Fischer warf einen Blick auf Marcels bleiche, zitternde Hände. »Wenn Scarlett heute ein Leben führt, das ihr besser gefällt als das alte, warum möchtest du dann, dass ich sie finde und zurückbringe?«
»Das möcht ich nicht.«
»Bitte?«
»Ich möcht nicht, dass Sie sie zurückbringen.«
Fischer schwieg. Ohne an etwas anderes zu denken.
»Ich möcht, dass Sie sie finden und ihr sagen, dass ich auf sie wart.«
»Du wartest auf sie«, sagte Fischer gegen seine Sprachlosigkeit an.
»Wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir immer auf uns warten. Auf dem Schulweg und im richtigen Leben.«
Auf dem Schulweg und im richtigen Leben. Vielleicht, dachte Fischer, sollte Marcel aufhören, bestimmte Gräser zu rauchen, und etwas mehr Realität inhalieren.
»Ich werde Scarlett nicht suchen«, sagte er.
»Aber das müssen Sie doch!« Erschrocken senkte Marcel die Stimme. »Ein unschuldiger Mensch sitzt im Gefängnis.«
Und als wäre alles wie immer, erwiderte der Kommissar: »Er ist rechtskräftig verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil bestätigt.«
»Scarlett lebt.« Marcel fingerte in den Taschen seines Mantels. »Sie hat meine Kette getragen auf dem Marienplatz, schwarze runde Steine, die hab ich ihr zum neunten Geburtstag geschenkt. So eine Kette hat sonst niemand. Und die hab ich bei ihr gesehen. Ich schwörs. Außerdem hat sie eine Narbe auf der linken Backe. Hab ich genau gesehen.« Er zog ein Päckchen Tabak aus der Tasche.
»Du hast die Kette und die Narbe wiedererkannt.«
»Ja.«
»Wie weit warst du von ihr entfernt, Marcel?«
»Fünf Meter. Höchstens zehn.«
»Im Gedränge auf dem Marienplatz.«
»Am Faschingssamstag, am zweiten Februar, hab ich doch in dem Brief geschrieben.«
»Nein.«
»Echt?«
»Du hast nicht ihren Namen gerufen.«
»Wollt ich grad, da kam der Bulle.«
»Sie hat deinen Namen auch nicht gerufen.«
»Weiß ich nicht. Nein. Sie hat mich angeschaut. Und ich hab ganz genau die Kette gesehen und die Narbe.«
Scarlett sei als Sechsjährige beim Spielen hingefallen und habe sich im Gesicht verletzt, hatte ihre Mutter damals behauptet. Ob die Narbe tatsächlich daher rührte, blieb ungeklärt.
»Waren viele maskierte Leute auf dem Marienplatz?«, sagte Fischer.
»Was? Entschuldigung. Nein, nicht so viele Leute. Ich würd gern eine rauchen, macht Ihnen das was aus? Dauert nur zwei Minuten.«
»Geh nur«, sagte Fischer. Er musste sowieso telefonieren.
»Bin gleich wieder da.« Marcel nahm das Tabakpäckchen und stand auf. Die Gäste schauten wieder zu ihm her. Im Gehen zog er etwas aus der Tasche und kam noch einmal zurück. »Haben Sie das gelesen?« Er legte eine zusammengeknüllte Zeitung auf den Tisch. »Da gehts um Sie.« Als er die Tür öffnete, flackerten wieder die Kerzen am Tisch der Trauernden.
Fischer strich die Zeitung glatt, sie war von diesem Tag, 13. Februar. Er hatte sie am Morgen nicht gelesen, nur gesehen. Auf der ersten Seite prangte zweispaltig sein Foto. Der Bericht handelte vom Überfall auf ein Taxi, dessen neunundvierzigjährige Fahrerin zunächst drei Tage lang spurlos verschwunden war, bevor ein Spaziergänger die schwer misshandelte, halb bewusstlose Frau am Nachmittag des 12. zufällig in einem Abbruchhaus in Harlaching bemerkte. Die Ärzte versetzten sie in ein künstliches Koma, ihr Zustand sei lebensbedrohlich. In den vergangenen Monaten waren nachts im Stadtgebiet bereits fünf Taxifahrer beraubt, einer von ihnen erstochen und die anderen vier schwer verletzt worden. Nach den Erkenntnissen der Polizei – der jüngste Überfall hatte in der Nacht zum vergangenen Sonntag stattgefunden – hätten die Täter, so die Zeitung, aus noch ungeklärten Gründen Ann-Kristin S. aus ihrem Taxi gezerrt und verschleppt. Deren Lebensgefährte, dessen Foto abgedruckt war, arbeite in der Mordkommission.
Vor lauter Angst redete Fischer sich ein, er müsse erst das Gespräch mit Marcel beenden, bevor er – zum dritten Mal an diesem Tag – im Krankenhaus anrief.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!