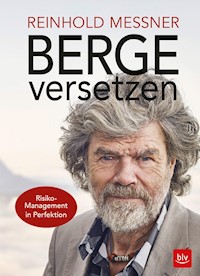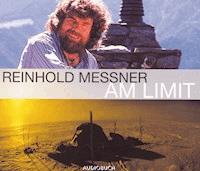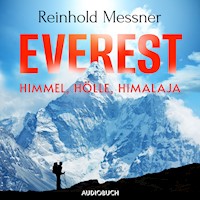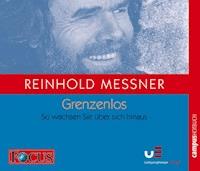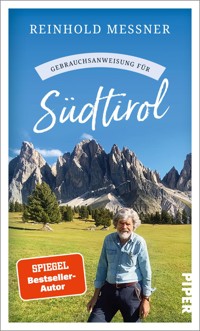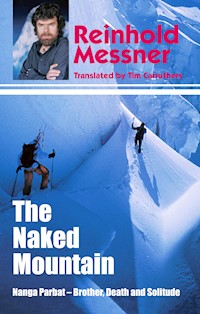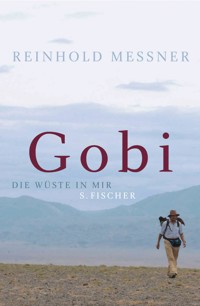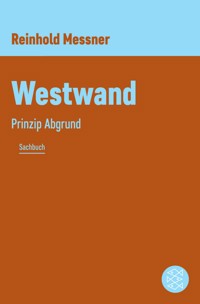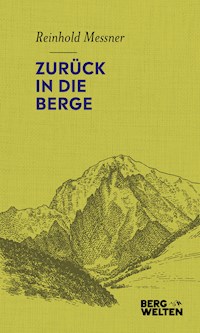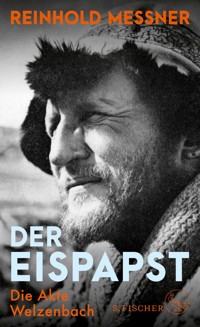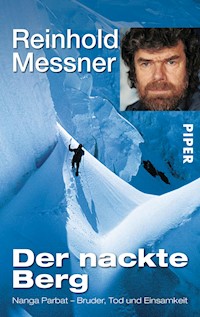15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Was mich jung hielt, waren die Ideen, die ich in die Zukunft projizierte.« Einer der letzten großen Abenteurer unserer Zeit erzählt von seinem Werdegang. Vom ersten Dreitausender in den heimischen Dolomiten im Jahre 1949 führten Reinhold Messners Touren ins Eis der Westalpen, in die Anden und schließlich zu den grandiosen Achttausendern des Himalaja. Nach seiner Zeit als Felskletterer und Höhenbergsteiger marschierte er zum Nord- und Südpol und durch die großen Wüsten. In einem Wechselspiel zwischen bergsteigerischer Extrem- und persönlicher Selbsterfahrung schildert Messner Begehung für Begehung, Idee für Idee seinen Lebensweg als selbstbestimmter Grenzgänger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
© Piper Verlag GmbH, München 1998, 2001
Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München
Covermotiv: Archiv Reinhold Messner
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
1. Villnöß
Kinderjahre in den Dolomiten, mein erster Dreitausender
2. Als erster am Seil
Mit meinem Vater durch die Ostwand der Kleinen Fermeda
3. Zwei Buben, zwei Haken und ein Helm
Mit meinem Bruder Günther durch die Saß-Rigais-Nordwand
4. Frei Solo
Alleinbegehung der Kleinen-Fermeda-Nordwestwand
5. Jugend am Berg
Meine ersten Varianten und Erstbegehungen
6. Wettersturz in der Pelmo-Nordwand
Eine dramatische Wiederholung der Simon-Rossi-Route
7. Die Kunst, am Leben zu bleiben
Begegnung mit Sepp Mayerl, genannt »Blasl«
8. Das Vogelnest in der Civetta-Mauer
Wiederholung der Aste-Verschneidung an der Punta Civetta
9. Jenseits des Gipfels
Wiederholung der »Philipp-Flamm« an der Punta Tissi
10. Die Prüfung
Soldà-Verschneidung am Piz-de-Ciavàces Solo
11. Die lange Kante
Erste Winterbegehung der Monte-Agnèr-Nordkante
12. Wettlauf im Winter
Erste Winterbegehung der Furchetta-Nordwand
13. Das Riesendach
Dritte Begehung der Südwand des Spiz delle Roé di Ciampedié
14. Die Wand mit den schwierigsten Kletterstellen
Dritte Begehung der Scotoni-Südostwand
15. Eine gefährliche Falle
Zweite Begehung der »Via Ideale« an der Marmolada
16. Die verratene Idee
Erstbegehung der direkten Civetta-Wand
17. Im Schatten des Monte Agnèr
Erste Winterbegehung der Nordwand
18. Peitler, große Klasse
Bericht von Günther Messner über die Erstbegehung der Nordwand
19. Bergsteigen gegen die Uhr
Klettern in den Dolomiten und Westalpen
20. Die Ideen der anderen
Eiger-Nordpfeiler, erste Begehung
21. Realisierte Träume
Erstbegehungen am laufenden Band
22. Burél – das heißt »Abgrund«
Zweite Begehung der Südwestwand
23. Expedition in die Anden
Jubiläumsexpedition des ÖAV Innsbruck in Peru
24. Nur eine halbe Stunde Schlaf
Erste Alleinbegehung der Droites-Nordwand
25. Ein seltsames Gesicht
Erster Alleingang an der direkten Langkofel-Nordkante
26. Die fixe Idee vom unbekannten Ziel
Erste Alleinbegehung der Punta-Tissi-Nordwestwand
27. Fingertraining eines Selbstmörders
Erstbegehung der direkten Südwand an der Marmolada di Rocca im Alleingang
28. Kein Ausweg
Erste Alleinbegehung der Soldà-Führe an der Langkofel-Nordwand
29. Wenn ein Löffel vom Tisch fällt
Zweite Begehung, gleichzeitig erster Alleingang der Furchetta-Nordwand, Meraner Weg
30. Odyssee am Nanga Parbat
Erstbegehung der Rupal-Wand
31. Nachspiel und Zwischenbilanz
Der Weg zum Profibergsteiger
32. Ndugundugu
Zwei Erstbegehungen an der Carstensz-Pyramide in Neuguinea
33. Womöglich unmöglich
Erstbegehung der Puncak Sumantri-Brogonegora
34. Über den Berg
Suchexpedition am Nanga Parbat
35. Schicksalsstunden am Manaslu
Erstbegehung der Südwand
36. Unterwegs
Zwischen den Expeditionen
37. Viento blanco
Erstbegehung an der Aconcagua-Südwand
38. Umkehr
Gescheitert an der Makalu-Südwand
39. Rekord
Acht Jahre und zehn Stunden für die Eigerwand
40. Ausbruchsbereitschaft
Zu zweit durch die Nordwand des Hidden Peak
41. Wand der Mitternachtssonne
Erstbegehung am Mount McKinley
42. Fluchtpunkt der Eitelkeiten
Versuch einer Erstbesteigung an der Dhaulagiri-Südwand
43. Der große Abbruch
Erstbegehung der »Breach Wall« am Kilimandscharo
44. Ein letztes Tabu
Erstbesteigung des Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff
45. Der Punkt auf dem i
Erster Alleingang am Nanga Parbat
46. Ein anderer Mensch
Erstbegehungen im Hoggar-Gebirge in der Sahara
47. Zeit und Geld
Der Abruzzi-Grat am K2
48. Tod am Heiligen Berg
Rettungsaktion am Ama Dablam
49. An meiner Grenze
Erste Alleinbesteigung des Mount Everest
50. Von Gipfeln zu Gesichtern
Auf dem Shisha Pangma und unter dem Makalu
51. Der Hattrick
Besteigung von drei Achttausendern im Rahmen einer Expedition
52. Gipfelgesichter
Winterexpedition zum Cho Oyu
53. Die Leidenschaft bis zur Krankheit weiterentwickelt
Die letzten vier Achttausender
54. Mehr wollte ich nicht
Auf den sieben höchsten Gipfeln aller Kontinente
55. 1000 Meter bis zum nächsten Jahrtausend
Internationale Expedition zur Lhotse-Südwand
56. Die Rache der zerstörten Mythen
Klettern, wandern, leben
57. Die Horizontale
Zehn Jahre Grenzgang
58. Peinliche Panne
Der Mauersturz
59. In der Falle
Auf Shackletons Spuren in South Georgia
60. Kein letzter Berg
Erste Begehung der Nanga-Parbat-Nordflanke
61. Visionen
Die sechste Phase meines Lebens
62. Das Erbe des Bergsteigens
Sechs Häuser zum Thema Berg
63. Als Storyteller unterwegs
Das Leben erzählt die besten Geschichten …
Niemandsland
Das Erbe
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Lebenslauf
Größeres wolltest auch du, aber die Liebe zwingtAll uns nieder, das Leid beuget gewaltiger, Doch es kehret umsonst nichtUnser Bogen, woher er kommt.
Aufwärts oder hinab! herrschet in heiliger Nacht. Wo die stumme Natur werdende Tage sinnt, Herrscht im schiefesten OrkusNicht ein Grades, ein Recht noch auch?
Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleichHabt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht Mich des ebenen Pfads geführt.
Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen, dass er, kräftig genährt, danken für Alles lern, Und verstehe die Freiheit, Aufzubrechen, wohin er will.
Friedrich Hölderlin
1. Villnöß
Kinderjahre in den Dolomiten, mein erster Dreitausender
Es war Kriegsende, 1945, als dieses Foto entstand. Mein Vater hat es aufgenommen. Er war gerade aus dem Krieg heimgekehrt. Wir Kinder, Helmut war zweieinhalb, ich noch kein Jahr alt, hatten Keuchhusten, und die Eltern zogen mit uns auf die Brogles-Alm. Unter den Fernveda-Türmen, in einer Höhe von 2000 Metern, sollten wir uns erholen. Ob diese ersten Eindrücke von den schlanken Dolomitenfelsen und den Weiten der Hochalm mich geprägt haben, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde ich rasch gesund und später ein Bergsteiger und Jäger wie mein Vater, der vor dem Krieg aus Neugierde auf die umliegenden Berge geklettert war und nach dem Krieg aus Not wilderte.
Unser Haus lag an der Dorfstraße. Ein Haus wie viele andere, mit roten Ziegeln am Dach, einem Kamin, einer Treppe aus Porphyrquadern und einer wilden Weinrebe, die im Sommer die Ostseite völlig überwucherte. Die Steinmauer unter der Treppe war kaum vier Meter hoch, und doch schimpfte der Vater immer, wenn wir an ihr herumkletterten.
Zum Spielen gingen wir deshalb in die Stadel der umliegenden Bauernhöfe, versteckten uns in Baumkronen oder stiegen hinauf bis zum Glockenstuhl, wenn die Kirchturmtür zufällig offenstand. Von dort konnten wir St. Magdalena sehen, die letzte Ortschaft im Tal, wo die Großeltern wohnten, bei denen wir die Sommermonate verbrachten. Wenn jeder von uns tief in seinem Herzen an eine Heimat als eine Art von Paradies glaubt, hier war sie.
Die mächtige Kette der Geislerspitzen war so nah und kam einer Herausforderung gleich. Sie ließ jene Harmonie in uns erwachen, die heute zwischen Hochhäusern und Autobahnen nicht entstehen kann. Es war alles friedlich und einfach und doch so reich, dass ich zufrieden war.
Der Vater pachtete für die Sommermonate eine Almhütte auf Gschmagenhart und war jedes Jahr ein paar Wochen lang mit der Mutter oben. Im Herbst brachten sie einen großen Sack mit Zirbelnüssen mit und erzählten von den Geislerspitzen, von der Mittagsscharte, von den Gemsen im Puezkar.
Oft saß ich zwischen den Hühner- und Kaninchenställen, in denen mein Vater Kleingetier züchtete, und schaute den Wolken zu, wie sie über den schmalen Streifen Himmel zogen, der zwischen hohen Waldrücken und düsteren Bergen zu sehen war. Sie kamen und gingen, oft dauerte ihr Spiel nur einige Minuten. So eingezwängt im Tal liegt dieser Ort, Pitzack, wo wir wohnten.
Jahrelang war Villnöß, das Tal, in dem ich aufwuchs, die ganze Welt für mich. Kindergarten gab es keinen, und so spielten wir Dorfkinder gemeinsam von früh bis spät. Als ich vier oder fünf Jahre alt war, wurde ich neugierig und wollte wissen, wohin die Wolken verschwanden. Was lag hinter diesen Bergen, die um mein Tal herum wie ein unüberschreitbarer Schutzwall standen? Die Bauern hatten kein Verständnis für so viel Neugierde. Nur selten fuhren sie mit dem Linienbus in die Stadt oder zum nächstgelegenen Markt. Im Ort gingen alle zu Fuß. Autos gab es nur einige wenige.
Der Troi-Clan (die Familie meiner Mutter) 1947. Links meine Eltern, vorne links mein Bruder Helmut, der mir den Arm um die Schulter legt.
Die Bauern im Tal waren fleißige Leute, zäh und bei der Feldarbeit auf zwei Pferde und ihre Kinder angewiesen. Große stattliche Höfe gab es nicht. Am Sonnenhang wirtschafteten kleine und mittlere Bauern, in der Talsohle einige Häusler. Die Felder zogen weit hinauf, und es überwogen die trockenen und kargen Böden. Die Almen reichten weit über die Waldgrenze, unmittelbar darüber standen die Dolomiten, die dem Talschluss einen wilden und zugleich harmonischen Abschluss verliehen.
Unser Vater war Lehrer in St. Peter. In seiner Jugend, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, war er in den Geislerspitzen geklettert. Nun, da seine Kletterpartner ausgewandert waren, wollte er uns Buben mitnehmen auf die Große Fermeda, die Furchetta, uns die Welt seiner Jugenderinnerungen zeigen.
Die Gespräche der Bauern verrieten, dass sie sich mehr mit Feld und Vieh beschäftigten als mit der Landschaft. Sie verstanden die Städter nicht, die zum Wandern und Bergsteigen nach Villnöß kamen. Sie hatten ihr Auskommen und begnügten sich damit. Wenn einer im Tal Geld ausgab für Urlaub, fuhr er in die Stadt oder ans Meer.
Pitzack (italienisch Pizzago) in Villnöß: Das Geburtshaus meiner Mutter und, unten rechts im zweiten Stock, unsere Wohnung.
Ich ging noch nicht zur Schule, als mich die Eltern erstmals auf die Gschmagenhartalm mitnahmen. Mein älterer Bruder Helmut und ich stapften hinter dem Vater her. Dort, wo der Fahrweg aufhörte und ein schmaler, steiler Steig begann, rasteten wir zum erstenmal. Während der Vater Himbeeren pflückte, fragte ich die Mutter, wie weit es noch sei, so müde war ich schon. Im Zickzack führte der Steig dann durch einen großen Kahlschlag, weiter oben querten wir andere Wege, stiegen über Wurzeln und Steinblöcke. Vereinzelt nur mehr standen Fichten zwischen den Zirbeln, und ganz oben blühten die Alpenrosen.
Als wir auf die freie Almwiese traten, standen die Geislerspitzen so unmittelbar über uns, dass sie mir wie mit dem Fernglas hergeholt erschienen; Aus dem fahlen Kar wuchsen sie erschreckend groß und bedrückend empor. So etwas Gewaltiges hatte ich nie zuvor gesehen.
Die Hütte stand zwischen Felsklötzen und einer Gruppe von Zirbeln. Der Vater machte die Läden auf und ging dann weg, um Wasser zu holen. Eigentlich hätten Helmut und ich noch am gleichen Tag zurück zu den Großeltern gehen sollen. Als sich aber herausstellte, dass wir die Petroleumlampe beim ersten Rastplatz vergessen hatten, kam für uns die Gelegenheit, mit der wir uns einige Ferientage auf Gschmagenhart verdienen konnten.
Florian Leitner und mein Vater auf dem Gipfel der Großen Fermeda. Rechts das » Wandl «.
»Ihr dürft dableiben, wenn ihr die Lampe bringt!« sagte der Vater, und in der Türschwelle noch: »Passt auf, es sind vier Quersteige, und beeilt euch, es wird bald Nacht!« Schon liefen wir über die Wiese hinunter. Alle Anstrengung war vergessen, alle Müdigkeit vorbei.
Im Wald war es schlüpfrig, und der Steig war oft nicht zu erkennen. Der einfache, klar vorgezeichnete Weg, auf dem wir hinter dem Vater hergestiegen waren, erschien jetzt geheimnisvoll. Die vorherige Gewissheit war eine Falle, die sich jetzt, da wir allein gingen, in jeder Abzweigung auftat. Ein erfahrener Bergsteiger oder Jäger findet sich im Wald immer zurecht. Wir aber suchten erstmals den Weg selbst und vermuteten hinter jedem Geräusch ein Reh. Bei jeder Wegbiegung standen wir vor einem Rätsel.
Von Schneise zu Schneise, von Baum zu Baum tasteten wir uns abwärts. Als wir die Lampe tatsächlich gefunden hatten, packte uns ein kindlicher Stolz. Wir durften also ein paar Tage auf Gschmagenhart bleiben!
Meine Mutter auf der Großen Fermeda. Die Kletterleidenschaft meiner Mutter hielt sich in Grenzen.
Bald kannten wir die Namen der Geislerspitzen: die Kleine Fermeda ganz rechts, die Große Fermeda, der Villnößer Turm, die Odla … das sind die kleinen Geisler, die Mittagsscharte trennt sie von der Hauptgruppe. Dort steht der breite Saß Rigais, mehr als 3000 Meter hoch, und links davon die schöne und schmale Furchetta, die fast gleich hoch ist. Dann kommen noch der Wasserkofel, die Valdussa-Odla, der Wasserstuhl und der Kampiller Turm. Ich erinnere mich an die Erzählungen des Vaters, der auf allen Gipfeln, die wir sahen, schon gestanden hatte. Vielleicht entstand damals der Wunsch, einmal alle diese Zacken zu erklettern.
Endlich kam der Tag, an dem auch wir mitgehen durften. Um fünf Uhr früh wurden wir geweckt. Ich kroch aus dem warmen Heu, schob die dicke Stadeltür zurück, sah, dass noch Sterne am Himmel waren, und zog mich zähneklappernd an. Ich war nicht aufgeregt, ich war voller Erwartung.
Eine halbe Stunde später gingen wir über die Wiese hinauf zum Waldrand. Reif hing am vergilbten Gras, und die Zirbelbäume hoben sich wie schwarze Ungeheuer gegen das helle Kar ab. Ein roter Farbfleck verriet den Beginn des Steiges, der zum Munkelweg hinabführt, am Nordlöß der Geislerspitzen entlang von Bogles bis St. Zenon. Eben war die Sonne aufgegangen und streifte die Nordkante der Furchetta. Das erweckte den Eindruck, oben sei ein Hauch von Wärme, in dieser unerreichbaren Welt – als ob die Geislerspitzen ein riesiger Vorhang wären, eine Trennwand zwischen zwei Welten. Die Luft war klar, durchsichtig vor Kälte. Sie trug jedes Geräusch weithin, so dass wir unwillkürlich flüsterten.
In Weißbrunn füllte der Vater die Wasserflasche. Der Steig führte durch ein Latschendickicht, dann im Zickzack durch die letzten Grasflecken und vorbei an verwitterten Zirbeln. Endlos erschien mir der Aufstieg im Kar hinauf bis zur Mittagsscharte. Im Morgenlicht schienen die Geislerspitzen jede Vorstellung von Höhe zu übertreffen. Dahinter ahnte ich ungezählte noch unberührte Geheimnisse.
Am letzten Baum, einer krummen Zirbel, die kaum zwei Mann hoch gewachsen war, rasteten wir. Ich erinnere mich an eine Episode, die ohne Bedeutung war: Der Vater versteckte seine Zigarettendose in ihrem hohlen Stamm. Er legte einen platten Stein darauf und mahnte zum Aufbruch. Damit wurde mir bewusst, dass mein Vater rauchte.
Das Steigen im Kar war anstrengender, als ich es mir nach den Erzählungen der Eltern ausgemalt hatte. Je höher wir kamen, desto feiner wurde der Schotter, desto mehr rutschte ich bei jedem Schritt zurück. Dabei lernte ich, dass man beim Steigen die ganze Schuhsohle aufsetzt und besser große Steinblöcke als Tritte ausnutzt. »Man muss langsam und gleichmäßig steigen, wenn man ans Ziel kommen will«, wusste mein Vater.
In der Mittagsscharte lag der erste Schnee. Und dahinter ein Meer von Gipfeln! Auf der anderen Seite liefen wir durch das Kar bis zur dritten Schluchtmündung hinunter. Wir suchten jeweils die Rinnen mit dem feinsten Schotter aus und sprangen mit Rücklage hinunter. Entschlossen mit den Fersen voraus, so dass die Steine spritzten.
»Das ist der Einstieg«, rief mein Vater. Wir blieben stehen. Ein feines Plätschern drang durch die Stille. Ab und zu fiel ein Stein. »Die Sonne löst das Eis, das sich in der Nacht gebildet hat«, sagte der Vater und zog das Hanfseil aus dem Rucksack. Mein Herz begann zu klopfen: die Kletterei fing an!
Wir standen am Beginn einer steilen Felsschlucht. Die Wände links und rechts waren gelb, zum Teil überhängend. Mir fehlte das rechte Selbstvertrauen, wenn ich so hinaufschaute. Hausgroße Klemmblöcke sperrten die Schlucht über mir, und an allen Schattenstellen glänzte das Eis.
Die Mutter stieg voraus, der Vater dicht hinter Helmut und mir her. Noch sicherte er uns nicht mit dem Seil. Die Kletterei war weit einfacher, als ich erwartet hatte. Immer gab es ein Band, einen Durchschlupf. Wir konnten bis unterm Gipfel auf das Seil verzichten. Kein einziges Stück war auch nur annähernd so schwierig zu überwinden wie die Stiegenmauer daheim. Zudem war an den steilsten Stellen ein Drahtseil fixiert.
Ich war müde, und nach jedem Felsaufbau suchte ich mit den Augen nach dem Gipfel. Ich wartete auf den Grat oder einen großen Steinmann. Bis heute weiß ich nicht, was dem Aufstieg eine solche Spannung gab, dass ich mit meinen fünf Jahren durchhielt. Ich hätte ja auch sitzen bleiben können, aber das tat ich nicht.
Dann sahen wir ihn plötzlich: »Der Gipfel«, bestätigte der Vater. Ein luftiger Grat trennte uns noch von ihm. Rechts fiel die Wand steil ins Wassertal ab, links ging es so senkrecht und tief hinunter, dass ich mich nicht hinunterzuschauen traute. »Sehr exponiert«, sagte einer der Männer, die gerade abstiegen und mir am Grat halfen. Ich hörte das Wort zum ersten Mal, verstand es aber gleich. Am Gipfel saßen einige Bergsteiger, die über den Ostgrat aufgestiegen waren. Sie schüttelten uns die Hände wie zu einem wohlvorbereiteten Fest. Gemeinsam genossen wir die gehobene Stimmung. Dabei war ich unendlich müde. Um uns nur Sonne, Wind und unter uns, 1000 Meter tiefer, die Gschmagenhartalm, auf die wir noch am gleichen Tag zurückkehren mussten.
Der Saß Rigais war auch für Erwachsene eine schwierige Tagestour, für mich war er der Anfang einer lebenslangen Leidenschaft.
Blick vom Gipfelgrat des Saß Rigais auf den Sella-Stock. Dies war mein erster Eindruck von den Dolomiten.
2. Als erster am Seil
Mit meinem Vater durch die Ostwand der Kleinen Fermeda
Als ich ein kleiner Bub war, schien mir die Ostwand der Kleinen Fermeda das Schwierigste zu sein, was es im Fels gab. Sie wirkte so steil und abweisend, dass meine Augen nirgends Halt finden konnten. In ihrem tiefen Kamin, der vor Nässe troff, verlief eine geheimnisvolle Route. Ich wollte sie durchklettern, obwohl ich erst zwölf Jahre alt war. Meine Fantasie regte sie so stark an, dass ich von ihr träumte.
So verwandelte eine Wand, nichts anderes als eine Felswand, alle Steine im Dorf in einen Klettergarten. Ich wusste schon lange, dass man beim Klettern immer drei feste Haltepunkte haben muss, entweder zwei Griffe und einen Tritt oder zwei Tritte und einen Griff. Ich befolgte streng diese Drei-Punkte-Regel und übte an der Treppe daheim, an der Friedhofsmauer, an einem Felsbrocken im Bachbett.
Wie stark hat sich diese Wand seit damals verändert! Die große Erfahrung, die ich in den Jahren gesammelt habe, hat sie entzaubert, obwohl die Wand gleich steil und gleich schwierig geblieben ist. Heute wundere ich mich manchmal darüber, dass diese 300 Meter hohe Felsflucht für mich das Wichtigste war, was es gab, der nasse Kamin mit den beiden Klemmblöcken der Inbegriff für Schwierigkeiten schlechthin, das große Geheimnis.
Schmerzlich muss ich heute einsehen, dass es ein bleibendes Geheimnis nicht gibt. Es genügt nicht, meinem heutigen Können gemäß größeren und schwierigeren Wänden gegenüberzustehen – ich müsste noch einmal so klein und so unerfahren sein, um Eingang in diese Welt der ersten Träume zu haben.
Als ich das erste Mal unter der Ostwand stand, war ich ein Schulbub. Mit einer einfachen Sackstichschlinge band ich mich ans Seil, legte es dann so um die Schulter, dass das Ende, welches mich mit meinem Vater verband, unter der rechten Achsel lief, das andere über die linke Schulter. Das war die Schultersicherung.
Mein Vater hatte sich zwei Haken an die Brustschlinge gehängt und stieg los. Ich stand unten, folgte allen seinen Bewegungen und war bemüht, das Seil so nachzugeben, dass es nie spannte. Nach 30 Metern blieb mein Vater stehen, zog das restliche Seil ein und verklemmte sich im Kaminspalt. So hätte ich ihn nicht herausreißen können.
»Nachkommen!« rief er herunter, und der Widerhall seiner Worte sprang mehrmals von einer Wand zur anderen. »Ich komme!« Der Fels war anfangs brüchig. Ich prüfte aufmerksam jeden Griff, bevor ich ihn belastete, klopfte mit der Fußspitze an fragwürdige Tritte und bemühte mich, die Haltepunkte vorwiegend nach unten zu belasten.
Nach den ersten Seillängen wurde es schwieriger. Die beiden Kaminwände waren etwa einen Meter voneinander entfernt und strebten senkrecht in die Höhe. Sie erschienen mir wie endlose Säulen. Weit oben steckte ein Block im Kamin und versperrte den Blick nach oben. Darüber musste das Geheimnis liegen, davon war ich fest überzeugt.
Vater war immer der erste, der den richtigen Verlauf der Route erkannte. Als Führer unserer Seilschaft wog er die Schwierigkeiten der folgenden Seillängen ab und wies mich auf besonders schwere Stellen hin. Anfangs staunte ich über seine Erfahrung. Er konnte jeden Standplatz von unten entdecken und die bevorstehenden Probleme voraussehen.
Die Ostwand der Kleinen Fermeda ist mit dem dritten Schwierigkeitsgrad bewertet. Damals schon wusste ich, dass eine Bewertung mit dem dritten Grad »schwierig« bedeutet. Insgesamt gab es damals sechs Schwierigkeitsgrade. Der erste war der unterste, er galt für Routen, die leicht waren, wo die Hände nur ab und zu zum Halten des Gleichgewichts gebraucht wurden. Der sechste Grad bezeichnete Schwierigkeiten, die, so hieß es wenigstens in der Definition, nur von den besten Bergsteigern der Welt bewältigt werden konnten. Ob ich je den sechsten Grad erreichen konnte?
Heute weiß ich, dass das mit dem sechsten Grad etwas übertrieben war. Es gab damals schon tausend Kletterer, die den sechsten Grad beherrschten. Vor sechzig Jahren waren es noch keine zwanzig, die so extrem klettern konnten. Heute sind es schätzungsweise mehr als hunderttausend – in Amerika, in England, in Japan und in Mitteleuropa vor allem, wo man zuerst mit dem extremen Bergsteigen begonnen hat.
Obwohl ich unerfahren war und mich die Ausgesetztheit der Route beeindruckte, erschrak ich nicht, als mir Vater unter dem zweiten Kaminüberhang die Führung anbot. Ich durfte als Seilerster klettern!
»Pass gut auf und klettere langsam!« betonte er nachdrücklich. »Und wenn du oben bist, häng deine Selbstsicherung an einen festen Felszacken!«
Mein Vater war als junger Kletterer auf allen Gipfeln der Geisler-Gruppe. Später, als ich selbst das Fermeda-» Wandl « führte, träumte ich von Erstbegehungen.
Bei einer Zweierseilschaft klettert jeweils nur einer, der andere sichert. Wenn der Seilerste nach 20, 30 oder 60 Metern eine flache, geschützte Stelle findet, einen »Standplatz«, hängt er sich an einen Felszacken oder an einen Haken, den er in eine Ritze treibt. Er sichert sich selbst. Dann erst lässt er den zweiten am gestrafften Seil nachkommen. Der Seilerste wird von unten gesichert. Im Gegensatz zu einem Sturz des Seilzweiten ist ein Sturz des Seilersten immer äußerst gefährlich. Er kann bei einer Seillänge von 30 Metern bis zu 60 Meter stürzen. Für den Seilzweiten ist es ungemein schwierig, einen so schweren Sturz abzufangen. Würde er sich nicht an mehrere Haken oder Felszacken binden, es risse ihn unweigerlich aus der Wand. Deshalb habe ich es mir zum Grundsatz gemacht, am Standplatz immer eine einwandfreie Selbstsicherung zu haben. Mein oberster Grundsatz war es aber, als Seilerster nicht zu stürzen. Und er ist es bis heute geblieben.
Ich schaute nochmals zum Vater, der im Kamin stand und sich an einen Haken gebunden hatte. Er hatte das Seil fest in der Hand und zeigte keinerlei Spuren von Bedenken. Im Gegenteil, an der Gelassenheit seiner Bewegungen erkannte ich zu meiner Erleichterung, dass er mir die kommende Seillänge zutraute.
Fünf Jahre lang hatte ich immer nur als zweiter klettern dürfen. Nun freute ich mich zu sehen, wie das Seil nicht mehr von meiner Brust nach oben lief, sondern zwischen den Beinen nach unten. Einmal wollte mich Vater gerade vor brüchigen Steinen warnen, doch da hatte ich die gefährliche Stelle schon umgangen.
In den darauffolgenden Seillängen wechselten wir uns in der Führung ab. Glücklich und so umsichtig wie möglich stieg ich voraus, wenn ich an der Reihe war. Als wir den Gipfel erreichten, meinte ich, dass ich ein bisschen erwachsener aussehen müsste.
3. Zwei Buben, zwei Haken und ein Helm
Mit meinem Bruder Günther durch die Saß-Rigais-Nordwand
Vier Jahre später sollte ich jenen Kamin wiederfinden, durch den mein Vater und ich in den Fünfzigerjahren in die Nordwand des Saß Rigais eingestiegen waren. Die Route durch diese Wand in der Mitte der Geisler-Gruppe war in Vergessenheit geraten, als Emil Solleder und Fritz Wiessner die benachbarte Nordwand der Furchetta durchstiegen und mit dieser Erstbegehung eine neue Epoche in der Erschließungsgeschichte der Dolomiten eingeleitet hatten.
Während man vor hundert und mehr Jahren allein darauf aus war, alle Gipfel zu besteigen, begannen die führenden Bergsteiger um 1880 neue Routen – einzelne Wände, Kanten oder Grate – zu durchklettern. Nicht mehr allein der Gipfel war ausschlaggebend, sondern die mehr oder weniger schwierige Route, über die man ihn erreichte.
Später bemühte man sich, neben bereits vorhandenen Führen noch andere zu finden, schwierigere, direktere. Diese Epoche hat vor bald 100 Jahren begonnen und bestimmte wenig später auch das Bergsteigen in den Anden, im Himalaja, im Karakorum.
Die Route in der Nordwand des Saß Rigais war für uns Buben damals ein Rätsel : ein Gewirr von Rissen, Bändern und Kaminen, die in diese 800 Meter hohe Kalkmauer eingegraben sind. Keine andere Wand sah so dunkel und gespenstisch aus – wie die Beine einer Riesenspinne.
Die Route war uns so wenig vertraut, dass wir ein Foto vom Saß Rigais in die Tasche steckten, um oben die Orientierung nicht zu verlieren.
An einem Julinachmittag schlugen mein jüngerer Bruder Günther und ich nahe an der Waldgrenze unser Zelt auf. Zuerst holten wir Wasser und Holz. Günther brachte trockene Zirbelnadeln zum Lagerplatz. Dann zogen wir einen Graben ums Zelt. Bevor es Nacht wurde, polsterten wir den Zeltboden mit den Nadeln aus, weil wir damals noch keine Luftmatratzen besaßen.
In der Nacht schüttelte es uns vor Kälte. Mit Grauen dachte ich dabei an ein richtiges Wandbiwak. Ich erinnerte mich an eine nächtliche Irrfahrt in den Odla-Türmen. Damals war ich noch ein Kind und war so lange weggeblieben, dass mein Vater die Bergwacht verständigt hatte. Ich lief Rinnen hinauf und Rinnen hinab, suchte, tastete mich über Absätze abwärts. Die Stunden dehnten sich, und weit nach Mitternacht erst kam ich auf einen Steig im hintersten Talboden.
Als Sechzehnjähriger übte ich viel in den Kletterfelsen Waldrand. Im Winter gingen wir Brüder auf Skitour.
Am Morgen, als wir in die Wand einsteigen wollten, war die Kälte am schlimmsten. Wir waren so durchgefroren, dass keiner von uns beiden Lust hatte, sich zu waschen. Heimlich dachten wir beide in dieser eisigen Atmosphäre ans Aufgeben, an den Abstieg ins Tal. Aber weil sich dies keiner von uns beiden zuzugeben traute, schulterten wir unsere Rucksäcke und mühten uns über das Kar zum Einstieg hinauf. Wir waren ziemlich kleinlaut.
Wenige Wochen zuvor hatte uns der Vater einen Steinschlaghelm aus der Stadt mitgebracht. Es war eines der ersten Modelle, hergestellt aus weißem Plastik und mit einem Schild vorne. Er war einem Grubenhelm ähnlicher als einem Sturzhelm. Am Einstieg stopften wir Handschuhe, eine Mütze und Zeitungspapier hinein, um ihn so auszupolstern.
Weil wir nur ein Exemplar besaßen, setzten wir ihn in der Wand abwechselnd auf, und zwar trug ihn jeweils der Seilzweite. In der Wandmitte, wo es eine Steinschlagrinne zu queren galt, erwogen wir, ihn beide aufzusetzen. Dazu hätten wir ihn aber am Seil über eine Schlucht ziehen müssen, und weil das Seil für dieses Manöver zu kurz war, kletterte ich ohne Helm und dementsprechend schneller, um nicht von den Steinen erschlagen zu werden.
Auf der großen, schrägen Rampe in der Wandmitte verloren wir die Route. Wir stiegen viel zu hoch. Erst als wir oben nicht mehr weiterkamen, entdeckten wir den richtigen Routenverlauf. Weit unter uns führte eine graue Plattenzone hinauf zu einem Riss in der senkrechten Schlusswand.
Als wir unter dieser Wand standen, konnten wir begreifen, dass sich unser Vater in seiner Jugend vergeblich an dieser Nordwand versucht hatte. Steil und nass stand sie vor uns. Wenn ich bedachte, dass man früher ohne Haken, allein mit einem Hanfseil und Kletterpatschen ausgerüstet kletterte, wuchs mein Respekt vor den Pionieren. Von hier hatte Vater wieder abgeseilt. Jetzt erschien uns sogar sein Rückzug als eine Pioniertat.
Wir hatten zwei Haken dabei, zwei Eisenstifte, die der Dorfschmied nach Wunsch gefertigt hatte. Zusammen wogen sie ein Pfund, und die Ösen waren so stark, dass die beiden Karabiner, die uns der Feuerwehrhauptmann im Dorfe leihweise zur Verfügung gestellt hatte, nur mit Mühe eingehängt werden konnten.
Im Mittelteil der Saß-Rigais-Nordwand. Wir waren unerfahren und bescheiden ausgerüstet, hatten aber den Instinkt zum Überleben schon entwickelt.
Auch das Seil, ein gedrehter Perlonstrick, war steif und bockig. Man hätte den indischen Seiltrick an ihm versuchen können. Das alles sage ich heute, dreißig Jahre später, wo uns so gute Ausrüstung zur Verfügung steht, dass sich unsere Einstellung zu diesen Wänden völlig verändert hat. Damals wussten wir nichts von all dem und kamen uns mit dem einen Steinschlaghelm, den beiden Haken und dem ersten Kunststoffseil vor wie im Training für die Eiger-Nordwand.
Auf kleinen Standplätzen schlug ich nun jeweils einen der beiden Stifte ein und band mich an ihm fest, um Günther nachsichern zu können. Verbissen bemühte er sich, die Standhaken wieder herauszuschlagen, weil wir sie ja notwendig brauchten. Erst in den Ausstiegsrissen, die vollkommen vereist waren, schlug ich einen Zwischenhaken. Es war der erste, den ich in meinem Leben anbrachte, und als ihn Günther nicht mehr entfernen konnte, war ich nicht wenig stolz, weil er so fest steckte. Gleichzeitig aber war ich ein bisschen traurig, weil wir nun nur mehr einen Haken besaßen, einen einzigen Haken.
Erstmals setzten wir ins Gipfelbuch neben unsere Namen auch den der Nordwandroute, über die wir aufgestiegen waren. Als unser Vater von dem Abenteuer erfuhr, war er nicht weniger stolz als wir selbst, obwohl er an dieser Wand immer abgeblitzt war.
Wir waren damals so jung, so unerfahren. Aber wir waren hungrig nach Abenteuern. Wir trugen weite Bundhosen aus Cord, verwaschene Anoraks und ein Seil aus Hanf. Wir konnten nicht tanzen, kauften den Mädchen keine Blumen und wurden rot, wenn wir einmal eines ans Seil nahmen.
Wir marschierten nach der Frühmesse von daheim los und kamen am Abend zurück. Auf die Bauern, die über unsere Rucksäcke den Kopf schüttelten, blickten wir gleichgültig. Wir besuchten keine Lokale und verachteten alle, die sich am Sonntag dort die Zeit vertrieben.
Mit der Durchsteigung der Saß-Rigais-Nordwand war unsere Kindheit vorbei. Wir hatten unsere Erfahrungen gesammelt. Und diese Welt, diese undurchdringliche Natur gab mir die Fähigkeit, mich dem Zufall auszusetzen. Ich hatte gelernt, auch bei großen Schwierigkeiten Verantwortung zu übernehmen, überall und zu jeder Zeit mir selbst treu zu bleiben. Damals und dort wurde ich der, der ich heute bin.
Oft sind wir im Winter auf die Gampen-, die Brogles- oder die Gschmagenhart-Alm gestiegen. (Rechts ich beim Wachsen)
4. Frei Solo
Alleinbegehung der Kleinen-Fermeda-Nordwestwand
Bis zum Beginn der eigentlichen Steilwand waren wir zu zweit geklettert. Mein Vater und ich sicherten uns abwechselnd. Diesen Teil der Route kannte er seit vielen Jahren, vielleicht war er ihn in seiner Jugend als erster gegangen. Das wusste niemand so recht. Jedenfalls hatte mich mein Vater schon früher durch diese offene Schlucht geführt, die aus dem Kar unter den Fermeda-Türmen in eine v-förmige Einschartung zwischen der Kleinen Fermeda und dem Seceda-Kamm leitet. Von unten, aus dem Tal, sah diese Schlucht aus wie ein halbaufgeschlagenes Buch, und bis spät in den Sommer hinein lagen Schneeflecken zwischen den grauen Felsen.
Hier oben sah alles ganz anders aus. Es war düster, kalt. Nur am Himmel, weit über den senkrecht aufragenden Felswänden links und rechts von uns, hing ein heller Schimmer. Nach einigen leichten Seillängen zwängten wir uns durch einen engen Spalt und stiegen dann über weniger steile Felsen. Der Berg lag nun als unförmige, riesenhafte Felsmasse vor uns, so unübersichtlich, dass ich den Weg allein nicht hätte finden können.
Das ist immer so: Was von unten logisch und geradlinig aussieht, ist oben am Berg eine einzige Ungereimtheit. Die Dimensionen verschieben sich, die Steilheit erscheint nicht beängstigend. Sie erschreckt nur beim Blick nach unten. Die Orientierung wird ein ernstes Problem. Aber mein Vater kannte den Weg, und ich stieg hinter ihm her. Ohne jeden Zweifel, voller Vertrauen zu ihm.
Dort, wo der Steilfels der Kleinen Fermeda eine seichte Einbuchtung hat, blieben wir stehen. Eine Serie von handbreiten Rissen zog schnurgerade durch das Grau dieser Dolomitenwand. Sie war senkrecht und höher als mehrere übereinandergestellte Kirchtürme.
Führte da wirklich eine Route hinauf? Wir wussten es nicht genau. Ich aber wollte es wissen und bat meinen Vater, wenigstens ein Stück weit hinaufklettern zu dürfen. Er zögerte zuerst, ließ mich dann aber lossteigen. Der Fels war griffig, aber nicht überall fest. Vater mahnte zur Vorsicht, wobei er – alle meine Kletterbewegungen verfolgend – das Seil bediente und, so gut es ging, sicherte.
Mein Vater vor seinem Ferienhaus in St. Magdalena. Von ihm habe ich mein wichtigstes Wissen. Im Hintergrund die Geislerspitzen.
Ich war damals Schüler. Nach vielen leichten Bergtouren war ich trittsicher und ausdauernd, aber kein extremer Kletterer. Weder mein Vater noch ich wussten wirklich, wie wir uns gegenseitig in einer so steilen Wand hätten halten sollen, wenn einer gestürzt wäre. Das Seil zwischen uns, dieser 40 Meter lange und steife Nylonstrick, war mehr eine psychische als eine praktische Hilfe. Es war aber angenehm, diese Sicherung zu haben.
Das erste Stück kam ich gut voran. Die Finger wurden zwar klamm am kalten Fels, aber meine Hände und Füße fanden immer wieder festen Halt, so dass ich ohne Angst höher steigen konnte. Zügig, Griff um Griff, Tritt um Tritt, schob und wand ich mich aufwärts. Vor mir, das Blickfeld war auf wenige Quadratmeter geschrumpft, zog der Fels vorbei. Die Landschaft unter mir hatte ich ganz vergessen. Der Wind zischte ab und zu an den Graten über mir, und aus dem Tal rauschte Wasser. Immer noch stieg die grauglänzende Felsflucht vor mir ins Unermessliche hoch, wenn ich nach oben schaute, noch steiler als am Anfang. Wolken segelten irgendwo darüber.
Mein Vater gab immer noch Seil nach. Er sah dabei etwas ängstlich aus. Unaufhörlich beobachtete er mich. Nach 40 Metern, das Seil war zu Ende, fand ich einen winzigen Standplatz. Vater sollte nachkommen. Aber er zögerte. Ich konnte nicht richtig stehen. Hing mehr schlecht als recht am Fels. Ich war kaum in der Lage, das Seil zu bedienen, zu sichern. Ich sollte zurück, meinte mein Vater. »Seil ab!« Das ging nicht am einfachen Seil. Abklettern konnte ich auch nicht mehr. Abseilen kam deshalb nicht infrage, weil ich 20 Meter tiefer das Seil nicht hätte befestigen können. Weiterklettern erschien mir als der sicherste Ausweg.
Was tun? Abwechselnd schaute ich zum Vater hinunter, der immer noch zögerte, und nach oben, wo überhängender Fels, der von schwarzen Wasserstreifen durchzogen war, die Sicht versperrte. Instinktiv hielt ich mich besser fest. »Ich steige allein zum Gipfel«, rief ich zum Vater hinunter. »Ich komme dann über den leichten Normalweg zurück.« Mein Vater war nicht damit einverstanden. Aber er sagte nichts. Also band ich mich vom Seil los, ließ es fallen und stand nun »vogelfrei« in der Wand. Ich war ganz auf mich allein gestellt. Um die Angst zu überwinden und keine Kraft zu verlieren, stieg ich gleich weiter. Bei einer ersten ruckartigen Bewegung hätte ich beinahe den Halt verloren. Ich musste jetzt sehr aufpassen und durfte keinen Fehler machen. Bald kletterte ich ruhig. Alle gefährlichen, weil lockeren Griffe fasste ich nicht an. Ich musste ohne sie auskommen.
Mein Vater sah mir von unten angespannt zu. Er verfolgte meine Bewegungen, bis er mich nicht mehr sehen konnte. Dann nahm er das Seil und stieg in die Scharte unter dem Normalweg auf. Dort wartete er. Still saß er in der Sonne.
Als die Wand an Steilheit verlor, rannte ich fast über die Felsen hinauf. Ich sprach mir selber Mut zu. Jetzt, da ich die Überhänge bewältigt hatte, konnte mich nichts mehr aufhalten. Ich hatte es geschafft. So, wie die Sache aussah, waren weiter oben keine großen Schwierigkeiten mehr zu erwarten. Trotzdem schaute ich gespannt voraus. Hinter jeder Felskante erwartete ich Unerwartetes.
Niemand im Tal hatte etwas von dieser Route gewusst, die Castiglioni erstbegangen hat, wie ich später erfuhr. Kein Haken und kein Steinmann wies mir den Weg. Ich stieg aufwärts, allein meinen Instinkten folgend. Über eine letzte Wandstufe und einen seichten Riss erreichte ich den Gipfelgrat und wenige Minuten später den Gipfel selbst. Damit waren Spannung und Aufregung vorbei. Den Abstieg kannte ich.
Abseilen im senkrechten Dolomitenfels. Das hat nichts mit Kletterkunst zu tun. Es ist ein Trick, schnell wieder vom Berg herunterzukommen.
In meinem Vater saß die Angst tiefer, als ich befürchtet hatte. Als wir auf dem Rückweg über die Pana-Scharte nochmals die Wand sahen, schüttelte er immer wieder den Kopf. Auch ich hatte zu großen Respekt vor so viel Höhe und Steilheit, als dass ich hätte übermütig werden können. Damals aber begann ich zu begreifen, dass wir in diesen Felswänden keinerlei Spuren hinterlassen sollten. Das Geheimnisvolle war ihnen sonst genommen. Jenes Unbegreifliche, das mich auch beim Abstieg noch schaudern ließ.
5. Jugend am Berg
Meine ersten Varianten und Erstbegehungen
Ich verstand lange jene Bergsteiger nicht, die ein Tourenbuch führen. Meines war bis dahin mein Gedächtnis gewesen. Viele werden darüber lachen, wenn ich behaupte, das Gedächtnis sei das beste Tagebuch. Lacht nur! Trotzdem höre ich immer noch, wie die Äste knacken, während ich mit meinen Eltern den steilen Pfad nach Gschmagenhart hinaufsteige. Es war im Herbst, ich muss damals fünf Jahre alt gewesen sein. Immer noch kommt diese unbändige Freude auf, wenn ich an jenen Sommertag denke, als ich die Kleine Fermeda gleich viermal bestieg: über die Südwand, die Südostkante, die Südwestkante und den Normalweg. Allein und einfach so.
Seltsam, unserem Gedächtnis gefällt es, gerade das Abscheuliche zu bewahren … Das Hässliche und Widerwärtige vergessen wir nicht, besonders dann nicht, wenn wir es vergessen wollen. Sollen wir Alltägliches, Selbstverständliches behalten, so müssen wir Tagebuch führen.
Aber auch das Schöne, das Aufregende bleibt in Erinnerung, ohne dass wir es auf Papier niederschreiben.
Ja, ich höre den Wind am Felsgrat und jeden fallenden Stein und freue mich über diese Geräusche und die Anspannung, die ich von damals bewahrt habe.
Mein ungeschriebenes »Tourenbuch« ist auch bebildert – mit beweglichen Bildern. Damals, vor fünfundzwanzig Jahren, sah ich die Geisler aus allen Blickwinkeln und zu allen Tageszeiten, im Morgengrauen, nachts, im Mondlicht.
Als wir einmal aus dem Dunkel des Zirbelwaldes auf eine Lichtung traten, erschrak ich über sie. Dunkel standen diese bizarren Zacken gegen den Nachthimmel. Wie abstrakte Malerei.
Dieses mein »Tourenbuch« ist mehr als ein bebildertes Buch, es ist ein kleines Lichtspielhaus. Es werden dort große Bilder gezeigt. In keinem Kino habe ich je solche Bilder gesehen. Mein Film läuft ohne Apparat und ohne Strom. Es braucht nur eine Anregung, dann kommt die Erinnerung.
Inzwischen sind sie kleiner geworden, die Geislerspitzen. Nicht wegen der Verwitterung. nein, einfach kleiner, weil ich sie nicht mehr so sehe wie damals. Als ich ein Bild von ihnen auf die erste Seite meines Tourenbuches klebte, verloren sie viel von ihrem Mythos für mich.
Im Sommer 1963 kletterte ich meine erste »Sechsertour« – die Tissi-Route am Ersten Sellaturm – und meine erste Eiswand – die Similaun-Nordwand in den Ötztaler Alpen. Ich war 18 Jahre alt.
All meine Begeisterungsfähigkeit galt jetzt dem Bergsteigen. Wenn ich in der Turnstunde laufen ging, trainierte ich für die Eiswände; wenn ich im Klettergarten war, übte ich für die großen Dolomitenwände.
Ich war inzwischen Schüler der Oberschule für Geometer in Bozen und nur den Sommer über daheim, wo ich in der stetig wachsenden Geflügelfarm meines Vaters mithelfen musste. An jedem Wochenende aber waren Günther und ich auf Tour. Wir beide, ich, der zweitälteste, und Günther, der drittälteste, Lehrerbub von St. Peter in Villnöß, hatten uns als Kinder nicht besonders vertragen. Erst jetzt, mit unserer wachsenden Kletterleidenschaft, wurden wir ein unzertrennliches Paar.
Schon im Frühsommer 1964 gelangen uns eine Reihe schwieriger Fels- und Eistouren, durch die Vertain-Nordwand, die Hochfeiler-Nordwand und die Ortler-Nordwand, wobei wir im Zentralteil direkt über den senkrechten Hängegletscher stiegen. Im Juli glückte mir mit Paul Kantioler und Heindl Messner eine Begehung der Furchetta-Nordwand. Wir stiegen zu weit links in der Ostwand ein und eröffneten so, ohne es zu wollen, eine Variante zur berühmten Solleder-Route, die seit Jahren mein größter Wunschtraum gewesen war.
Günther und ich waren nicht nur Brüder, wir waren eine eingespielte Seilschaft. Im Sommer 1965 wollten wir unsere Träume in die Tat umsetzen: Erstbegehungen in den Dolomiten, eine Fahrt in die Westalpen und alle Eiswände in Südtirol standen auf unserem Programm.
Wir suchten die Routen selbst, immer wieder neue, schwierigere. Öfter hatten wir Glück und natürlich auch Angst; jeder wurde wenigstens einmal vom Steinschlag verletzt. Aber eine Woche danach kamen wir wieder. Als Brüderpaar hatten wir viele Touren gemacht und Erfahrungen gesammelt. aber immer noch träumten wir von den ganz großen Abenteuern.
Am Gipfelgrat, Günther ist voraus, Erich und ich in der Mitte. Im Hintergrund die südöstlichen Dolomiten, in der rechten Bildmitte der Saß Songher.
Wir lasen die Bücher von Heinrich Harrer, Hermann Buhl und Walter Bonatti. Wir lauschten alpinen Vorträgen und den Erzählungen der »Extremen« im ungeheizten Hüttenraum. Viel später erst, als ich selbst schon alle Kontinente bereist hatte, ahnte ich, dass das Abenteuer nicht in fernen Ländern und nicht in Gipfelhöhen besteht, sondern einzig und allein in der Bereitschaft, den häuslichen Herd gegen eine ungewisse Lagerstätte zu vertauschen.
So stillstehend ruhig mein Leben, das Leben eines Bergdorfbuben auch war, es begeisterte mich. Ein wahrhaftig lebendiges Leben!
Auch leblose Gegenstände konnten in meiner Welt sprechen und handeln. Ja, ich redete mit den Wolken und Felsen. Bis ich zwanzig war, habe ich meinen Vater jedes Mal um Erlaubnis gefragt, wenn ich weiter weg wollte oder seine »Lambretta« brauchte. Dann meldete ich mich nur noch ab. »Morgen gehen wir in die Große Fermeda-Nordwand«, rief ich in die Küche. Ich sagte es nur, weil ich übermütig war, ganz einfach übermütig. Ich begann den Rucksack zu packen, begeisterte Günther für das Unternehmen und wartete nicht auf ein Verbot des Vaters. Er war großzügig, wenn es darum ging, uns am Berg unsere Freiheit zu lassen.
Heute bewundere ich meinen Vater dafür, dass er uns solche Erstbegehungen nicht verbot. Von Freiheit hatte ich damals ein verwirrtes Bild: »Der Name ist heute das einzige, was die Menschen an der Freiheit kennen. Frei von Gesetzen, frei von Sorge des Alltags, frei von Hass, frei von Ehrgeiz wollen sie sein. Wer kennt ihn, diesen Zustand? Niemand. Ich denke oft, wir Bergsteiger sind ihm am nächsten, diesem Paradies auf Erden. Oder: Der freie Bergsteiger wählt keine Gesetze. Er ist kein Ehrgeizling (besser zu sein als der oder so gut zu bleiben wie jener ist nicht mein Ziel), kein Sklave der anderen (um bei ihm Eindruck zu machen) oder Sklave der Gipfelfallnie (die Direttissima-Männer). Mir tun sie alle leid, besonders aber die, die es gar nicht merken, dass zwischen sie und die Berge sich die Gesetze drängen.«
Der Plan stand fest. Mit Heindl und Paul werden Günther und ich bis unmittelbar unter das breite Kar der Fermeda-Nordwand gehen. Schwer bepackt gingen wir durchs Dorf. Die Vorbeigehenden grinsten oder schüttelten den Kopf. Knapp über dem Wald wurde es steil, und Latschen standen überall. Nur vereinzelt noch buschige Zirbelbäume.
Günther war kleiner als ich, schwarz. Wir hatten damals noch keine Bärte. Wir waren kurz geschoren. Wie die Schafe im Frühjahr beim Almauftrieb. Wir trugen Schnürlsamthosen, Bergschuhe mit Profilgummisohlen und verwaschene Anoraks. Im Rucksack, einem »Schnärfer«, wie die Holzarbeiter ihn nannten, lagen einige Haken, Kletterhämmer, ein Pullover und sonstiger Kleinkram.
Die Sonne ging auf. Das helle Licht verwandelte das Schwarz-Weiß in eine bunte Welt. Alles Entsetzen der Seele, die morgendliche Angst, war aufgehoben. Wir vier schauten empor, schauten diese lange graue Wand an und merkten, dass sie nicht ins Unendliche aufstrebte. Es waren Absätze da, auf denen man stehen konnte, von denen aus immer wieder erneut eine Möglichkeit zum Weitersteigen zu finden sein musste. Aus unserer Perspektive hatte sich die Wand zum Machbaren verkürzt.
Es war am Peter-und-Paul-Tag, Kirchtag in Villnöß. Ihn wollten wir an den Fermeda-Türmen »feiern«. Über eine steile Rinne zwischen Großer Fermeda und Villnößer Turm stiegen wir ein. Der Quergang darüber war ausgesetzt, und wir kletterten direkt bis auf einen großen Absatz hinauf. Ein Riss führte von dort 25 Meter nach rechts aufwärts zu einem Standplatz. Nun ging es durch eine 20 Meter hohe, schwach ausgeprägte Verschneidung weiter und nach links durch eine überhängende Rissverschneidung in ein Kaminloch. In diesem Kamin stiegen wir auf und balancierten in die linke Wandhälfte hinüber. Ein gerade schuhgroßer Tritt war da. Von diesem ließen wir uns wieder in die andere Wand fallen, die Hände voraus. Über dem Kamin zogen wir uns an kleinen Griffen zwei Meter an der überhängenden Wand hoch. Es folgte eine glatte Verschneidung, und in zwei weiteren Seillängen turnten wir über Platten zum Gipfel. Der Fels war fast durchwegs brüchig gewesen.
Günther und ich nach der Tour wieder im Tal. Neben uns die Großmutter, Klosterfrau Beatrix (eine Schwester des Vaters), Mutter und Schwester Waltraud.
Erst Jahre später wurde diese Erstbegehung in den Fachzeitschriften erwähnt: »Die 600 Meter hohe Nordwand der Großen Fermeda (V+) wurde im Sommer 1965 durch die Villnößer Paul Kantioler, Heindl Messner, Günther Messner und Reinhold Messner erstmals durchstiegen. Die Führe verläuft unmittelbar über die abgerundete Nordkante der Großen Fermeda.«
1965 fuhr ich zum erstenmal in die Westalpen. Zusammen mit meinem Bruder Günther wollte ich neue Dimensionen kennenlernen, größere Berge. Es gelangen uns eine Wiederholung an der direkten Nordwand der Courtes und die vierte Wiederholung an der direkten Nordwand der Triolet. Dabei stiegen wir über eine neue Route an der Nordwestseite ab, die Route, die Renato Casarotto und Giancarlo Grassi 15 Jahre später im Aufstieg wiederholten. Wir hatten uns eigens für diese Unternehmungen durch Dauerläufe trainiert. Auch hatten wir im Winter das Eisklettern an gefrorenen Wasserfällen geübt.
Im selben Sommer glückten mir einige klassische Touren in der Berninagruppe und weitere Erstbegehungen in den Dolomiten: die direkte Südwand der Neunerspitze im Fanes-Gebiet und der Nordwestpfeiler an der Villnößer-Odla (Wandhöhe 500 Meter; Schwierigkeit V+). Die Route wurde bis heute nie wiederholt.
In diesem Sommer war ich glücklich. Von Juni bis September, von morgens bis abends.
Was ich genoss, war dieses Gefühl der Unsterblichkeit auf der Haut, dieser Dunst in der Luft, wenn ich unausgeschlafen und widerstandslos zum Einstieg ging oder am Abend zerschunden und schwerelos vor Müdigkeit am Gipfel saß. Die Zukunft war eine Gerade.
Mit in Rissen verkeilten Fingern, tagelangen Eilmärschen, Käse und Brot im Rucksack führte ich – oft hart an der Grenze des Machbaren – ein unbeschwertes Leben.
Was ich in den ersten Schuljahren und daheim gelernt hatte, hätte für mein Leben gereicht. Später habe ich auf der Schulbank meine Zeit totgeschlagen, aber plötzlich stand ich auf eigenen Füßen. Heute noch kann ich auf jeden Berg klettern, wochenlang marschieren und im Notfall einen Mann mit der bloßen Faust erschlagen. Ich bin Bauer geworden und ernähre mich selbst. Für eines aber fehlt mir heute wie damals die Ausdauer: mich ein für alle Mal der Obhut unseres Sozialstaates anzuvertrauen. Ich bin von meinem Vater zu einem gehorsamen Bürger erzogen worden, und er hätte es gerne gesehen, wenn ich Angestellter geworden wäre. Von meiner Familie war ich zum Techniker bestimmt. Niemand weiß, warum. Es gibt für mich kein langweiligeres Thema als Technik und keines, das mir ferner läge.
Trotzdem sollte es ein Jahrzehnt lang dauern, bis ich mich aus einer Gesellschaft, die die Menschen in Berufsgruppen einteilt, befreien konnte. Der Mensch hat von Natur aus keinen Beruf. Vielleicht eine Berufung. Wer einmal eine Zeit erlebt hat, in der keine Stunde der anderen gleicht, in der sie alle verfliegen, die Stunden, und im Rückblick doch unendlich lang sind, weil einzigartig, der sucht, der braucht diese Zeit immer wieder.
So wurde ich süchtig nach diesen intensiven Erlebnissen am Berg, und ich habe gelernt, mich einzuschränken, um weiterzukommen. In der Freiheit gibt es den Verzicht, aber keine Grenzen.
An der Südwand des Torre Grande in der Cinque-Torri-Gruppe. Mit Achtzehn war ich fasziniert von haken und Strickleitern.
6. Wettersturz in der Pelmo-Nordwand
Eine dramatische Wiederholung der Simon-Rossi-Route
Unser »Hubschrauber« lärmte die Passstraße zum Falzarego hinauf. »Hubschrauber« nannten wir Vaters Motorrad, wenn er selbst nicht dabei war. Er stellte uns den Motorroller, eine klapprige »Lambretta«, Sonntag für Sonntag zur Verfügung, und wir rollten so weit wie möglich in irgendein Tal hinein, plagten uns durch Wald und Schutt zum Einstieg dieser oder jener Wand, durchstiegen sie oder kehrten in halber Höhe um, suchten den schnellsten Weg ins Tal, erreichten müde den Roller und fuhren nach Hause.
Wir kannten die Dolomiten damals schon gründlich und waren nun darauf aus, die großen Wände auf ihren klassischen Routen zu durchsteigen. Wir träumten von der Solleder-Führe in der Civetta-Nordwestwand, von den Südwandrouten an der Marmolada, von der Nordwand der Großen Zinne. Die alpine Geschichte kannten wir besser als die Geschichte der italienischen Freiheitskriege. Besonders angetan hatte es uns die Kühnheit von Hans Vinatzer, Emil Solleder, Emilio Comici, Gino Soldà, Riccardo Cassin, Anderl Heckmaier und Hias Rebitsch.
Emil Solleder galt damals meine große Bewunderung. Er war es, der vor knapp hundert Jahren in die Dolomiten gekommen war und alle großen Probleme gelöst hatte, an denen die besten Kletterer der Vorkriegszeit gescheitert waren. Vor allem imponierte mir sein Stil. An einem Tag nur stieg er durch die 1100 Meter hohe Nordwestwand der Civetta, und noch schneller löste er das Problem der Furchetta-Nordwand. Die Ostwand des Saß Maor durchstieg er ein Jahr später, 1926. Er war es, der die Einführung des sechsten Schwierigkeitsgrades notwendig machte, und seine drei großen Routen galten neben der Pelmo-Nordwand längere Zeit als die schwierigsten der Dolomiten, ja der Alpen überhaupt.
Wir fuhren unter der Civetta-Wand vorbei, und Günther schrie mir ins Ohr: »Die kommt als nächste dran!« Wir konnten damals nicht ahnen, was uns in der Pelmo-Nordwand bevorstand.
Uns beide juckte bereits das Sitzleder, und ungeduldig rutschten wir auf dem Sattel hin und her. Neun Monate hindurch hatten wir auf der Schulbank gehockt, und doch fehlte uns die nötige Abhärtung in dieser Beziehung. »Nicht einmal dafür nützt das Schulegehen«, lachte mein Bruder. Günther ging damals wie ich in Bozen in die Schule. Er war Handelsoberschüler, ich lernte, Land zu vermessen und Häuser zu bauen. Im Sommer verschwendeten wir keinen Gedanken ans Lernen.
Oft schon hatten wir den Monte Pelmo auf einer Ansichtskarte gesehen und noch öfter seine markante Gestalt von der Mittagsscharte in der Geisler-Gruppe aus bewundert. Endlich konnten wir seine breite Nordwand aus nächster Nähe betrachten. Wir bogen vom Fahrweg ab, ließen unsere Maschine rasten und schauten hinauf in die Wand. Verdammt nass sah sie aus. Unter den Schneeflecken waren lange schwarze Streifen zu erkennen – Schmelzwasser.
Auf dem Weg zum Rifugio di Fiume machte der »Hubschrauber« seinem Namen nochmals alle Ehre, aber er tat seinen Dienst. Noch einen Blick auf die Wand – auch das Wetter versprach zu halten. Wir gingen zur Hütte. Am Eingang aber versperrte uns die Wirtin den Weg. Uns von oben bis unten musternd, machte sie ein Gesicht, als seien ihr Menschen in unserem Aufzug noch nie über den Weg gelaufen. In ihrer Vorstellungswelt ließen sich Milchgesichter offensichtlich nicht mit extremen Kletterhosen verbinden.
Aufgrund ihrer Miene vermuteten wir, auf der falschen Hütte zu sein, und fragten etwas verlegen, ob dies die Ausgangshütte zur Pelmo-Nordwand sei. »Sapete che la parete nord è molto difficile?« war ihre Antwort. Ja, wir wussten, dass die Nordwand besonders schwierig war, gerade deshalb waren wir hier. Wir suchten Schwierigkeiten, wir waren sogar stolz auf unsere ersten großen Klettertouren, die wir, auf uns selbst gestellt, gemeistert hatten. Natürlich wussten wir auch, dass man den Monte Pelmo von Süden her leichter besteigen kann als über seine glatte, senkrechte Nordwand.
Wir wollten aber nicht den Gipfel erreichen, wir wollten die Pelmo-Nordwand klettern, auch wenn die Wirtin ein finsteres Gesicht machte.
Wir richteten das Lager her, packten die Rucksäcke aus, baten den Wirt, den Schlüssel stecken zu lassen, und gingen in die Stube. Der Wirt machte Feuer im offenen Herd, und bald wurde der Gästeraum zur Selchküche. Wie ausgeräucherte Füchse verließen wir das Zimmer und krochen in unser Lager. Das mit dem Rauch – dachte ich beim Einschlafen – ist ein schlechtes Wetterzeichen, und wenn morgen die Wetterprognosen nicht gut sind, wollen wir nicht einsteigen.
Früh wachten wir auf. Die Wand war in ihren Umrissen klar zu erkennen. Der Himmel hing voller Sterne. Auf Socken schlichen wir die Treppe zur Stube hinunter. Wir wollten gleich ins Freie treten. Was für eine Enttäuschung! Die Tür war abgesperrt, der Schlüssel abgezogen.
Wir saßen also im Käfig. Mein Bruder fand, seinem Hausverstand folgend, den Schlüssel in einer Schublade in der Küche. Inzwischen war es drei Uhr morgens. Wir gingen ins Freie. Die »Schlüsselstelle« war überwunden – der Weg zur Wand war frei.
Günther und ich auf dem Roller vor unserer Wohnung in Pitzack. Wir fahren in die Westalpen.
Wir stolperten durch den Wald, durchquerten ein Latschenfeld, stiegen im ersten Morgengrauen übers Kar zum Einstieg auf. Mit dem Tageslicht nahm auch unsere Selbstsicherheit zu. Die Spannung zwischen Vertrautheit und Freude ließ uns besonders wachsam werden.
Wir standen am Einstieg, als die ersten Sonnenstrahlen den Gipfel trafen. Obwohl der höchste Punkt aus der Froschperspektive zum Greifen nahe schien, wussten wir, dass uns 850 Meter von ihm trennten.
Wir übersprangen die gewaltige Spalte zwischen Fels und Gletscher an ihrer schmalsten Stelle und gingen den ersten Felspfeiler an. Aber nach einigen Metern schon kamen wir nicht mehr weiter. Das Gelände sah leicht aus, und auch der Führer sprach von unschwierig; aber wir mussten gleich feststellen, dass wir uns getäuscht hatten: Der Fels war glatt, abgewaschen, feucht und teilweise brüchig. Wir seilten uns an. Ich ging los, während Günther sicherte. Die ersten Bewegungen waren steif, ungeschickt, es fehlte der richtige Rhythmus. Vier Haken steckten in dieser Seillänge; so viele haben wir später in keiner mehr gefunden.
Bald war uns der Fels vertraut, und die Bewegungen wurden flüssiger. Die extreme Kletterei begann. Wir querten auf brüchigen Platten höher, überlisteten eine Seilstufe durch einen engen Riss, verfolgten eine steile Rinne und erreichten ein Band. An diesem querten wir nach links, spreizten eine Verschneidung hinauf, schoben uns an glatter Wand rechts in einen Kamin, überwanden in diesem spreizend einen Überhang und erreichten eine schmale Leiste, die uns auf den ersten großen Absatz der Wand leitete.