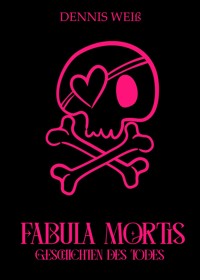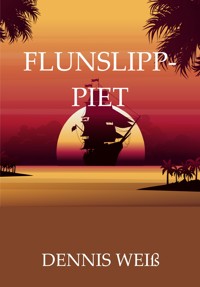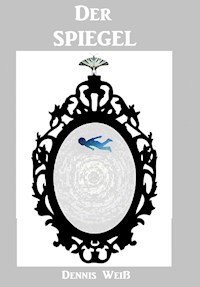Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Band 1: Die Geisterbande und die geheimnisvolle Kraft Tjalf ist ein typischer achtjähriger, der mit seinen Eltern auf ein Schloss nach Brachenfeld ziehen muss. Dort spukt es. Eines Nachts hört er Geräusche, die ihn zu Peter führen, einem Geisterjungen, der in einem Spiegel gefangen gehalten wird. Was Tjalf nicht ahnt, ist seine Schuld an der Befreiung eines Poltergeistes, der dann sein Unwesen treibt Band 2: Die Geisterbande und die sagenhafte Ruine Ein mysteriöses Geistermädchen hat Tjalf aufgesucht, um ihn um Hilfe zu bitten. Sie erzählt, dass ein Hexer viele Geister gefangen hält und möchte, dass Tjalf sie befreit. Als er und Peter ihr folgen, geraten sie in zu einer Ruine, die ein Tor in eine andere Welt öffnet. So erleben Peter und er viele Dinge und plötzlich kommt alles ganz anders, als geplant. Band 3: Die Geisterbande und die Liga der Venatoren Im ersten Abschnitt wird die Geschichte von Erik und Barnd erzählt. Sie reicht weit zurück bis kurz nach Christi Geburt. Im zweiten Abschnitt lernen Tjalf, Peter und Hanna die Venatoren kennen. Eine Vereinigung, die die Wesen aus der Unterwelt bekämpfen will. Dabei treffen sie auf Bartholomäus. Plötzlich wird die Zentrale angegriffen und die Wesen der Unterwelt erscheinen und mit ihnen ein alter Bekannter, der einen dunklen Plan verfolgt Band 4: Die Geisterbande und der Nekromant Professor Lux taucht auf. Ein Nekromant hat ihn aus der Unterwelt befreit. Als dann auch noch Tjalf zurückkehrt, ist die Geisterbande verwundert, denn Tjalf ist gealtert. Zudem müssen sie dann wieder zurück in die Unterwelt, denn Larvaster ist dabei, alle Artefakte des Todes zu sammeln, um etwas Schreckliches zu tun! Band 5: Die Geisterbande und die Hexe Filum Die Geisterbande verschlägt wegen der Artefakte des Todes es zur Hexe Filum. Was anfänglich ein Traum scheint, entpuppt sich nach und nach zu als Alptraum, denn Filum birgt ein Geheimnis, was alles verändert. Am Ende kommt es zum finalen Kampf zwischen Larvaster und Tjalf, um die Erschaffung Luzifers zu verhindern. Band 6: Die Geisterbande und der Kampf gegen Luzifer Luzifer hat es vollbracht- er ist wieder da! Tjalf und die Geisterbande treffen auf Kauko, einem Zeit- und Raumreisenden. Sie helfen ihm, damit er seine Familie wiederfindet. Im Gegenzug bringt er sie direkt zu Larvaster, wo sie eine böse Überraschung erleben. Band 7: Die Geisterbande und die Kräfte des Dämons Um überleben zu können, wird Tjalf von einem Dämon namens Mereg in Besitz genommen. Beide müssen lernen, miteinander zurecht zu kommen, gerade da sie zu unterschiedlichen Seiten gehören Band 8: Die Geisterbande und der Fluch der Santa Maria Claas Wygbold bittet die Geisterbande um Hilfe, denn seine Tochter wurde entführt. Für dieses Abentuer müssen sie direkt ins Bermudadreieck. Hier erleben sie ein Abenteuer, welches sie nicht so schnell vergessen werden. Band 9: Die Geisterbande und die Geschichte des Dr. Maulbart Nachdem Abenteuer im Bermudadreieck wacht Tjalf in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie auf. Bei ihm wurde eine Persönlichkeitsstörung festgestellt und die ganze Welt mit den Geistern und anderen Monstern soll er sich nur ausgedacht haben, um einen wahren Schmerz zu verdrängen. Band 10: Die Geisterbande und das Tor zum Himmel Die Geisterbande ist gezwungen, den Kranz von Jesus aus dem Himmelreich zu holen, um das Leben von Hanna und Tjalf Bruder Tjorven zu retten. Wird es ihnen dennoch gelingen, Malit, den neuen Fürsten der Unterwelt aufzuhalten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1609
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dennis Weiß
Die Geisterbande Dekalogie
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
DIE GEISTERBANDE UND DIE GEHEIMNISVOLLE KRAFT
DIE GEISTERBANDE UND DIE SAGENHAFTE RUINE
DIE GEISTERBANDE UND DIE LIGA DER VENATOREN
DIE GEISTERBANDE UND DER NEKROMANT
DIE GEISTERBANDE UND DIE HEXE FILUM
DIE GEISTERBANDE UND DER KAMPF GEGEN LUZIFER
DIE GEISTERBANDE UND DIE KRÄFTE DES DÄMONS
DIE GEISTERBANDE UND DER FLUCH DER SANTA MARIA
DIE GEISTERBANDE UND DIE GESCHICHTE DES DR. MAULBART
DIE GEISTERBANDE UND DAS TOR ZUM HIMMEL
Impressum neobooks
DIE GEISTERBANDE UND DIE GEHEIMNISVOLLE KRAFT
Band 1
Idee: Dennis Weiß
Text: Dennis Weiß
©Dennis Weiß 2015- 2017
Besondere Worte
Ich veröffentliche nun seit 2013 Bücher unterschiedlicher Genres, von Fantasybüchern für Erwachsene bis hin zu Kinderbüchern und es macht mir noch genauso Spaß wie zu Beginn. Leser werden wissen, dass ich nicht fehlerfrei bin, aber es geht mir in erster Linie darum, Geschichten zu erzählen und nicht, perfekte Texte zu verfassen.
Ich möchte an dieser Stelle meinen besonderen Dank meinem Sohn Vinzent aussprechen, der bisher alle meine Bücher gelesen und sogar Kritiken erstellt hat. Dann danke ich meiner Familie für die Geduld mit mir.
Nachtgeräusche
Jeder kennt das Schloss des weltberühmten Vampirfürsten Dracula in Transsilvanien. Aber wer kennt das Alte Schloss in Brachenfeld? Obwohl, es handelt sich eher um ein Schlösschen.
Niemand?
Das ging mir auch mal so. Mein Name ist übrigens Tjalf und ich erzähle euch meine Geschichte.
Am Anfang war alles schön. Ich ging in die zweite Klasse und hatte gerade mein Zeugnis bekommen und was soll ich sagen, ich bin einfach ein Musterschüler- Mr. Einstein und habe das Klassenziel natürlich erreicht? Das klingt eingebildet? Warum ich sowas mache? Na ja, weil ich‘ s kann…
Es war also der letzte Schultag und die besten Ferien ever standen vor der Tür, als meine Mutter und mein Vater mir mitteilten, dass wir umziehen werden.
„Wieso das denn?“ fragte ich in der Hoffnung, sie fühlen sich emotional verpflichtet, den Umzugsgedanken zurück zu nehmen, „Wollt‘ ihr mir mein Leben versauen?“
Das wollten meine bestimmt nicht, aber das wusste ich damals natürlich noch nicht.
„Aber Tjalf“, entgegnete mein Vater, „wir haben das doch schon tausend Mal mit dir besprochen.“
Richtig?!
Mein Vater übertreibt dauernd. Ich weiß noch, wann sie mich das erste Mal damit zugetextet haben. Es war etwa vor drei Monaten. Falls mein Vater mir dies tatsächlich tausend Mal erzählt hätte, dann wäre es etwa zehn bis elf täglich (!) gewesen und daran hätte ich mich erinnert. Aber darum geht es nicht.
Meine Eltern wollen einfach nicht kapieren, dass ich schlicht und weg nicht wollte. Da hätten sie es mir auch zehntausend oder sogar eine Million Mal verklickern können. Als ich dann noch zu erfahren bekam, wohin wir ziehen sollten, wollte ich erst recht nicht.
„Wir ziehen nach Neumonster“, verriet Mama, „eine kleine Stadt mitten im Herzen Schleswig- Holsteins.“
„Mit zwei Meeren“, ergänzte Papa, aber ich hatte schon auf Durchzug geschaltet.
Ich hatte es gegoogelt, Mama und Papa sicherlich nicht. Vielleicht waren sie auch zu alt, wahrscheinlich hatten sie schon gelebt als es den Tyrannosaurus Rex noch gegeben hatte und kannten Google nicht.
Höchste Kriminalitätsrate!
Höchste Arbeitslosenquote!
Daher auch die höchste Hartz- Vier- Empfänger Dichte!
Und heimliche Hauptstadt von Neo- Nazis!
Ich meine, schlimmer geht’s einfach nicht mehr! Dachte ich, aber dazu kommen wir später.
„Und wann wollt‘ ihr dahinziehen?“ fragte ich und wollte eigentlich nicht „Schon Morgen, Tjalf“ hören, aber meine Eltern sagten genau das! Oh nein!
„Ich will aber nicht“, machte ich mit verschränkten Armen meine Haltung zu dem ganzen Thema deutlich, „müsst‘ ihr halt ohne mich fahren!“
„Tjalf, das bringt doch nichts“, sprach meine Mama und sie hatte dabei immer so eine ruhige, verständnisvolle und herzliche Stimme, „wir haben dich bereits auf eine andere Schule umgemeldet.“
„Dann meldet mich wieder zurück“, stänkerte ich, „ist ganz einfach.“
„Schatz“, sagte mein Vater zu meiner Mutter, „es bringt doch nichts mit dem Jungen zu diskutieren. Wir müssen mit härteren Mitteln auffahren. Jetzt ist Schluss!“
Und wenn mein Papa das „S- Wort“ benutzte und ich meinte nicht „scheiße“, dann war meist auch Schluss.
„Mein lieber Sohn, es ist an der Zeit“, begann mein lieber Vater und meine Mutter saß stumm daneben, „dass wir Fakten schaffen: Wir fahren nach Neumonster und Basta!“
Bevor ich was entgegnen konnte, legte er etwas auf den Tisch. Aus Trotz schaute ich erst nicht hin, aber als meine Augen, durch ein kurzes Blinzeln, es erspähten, wusste ich sofort, was es war und ich fühlte mich wie im siebten Himmel!
Ich sag nur Cavegame!
Ihr wisst nicht, was Cavegame ist?
Loser.
Nein, im Ernst, entweder ihr seid steinalt oder von einem anderen Stern oder blind, taub und könnt nicht lesen- dann könnte ich es verstehen.
Für alle Newbies. Es ist ein Game für den Spintendo 3DS. Was sage ich…es ist DAS Game… oh ja!
„Und können wir nach Neumonster fahren?“ wollte Mama von mir wissen, „du kannst während der gesamten Fahrt über spielen.“
Was? Ihr denkt jetzt, ich hätte nachgegeben und habe mich wegen eines Games für 40,-€ kaufen lassen? Ihr denkt, ich habe meine Prinzipien aufgegeben?
Was? Ich bin halt käuflich! Nur die Dummen haben Prinzipien, wenn es um Cavegame geht. Fahren wir ruhig nach Neumonster, ich werde von dort aus meinen Kampf fortsetzen und wir werden bald wieder zurückziehen. Die werden schon sehen.
Ich bin dann erstmal raus, Cavegame zocken und melde mich bald zurück.
Der Umzugstag! Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe festgestellt, dass ich das letzte Mal in meiner Geburtsstadt geschlafen habe. Das letzte Mal in meinem Stadtteil, in meiner Straße, in unserem Haus und in meinem Zimmer!
Zur Sicherheit schaute ich mir noch mal das Cavegame an, um meinen Preis für das Ganze zu betrachten.
Da mir der Umzug emotional so schwer fiel, brauchte ich natürlich nicht helfen und konnte den ganzen Tag zocken. Erst gegen Nachmittag machten wir uns auf den Weg. Mama musste weinen. Warum zieht sie denn erst um, wenn sie in Wirklichkeit gar nicht will? Ja, ich weiß, Papa hat einen neuen Job beziehungsweise, er wurde versetzt- er ist nämlich Geschichts- und Kunstprofessor an einer Universität und wollte der Karriere wegen nach Neumonster, da sich in dem kleinen Städtchen eine der ältesten Universitäten des Landes befanden- ihr merkt, ich kannte dieses Lied.
Die eigentliche Reise nach Neumonster begann mit einem Stau auf der A7. Und was für einer! Ich meine, wir hätten es kommen sehen können, denn es war Ferienbeginn und das auch noch im Sommer!
Daher glühte der Akku meines Spintendo 3DS und Cavegame könnte gezockt werden bis zum Ende der Reise, aber es geschah das Undenkbare! Das Spiel ging plötzlich aus! Was war los? Erst dachte ich, dass ich aus Versehen gegen den Reset- Button gekommen war, doch die Gewissheit kam mit 130 km/h daher, anders als wir gerade in unserem Wagen auf der Autobahn.
Was sollte ich denn nur machen ohne Cavegame?
„Na, bist du fertig mit Spielen und hast genug?“ fragte meine aufmerksame Mutter.
NEIN! Ich war nur zu blöd, den Akku nicht mehr vor der Reise aufzuladen, da ich den gesamten Tag schon gespielt hatte, war die Wahrscheinlichkeit der Akkuaufgabe sehr hoch, doch meine Spielsucht und meine Angst davor, helfen zu müssen, ließen mich das übersehen.
Ich antwortete meiner Mutter nicht, sondern schaute aus dem Fenster.
„Wir können ja auch ein anderes Spiel spielen“, versuchte sie mich aufzumuntern, denn wie jede Mutter hatte sie ihre berühmte Intuition und roch den Braten natürlich.
„Wie wäre es mit -Ich sehe was, was du nicht siehst-?“ wollte Mama von mir wissen.
„Nö!“ entgegnete ich kurz und knapp und bildete mir tatsächlich ein, sie würde nachgeben, aber ich kenne meine Mutter mein ganzes Leben und ich hätte es wissen müssen, dass sie einen langen Atem hatte.
„Vielleicht Nummernschilderraten?“ fragte sie dann.
Wer das Spiel des Jahrhunderts noch nicht kennt: Entweder errät man die Herkunft der Abkürzung auf dem Nummernschild eines Autos oder man addiert den Zahlenwert (Wortwahl meiner Mutter). Wer die meisten Punkte hat, verliert!
Erneut antwortete ich nichts. Das war mir einfach zu dumm. Hier im Auto hocken, zu einem Ort zu fahren, der mir nicht gefällt und nicht Cavegame spielen können- das war fast wie die Hölle. Das Auto bewegte sich wieder. Irgendwie war ich froh, auch wenn ich eigentlich gar nicht nach Neumonster wollte.
„Wir halten noch mal bei einer Raststätte“, kündigte Papa an, „ich muss mal dringend für kleine Autofahrer. Wir können uns noch etwas Warmes holen und dann geht’s weiter.“
Auch ich nutzte die Zeit, um mich zu erleichtern. Mein Vater war schon fertig und erklärte mir, dass er vorgehen würde.
„Was willst du essen?“ fragte er mich.
Da ich es eilig hatte, antwortete ich schnell.
„Pommes.“
„Nur Pommes?“ wollte mein Vater genauer wissen.
„Ja.“
„Ich frag‘ ja nur“, ließ er mich wissen.
Ich sagte nichts, sondern ging meinem Business nach. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich mich völlig allein in der Raststättentoilette befand. Ich dachte nach über den Umzug und ich vermisste meine Freunde! Benny allen voran. Er war mein bester Freund. Wir kannten uns seit dem Kindergarten. Wir waren uns vom ersten Tag an sympathisch und seitdem unzertrennlich. Und nun? Tja, nun sind wir doch getrennt worden. Wie eine umgekehrte Wiedervereinigung. Es wurde getrennt, was eigentlich zusammengehört. Gedankenversunken bemerkte ich erst jetzt, dass jemand hinter mir stand. Es lief mir im ersten Moment kalt den Rücken runter, denn ich hatte nicht mitbekommen, wie die Toilettentür aufgegangen war. Andererseits war ich gerade am Tagträumen. Ich schloss meinen Pinkelvorgang ab und bewegte mich Richtung Waschbecken. Ich konnte aus dem Augenwinkel erkennen, dass es ein Junge war. Etwas jünger als ich, vielleicht fünf Jahre alt. Ich wusch meine Hände und ließ sie trocken föhnen.
Als ich mich umdrehte, war der Junge verschwunden. Erneute habe ich nicht vernommen, dass er den Raum verlassen hat. Dennoch war ich die ganze Zeit damit beschäftigt nachzudenken. Vielleicht hatte ich es deshalb nicht mitbekommen.
„Da bist du ja endlich“, begrüßte Mama mich, als ich in die Gaststätte kam, um meine Pommes entgegenzunehmen.
„Was hast du denn gemacht? Wohl ein dickes Geschäft erledigt, was?“ scherzte mein Vater.
Ich lachte etwas mit, obwohl er diesen Scherz tatsächlich schon tausend Mal gebracht hatte. Die Pommes schmeckten sehr lecker, was man gar nicht von Raststätten- Pommes erwarten würde. Meine Mutter hatte sich einen Salat geholt, der ihr offensichtlich nicht schmeckte, denn sie hatte die Hälfte übrig gelassen. Mein Vater holte sich den „Best- Burger mit Pommes Spezial“ und haute richtig rein, als gäbe es keinen Morgen mehr.
Als Belohnung durfte meine Mutter den Rest der Strecke nach Neumünster fahren, da Papa ins Suppenkoma fiel. Irritierend ist hier vielleicht der Begriff „Suppe“- es müsste eher „Pommes- und Burger- Koma“ heißen.
Wir verließen das Lokal und ich stieg wieder in das Auto. Es ließ mich sofort daran erinnern, dass ich immer noch kein Cavegame spielen konnte, So weit weg von einer Ladestation! Meine Mutter stellte das Auto auf sich ein, richtete Spiegel und Sitz und wir fuhren los. Als wir wieder auf die Autobahn wollten, mussten wir stehen, da uns keiner reinfahren ließ bei dem Stopp and Go.
„Schau mal“, sprach meine Mutter, „manche fahren wie die Idioten.“
Sie zeigte auf ein Kreuz aus Holz, welches am Straßenrand, links von mir stand. Darunter waren viele frische Blumensträuße. Auf dem Kreuz stand:
„Gott hat dich zu früh von uns genommen. Wir halten dich ewig in unseren Herzen.“
Ich sah das Foto, welches direkt an das Kreuz gestellt war und es ließ mich erschaudern! Das war doch der Junge von der Toilette?! Ich schaute auf das Geburtsdatum und das Sterbedatum und rechnete. Er wäre knapp sechs Jahre alt gewesen. Kann das sein?
Meine Mutter nutzte die nächste Lücke und wir bewegten uns weiter. Es dauerte etwa eine viertel Stunde, ehe wir uns mit angemessener Geschwindigkeit auf der Autobahn bewegen konnten. Der Junge aber ging mir nicht aus dem Kopf. Immer wieder verglich ich das Foto mit der Begegnung auf dem Klo und er kam mir jedes Mal noch ähnlicher vor. Und jedes Mal wurde mir mulmiger bei dem Gefühl, dass es stimmen könnte. Daher schlich sich bei mir der Gedanke ein, dass es alles nur Zufall sein konnte. Wir sind ja hier nicht bei „Sixth Sense“.
Mitten in der Nacht kamen wir in Neumonster an. Eine hässliche Stadt. Selbst in der Nacht. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich müde war und dass ich einfach nicht hier sein wollte.
Wir fuhren in eine Gegend, die etwas abgeschieden war, in einen Stadtteil namens Brachenfeld. Als wir am Tor vorbeifuhren, konnte ich von weitem das beleuchtete Schlösschen sehen. Ringsherum waren Bäume, die keine Blätter mehr trugen, mitten im Juli! Das gesamte Gelände schien nicht gerade einen Nährboden zu haben. Mit der Dunkelheit wirkte es gruselig, aber ich hatte keine Angst, denn ich war zu müde.
Warum musste es ein Schloss sein? Und wie kommen Normalsterbliche zu solch einem Besitz, fragt ihr euch? Nun ja, meine Eltern waren schon immer alternativ, schon weit vor den Neunzigern. Meine Mutter ist Tierärztin und mein Vater im Vorstand eines Elektrofachhandel- Riesen. Da verdient man so Einiges und als sie im Internet gelesen hatten, dass man das Alte Schloss abreißen wollte, haben sie es sich gekauft und modernisiert.
So einfach ist das!
Ich hatte keinen Bock auf so ein Dekadent- Alternativ- Leben, aber ich hatte keine Wahl. Ich sah wie ein Mann, gekleidet wie ein Butler und eine Frau, die wie ein Dienstmädchen aussah, auf uns warteten.
„Wer sind die denn?“ fragte ich mit leicht genervtem Ton, den ich wollte keine Sklaven, die für mich arbeiteten.
„Das sind Heinrich und Isabell“, verriet Mama, „er ist unser Diener und sie Hauswirtschafterin.“
„Wieso das?“ wollte ich wissen und regte mich schon mehr auf.
„Der Oberbürgermeister, Herr Taunus, hatte darum gebeten, der sie hatten schon für die Familie gedient, welche hier früher einmal gelebt hat“, antwortete meine Mutter.
Erst jetzt sah ich, wie alt die beiden waren- das war mir aus der Ferne gar nicht aufgefallen. Merkwürdig. Ich beschloss, die beiden wie Menschen zu behandeln und sie als erstes zu begrüßen.
„Hallo“, sagte ich und mir fiel ehrlich gesagt auch nicht mehr ein.
„Moin“, entgegnete mir Heinrich.
„Es ist Nacht, nicht Morgen“, korrigierte ich und wollte aber nicht unhöflich sein und senkte meinen Kopf nach unten, da ich mich etwas schämte, denn ich wollte den Mann wie einen Menschen behandeln und dann verbessere ich ihn als zweite Handlung.
„Dat heest och net Morgn, sonnern Moin“, lachte Heinrich, „dat is Plattdütsch.“
„Heinrich, verwirr‘ den Jungen nicht“, maßregelte Isabell Heinrich, „entschuldigen Sie bitte“, sagte sie dann zu mir und machte einen Knicks, „er vergisst manchmal seine Manieren. Ich bin Isabella. Zu Ihren Diensten.“
Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte, war ich doch keiner, der blaues Blut in sich trug. Daher gab ich ihr die Hand. Dies wiederum irritierte sie, aber die gab mir die Hand. Heinrich nahm indes unsere Koffer und die anderen Dinge, die wir mitgebracht hatten.
„Ist das Schloss etwa bezugsfertig?“ fragte mein Vater und man vernahm ein Erstaunen in seiner Stimme.
„Gewiss doch, mein Herr“, bestätigte Heinrich und verneigte sich.
„Lassen Sie diese vornehmen Gepflogenheiten“, verlangte Papa und machte mit seiner Hand eine Bewegung als wolle er das Benehmen entfernen.
„Wie Sie wünschen“, sagte Heinrich, „aber wir sind zum Dienen verspflichtet und müssen uns den Vorschriften der Dienerschaft unterwerfen, bitte habt Verständnis.“
„Gut“, sprach mein Vater, „geht in Ordnung. Können wir jetzt in unser Heim?“
Heinrich nickte und führte die beiden und mich natürlich auch zum Eingang. Isabell öffnete die großen, mit Blumen und Drachen verzierten Türen und wir gingen hinein.
„Es ist unglaublich“, zeigte sich Mama begeistert und stürmte in den Saal, der mit Kronenleuchtern, alten Bildern von Landschaften, etlichen Verzierungen, einen roten Teppich und anderem Schnickschnack bestückt war.
Mein Vater war sprachlos, was gleichzusetzen war mit Erstaunen. Er konnte seine Freude allerdings nicht mit der Außenwelt teilen.
„Gut, junger Mann“, sagte meine Mutter plötzlich, „du machst dich jetzt bettfertig und dann wird geschlafen.“
Auf einmal fiel mir wieder Cavegame ein und ich hatte einen Plan. Ich würde mich waschen, Zähne putzen und den Spintendo heimlich in einer Steckdose zum Aufladen anschließen, sodass ich heute Nacht weiterzocken kann.
Ich wusch mich besonders gründlich und meine Zähne würden bei meiner Mühe selbst im Dunkeln funkeln, sodass Mama keine Beanstandung hatte, mich nochmals zum Bettfertigmachen zu schicken.
„Das war aber sorgfältig“, lobte meine Mutter mich, ehe sie mir einen Kuss auf die Wange gab.
„Nacht“, sagte mein Vater kurz und knapp, aber das war in Ordnung- Männer machen das untereinander so.
Eigentlich würde ich mich von meiner Mutter nicht mehr abschmatzen lassen, aber Papa sagte mal, dass sie sonst traurig wäre und das wollte ich natürlich nicht. Und solange es keiner meiner Freunde mitbekam, war es okay.
Ich stürmte nach oben und wollte in mein Zimmer. Auf dem Flur begegnete ich Isabell. Sie lächelte.
„Guten Nacht, junger Mann“, sprach sie.
„Gute Nacht“, entgegnete ich, aber war in Gedanken schon bei Cavegame.
Mein Zimmer sah aus wie aus einem Museum, das Dinge ausstellt aus dem 17. Oder 18. Jahrhundert. Ich hatte es kurz betreten als ich vorhin den Spintendo aufladen wollte, aber nicht weiter beachtet. Mir war nur wichtig, dass eine Steckdose vorhanden war- mehr nicht.
Ich schmiss mich auf das Bett und griff nach unten, wo ich die Steckdose vermutete, aber da war nichts. Gut, die Steckdose schon, aber kein Spintendo! Ich schaute nach, um mich abzusichern, aber das noch immer nichts. Jetzt guckte sich unter dem Bett nach- Nichts! Wie kann das sein?
Es öffnete sich die Tür meiner Zimmers und ich erschrak etwas. Ich sah unter dem Bett hindurch und eine Person bewegte sich, mit langsamen Schritten auf knarzenden Boden, auf mich zu. Als ich umdrehte, sah ich sie:
„Mama?“ mein Gott, war ich erleichtert.
Im nächsten Moment wurde daraus allerdings ein schwerer Klos im Hals, denn meine Mutter hatte den Spintendo in der Hand!
„Was hattest du denn damit vor?“ fragte sie mit leicht wütendem Unterton.
„Äh, nichts“, antwortete ich mit noch zittriger Stimme, die von Erleichterung begleitet wurde, denn es war nur meine Mutter und nicht ein Monster!
„Ich nehme ihn erstmal an mich“, teilte sie mir mit, kam zu mir und drückte mir widerwillig einen Gute- Nacht- Kuss auf die Stirn.
Früher wollte sie immer einen auf den Mund, da ist die Stirn schon ein Erfolg.
„Gute Nacht, Tjalf“, sagte sie, „träume schön. Wusstest du, dass der erste Traum in einem neuen Zuhause wahr wird?“
„Mama“, quengelte ich, denn ich mochte es nicht, wenn sie immer so tat, als sei ich ein kleiner Junge, „den Weihnachtsmann gibt es auch nicht, geschweige denn den Osterhasen oder eben diese Traumerfüllung.“
„Ich wollte es nur gesagt haben“, entgegnete sie und schloss die Tür.
Ich zog mich um und legte mich in mein Bett. Es war ziemlich ruhig geworden und ich konnte, obwohl ich meine Müdigkeit spürte, noch nicht einschlafen. Einen Spintendo XXL wünsche ich mir! Es fiel mir ein, als ich über Mamas Worte nachdachte, die mir lustigerweise einfielen. Wer hätte das gedacht, dass ich über das nachdenke, was meine Mom mir erzählt. Ich glaubte natürlich weiterhin nicht daran. Aber falls es doch zu einer Traumerfüllung durch die erste Nacht kam, dann wollte ich mich absichern! Eine Quasi- Traum- Wunsch- Erfüllung. Spintendo XXL. Er war größer, der Akku hielt bei weitem länger, denn wir hätten mit diesem wahrscheinlich zweimal die Strecke Neumonster fahren können.
Jetzt dachte ich an Zuhause. Vielleicht sollte ich mir etwas anderes wünschen, etwas, was ich eigentlich viel lieber wollte als den Spintendo XXL. Ich wollte wieder zurück nach Hause! In mein Zimmer und in mein Bett!
Meine Gedanken wurden von einem trippelnden Geräusch unterbrochen. Ich konnte es zunächst nicht orten und hörte genauer hin. Es musste vom Dachboden kommen oder eine Etage über mir. Eine Stimme in mir rief, dass ich liegen bleiben sollte, da es sich vermutlich um einen Mader handeln würde. Doch es gab eine weitere Stimme, die sagte, dass ich nachschauen sollte. Sie war die Neugier, die am Ende meines inneren Dialoges siegen sollte.
Ich stand auf und schlüpfte in meine Puschen. Langsam und vorsichtig ging ich in Richtung Zimmertür. Ich wollte kein knarzendes Geräusch erzeugen und den Mader somit verscheuchen. In meinem alten Zuhause gab es keine Mader, nicht mal Mäuse!
Ich fand es irgendwie spannend und es lenkte mich ab von meinem Heimweh. Ich öffnete die Tür und lugte heraus. Es war duster und irgendwie fremd. Der Flur, der einfach riesig war, flößte mir Respekt ein, denn ich war zum einen beeindruckt von dem Bauwerk und zum anderen war es mitten in der Nacht und zwölfjährige haben nun mal ein wenig Furcht, wenn sie durch die Dunkelheit ziehen, auch wenn sie neugierig sind.
Ich hielt kurz inne, um erneut nach dem Geräusch zu hören, denn ich hatte lange nichts mehr wahrgenommen. Just in diesem Moment kam es erneut. Ich schaute in die Richtung des Lautes. Es war direkt über mir! Erst in diesem Augenblick bemerkte ich die Dachbodentür. Ich konnte die Dachbodentür nicht erreichen, da sie sich etwa drei Meter über mir befand.
Meine Suche nach einem Öffner lief ergebnislos, sodass ich nach einiger Zeit aufgab, denn ein kräftiges Gähnen signalisierte mir, dass ich sehr müde war und ich beschloss, die Reise für heute zu beenden und ins Bett zu gehen. Ich würde sicher Morgen herausfinden, wie man oben kommt.
Bevor ich einschlief, dachte ich an den Spintendo XXL und versank im Land der Träume.
„Guten Morgen, Tjalf“, begrüßte mich meine Mutter und riss die Vorhänge auf.
Die Sonne knallte mir ins Gesicht und ich konnte vor lauter Helligkeit kaum etwas erkennen. Meine Augen gewöhnten sich an das Licht.
„Mama, was ist los?“ fragte ich, denn meine Mutter war total aufgebrezelt.
Sie trug ein rotes Kleid, dazu rote Pumps und ein Cardigan in schwarz mit weißen Kreisen.
„Liebling“, antwortete sie in einem Ton, der für sie untypisch war, „die erste Nacht ist vorüber und wir feiern.“
Ich war verwirrt und rieb mir meine Augen, da ich annahm, meine Müdigkeit vernebelte mir das Gehirn. Währenddessen überlegte ich angestrengt, was es denn heute zu feiern gebe und ich kam zu keiner Lösung, denn meine Mom würde da nie ein Geheimnis draus machen- sie freute sich immer sehr und wollte eher, dass wir alle vorbereitet waren als dass wir überrascht gewesen wären.
Plötzlich kam mein Paps hervorgesprungen mit einem Paket in der Hand. Er streckte es mir entgegen und grinste wie ein kleiner Junge. Mein Fragezeichen, das sich in meinem Gesicht gebildet hatte, wurde größer und größer.
„Ich verstehe noch immer nicht“, gab ich zu verstehen, aber dies schien meine Eltern nicht zu interessieren.
„Weißt du denn nicht mehr, was du dir sehnlichst gewünscht hast“, fragte mich mein Papa freudestrahlend und da ich diesen Gesichtsausdruck nicht kannte, machte es mir wenig Angst.
„Ähm, ehrlich gesagt nicht“, antwortete ich, denn ich war in dieser Situation überfordert, „kann ich nicht erstmal aufstehen und duschen?“
„Duschen?“, zeigte sich meine Mutter verwundert, „ ach, das ist überbewertet. Das brauchst du nicht.“
„Vor allem nicht, wenn du unser tolles Geschenk ausgepackt hast“, ergänzte mein Vater.
„Nein, ich kann jetzt nicht“, wehrte ich mich, „und will auch nicht!“
„Aber du musst“, sagte Paps und er wirkte als sei er besessen von einem Roboter.
„Genau, Tjalf, du musst…!“ pflichtet meine Mutter ihm bei.
„Der Spintendo XXXXXXXXL wartet“, flüsterte mein Vater.
„Jetzt hast du es ihm verraten“, sprach meine Mutter und schaute meinen Vater dabei an, „aber egal. Das ändert rein gar nichts.“
Sie gingen auf mich zu und packten mich.
„Jetzt wird gefeiert!“ sagten sie immer wieder.
Ich entriss mich ihrer Fänge und wich nach hinten. Leider war dort das Ende des Bettes, sodass ich Richtung Boden fiel und auf meinen Hinterkopf aufkam. Meine Eltern kamen über das Bett und griffen immer wieder nach mir. Ich hielt meine Arme schützend vor meinem Gesicht und versuchte mich zu wehren.
„Tjalf!“ riefen sie, „Tjalf!“
„Tjalf“, rief eine Stimme, „aufstehen. Was ist los?“
Ich öffnete die Augen und schaute mich um. Meine Mutter war in mein Zimmer gekommen und bewegte sich auf mich zu.
„Tjalf, alles in Ordnung mit dir?“ wollte sie wissen und setzte sich auf die Bettkante.
Ich wich sofort zurück und beäugte sie vorsichtig.
„Kein Geschenk?“ fragte ich dann.
Ich wollte prüfen, ob es nur ein Traum war oder ich gleich wieder angelächelt werde. Dabei registrierte ich, dass meine Mom andere Kleidung trug, was mich ein wenig beruhigte.
„Was für ein Geschenk?“ wollte sie von mir wissen.
Nun schien es, als sei sie verwirrt, welches für mich das Zeichen dafür war, dass ich nur geträumt hatte.
„Ich hatte ein Albtraum“, sagte ich zu ihr.
Mom begann zu lächeln und drückte mich.
„Ein Albtraum über ein Geschenk? Sehr merkwürdig“, sprach sie.
„Es war auch nicht das Geschenk“, entgegnete ich, „sondern die verrückte Art, die du und Paps hattet. Das Geschenk würde mir gefallen.“
„Was war es denn?“ fragte sie, stand auf und ging in Richtung Gardinen, um sie zu öffnen.
Es erinnerte mich sofort an den Traum. Instinktiv zuckte ich erst zusammen, aber als die Vorhänge zur Seite gezogen waren, beruhigte ich mich, denn draußen war Regenwetter, ganz anders als im Traum.
„Ein Spintendo XXL“, antwortete ich.
„Ich denke, das ist eher ein Albtraum für mich und deinen Vater als für dich“, sagte sie, „und nun steh‘ auf, es gibt Frühstück unten in der Küche.“
Ich machte mich auf den Weg in die Küche, wo es nach gebackenen Brötchen roch. Ich liebte diesen Geruch. Ich stopfte mir den Bauch voll und ging wieder nach oben in mein Zimmer. Erst jetzt fiel mir wieder dieser Albtraum ein. Wenn tatsächlich jeder Traum, den man in einem Haus träumt wahr wird- na dann Prosit Mahlzeit. Ich hätte dann zwar einen Spintendo XXL, aber auch völlig abgedrehte Eltern.
Bei der ganzen Nachdenkerei über den Albtraum hätte ich fast vergessen, dass es gestern ja einen Maderalarm gab. Ich beschloss, auf den Dachboden zu gehen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich benötigte eine Taschenlampe, da es dort sicherlich dunkel war. Ich suchte meine Mutter auf, die sich noch immer in der Küche war und den Abwasch machte.
„Was gibt es denn?“ fragte sie, während sie den abwusch.
Einen Geschirrspüler gab es noch nicht. Meine Eltern wollten ihn erst nächste Woche besorgen.
„Haben wir irgendwo eine Taschenlampe?“ fragte ich.
Meine Mutter schaute ohne weiter zu fragen in ein paar Kartons und anderen Stellen nach bis sie schließlich zurückkam.
„Leider nicht“, sagte sie, „oder ich kann es einfach nicht finden. Wofür brauchst du denn eine?“
„Ich wollte auf den Boden“, teilte ich ihr mit, „ich habe gestern Abend einen Mader oder sowas gehört.“
„Nein Tjalf“, wurde sie etwas lauter, „du kannst da nicht hoch. Erst recht nicht, wenn sich dort ein Mader aufhält.“
„Ach Liebling“, unterbrach mein Vater, der gerade die Küche betrat, „lass‘ ihn doch. Mader haben in der Regel mehr Angst vor uns als wir vor ihnen.“
Danke Papa, dachte ich. Er kam im richtigen Moment, um mich zu unterstützen. Allerdings würde dies auch nicht zum Erfolg führen, wenn meine Mom jetzt hartnäckig bleiben würde.
„Wir haben gar keine Taschenlampe“, entgegnete sie mit patzigem Unterton.
„Er kann doch mein Handy haben“, schlug Paps vor.
Meine Mutter überlegte für einen Moment und nickte: „Aber auf deine Verantwortung. Es ist ja nicht mein Handy.“
„Okay“, sagte mein Vater und wandte sich mir zu, „du bist vorsichtig?!“
„Ja.“
„Und baust keinen Mist?“
„Nein.“
Ich war leicht genervt, war ich doch kein Baby mehr, dass noch auf den Arm genommen werden musste. Für mich war es gerade das einzige Spannende hier in diesem alten Haus.
„Na gut, aber du bist zum Mittag wieder hier“, war Moms Kompromiss.
Paps gab mir sein Handy mit dem „du weißt, was dir blüht, wenn dem Smartphone etwas zustößt“ und ich konnte nach oben gehen. Der Dachboden konnte durch eine Ausziehtreppe erreicht werden. Und noch immer hatte ich keine Ahnung, wo sie der Stab befand, der diese Tür öffnen konnte. Ich durchstöberte daraufhin alle Zimmer und fand ihn in einem auf dem Boden liegend. Es erschien mir unlogisch, dass ein Stab, mit dem man zum Dachboden gelangen konnte, weit weg von der Luke lag. Wie sollte denn jemand darauf kommen? Oder sollte dort keiner hoch?
Ich schnappte mir den Stab und ging zu der Stelle, wo sich die Dachbodentür befand. Ich versuchte einige Male, den Haken in die vorgesehene Öse zu bugsieren und es sollte mir erst nach einigen Versuchen und ein einer kleinen Geduldsübung gelingen. Und ja, ich habe auch geflucht, aber das hat meine Mutter (hoffentlich) nicht gemerkt.
Es quietschte und knarzte als ich mit Kraft die Tür aufzog. An ihr war dann die eigentliche Treppe befestigt, die ebenfalls mit einer Öse versehen war. Diese erreichte ich leichter und es gelang mir, die Treppe hinunter zu ziehen.
„Endlich“, flüsterte ich leise und freute mich schon darauf, den Dachboden zu entdecken.
Ich ging vorsichtig hinauf. Meine Angst ließ mich ein wenig in dem Glauben, der Mader könnte dort noch oben sein und würde womöglich sein Revier verteidigen. Ich aktivierte die Taschenlampenfunktion auf dem Handy meines Vaters und leuchtete es einmal rundherum, um mir eine Übersicht zu verschaffen.
Der Dachboden war ein dunkel. Einen Lichtschalter oder eine andere Lichtquelle konnte ich zunächst nicht finden. Ich ging ganz hinauf und horchte, falls das Madervieh kommen sollte. Bei jedem Schritt knarzte der alte Holzfußboden. Nach einiger Zeit bekam ich das Gefühl, dass der Dachboden riesig sein musste. Die ganze Konstruktion wurde durch riesige, dicke Holzbalken getragen. Weiter hinten befanden sich kleine Fenster, die ein wenig Sonnenlicht hinein ließen.
Überall lagen Kisten und Gerümpel herum, die von Staub, Spinnweben und Schmutz bedeckt waren. Eine der Kisten stach mir sofort ins Auge. Sie lag neben einem Spiegel, der einen goldenen und verzierten Rand hatte. Als ich näher kam, erkannte ich kleine Kinder, die wie diese Engelskindern auf manchen Bildern oder als Porzellanfiguren auf Flohmärkten zu finden waren. Sie sahen gruselig aus, aber meine Neugierde trieb mich voran.
Ich ging schnurstracks zur Kiste, die aus massivem Holz war. Sie hatte Verschnörkelungen und Verzierungen, die ich nicht näher erkennen konnte. Es waren aber definitiv keine Kinder oder kleine angstmachende Engel.
Immer wieder fielen meine Blicke aber auf die geheimnisvolle Kiste. Ich konnte es nicht erklären, aber sie zog mich in ihren Bann. Sie war magisch. Ich hielt mit der einen Hand das Smartphone meines Paps und mit der anderen öffnete ich vorsichtig die Kiste.
Sie war schwer, dass merkte ich. Meine Mom würde wieder sagen, ich hätte zu wenig Schwarzbrot gegessen und daher Pudding in den Armen, aber der Deckel von dieser Holzkiste war von Gewicht. Ich beschloss, dass Handy auf den Boden zu legen und mit beiden Händen nun zu Werke zu gehen.
Leider gab das bisschen Licht nicht genug her, sodass ich sehen konnte, was sich in dieser Kiste befand. Ich hielt daher mit der einen den Deckel fest und mit der anderen versuchte ich das Handy zu nehmen.
Ein zufälliger Blick in den Spiegel ließ mich erschaudern, denn ich sah dort einen Jungen, der mich anstarrte. Vor Schreck zog ich beide Hände an mich heran. Der Deckel knallte auf die Kiste und verursachte einen lauten Knall. Das Smartphone meines Vaters ging aus und ich verlor es aus meinen Händen. Nun war es wieder dunkel. Ich spürte mein Herz, wie es mir bis an die Halsschlagader ging und laut pochte. Zudem füllte Kälte den Dachboden. Mein warmer Atem kam wie Nebel aus meinem Mund.
Ich riskierte einen Blick Richtung Spiegel, aber dort war niemand zu sehen. Ich drehte mich langsam um, um nachzusehen, ob ich mir meine Einbildung einen Streich gespielt hatte. Ich konnte nichts erkennen. Vorsichtig kniete ich mich nieder, um das Handy zu ertasten. Ich musste den sandigen und staubigen Boden ein wenig absuchen, ehe ich es finden konnte.
Ich aktivierte die Taschenlampe und hielt das Licht in die Richtung aus der ich den Jungen, oder was auch immer die Gestalt war, vermutete. Plötzlich sah ich ihn dort stehend in einem weißen Nachthemd. Ich erstarrte und meine Hände begannen zu zittern. Ich hatte das Gefühl, Opfer eines Streichs zu werden.
„Das ist nicht witzig, Kleiner“, rief ich mit ängstlicher Stimme, denn obwohl ich annahm, es handelte sich um einen Nachbarsjungen, war ich mir unsicher, denn er lief für seine Verhältnisse spärlich bekleidet herum.
Es kam keine Reaktion.
„Ich schlage vor, du gehst wieder nach Hause“, sagte ich.
Dieses Mal wirkte ich entschlossener. Plötzlich regte sich der Junge und seien Augen wurden rot. Ich bekam einen Schreck und hielt das Handy direkt auf ihn.
„Das glaubt mir keiner“, staunte ich und mir fiel ein, dass das Smartphone eine Kamerafunktion hatte.
„Gut, dass es die moderne Technik gibt“, flüsterte ich, drehte das Handy in die Horizontale und drückte ab.
Es aktivierte sich der automatische Blitz und es wurde für einen Moment hell, als wäre die Sonne in diesen Raum gekommen. Dann wurde es genauso schnell wieder finster. Ich leuchtete wieder mit der Taschenlampenfunktion, aber von dem Jungen war keine Spur.
Aber ich hatte ja die Aufnahme von der Kamera! Ich schaute schnell nach, konnte aber nichts Konkretes erkennen. Ich ging schnell zum Eingang des Dachbodens und merkte, wie etwas hinter mir her war. Dieses Mal packte mich nicht die Neugier, sondern die Angst! Ich beeilte mich und es war ein Lauf inmitten der Dunkelheit. Ich sah den Eingang des Dachbodens, den ich schnell erreichte. Es musste nun rasant gehen, aber ich wollte die Leiter nicht runterfallen. Als ich mich in mittig auf der Holzleiter befand, schaute ich nach oben und sah den Jungen mit den feuerroten Augen. Ich fürchtete, dass er vorhatte, mir zu folgen, sodass ich schnell mithilfe des Stabs die Lucke schloss.
„Alles okay?“ fragte eine Stimme und es versetzte mich in Panik.
Mein Herz macht einen Satz. Als ich wieder klar war, erkannte ich die Stimme meiner Mutter.
„Äh, ja, schon gut“, antwortete ich und wirkte verstört.
„Also Tjalf“, sprach sie, „ich bin deine Mutter und kenne dich. Du kannst ja anderen etwas vorschwindeln, aber nicht mir.“
Sie hatte recht. Sie konnte bei mir eine Lüge immer an der Nasenspitze erkennen. Daher brachte es nichts, sich etwas auszudenken, denn die Dachbodengeschichte an sich klang schon ausgedacht.
„Es war etwas auf dem Dachboden“, antwortete ich.
Meine Mutter schaute verdutzt.
„Was denn?“ wollte sie von mir wissen.
„Ich glaube, es war ein…“, ich überlegte, denn es konnte nicht echt gewesen sein.
Vielleicht machte mir die Angst einen Strich durch die Rechnung und ließ mich Dinge einbilden.
„…Ja?“ wartete meine Mutter meine Antwort ab.
„Marder?“
„Weißt du es nicht?“ fragte sie.
„Nein, ich bin mir nicht sicher“, gab ich wahrheitsgemäß an.
„Hast du etwa ein Foto gemacht?“ wollte meine Mutter erfahren und zeigte auf Paps Smartphone.
„Ähm…“
Ich konnte kaum antworten, da riss mir meine Mutter das Handy aus der Hand und schaute in die Fotoalben des Speichers nach.
„Tolles Bild“, lachte sie, „da erkennt man ja gar nichts.“
Sie reichte es mir zurück.
„Gib‘ es deinem Vater“, sagte sie und ging in die Küche.
Ich konnte es nicht glauben und forschte ebenfalls nach. Was ich erblickte, machte mir Angst und warf Fragen auf, denn ich konnte ganz klar auf dem Bild einen Jungen mit roten Augen erkennen. Er sah krank und irgendwie aus, wie ein Zombie aus einem Film.
Hatte meine Mama das falsche Foto angeschaut oder wollte sie es nicht wahrhaben? Dachte sie, ich spiele ihr einen Streich? Auf all diese Fragen wusste ich keine Antwort.
„Und wie war dein Ausflug auf dem Dachboden?“ wollte mein Vater von mit erfahren als ich ihm sein Smartphone zurückgab.
„Spannend“, antwortete ich.
„Marder- spannend?“ fragte mein Paps.
„Ich denke schon“, sagte ich knapp.
„Vielleicht sollten wir zusammen hoch gehen, um nachzuschauen“, schlug er vor und ich fand die Idee gar nicht schlecht.
„Essen!“ rief meine Mutter aus der Küche und unterbrach unseren Gedanken.
„Wir werden uns erstmal die Bäuche vollschlagen und dann gehen wir auf die Jagd“, grinste mein Vater und ging Richtung Küche.
Und wir hauten rein, dass die Wände wackelten! Es gab nämlich mein Lieblingsessen: Senfeier! Und meine Mami konnte schon immer die besten Senfeier der Welt machen. Das Geheimnis lag daran… ja jetzt hätte ich es fast verraten. Es ist die Sauce. Und ihr Geheimnis ist besser gehütet als das Gold von Fort Knox.
Kurz nach unserem Mal geriet ich ins Suppenkoma. Es ist der Zustand, nachdem der Bauch sich schon etwas dehnen musste und man die Sättigungssignale ignoriert hat und trotzdem weiter geschlemmt hat. Einem ist übel und wohlig zugleich.
„Dachboden?“ sagte mein Vater mit satter Stimme.
„Powernapp?“ entgegnete ich und er nickte sofort.
Okay, für alle Nichtwissenden. Ein Powernapp ist wie richtiger Schlaf, aber halt nur eine Viertelstunde bis längstens zwanzig Minuten. Dann muss man aufstehen, wenn nicht, dann wird es sehr schwer. Und es ist typabhängig- es gibt Menschen, die können es und es gibt Mama- die kann es nämlich nicht (sie schläft dann weiter oder wird erst richtig müde).
Wir ratzten also unseren Schlaf der Gerechten oder wie Paps zu sagen pflegte, wir benutzten die Powern- App. Wortwitz und zwar ein schlechter, aber dafür war mein Vater bekannt.
„Paps“, flüsterte ich nachdem ich aus dem Powernapp wieder erwacht war.
„Ja?“ sagte er und der Schlaf hatte ihn noch fest im Griff.
„Wir wollten auf den Dachboden“, erinnerte ich ihn.
„Stimmt“, sagte er und schwang sich auf.
Es klappte nicht beim ersten Mal, sodass er ein zweites Mal ansetzen musste. Mein Vater wurde halt älter, sagte er selbst immer über sich.
„Taschenlampe“, sprach er und verschwand kurz, um mit einer riesigen zurück zu kommen, „Recht diese hier?“
„Auf jeden Fall“, antwortete ich begeistert und wir machten uns auf.
Papa öffnete mithilfe des Stabs die Lucke und wir kletterten vorsichtig hinaus, zumindest ich, denn ich hatte noch immer den Marder und den Jungen im Kopf. Natürlich wollte ich meinem Vater davon nichts erzählen. Zum einen, um meine eigentliche Angst zu verbergen und zum anderen, damit er mich nicht für verrückt erklärt. Mein Vater schaltete die Taschenlampe an und der Dachboden wirkte an sich schon heller, denn sie strahlte mehr als das Handy.
„Wo war der Marder denn?“ fragte Paps während er suchte.
„Da hinten“, antwortete ich und zeigte in die Richtung der Truhe und des Spiegels.
Mir wurde plötzlich wieder Bange, denn mir wurde wieder bewusst, dass ich diesen Jungen im Nachthemd gesehen hatte. Ich wollte meinem Vater dennoch nichts anmerken lassen und blieb cool.
„Alles in Ordnung?“ fragte mein Paps.
„Ja“ antwortete ich mit zitternder Stimme.
„Der Marder tut dir schon nichts“, versuchte er mich zu beruhigen, „der hat mehr Angst vor dir als du vor ihm.“
Mein Vater ging in Richtung der Truhe und des Spiegels und kam schnell dort an.
„Oh schau mal“, sagte er, „eine Truhe und ein alter Spiegel und anderer antiker Trödel.“
„Mh“, sagte ich kurz und dreht mich ständig um, denn ich wollte nicht schon wieder überrascht werden von diesem Jungen.
Als mein Blick beim Spiegel vorbeiging, erhaschte ich den Jungen wieder. Er stand hinter meinem Vater! Ich schreckte auf und fing zu schreien an. Mein Vater drehte sich blitzschnell zu mir und leuchtete mir ins Gesicht, was mir noch mehr verwirrte.
„Hinter dir ist etwas!“ schrie ich, „Papa, schnell, hinter dir!“
Mein Vater machte eine weitere Drehung und hielt seine Taschenlampe dorthin, aber da war nichts!
„War es der Marder?“ fragte er, schaute sich um und nahm einen herumliegenden Besenstiel vom Boden.
„Ich weiß nicht“, antwortete ich zögerlich, denn ein zweiter Blick in den Spiegel verriet, dass der Junge noch immer da stand.
Ich erstarrte vor Angst und konnte nicht glauben, was ich dort sah. Im Spiegel bildete sich ab, dass der Junge direkt vor meinem Vater stehen musste, aber das tat er nicht, wenn ich in die Richtung schaute. Ich musste unter Halluzinationen leiden- das musste es sein!
„Was ist los?“ fragte mein Vater, der meine Irritation mitbekommen hatte.
Ich sagte kein Wort, denn ich konnte nichts sagen. Als steckte ein dicker fetter Kloß in meinem Hals! Als habe es mir die Luft verschlagen! Durch meinen starren und ängstlichen Blick in Richtung Spiegel, wo noch immer der Junge mit dem weißen Nachthemd stand, drehte sich mein Vater ebenfalls dort hin.
„Ist da was im Spiegel?“ fragte er und seine Stimme verriet, dass er nicht wusste, worauf meine Augen sich fixiert hatten.
„Verrate mich nicht“, ertönte eine Stimme klar und deutlich in meinem Kopf als hätte ich In- Ear- Kopfhörer drin.
„Tjalf“, sprach mein Vater mich an und packte mich an der rechten Schulter, um mich leicht zu schütteln, „Erde an Tjalf, bitte melden.“
Erst jetzt riss es mich aus der Starre und ich schaute meinen Paps an.
„Ja?“
„Alles in Ordnung mit dir?“ fragte er besorgt, „du wirkst abwesend. Hast du Angst?“
„Ja, nein“, stammelte ich, „ich weiß nicht. Habe mich wohl erschrocken.“
„Das hat man gesehen“, sagte mein Vater dann, „ es handelte sich aber wahrscheinlich nicht um Marder- Angst, oder?“
Ich überlegte kurz, denn ich wusste auf Anhieb nicht, was ich ihm antworten sollte. Ich hatte einen Jungen im Spiegel gesehen- was kann man da schon zu sagen? Klapsmühle vielleicht. Und so eine Furcht vor einem Marder? Das kaufte er mir auch nicht ab. Und dann fiel mir wieder die Stimme im meinem Kopf ein und dass dies ebenso verrückt klang wie alles andere. Ich entschied mich für eine Lüge, obwohl ich meinen Vater ungern anschwindele.
„Es war ein Schatten, vor dem ich mich erschrocken habe“, sagte ich, „er erinnerte mich an eine Schattenwesen aus Cavegame.“
„Dieses bekloppte Spiel“, ärgerte es meinen Vater, „überbeansprucht deine Fantasie. Du solltest in Zukunft weniger spielen oder besser gar nicht mehr, wenn es nach mir ginge.“
„Ja, Paps“, pflichtete ihm bei und hoffte insgeheim, dass er es bis heute Abend wieder vergessen hatte.
„Ich denke, für heute beenden wir die Marderjagd“, beschloss mein Vater.
Ich nickte und machte einen letzten Blick auf den Spiegel, wo ich nichts sah, außer dem Spiegelbild. Dann drehten wir um und verließen den Dachboden.
„Na, habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt?“ wollte meine Mama wissen, als wir wieder in der Küche waren.
„Naja, nicht ganz“, lachte mein Vater, „kein Marder, aber Tjalf hat sich erschrocken von einem Schatten. Und drei Mal darfst du raten, wo das herkommt… von diesem Hefgame…“
„Cavegame“, verbesserte ich.
„Wie auch immer“, entgegnete er, „es ist einfach nicht gut für ihn.“
„Aber Schatz“, sprach meine Mom, „ wir werden ihm jetzt nicht verbieten, damit zu spielen, weil er einmal Angst vor einem Schatten hatte. Der Junge muss lernen, damit umzugehen. Immerhin hast du es ihm zu Weihnachten besorgt.“
Mein Vater schwieg. Es hieß in der Regel, dass meine Mutter recht hatte. Er guckte mich an und verließ die Küche.
„Ist denn alles okay mit dir?“ wollte Mama von mir erfahren und beugte sich ein wenig zu mir hinunter.
„Ja“, antwortete ich und lächelte ein bisschen, damit meine Mutter keinen Verdacht schöpfte, „es geht schon, Ich habe mich nur etwas erschreckt… jetzt geht es wieder.“
„Wirklich?“
„Ja, Mama.“
Damit hatte sich die Sache für meine Mutter erledigt und sie ließ von mir ab. Offenbar glaubte sie mir. Aber für mich war es nicht vom Tisch. Ich machte mich auf in mein Zimmer, denn ich musste nachdenken- scharf nachdenken!
Ich schmiss dabei auf das Bett. So ließ sich am besten der Gehirnschmalz in Wallung bringen. Ich erinnerte mich an den Jungen im weißen Nachthemd. Irgendwie schien er nicht aus unserer Zeit zu stammen. Er machte mir Angst. Zudem hörte sich die Stimme in meinem Kopf so echt an. Ich zweifelte nicht daran, dass er wirklich dort gewesen war, ich zweifelte an mir selbst.
„Vielleicht bist du verrückt?“ fragte ich mich.
Aber ich wusste keine Antwort. Natürlich nicht, das sage ich jetzt, aber damals wusste ich es nicht. Vor lauter Gedanken schlief ich letztendlich ein.
Bilder von dem Jungen im Nachthemd spukten im meinem Kopf herum und immer wieder dieses Bild von ihm im Spiegel. Nur wirkte er böse. Mein Vater war kleiner und schmächtiger. Als er sich umdrehte wirkte er zudem dümmlicher.
„Was ist?“ fragte er lispelnd.
Ich konnte nichts sagen, da eine Kraft mich zurückhielt. Der Junge stieg aus dem Spiegel und ging schnurstracks auf meinen Vater zu. Ich war wie angewurzelt und konnte mich nicht bewegen, obwohl ich es mit meiner ganzen Kraft versucht hatte. Mein Vater schien ihn nicht wahrzunehmen, denn er schaute nur auf mich.
„Was ist denn nun?“ lispelte er weiter.
Der Junge war angekommen, drehte sich grinsend um, bevor er einen Strick emporbrachte und es meinem Vater um den Hals legte. Innerlich schrie ich, dass er aufhören sollte.
Ich wachte schweißgebadet auf. Nur ein Traum.
„Hilf mir!“ hörte ich eine Stimme und sie klang wie die des Jungen vom Dachboden.
Es drang so tief in mich, sodass ich hochschreckte, denn es erinnerte mich an meinen Traum. Er wirkte so real, obwohl ich wusste, dass ich träumte, spürte ich noch immer meine Angst, mein Vater könnte sterben.
„Hilf mir“, ertönte erneut die Stimme.
Vielleicht war es wieder ein Traum? Oder ich war tatsächlich verrückt. Im jedem Fall wollte ich nun wissen, was da vor sich ging, auch wenn ich schiss hatte. Ich stand auf und machte mich auf den Weg zum Dachboden. Meine Neugier leitete mich und ich lief durch das Dunkel des Schlösschens. Es war zwar schwierig, aber es gelang mir, die Luke zum Dachboden zu öffnen. Als ich die Leiter hochkletterte, knarzte und knackte sie.
Mein Puls pochte bis zu meinem Hals als ich tatsächlich auf dem Dachboden stand und bemerkte wie finster es hier oben wirklich war.
„Hilf mir“, wiederholte er sich.
Es könnte eine Falle sein, dachte ich, aber ich schlich dennoch voran. Eine Seite in mir wollte es, auch wenn es sehr langsam war. Wie soll man sich auch vorwärts bewegen, wenn man die Hand vor seinen Augen kaum sehen konnte?
Ein Restlicht ließ Silhouetten von einem Spiegel und einer Truhe erkennen. Ich beschloss, mich hinzuknien, um mir eine Übersicht zu verschaffen und um nicht gleich einen Blick in den Spiegel zu riskieren.
„Bist du da?“ fragte die Jungenstimme.
Ich antwortete ihm nicht, denn ich wollte wissen, ob er sich zeigte. Es könnte sich bei all diesen Ereignissen doch auch um einen Streich eines Nachbarjungen handeln, der gleich aus der Ecke hervorspringt und „verarscht“ ruft, das ganze gefilmt hatte und im Internet veröffentlicht und mich für den Rest meines Lebens mobbt.
Es kam nichts.
„Zeig‘ dich“, sprach ich und ich zitterte am ganzen Körper, denn die Nachbarjungentheorie konnte ich selbst nicht so ganz glauben.
Zumindest nicht in diesem Moment. Es gab immer Restzweifel. Nachdem keine Reaktion kam, lugte ich kurz hoch, sodass ich zwangsläufig den Spiegel sehen konnte, den ich eigentlich vermeiden wollte. Ich sah den Jungen, wie er in meine Richtung starre. Schnell bückte ich mich wieder und ich spürte wie die Furcht meinen Herzschlag beschleunigte.
„Bleib‘ doch“, sagte die Jungenstimme, „ich will dir doch gar nichts antun.“
Trotz dieser sanften und harmlos wirkenden Stimme, konnte ich im ersten Moment nicht anders als unten zu bleiben. Dann aber zog es mich hoch und ich stellte mich hin. Ich sah den Jungen, wenn auch nur schemenhaft. Ich versicherte mich, ob er hinter mir stand. Als ich niemanden vorfand, wandte ich mich erneut dem Jungen zu.
„Danke“, sagte er.
Auf meinem Gesicht bildete sich ein Fragezeichen, denn ich verstand nicht, was er von mir wollte und wofür er sich bei mir bedankte.
„Mein Dank gilt dafür, dass du mich nicht verraten hast“, erläuterte der Junge.
Mit jedem Wort, das seinen Mund verließ, schien er weniger bedrohlich für mich zu sein. Und dennoch blieb ich auf der Hut. Ich meine, ich war mitten in der Nacht auf dem Dachboden eines mir noch fremden Anwesens. Da musste man aufpassen!
„Was machst du in dem Spiegel?“ fragte ich, obwohl eine andere Frage wohl passender gewesen wäre, aber vielleicht wusste ich die Antwort auf diese Frage ja bereits.
„Ich bin ein Gefangener“, antwortete der Junge schüchtern.
„Das verstehe ich nicht“, zeigte ich irritiert, denn es erklärte noch nicht, weshalb er im Spiegel zu sehen war und hinter mir nicht, „ ist das eine Art Trick?“
„Nein, gewiss nicht“, gab er mir zu verstehen, „es liegt viel mehr daran, dass…“
Und er unterbrach seinen Satz mit einem Schluchzen. Es fiel ihm sichtlich schwer, mir auf die Frage eine Antwort zu geben.
„Bist du ein Geist?“ platzte es aus mir heraus.
Es war eine Mischung aus Begeisterung, Restfurcht und einem „Ich hab es schon immer gewusst, dass es mehr gibt, als wir wahrnehmen“- Moment.
„Ja“, bestätigte er meine Vermutung.
„Und was machst du hier?“ bohrte ich weiter.
„Ich brauche jemanden, der mich befreit“, teilte der Junge mir mit.“
Meine Angst verflog von Sekunde zu Sekunde, denn ich hatte das Gefühl, abgesehen von dem Spiegelding, einen ganz normalen, etwa gleichaltrigen Jungen vor mir zu haben.
„Vielleicht hat es einen Grund, dass du in dem Spiegel steckst“, entgegnete ich ihm.
Sein Blick wurde trauriger.
„Ich kann doch nichts dafür, dass ich hier bin, ich habe mir das nicht ausgesucht!“ brüllte er.
Ich erschrak mich vor seiner plötzlichen Energie, die wie ein Blitz durch mich hindurchströmte und genauso schnell verschwand.
„Ey, ich kann auch nichts für deine Situation“, machte ich klar.
Er beruhigte sich wieder und schaute mich an.
„Ich bin Peter“, sprach er, „und ich bin hier gefangen, weil Larvaster mich hier eingesperrt hat.“
„Wer ist Larvaster?“ fragte ich und war leicht aus dem Konzept- klar, ich hatte im Grunde auch nie eines.
„Vielleicht erzählst du mir alles“, schlug ich vor, „und wir schauen, wie ich dir helfen kann.“
Peters Geschichte
Im Jahre 1958 verschlug es Elfriede und Kurt nach Brachenfeld, einem Stadtteil von Neumonster, weil sie dort ein kleines Schloss günstig erwerben konnten. Gerade nach dem zweiten Weltkrieg waren die Häuser der meisten Menschen aus Schutt und Asche gebaut worden. Das war bei diesem edlen Gebäude anders. Es war nicht beschädigt worden und massiv. Elfriede war Lehrerin und Kurt Geschäftsmann, der sehr gut verdiente, sodass sie sich dieses Schloss leisten konnten.
Es war wunderschön und so verliebten sich Elfriede und Kurt in dieses Anwesen. Bei sich hatten sie den kleinen achtjährigen Peter, ihr einziges Kind. Elfriede und Kurt waren glücklich. Und so bezogen sie das Anwesen und verschönerten es auf ihre Weise.
Peters Familie war finanziell sehr gut gestellt, sodass sie sich einen Hauslehrer leisten konnten, während Elfriede an der ortsansässigen Grundschule die Fächer Mathematik und Musik unterrichtete. Kurt hatte einen Laden für Holzspielzeug in Hassbek, einer Nachbargemeinde von Neumonster. Sie lief ziemlich erfolgreich, da er hochwertiges Holzspielzeug anbot. In Neumonster wollte er nun eine zweite Filiale eröffnen, welches viel Zeit binden sollte.
Die Eltern von Peter hatten durch ihre Erwerbstätigkeiten und durch ihre Freizeitbeschäftigung keine Zeit für ihren Jungen. Elfriede war nämlich in der Gemeinde Brachenfeld sozial engagiert, während Kurt dem Golf frönte.
„Mutter, kannst du heute Nachmittag mit mir spielen?“, frage der kleine Peter seine Mutter.
„Aber Peterle“, antwortete sie, „du musst noch Latein und Deutsch machen und außerdem habe ich heute Essensausgabe bei den Armen. Also keine Zeit.“
Peter fragte daraufhin seinen Vater:
„Vater, kannst du etwas mit mir spielen?“
„Mein Sohnemann“, antwortete sein Vater daraufhin, „willst du in der Gosse enden, weil du die ganze Zeit gespielt hast?“
„Nein, Vater, das will ich nicht, ich will…“
„…Kindern mit einem Will’n kriegen was auf die Brill’n“, unterbrach seine Mutter.
„Ja, Mutter“, sagte Peter und schaute traurig auf den Boden.
„Du wirst uns später mal dankbar sein“, sprach der Vater, „und nun mache deine Aufgaben, dein Lehrer wartet schon.“
Peter wollte gerade weggehen als er innerlich seinen kleinen, aber feinen Widerstand spürte, der zu nerven begann. Er veranlasste den Jungen stehen zu bleiben.
„Gibt es noch etwas, Peterle?“ fragte die Mutter neugierig.
Peter aber sagte nichts. Er befand sich inmitten eines Gefechts zwischen Widerstand und Gehorsam.
„Peter, hörst du mich?“ wollt der Vater wissen und schaute streng, was Peter aber nicht sehen konnte, „antworte deiner Mutter gefälligst, wenn sie dich etwas fragt!“
Der Ton wurde ziemlich deutlich und Peter spürte die aufkommende dicke Luft, die sich bildete.
Dann drehte Peter sich wieder um.
„Ich will nicht!“ brüllte Peter auf einmal und sein Vater stand auf und gab seinem Jungen eine Backpfeife, sodass sein linkes Ohr klingelte, seine Wange ganz heiß und rot wurde und er kehrt machte und weinend weglief.
„Kurt, dass hätte nicht sein müssen“, sagte Elfriede.
„Aber der Junge wurde aufsässig, das darf ich nicht dulden!“ rechtfertigte der Vater sein erzieherisches Mittel, „sonst wird aus ihm noch ein fauler Sack.“
„Sag sowas nicht, Kurt“, entgegnete sie.
„Ich bin der Herr im Haus und habe das letzte Wort und damit Schluss“, machte der Vater mit energischer Stimme deutlich, sodass die Mutter sich zurückhielt, denn zu der Zeit war es so.
Peter lief auf sein Zimmer und weinte bis er Kopfschmerzen davon bekam. Er hasste sein Leben! Immer war er allein oder mit seinem Lehrer am Lernen. Seine Mutter hatte keine Zeit für ihn, genauso wenig wie sein Vater. Wahrscheinlich wollten sie ihn gar nicht.
Seine Gedanken wurden durch einen gewaltigen Donnerschlag unterbrochen. Peter ging ans Fenster, denn er liebte es, Gewitter anzuschauen. Sie machten ihm keine Angst- sie faszinierten ihn.
Es regnete noch nicht, aber die Blitze schossen durch den Nachthimmel als spielten sie eine Sinfonie. Sie waren derart schnell, sodass Peter sie nicht alle erfassen konnte. Und ihnen folgte stets ein Donnergrollen. Manchmal laut und stark als wenn eine Riese den neben dem Haus vorbeitrabte und manchmal etwas leiser, als wäre es noch weit weg.
„Vielleicht haue ich einfach ab“, sagte Peter zu sich.
In diesem Moment betrat seine Mutter das Zimmer. Hatte sie etwas mitbekommen, als er mit sich gesprochen hatte?
„Wir wollen Abendbrot essen“, sagte sie ihm, „und wenn du bereit bist, dich für dein Verhalten vorhin zu entschuldigen, wird dein Vater dir verzeihen.“
In ihrer Stimme war etwas Flehendes, das Frieden zwischen den Männern im Haus wollte. Gar nicht auszudenken, wenn das weiter anhielt und Vater und Sohn immer stritten, sogar bis ins hohe Alter.
Peter aber stand noch immer am Fenster und guckte sich das Naturschauspiel als hätte er seine Mutter gar nicht gehört. Natürlich hatte er das, aber er wollte eben nicht. Stets verhielt es sich so, dass sein Vater wütend war und er sich entschuldigen musste, ganz gleich ob er schuld war oder nicht. Der Vater war es nie!
„Peter, nun komm‘“, sagte die Mutter und es war ihr wichtig, denn sie fürchtete, dass es sonst sehr ungemütlich werden könnte, „du weißt, dass dein Vater es nicht so gemeint hat. Er liebt dich und sorgt sich um dich. Seine Arbeit läuft gerade nicht so gut, daher ist er gerade so.“
Peter aber wollte all dies nicht hören. In diesem Moment entschied er sich, seine Familie zu verlassen. Er würde es nicht sofort tun, denn seine Mutter würde ihn aufhalten wollen und sein Vater würde ihm den Hintern versohlen, sodass er wochenlang nicht richtig sitzen könnte, ohne Schmerzen zu haben. Also riss er sich zusammen.
„Ich komme gleich, Mutter“, sprach er mit ruhiger Stimme, obwohl er innerlich zitterte, „ich wollte nur noch ein paar Blitze sehen.“
Ein Donnern ertönte. Seine Mutter drehte sich um und ging aus seinem Zimmer.
„Bis gleich“, sagte sie, „und denke daran, dich zu entschuldigen.“
Sie wirkte freundlich, da sie wusste, alles würde wieder gut werden. Dann war sie weg. Peters Anspannung wurde ihm deutlich, denn er spürte, wie anstrengend es war, sich zu verstellen. Er holte flugs seinen Koffer unter seinem Bett hervor, den er noch vom Einzug kannte und packte seine wichtigsten Sachen hinein. Neben ein paar Unterhosen, die man immer benötigte, legte er sich seinen Lieblingsbären Bernd hinein.
Dann ging er nach unten in die Küche, wo bereits sein Vater am Essenstisch saß und die Tageszeitung las. Sein Vater bekam zwar mit, dass sein Sohn die Küche betrat, würdigte ihm aber keines Blickes. Er wollte es ihm schwer machen, da er lernen sollte, wer hier das Sagen hatte. Und das war definitiv nicht Peter!
Peter machte sich sofort auf den Weg zu seinem Vater und blieb vor ihm stehen. Er wartete, ohne ein Wort zu sagen. Peter wollte nur nicht, dass irgendeiner Verdacht schöpft, daher verhielt er sich wie immer, oder zumindest wie er es dachte. Sein Vater knickte eine Ecke der Zeitung ein und schaute grimmig und gespannt.
„Es tut mir Leid“, sagte Peter mit seiner unsicheren Art.
„Was tut dir Leid?“ wollte der Vater wissen und benutzte absichtlich einen strengen Ton.
Er wollte prüfen, ob sein Sohn diese Entschuldigung wichtig war oder gleich.
„Für mein Benehmen vorhin“, antwortete Peter und sein Blick richtete sich gen Boden.
„In Ordnung“, sprach der Vater, „das gibt eine Woche Hausarrest und es hat sich für mich erledigt.
Die Mutter blickte erstaunt, hatte sie nicht mit einer weiteren Strafe ihres Mannes gerechnet. Dennoch sagte sie nichts dazu, um eine Provokation zu vermeiden. Peter blieb ruhig, um ebenfalls seinem Vater nicht das Gefühl zu geben, dass er es nicht akzeptierte.
Im Inneren fand er es total ungerecht. Sein Vater hatte ihn ins Gesicht geschlagen und bekommt keine Strafe. Hätte er den Nachbarn gehauen, würde er im Gefängnis sitzen müssen. Peter brannte innerlich und hätte schreien könne, aber er wollte es nicht. Er wollte jetzt seinem Vater, der ihn eh nicht verstehen wollte, nicht auch noch vorheulen, dass er eigentlich wütend war. Stattdessen kam ein leises:
„Ja, Vater.“
„Gut, dann kannst du dich setzen und Abendbrot essen“, entschied das Familienoberhaupt.
Peter aß so viel wie in seinen kleinen Bauch passte. Als er kurz vor dem Platzen war, schickte ihn sein Vater ins Bad, um sich bettfertig zu machen. Peter tat, was ihm aufgetragen wurde wusch sich und zog seinen Schlafanzug an, um dann ins Bett zu gehen. Seine Mutter kam vor dem Einschlafen noch mal zu ihm, um Peter einen Gute- Nacht- Kuss zu geben.
„Schlaf gut“, sagte sie.
Peter erkannte die liebevolle Stimme, die sie hatte, wenn sie dachte, alles sei in Ordnung. Dass sie sich irrte, wusste sie nicht.
„Gute Nacht“, flüsterte Peter und legte sich in seine gewohnte Schlafposition.
Seine Mutter löschte das Licht und macht die Tür hinter sich zu als sie das Kinderzimmer verlies. Es war plötzlich ruhig. Peter lauschte in die Nacht hinein und es war absolut still. Selbst das Gewitter war weitergezogen und der Regen machte eine wohl Pause.
Peter wartete bis tief in die Nacht, da seine Eltern nicht mitbekommen sollten, wenn er ging. Er schrieb ihnen noch einen Abschiedsbrief.
Liebe Mutter und Vater,
wenn ihr diese Zeilen lest, habe ich euch bereits verlassen. Ich ertrage es nicht mehr, für alles die Schuld zu bekommen und die Unwahrheit hinzunehmen. Es tut mir zwar Leid für meine Mutter, aber ich will nicht mehr geschlagen werden.
Ihr seid besser dran ohne mich - lebt wohl
euer Peter
Währenddessen beschlich ihn ein kleines Gefühl der Unsicherheit, doch er sich entschied, auf jeden Fall wegzulaufen, da ihm die Bilder des Tages immer wieder in den Kopf schossen.
„Die werden schon sehen“, dachte er sich, „wie sie ohne mich zurechtkommen. Wahrscheinlich vermissen sie mich noch nicht einmal. Vielleicht meine Mutter, aber mein feiner Herr auf keinen Fall.“
Peter nahm seinen gepackten Koffer und schlich wie ein Schatten aus seinem Zimmer. Dabei bemerkte er, dass unten im Wohnzimmer noch Licht brannte. Wahrscheinlich las sein Vater noch ein spannendes Buch, ehe er sich ins Bett begab. Peter blieb zunächst stehen.
Ich will nicht warten, dachte er sich, denn jetzt war er schon unterwegs. Wenn er in diesem Augenblick wieder umdrehte, würde er es nie schaffen. Daher ging er weiter die Treppe hinunter.
Ein Geräusch sorgte dafür, dass er ein weiteres Mal inne hielt. Es hörte sich an, als ob ein Schwein grunzte. Peter natürlich, dass es nicht ein Schwein sein konnte und vermutete zuerst, dass es sich um eine Einbildung handelte, denn es war mitten in der Nacht und Peter schlief eigentlich um diese Zeit schon längst.
Peter wollte weiter, aber ein weiteres Grunzen hielt ihn auf. Zumindest fürs erste. Doch dann kam ihm etwas in den Sinn. Jetzt weiß ich, fiel es ihm ein, es ist das Schnarchen meines Vaters. Er war wohl im Land der Träume und somit hatte der Junge freie Bahn, um das Schloss verlassen zu können.