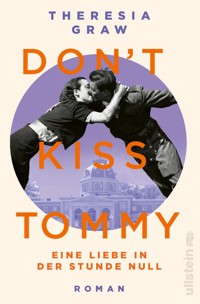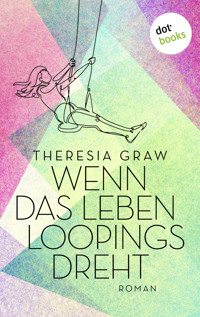11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Verlorene Heimat - eine junge Frau kämpft um ihren großen Traum 1952: Dora ist nach ihrer Vertreibung aus Ostpreußen mit ihrer Familie auf einem Hof in der Lüneburger Heide einquartiert worden. Die einstige Gutstochter ist von der Enge und den täglichen Reiberein mit der Bäuerin erdrückt. Sie träumt davon, Tierärztin zu werden und bricht für ein Studium auf nach Berlin. Dort bekommt sie Hinweise zum Verbleib ihrer großen Liebe Curt von Thorau, der seit Kriegsende als verschollen galt. Sie macht ihn schließlich in einem Stasigefängnis ausfindig und kämpft mit allen Mitteln um seine Freilassung. Doch während der Unruhen im Juni 53 gerät sie zwischen die Fronten und muss Hals über Kopf fliehen. Wird Dora es noch einmal schaffen, neu anzufangen – und Curt wiederzufinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Heimkehr der Störche
Die Autorin
THERESA GRAW wurde 1964 in Oberhausen geboren. Neben ihrer Arbeit als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk begeistert sie die Leserinnen mit ihren epischen Romanen. In der Gutsherrin-Saga hat sie die Geschichte ihrer Familie mit einer fiktiven Handlung verwebt. Theresia Graw hat zwei erwachsene Kinder und lebt in München.
Theresia Graw
Die Heimkehr der Störche
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Paperback1. Auflage August 2021© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: © Arcangel/Matilda Delves (Kind); © Arcangel/Ildiko Neer (Frau, Feld); © www.buerosued.deE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comISBN 978-3-8437-2550-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Teil 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Teil 2
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Teil 3
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Epilog
Anhang
Nachwort
Leseprobe: Der Freiheit entgegen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Teil 1
Teil 1
1.
Anfang Mai 1952
Dora Twardy saß auf dem sorgfältig aufgeschichteten Stapel Holz hinter der Scheune, lehnte den Kopf an die warme Bretterwand in ihrem Rücken und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Neben ihr flatterte weiße Wäsche an einer langen Leine, die quer über die Wiese zwischen den Obstbäumen gespannt war. Ein Windhauch blies ab und zu den zarten Duft der Apfelblüten herüber, vermischt mit dem seifigen Geruch der frisch gewaschenen Bettlaken, Kissenbezüge und Tischdecken. Dora rieb sich die geschundenen Finger. Rot und rissig waren ihre Hände, nachdem sie den ganzen Vormittag am Waschbrett gearbeitet hatte, mit schmerzendem Rücken über die klobige Zinkwanne gebeugt.
Es war ein milder Maitag. Am wolkenlosen Himmel zogen die ersten Schwalben des Jahres pfeifend ihre Kreise. Vor ein paar Wochen war schon das Storchenpaar von seinem Winterquartier in Afrika zurückgekommen und hatte wie in jedem Frühling das große Nest auf dem Scheunendach des Stübeckhofs bezogen. Tagelang hatte ihr Geklapper die Mittagsstille unterbrochen, so laut, als rappelte eine Mühle im Hof. Trotz seiner Eintönigkeit liebte Dora dieses Geräusch, das ihr seit frühester Kindheit vertraut war. Auch damals in Ostpreußen auf dem Gutshof der Twardys hatten Störche gelebt, ihre Ankunft hatte sie jedes Mal herbeigesehnt, bedeutete die Rückkehr der großen, majestätischen Vögel doch, dass der lange, kalte Winter endlich zu Ende war. Hier in der Lüneburger Heide waren die Winter zwar nicht so streng und schneereich wie in ihrer alten Heimat, doch noch immer erschien es Dora, als würde sie selbst erst wieder richtig auftauen, wenn die Störche zurück waren. Ein neuer Sommer, ein neues Glück. War nicht der Storch ein Symbol für den Neuanfang? Eine Aufforderung, das Alte zurückzulassen und weiterzuziehen? In diesem Jahr, dachte Dora, gilt das mehr denn je.
Sie zog einen Brief aus der tiefen Tasche ihres Rockes und strich mit den Fingern darüber, als müsse sie sich davon überzeugen, dass es ihn wirklich gab und sie nicht nur davon geträumt hatte. Nach einer Weile faltete sie das Blatt auseinander und las den Brief noch einmal, wie sie es schon so viele Male getan hatte, seit er vor drei Tagen angekommen war und sie ihn unbemerkt von den anderen aus dem Briefkasten gefischt hatte.
Sehr geehrtes Fräulein Twardy! Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Studium der Veterinärmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit Ihrem Kriegsabitur am Gymnasium von Wormditt in Ostpreußen sowie Ihrer jahrelangen Aushilfstätigkeit als Hofarbeiterin in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen haben Sie die formale Voraussetzung erfüllt. Über eine endgültige Zulassung zum Studium wird ein Aufnahmegespräch entscheiden, das am Montag, den 26. Mai 1952, um 16 Uhr 30 im großen Hörsaal des Universitäts-Hauptgebäudes, Berlin, Unter den Linden 6, stattfindet. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme spätestens eine Woche vorher schriftlich oder fernmündlich der Institutsleitung an …
Es folgte noch ein Name und eine Telefonnummer.
Dora atmete tief ein. Die erste Hürde war geschafft. Man hatte sie zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Warum sollte nun nicht auch der zweite Schritt klappen? Sie hatte zu Hause in Ostpreußen jahrelang den elterlichen Gutshof geleitet, nachdem ihr Vater im Krieg eingezogen worden war. Zumindest mit Nutzvieh kannte sie sich gut aus. Sie wusste, worauf es beim Melken, beim Füttern und bei der Pflege kranker Pferde und Kühe ankam. Wie vielen Fohlen und Kälbern hatte sie geholfen, auf die Welt zu kommen! Und einmal hatte sie sogar eines ihrer liebsten Tiere erschießen müssen, weil es zu schwach gewesen war, um den Weg über das zugefrorene Haff zu überleben. Damals war sie über sich hinausgewachsen. Ja, sie konnte was. Aber sie wollte noch so viel mehr lernen. Sie wollte alles wissen, was man nur wissen konnte, um Tiere gesund zu machen. Nie wieder wollte sie hilflos dabei zusehen, wie ein Pferd oder ein anderes Tier leidet. Sie presste den Brief an ihre Brust und spürte ihr Herz klopfen. Würde sie bald eine Studentin sein? Und in ein paar Jahren Tierärztin? Sollte ihr Traum tatsächlich wahr werden?
Ganz allmählich war dieser Wunsch im Laufe des vergangenen Jahres in ihr herangereift, denn ihr war klar geworden, wie sehr der Umgang mit Tieren sie über das Leid hinwegtröstete, das sie erlebt hatte. Zunächst war es nur eine verrückte Idee gewesen, an deren Umsetzung sie gar nicht wirklich geglaubt hatte, ein Strohhalm, an den sie sich geklammert hatte, um den ungeliebten Stübeckhof endlich verlassen zu können. Eine Perspektive, um ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Doch der Gedanke an ein Studium hatte Dora nicht mehr losgelassen. Vor zwei Monaten hatte sie endlich den Mut gefunden und verschiedene Universitäten in Deutschland angeschrieben, um sich um einen Studienplatz in Veterinärmedizin zu bewerben. Es war zunächst eine bittere Enttäuschung gewesen: Die meisten Hochschulen hatten ihr postwendend abgesagt. Einer Frau von 28 Jahren schien niemand eine Chance geben zu wollen. Und dann, als sie alle Hoffnung beinahe schon aufgegeben hatte, war dieser Brief von der Humboldt-Universität gekommen, der ein verheißungsvolles Kribbeln in ihr auslöste.
Trotzdem zögerte Dora, ihn zu beantworten.
Sie schlang die Arme um die angewinkelten Beine und stützte das Kinn auf die Knie. Nachdenklich betrachtete sie die Heidschnucken, die hinter dem Staketenzaun auf der struppigen Weide grasten. Siebenundzwanzig schwarzgraue Schafe mit großen gebogenen Hörnern waren es, zwischen ihnen sprangen ein paar schwarze Lämmer umher, die erst im März zur Welt gekommen waren. Wie munter und kräftig die Kleinen in den vergangenen Monaten hier draußen geworden waren. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis der Schäfer kam, um den Sommer über mit der ganzen Herde durch die Heide zu ziehen. Noch trugen die großen Schafe ihr dickes, zotteliges Winterfell, das die Bäuerin in ein paar Wochen, wie immer um diese Zeit, unter großem Geblöke der Tiere scheren würde, bevor sie zu ihrer jährlichen Wanderung aufbrachen. Dora überlegte. Bis zur Schafschur Ende Mai würde sie wissen, ob ihr Leben diese aufregende Wendung nehmen würde oder nicht. Allmählich musste sie sich entscheiden.
Es war nicht besonders bequem auf den rohen Buchenscheiten, Dora hatte sich die alte Flanelljacke untergelegt, die sie bei der Stallarbeit trug. Aber hier hatte sie wenigstens ihre Ruhe. An diesen Platz zog sie sich immer zurück, wenn sie über etwas Wichtiges nachgrübeln musste, weil er von dem großen Bauernhaus aus nicht zu sehen war. Sonst hätte Frau Stübeck Dora vermutlich längst an die Arbeit gerufen. Die schrille Kommandostimme der Bäuerin klang ihr noch in den Ohren:
»Wir haben keine Zeit zum Faulenzen, Dora. Wollten Sie nicht längst die Eier im Hühnerstall aufgesammelt haben? Und die Wäsche liegt auch noch im Zuber, wie ich sehe. Herrje, das ist doch kein Hotel hier. Sie denken wohl mal wieder, Sie sind etwas Besseres, oder? Nur weil Sie früher einmal einen Gutshof hatten, brauchen Sie Ihr hübsches Näschen nicht so hoch zu tragen. Bei mir wird fleißig gearbeitet. Und das gilt auch für Sie. Verhungert wären Sie alle, wenn ich und mein Mann – Gott hab ihn selig! – nicht so gütig und selbstlos gewesen wären, Ihnen ein Obdach zu gewähren, so elend und erbärmlich, wie Sie damals hier ankamen. Da ist es doch wohl nicht zu viel verlangt, dass Sie mir bei der Arbeit ein wenig zur Hand gehen …«
Der Rest ihrer Rede ging regelmäßig in wütendem Gemurmel über die Undankbarkeit der Vertriebenen unter, die Frau Stübeck grundsätzlich als Fremdlinge bezeichnete, als wären sie von einem fernen Planeten in diesem Dorf gelandet. Dora kannte die Klagen der verhärmten, alten Frau nur zu gut. Seit mehr als sechs Jahren ging das nun schon so. Natürlich war sie damals nach dem Krieg froh gewesen, dass sie mit ihren Eltern, ihrer Schwester Marianne, den beiden halbwüchsigen Zwillingsbrüdern Klaus und Arno und der kleinen Clara wenigstens die bescheidenen Gesindekammern unter dem Dach dieses Bauernhofes zugewiesen bekommen hatten. Es war die zufällige Entscheidung irgendeines Mitarbeiters der Wohnungsbehörde, die dafür gesorgt hatte, dass sie hier in der Lüneburger Heide gelandet waren und nicht auf einem Betrieb in Schleswig-Holstein, in Bayern oder sonst wo. Im Grunde war es ihnen gleichgültig gewesen. Alles erschien ihnen besser als das schäbige Flüchtlingslager, in dem sie nach ihrer Irrfahrt aus Ostpreußen zunächst untergebracht worden waren. Aber zu der Erleichterung, eine Bleibe gefunden zu haben und sich hier einen bescheidenen Lebensunterhalt verdienen zu können, war bald die Erkenntnis gekommen, dass die Twardys bei den Stübecks und den meisten anderen Bewohnern des Dörfchens Wielenstedt nicht sehr willkommen waren.
Schmarotzer und dreckiges Polackenvolk, das waren einige der Bezeichnungen gewesen, die die Leute dieses kleinen Orts in der Nähe von Celle einander zuraunten, wenn sie über die Familie aus Ostpreußen sprachen, die da neuerdings auf dem Stübeckhof wohnte. Dora waren diese hässlichen Worte nicht entgangen, und sie hatten ihr oft genug die Tränen in die Augen getrieben. Anfangs hatte sie noch versucht, den Stübecks und den anderen zu erklären, was geschehen war. Dass die Twardys nach dem verlorenen Krieg aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, wo sie früher sorglos und in Wohlstand auf einem großen Gutshof gelebt hatten, dass sie in Haus und Stall etliche Angestellte gehabt hatten, Felder und Wälder, die bis zum Horizont reichten, und eine Trakehnerzucht, die im ganzen Land bekannt gewesen war. Aber für die Wielenstedter blieben die Twardys die mittellosen Flüchtlinge aus dem Osten, unerwünschte Eindringlinge, die ihnen den Wohnraum und die knappen Lebensmittel in den Nachkriegsjahren streitig machten. Inzwischen hatte sich die Versorgungslage in Deutschland zwar erheblich verbessert, nicht zuletzt durch die Einführung der D-Mark mit der Währungsreform von 1948. Sie hatte dafür gesorgt, dass praktisch über Nacht alle erdenklichen Waren in den Läden wieder zu haben waren und man sich nicht mehr auf dubiose Schwarzmarktgeschäfte einlassen musste, um das Nötigste fürs Leben zu bekommen. Doch auch Jahre danach fühlte sich Dora im Dorf noch immer wie ein Mensch zweiter Klasse.
Aber vielleicht, dachte sie jetzt, vielleicht ist das hier ja bald vorbei. Wenn sie die Zulassungsprüfung an der Humboldt-Universität schaffte, würde sie im Herbst nach Berlin ziehen. Dann wäre das ihr letzter Frühling auf dem Stübeckhof. In Gedanken sah sie sich bereits Abschied nehmen von der Heidelandschaft, die sie umgab. Von den krautigen Wiesen, die sich im Hochsommer, wenn die Besenheide blühte, in ein leuchtend lila Farbenmeer verwandelten. Von den Birken, die die sandigen Wege und die schmalen Bäche säumten, den blühenden Obstbäumen, den lichten Eichenwäldern und den dunkelgrünen Wacholderbüschen, die in dem weiten welligen Gelände wie Zypressen in die Höhe ragten. So bilderbuchschön dieser Teil Deutschlands auch war, der Gedanke, vielleicht für immer von hier fortzugehen, tat Dora nicht weh. Denn dieser Ort war ihr nie ein Zuhause geworden.
In diesem Augenblick erschien ihr die Zukunft so verheißungsvoll wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und doch gab es etwas, das sie bis jetzt daran gehindert hatte, den Brief zu beantworten und der Universität ihr Erscheinen beim Bewerbungsgespräch zu bestätigen: Niemand in ihrer Familie wusste von ihren aufregenden Plänen. Sie brachte es einfach nicht übers Herz, ihren Eltern und Geschwistern zu sagen, dass sie von ihnen weggehen und nach Berlin ziehen wollte. Nach Ostberlin, in die ehemalige sowjetische Zone.
Dora war nie feige gewesen. Bisher hatte sie in ihrem Leben stets mutig für ihre Ideen und Überzeugungen gekämpft, wie aussichtslos das auch gewesen sein mochte. Aber dieses Mal fiel es ihr schwer. Diesmal ging es nicht um sie, sondern um die anderen. Denn die Twardys gehörten zusammen. Das war immer das Credo der Familie gewesen, seitdem der Vater im Sommer 1945 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen war. Dora erinnerte sich nur zu gut noch an all die Schrecken, die sie seitdem mitgemacht hatten. Völlig unerwartet hatten sie von einem Tag auf den anderen den heimatlichen Gutshof in Ostpreußen verlassen müssen, nachdem ihnen mitgeteilt worden war, dass der alte Familienbesitz, dessen Pracht längst dahin war, nun neuen polnischen Eigentümern gehörte. Zusammen mit all den anderen hungernden und zerlumpten Vertriebenen hatten sie in einem überfüllten Güterwaggon gesessen, der sie nach einer wochenlangen Irrfahrt irgendwann in der Nähe von Berlin vor den Toren eines Flüchtlingslagers ausgespuckt hatte. Sie hatten auch die Zeit in den zugigen Baracken überstanden, waren Monate später in einem klapprigen Bus mit dem wenigen Gepäck, das ihnen geblieben war, hergebracht worden, zu diesem gedrungenen, reetgedeckten Bauernhaus mit seinen verklinkerten Fachwerkwänden, den verzierten Windbrettern am Giebel und den weißen Sprossenfenstern. Sicher war dieser Hof früher einmal ein Schmuckstück gewesen, doch die Besitzer hatten notwendige Reparaturen lange vernachlässigt, sodass er jetzt verwahrlost und baufällig wirkte. Seit damals lebten die Twardys in diesen beiden Kammern unter dem niedrigen Strohdach, wo es im Winter zu kalt und im Sommer zu warm war, und in dem es zu jeder Jahreszeit beständig knackte und raschelte – vom Wind und von den Mäusen, die darin hausten. Aber die Twardys hielten noch immer zusammen. Nur ihr Bruder Erich hatte die Fahrt nicht bis zum Ende mitgemacht. Er war in Berlin geblieben, um sich allein in der Stadt durchzuschlagen. »Kräftige junge Männer wie ich werden überall zum Wiederaufbau gebraucht, hier kann ich mich nützlich machen und liege niemandem sonst auf der Tasche«, hatte er damals gesagt.
Jetzt war er vierundzwanzig, und soweit Dora wusste, ging es ihm gut in der großen Stadt. Auch er hatte früher einmal andere Pläne gehabt, als auf dem Bau Steine zu klopfen, aber der Zusammenbruch nach dem Krieg hatte seiner Schulzeit ein abruptes Ende verpasst und nun war er froh, überhaupt ein Auskommen zu haben. Inzwischen hatte er ein nettes Mädchen kennengelernt und seine Hetti im vorigen Sommer sogar geheiratet. Mitten in der Erntezeit, in der Dora auf dem Hof dringend gebraucht wurde, sodass es für sie unmöglich gewesen war, nach Berlin zu reisen.
So manches Mal, wenn sie sich wieder einmal über Frau Stübeck ärgerte, hatte sich Dora in den vergangenen Jahren gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie es ihrem Bruder gleichgetan hätte und mit ihm in Berlin geblieben wäre. Aber damals war es undenkbar gewesen, ihre Eltern, die so viel durchgemacht hatten, mit den jüngeren Geschwistern allein zu lassen. Sie hatte die Verantwortung gespürt, die auf ihren Schultern lag, seit so vielen Jahren schon. Als sie mitten im Krieg die Leitung des Gutshofes übernommen hatte, war sie fast von einem Tag auf den anderen zum Familienoberhaupt gereift. Wenngleich ihr Vater längst wieder bei ihnen war, so ganz hatte sie die Bürde aus jenen Jahren nie mehr abgelegt. Und jetzt sollte sie tatsächlich den großen Schritt wagen und die anderen zurücklassen? War es Zeit, den eigenen Weg einzuschlagen?
Bevor sie einen Entschluss fassen konnte, ließ eine Windbö die Wäsche an der Leine flattern. Eine Klammer löste sich und ein Betttuch fiel ins Gras. Dora rutschte vom Holzstapel hinunter. Sie hob das Laken auf, bevor es auf die Schafwiese geweht wurde, und steckte es wieder fest. Nach einem letzten Blick auf den Brief schob sie ihn zurück in die Rocktasche und machte sich auf den Weg in Richtung Hühnerstall.
In dieser Nacht träumte Dora von Ostpreußen. Und von Curt.
Es war Sommer, und sie und Curt ritten zusammen über die Wiesen, die das Gehöft der Twardys umgaben. Wie gut er auf dem großen Pferd aussieht, dachte Dora im Traum, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan, als mit ihr auszureiten. Dabei wusste sie doch, dass Curt normalerweise sein Auto bevorzugte, einen schicken weinroten Opel Olympia, in dem sie oft genug an seiner Seite herumgekurvt war. Auf dem leicht abfallenden Gelände vor ihnen standen in langen Reihen die Heuhocken, wie kopflose Gestalten. Zur Linken erstreckte sich ein schier endloses Roggenfeld, auf dem die kräftigen Ähren im leichten Sommerwind wogten wie Wellen auf dem Meer. Am Waldrand schimmerte ein See im Nachmittagslicht, rund und ruhig, wie ein großes blaues Auge. Der Blick ging weit über die sanfte Hügellandschaft bis zu dem dunkel bewaldeten Horizont, ein Farbrausch in Gelb und Grün mit bunten Tupfern von Mohn- und Kornblumen. Hinter den mächtigen Linden, die die Auffahrt zum Anwesen der Twardys säumten, waren nur die roten Dächer von Gutshaus und Scheune zu erkennen. Der Hof war umgeben von Pferdekoppeln, auf denen sich Dutzende Trakehner tummelten. »Komm, Dora!« Im Traum hörte Dora Curts Stimme. »Beeilen wir uns. Wir wollen doch noch zum Tanzen in den Königsberger Jazzkeller. Hörst du? Die Musik spielt schon!«
Plötzlich und so selbstverständlich, wie es nur in Träumen möglich ist, standen sie im Jazzkeller von Königsberg. Der niedrige Raum vibrierte förmlich von der lauten Musik, die die siebenköpfige Kapelle zum Besten gab, und vom Gelächter und Geschrei der vielen Leute, die dicht an dicht über die Tanzfläche kreisten. Es war Swingmusik, »Sing, Sing, Sing« von Benny Goodman, Doras Lieblingslied. Sie erkannte es sofort. Trompeten und Posaunen schmetterten, das Schlagzeug hämmerte, die Musiker schienen einander überbieten zu wollen im Wettstreit der Instrumente. Der packende Rhythmus erfasste Dora bis in die Fingerspitzen. Schon wirbelte sie in Curts Armen lachend über die Tanzfläche. Immer schneller ging die Trommel, immer lauter lärmten die Trompeten und Posaunen …
Dora schlug die Augen auf. Da waren keine Trompeten und Posaunen. Stattdessen schepperte der kleine Wecker auf ihrem Nachttisch erbarmungslos. Matt streckte sie den Arm aus und tastete mit der Hand über das Tischchen, bis sie den Wecker fand und ausschaltete. Stille. Nur ihr Herz pochte laut. Sie blinzelte. Graues Morgenlicht drang durch einen Spalt zwischen den Fenstervorhängen ins Zimmer. Halb sechs, Zeit zum Aufstehen. Erschöpft ließ sie sich zurück ins Kopfkissen sinken, noch ganz verwirrt von den Hirngespinsten der Nacht. Sie hatte also wieder von zu Hause geträumt und von Curt, wie so oft. Und wie jedes Mal, wenn sie davon erwachte, ließ sie dieser Traum in tiefer Melancholie zurück. So klar sah sie jedes Detail vor sich, so deutlich hörte sie Curts Stimme, als wäre er bei ihr. Als hätte es diesen mörderischen Krieg und seine Folgen nie gegeben. Dabei war es nun schon sieben Jahre her, dass Ostpreußen nicht mehr zu Deutschland gehörte, sondern zu Polen und zu Russland. Und der Jazzkeller von Königsberg, in dem sie damals so oft mit Curt von Thorau getanzt hatte, lag vermutlich immer noch unter den verkohlten Trümmern begraben, die die Bombennächte des Krieges von der hübschen Provinzhauptstadt übrig gelassen hatten.
Dora fuhr sich mit dem Handrücken über die Lider. Sie spürte ein Brennen in den Augenwinkeln. Der Verlust der Heimat und das bedrückende Leben auf dem Stübeckhof wären leichter zu ertragen, wenn nur Curt an ihrer Seite wäre.
Wie viele tausend Mal hatte sie sich schon gefragt, wo er geblieben sein mochte, dieser Mann, der sich an diesem merkwürdigen Tag im Sommer 1944 im Hof des Gutshauses so hastig von ihr verabschiedet hatte und dessen Spuren sich in den Wirren der folgenden Jahre verloren hatten.
Leise richtete Dora sich auf und schaltete das kleine Messinglämpchen neben ihrem Bett an. Der tütenförmige, stoffbezogene Lampenschirm verbreitete ein schwaches gelbliches Licht. Sie sah hinüber zu dem anderen Bett an der gegenüberliegenden Wand. Trotz des Weckerklingelns schlief Clara noch. Ruhig und regelmäßig hob und senkte sich die Bettdecke. Von dem Mädchen selbst war nur ein Schopf hellbraun geringelter Haare auf dem Kopfkissen zu sehen. Auf dem Bett daneben rollte sich ihre Schwester Marianne auf die andere Seite und zog sich die Decke über die Ohren. »Mach schnell, Dora, und lass mich noch ein bisschen schlafen«, murmelte sie.
Dora wollte aufstehen, doch dann zögerte sie. Behutsam, um kein Geräusch zu machen, zog sie die Schublade ihres Nachttisches auf, nahm einen ausgeschnittenen Zeitungsartikel heraus und faltete ihn auseinander. Das Papier war ganz abgegriffen und auf zwei Seiten eingerissen, weil sie es schon so oft in die Hand genommen hatte. Curts Gesicht war auf dem Foto nur noch zur Hälfte zu sehen. Aber er war es, daran bestand kein Zweifel. Sein letztes Lebenszeichen. »Fotograf der Hoffnung«, stand in der Titelzeile. Den Text darunter kannte Dora beinahe auswendig.
Jahrelang habe er das Grauen und das Elend des Krieges fotografiert, sagt Curt von Thorau. Jetzt möchte er die Hoffnung und die Zuversicht der Menschen zeigen. Mit seinen Bildern ist er zum Chronisten des Lagerlebens geworden, er hält den Alltag der Vertriebenen und Kriegsheimkehrer fest …
Das Datum am oberen Rand des Artikels war kaum noch zu erkennen, so ausgefranst war das dünne Papier vom vielen Anfassen: 16. Juli 1945. Dieser Artikel war der Beweis, dass Curt den Krieg überlebt hatte. Wie glücklich war sie gewesen, als sie diesen Bericht ein paar Monate später an der Informationswand der Flüchtlingsbaracke entdeckt hatte, im folgenden Herbst, als sie zusammen mit dem Rest ihrer Familie gerade in einem der Vertriebenentransporte von Ostpreußen in den Westen gekommen war. »Der Fotograf hat versprochen, spätestens im nächsten Monat zurückzukommen«, hatte ihr die Betreuerin des Lagers damals versichert.
Die Worte der Frau hatten Dora mit so viel Zuversicht erfüllt. Die Gewissheit, dass sie und Curt einander wiederfinden würden, nachdem sie durch den Krieg und die Naziherrschaft auseinandergerissen worden waren, ließ sie damals allen Kummer, den sie erlitten hatte, und alles Elend, das sie umgab, vergessen. Aber sie hatte vergeblich auf ihn gewartet. Woche um Woche verging, und Curt war nie mehr aufgetaucht. Ein paar Monate danach hatte Dora mit ihrer Familie das Lager verlassen müssen und war nach Westdeutschland gebracht worden, hierher zum Stübeckhof, während Curt wie vom Erdboden verschluckt blieb. Was mochte passiert sein? Warum hatte er sich nie wieder bei ihr gemeldet? Er liebte sie doch. Und er wusste, dass sie ihn, trotz allem, was gewesen war, auch noch immer liebte. Und dass Dora seine Tochter, die seine sterbende Frau ihr in die Arme gedrückt hatte, aufzog, als wäre sie ihr eigenes Kind. Er musste doch auch Clara endlich wiedersehen wollen. Warum hatte sie nie etwas von Curt gehört? Lebte er überhaupt noch? Es gab so viele Fragen, die sie seit Jahren quälten und auf die sie keine Antwort wusste.
Dora hörte Stimmen unten im Haus, das Geräusch von Schritten und Türen, die geöffnet und geschlossen wurden. Ein neuer Arbeitstag auf dem Stübeckhof begann. Die alte Bäuerin erwartete sie sicher schon im Kuhstall zum Melken. Wenn sie sich nicht beeilte, blieb ihr keine Zeit, um vorher wenigstens noch schnell in der Küche eine Tasse Kaffee zu trinken. Rasch legte Dora den abgegriffenen Fetzen Papier zurück in die Nachttischschublade und stand auf.
Flüchtig wusch sie ihr Gesicht über der mit Wasser gefüllten Blechschüssel, die sie sich am Abend zuvor auf dem Tisch am Fenster bereitgestellt hatte, und trocknete sich ab. Sie nahm ihr graues Arbeitskleid von der Stuhllehne und zog es an. Während sie sich die dunklen Locken zu einem praktischen Zopf zusammenband, betrachtete sie ihre eigene magere Gestalt in dem schmalen, fleckigen Spiegel an der Zimmertür. Selbst im Halbdunkel des Raumes sah sie, wie schäbig das Kleid war. Es hing wie ein Sack an ihrem Körper. Sie hatte es sich vor einigen Jahren mehr schlecht als recht aus einer alten Wehrmachtsuniform geschneidert, im ersten Jahr nach dem Krieg, weil andere Stoffe einfach nicht zu bekommen gewesen waren. Auch ein alter Vorhang und ein zerrissener Bettbezug waren damals noch gut genug gewesen, um mit der Hilfe ihrer Mutter eine Bluse für sich und einen Rock für Clärchen daraus zu nähen. In jener schweren Zeit war sie froh um jedes Kleidungsstück gewesen und hatte sich nicht darum gekümmert, ob sie darin hübsch aussah oder nicht. Allein sauber und ordentlich gebügelt mussten die Sachen sein. Wir mögen unsere Heimat verloren haben, sagte sie, wenn Clara kopfschüttelnd beobachtete, wie sie das heiße Plätteisen über eine gestopfte Stelle im Stoff strich, aber niemand soll behaupten, dass wir nicht ordentlich gekleidet sind. Inzwischen war die schlimmste Zeit des Neubeginns in der Fremde zum Glück vorbei und Dora besaß ein paar bessere Kleider, aber die galt es zu schonen. Für die schmutzige Stallarbeit war der graue Lumpen gut genug.
Was wäre ich heute, wenn der Krieg nicht gewesen wäre, ging es Dora durch den Kopf. Eine Gutsherrin mit einer eigenen Familie vielleicht, wohlhabend und sorglos, so wie ihre Mutter damals, der eine ganze Riege von Hausangestellten zu Diensten war und die ihre Tage damit verbrachte, Damasttischdecken oder feine Taschentücher zu besticken? Oder hätte sie Curt geheiratet und ihn auf seinen Fotoreportagen begleitet, wäre sie an seiner Seite zu den aufregendsten Orten der Welt gereist? Vielleicht hätte sie auch, wie es ihr Kindheitstraum gewesen war, ihr Leben den Pferden gewidmet und wäre eine erfolgreiche Springreiterin geworden. So viele Möglichkeiten hatte sie gehabt und so viele Träume. Keiner davon war Wirklichkeit geworden. Dora legte die Haarbürste weg, nahm die verwaschene Schürze vom Haken und band sie sich mit einer energischen Bewegung um. Sie durfte den alten Zeiten nicht länger nachtrauern. Sie hatte doch ein neues Ziel. Warum wagte sie es nicht, endlich die Chance zu einem Neuanfang zu ergreifen?
2.
»Na, sieh mal einer an, und ich dachte schon, das feine Fräulein steht heute gar nicht mehr auf.«
Frau Stübeck stand mit einem Reisigbesen in der Hand im Stallgang, als Dora hereinkam. Wie jeden Tag trug die Bäuerin eine grobe Strickjacke über ihrem schlichten Kittelkleid und ein geblümtes, unter dem Kinn zusammengebundenes Kopftuch. Sie warf Dora einen missmutigen Blick zu. »Höchste Zeit, dass Sie endlich mit dem Melken anfangen. Die Kühe warten schon lange.«
Dora ließ sich von dem mürrischen Tonfall der alten Frau nicht beirren. »Ich bin pünktlich auf die Minute. Hören Sie doch!« Von der Dorfkirche her klang gerade das Sechs-Uhr-Läuten herüber.
Frau Stübeck stieß ein unverständliches Grummeln aus und begann, mit raschen, kräftigen Zügen den Boden zu fegen.
Die ersten Strahlen der Sonne fielen durch die geöffneten Oberlichter in den Stall und ließen die Staubflocken in der Luft silbrig aufleuchten. Unter der hohen Decke schossen pfeifend ein paar Schwalben umher, auf der Suche nach Fliegen oder um ihre Nester unter den Dachbalken für die Brut vorzubereiten. Das Zwitschern der Vögel vermischte sich mit den anderen Geräuschen des Stalls, dem metallischen Klirren der Ketten, mit denen die zehn schwarz-weiß gefleckten Kühe an ihrem Futterstand festgemacht waren, dem Grunzen der Schweine, die an der gegenüberliegenden Wand in ihrem Koben scharrten, und dem gelegentlichen Schnauben aus dem Holzverschlag im Raum nebenan, wo die Kaltblutstute stand, die Frau Stübeck im Sommer vor den Erntewagen und im Herbst vor den Pflug spannte. Vom Hof her drang das Gackern der Hühner, das Gurren der Tauben und das Krakeelen der Spatzen herein.
Als Dora diese Geräusche hörte und den warmen, vertrauten Geruch des Stalles einatmete, fühlte sie sich – wie jeden Morgen, wenn sie hereinkam – für einen Moment in ihr früheres Leben auf dem elterlichen Gutshof zurückversetzt. Doch der harsche Ton der Bäuerin rief sie augenblicklich wieder in die Realität.
»Jetzt aber los«, knurrte sie. »Der Milchwagen wartet nicht. Der fährt vorbei, wenn die Kannen nicht draußen stehen.«
»Bis jetzt bin ich noch immer rechtzeitig fertig geworden«, entgegnete Dora leichthin und strich einer Kuh im Vorbeigehen über den weißen Fellwirbel an der Stirn. Dann griff sie nach dem Melkschemel.
»Sie werden die Kannen eigenhändig zur Molkerei tragen, mein Fräulein, wenn Sie den Milchwagen verpassen!«
Dora nickte nur. Schweigend schob sie sich den Schemel zurecht und stellte den Melkeimer auf, um mit der Arbeit zu beginnen.
»Im Übrigen«, fügte Frau Stübeck hinzu und hielt für einen Moment mit dem Fegen inne. »Ich darf Sie daran erinnern, Fräulein Twardy, dass Ihnen die Benutzung meines Badezimmers laut Wohnraumvereinbarung nur bis 22 Uhr zusteht. Gestern Abend habe ich genau gehört, dass um Viertel nach zehn noch Wasser gelaufen ist.«
»Ich habe nur kurz die Schüssel für die Morgenwäsche aufgefüllt. Das hat keine zwei Minuten gedauert. Und ich hatte die Tür auch gar nicht abgeschlossen. Sie hätten jederzeit hereinkommen können.«
»Was Sie im Badezimmer getan haben, interessiert mich nicht. Ich bestehe darauf, dass Sie die Nutzungsregeln einhalten. Es gilt: Um 22 Uhr ist das Bad frei. Punktum. Ansonsten werde ich das bei der Behörde melden.«
Dora spürte, wie ihr eine heiße Zornesröte in die Wangen schoss, und konnte nicht länger an sich halten.
»Dann melde ich, dass Sie vorigen Mittwoch mit Ihren Kaffeeklatsch-Damen stundenlang die Küche blockiert haben, obwohl Ihnen die Benutzung laut Vereinbarung nur von halb zwölf bis dreizehn Uhr zusteht«, gab sie zurück. »Wir konnten uns überhaupt kein Mittagessen kochen, obwohl die Kinder so hungrig waren, als sie aus der Schule kamen. Und am Sonntag davor haben Sie uns den Herd auch erst mit einer Stunde Verspätung überlassen. Wie kann das sein? Die Wohnraumvereinbarung gilt schließlich auch für Sie!«
»Das ist doch wohl die Höhe! Muss ich mir solche Frechheiten in meinem eigenen Haus und Hof gefallen lassen? Undankbares Pack!«
Frau Stübeck erwartete keine Antwort. Zornig knallte sie den Besenstiel an die Wand und stapfte aus dem Stall.
Dora atmete tief durch. Es verging kaum ein Tag, an dem sie nicht mit der Bäuerin aneinandergeriet. Sosehr sie sich auch bemühte, geduldig zu bleiben, die alte Frau schaffte es immer, dass sie aus der Haut fuhr.
Das Quietschen der Stalltür ließ sie seufzend aufblicken, in der Erwartung, dass die Bäuerin zurückkam, um ihr noch ein paar harsche Anweisungen für den Tag zu geben.
Doch es war ihr Vater, der den Stall betrat.
»Guten Morgen, Dora! Was ist denn los? Frau Stübeck macht ja ein Gesicht wie saure Krautbrühe. Habt ihr euch wieder gestritten?«
Dora zuckte mit den Schultern. »Ich lasse mir ihre Gemeinheiten nicht gefallen. Sie muss sich genauso an die Regeln halten wie wir.« Seufzend fügte sie hinzu: »Ach Papa, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du oder Mama jemals mit den Leuten auf unserem Hof so ungerecht umgegangen seid.«
»Das waren andere Zeiten, Dora. Damals waren die Aufgaben klar verteilt. Es gab Herren und es gab Knechte. Nach dem Krieg wurde alles durcheinandergewürfelt. Frau Stübeck ist es nicht gewohnt, Anweisungen zu erteilen, und du bist es nicht gewohnt, Anweisungen zu erhalten. Das ist das Problem.«
»Nein, das ist es nicht, Papa. Es macht mir nichts aus, Anweisungen zu erhalten. Aber diese Frau hasst mich. Sie hat ständig etwas zu nörgeln, ganz gleich, wie gut ich meine Arbeit mache.«
»Ach Dora! Du weißt doch, dass sie es auch nicht leicht gehabt hat in ihrem Leben. Ich glaube, sie ist nie darüber hinweggekommen, dass ihre beiden Töchter so kurz nacheinander an der Spanischen Grippe gestorben sind. Dann hat sie im vorigen Krieg auch noch ihre beiden Söhne verloren und vor ein paar Jahren ihren Mann. Kein Wunder, dass sie verbittert ist.«
»Alle Familien haben Tote zu beklagen, aber sie hat wenigstens in ihrer Heimat bleiben können, als der Krieg zu Ende war«, rief Dora heftig. »Niemand hat ihr Haus und Hof genommen. Niemand hat sie in die Fremde vertrieben. Warum kann sie nicht begreifen, dass alle Deutschen den Krieg verloren haben? Nicht nur die Ausgebombten und die Heimatlosen. Ich habe es so satt, mich wie eine unwillig geduldete Magd behandeln zu lassen. Das ist nicht das Leben, das ich leben möchte!«
Es lag ihr auf der Zunge, ihrem Vater endlich von ihren Studienplänen zu berichten. Doch wie so oft brachte sie es auch diesmal nicht heraus. Etwas im Blick ihres Vaters hatte sich verändert. »Nun, Dora, ich denke, wir müssen die Menschen und die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Glaub mir, mein Mädchen, ich würde alles dafür tun, wenn ich die vergangenen Jahre ungeschehen machen könnte.«
Er wandte sich ab. Dora schwieg und schämte sich ein wenig, dass sie so gereizt auf die Worte der Bäuerin reagiert hatte. Wie viel mehr hatte ihr Vater durch den Krieg verloren, seinen ältesten Sohn, seine Gesundheit, seine ganze wirtschaftliche Existenz, und doch beklagte er sich nie.
Sie beobachtete, wie Josef Twardy durch den Stall schritt. Er bemühte sich aufrecht zu gehen, doch er hinkte schwer, und Dora wusste, wie sehr ihn jeder Schritt schmerzte. Wie immer, wenn sie ihren Vater sah, war sie stolz und gerührt über seine Selbstbeherrschung und doch auch so erschüttert zu sehen, was aus dem stattlichen und wohlhabenden Gutsherrn von einst geworden war. Seine Schuhe waren ausgetreten und löchrig, der abgetragene und an etlichen Stellen geflickte Arbeitsanzug schlotterte um seinen ausgemergelten Körper. Graue Bartstoppeln bedeckten sein Kinn, weil er keine scharfe Rasierklinge mehr besaß, und sein Hals ragte dünn und faltig wie der einer Schildkröte aus dem zerschlissenen Hemdkragen. Sein einst so volles dunkles Haar war schütter und schlohweiß geworden. Doch trotz seines Alters und seiner Hüftverletzung, die er sich im Krieg beim Russlandfeldzug zugezogen hatte, ließ er es sich nicht nehmen, jeden Morgen im Stall mitzuarbeiten.
»Es ist gut, wenn der Mensch eine Aufgabe hat«, pflegte er zu sagen. »Sonst bekommt er nur schlechte Laune.«
Kein Wort davon, dass er früher einmal Herr über etliche Knechte und Mägde gewesen war und die Stallungen meist nur betreten hatte, um den Leuten seine Anweisungen zu erteilen oder zu kontrollieren, ob sie ihre Arbeit ordentlich machten und es den Tieren gut ging. Heute griff Josef Twardy ohne mit der Wimper zu zucken nach dem Eimer mit den Küchenabfällen, der neben dem Schweinekoben bereitstand, und schüttete den Inhalt in den Futtertrog, worauf sich die drei Sauen geräuschvoll darüber hermachten. Dann nahm er die Mistforke von der Wand.
Dieser Anblick war Dora auf einmal unerträglich.
»Ach Papa, hattest du dir das nicht auch alles anders vorgestellt?«, rief sie von einer plötzlichen Verbitterung erfasst. »Hattest du nicht gehofft, irgendwann einmal wieder einen eigenen Hof zu haben und Pferde, wie früher?«
»Wie soll das gehen, Dora? Meine magere Kriegsversehrtenrente reicht nicht, um hier im Westen Grund und Boden zu kaufen. Solange nicht geklärt ist, ob wir eine Entschädigung bekommen, bleibt mir nichts anderes übrig, als auf diesem Hof auszuhelfen. Und irgendwo anders als mit Tieren in der Landwirtschaft zu arbeiten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.«
»Ich weiß, Papa. Ich auch nicht. Aber du solltest eigentlich gar nicht mehr arbeiten mit deinem kranken Bein.«
Statt einer Antwort zuckte ihr Vater nur mit den Schultern. Wortlos schaufelte er den Mist auf den Schubkarren und schob ihn dann humpelnd den Stallgang entlang. An der Tür blieb er stehen und sah sich noch einmal um.
»Sag, Dora, bereust du es, dass wir nach dem Krieg nicht nach Argentinien ausgewandert sind? So wie es deine Freunde Elli und Wilhelm gemacht haben? Man hätte uns einen günstigen Kredit für den Aufbau einer Pferdezucht geboten. Vielleicht ginge es uns in Südamerika jetzt besser als hier. Ich denke manchmal darüber nach. War es ein Fehler, in Deutschland zu bleiben?«
»Nein, Papa! Das war kein Fehler. Nicht um alles in der Welt wollte ich nach Amerika. Ich will nicht in einem fremden Land am Ende der Welt leben, ich will hierbleiben.«
Ihr Vater nickte erleichtert. »Ja, so ähnlich sieht es deine Mutter auch.«
Dora sah ihm zu, wie er die Stalltür öffnete und die Mistkarre nach draußen schob.
Nein, sie wollte nicht nach Argentinien, so verlockend es auch klingen mochte, wieder einen großen Gutshof zu haben mit Pferdekoppeln und Rinderweiden bis zum Horizont. Im fernen Argentinien würde Curt sie niemals finden.
Als Dora mit dem Melken fertig war, hob sie den Eimer hoch, goss die Milch durch ein sauberes Tuch in die letzte der großen Blechkannen und setzte den Deckel darauf. Den Milchschaum, der im Tuch hängen geblieben war, kippte sie in eine flache Schüssel, damit die Stallkatzen etwas zum Naschen hatten, die auch gleich herangelaufen kamen und ungeduldig um ihre Beine strichen. Dann schleppte sie die Kannen hinaus, immer zwei auf einmal, und stellte sie neben dem offenen Hoftor in den mit frischem Wasser gefüllten Brunnentrog, damit die Milch abkühlte. Als sie alle Kannen herausgebracht hatte, tauchte sie auch ihre Hände in das kalte Wasser und rieb sich noch ein wenig die Finger, die von der schweren Last, die sie an den dünnen Henkeln trugen, ganz weiß und taub geworden waren. Das Klingeln einer Fahrradschelle ließ sie aufsehen.
Es war der Briefträger, der wie jeden Morgen die staubige Dorfstraße entlangradelte, die Schöße seiner offenen Postuniformjacke flatterten im Fahrtwind. Dora winkte ihm zu. Er war einer der wenigen Menschen in der Umgebung, der den Twardys stets freundlich begegnete.
Vor dem Hoftor bremste er ab. »Guten Morgen, Fräulein Twardy!«
»Guten Morgen, Herr Schulte. Haben Sie Post für uns?«
»Jawohl. Das meiste ist zwar wie immer für die Bäuerin, aber diesmal ist auch was für Sie dabei. Ein dicker Brief aus Argentinien, wenn mich der Poststempel nicht täuscht. Bitte sehr.« Er reichte ihr den Stapel Post.
»Ach, wie schön. Gerade habe ich mit meinem Vater noch über meine Freundin Elli gesprochen. Soll ich Ihnen die hübschen Briefmarken wieder herausschneiden? Die bekommen Sie morgen.«
»Oh, gerne. Damit machen Sie einen Sammler sehr glücklich.«
Herr Schulte tippte sich zum Gruß mit zwei Fingern gegen den Schirm seiner blauen Kappe und fuhr weiter dem Dorf zu.
Dora schob die Briefe ungesehen in ihre Schürzentasche und machte, dass sie ins Haus kam. Es war höchste Zeit, nach den Kindern zu sehen, damit sie pünktlich zur Schule kamen. Doras Zwillingsbrüder saßen neben Clara an dem langen, blank gescheuerten Eichentisch in der großen Bauernküche, als sie hereinkam. Sie hielten ein angebissenes Marmeladenbrot in der einen, ein Kakaoglas in der anderen Hand. Fast wie Geschwister sahen die drei aus und so waren sie auch aufgewachsen. Verstohlen betrachtete Dora sie, während sie sich im Spülstein die Hände wusch. Klaus und Arno, die sich wie ein Ei dem anderen glichen, waren schlaksige junge Burschen von fast siebzehn Jahren, die Dora bereits um einen halben Kopf überragten. Doch ihre strubbeligen blonden Haare, ihre Stupsnasen und die vielen Sommersprossen verliehen ihnen noch immer das Aussehen von frechen kleinen Jungen. Und zum Bedauern ihrer Eltern verhielten sie sich auch meist so. Claras Wangen waren ebenfalls von leichten Sommersprossen betupft, hellbraune Locken kringelten sich um ihr zartes Gesicht mit den großen dunklen Augen. So viel Schlimmes hatte sie mit ihren acht Jahren schon erlebt, und doch war sie immer ein freundliches Kind mit einem sonnigen Gemüt geblieben. Dora bewunderte sie sehr dafür. Manchmal, wenn sie Clara ansah, so wie jetzt, dann dachte sie daran, wie unglücklich sie damals gewesen war, als sie erfahren hatte, dass Curt und Wilma ein Kind bekamen. Und schämte sich noch heute für die Gedanken, die sie damals gehabt hatte. Wie sehr hatte sich die Welt seither verändert. Und wie sehr hatte sie sich verändert. Mehr als Clara konnte sie auch ein eigenes Kind nicht lieben.
Die gepackten Schultaschen der drei standen neben der Tür. Durchs Fenster sah Dora den gebeugten Rücken ihrer Mutter, die vor dem Haus dabei war, den Streifen Gemüsebeet zu harken, das die Bäuerin ihnen nach anfänglichem Protest zugestanden hatte.
Marianne war schon unterwegs. Doras jüngere Schwester arbeitete nicht auf dem Stübeckhof, sondern fuhr jeden Morgen mit dem Postbus nach Celle. In der nahen Stadt mit den unzähligen hübschen Fachwerkhäusern, die durch den Krieg kaum beschädigt worden war, hatte sie vor Kurzem eine Stelle als Bedienung in einer Bäckerei angetreten. »Da riecht es wenigstens nicht nach Schaf«, hatte sie Dora wissen lassen. »Dafür nehme ich die lange Busfahrt gerne in Kauf.« Mariannes Abneigung gegen die Stallarbeit war Dora nichts Neues. Schon zu Hause in Ostpreußen hatte ihre Schwester, so gut es ging, einen Bogen um die Ställe und Scheunen des Gutshofes gemacht und sich lieber mit einer Handarbeit oder anderen häuslichen Tätigkeiten beschäftigt, während Dora jede freie Minute bei den Pferden verbracht hatte. Und doch war Mariannes Job ein Glücksfall für die Familie. Denn sie durfte abends oft einen Laib Brot oder anderes Gebäck vom Vortag mit nach Hause nehmen, das im Laden nicht mehr verkauft werden konnte.
Dora warf die Briefe auf den Tisch, nahm die große blaue Emaillekanne und goss sich Kaffee in eine Tasse. Dann setzte sie sich und genoss den ersten Schluck nach der Stallarbeit. Der Kaffee war dünn, denn Röstbohnen kosteten noch immer viel Geld und mussten sparsam verwendet werden, aber immerhin war es echter Kaffee. Sie nahm Elsbeths Brief in die Hand, der zuoberst auf dem Stapel lag. Wie immer freute sie sich, wenn sie die mädchenhafte Handschrift ihrer Freundin sah. Sie war einfach eine treue Seele! Auch die Tausende von Kilometern, die zwischen ihnen lagen, konnten ihrer Freundschaft, die seit Kindertagen bestand, keinen Abbruch tun. Elsbeth schrieb fleißig, mindestens einmal im Monat, obwohl sie inzwischen selbst eine Familie und viel zu tun hatte. Dora hatte deswegen ein schlechtes Gewissen. Von jeher war sie keine eifrige Briefschreiberin, und sie schickte nur wenige Male im Jahr Antwortpost nach Argentinien. Umso mehr freute sie sich, wenn sie von Elsbeth hörte, und vertiefte sich nun in ihren ausführlichen Bericht, während sie ab und zu an ihrem Kaffee nippte.
»Da ist noch mehr Post für dich«, stellte Clara fest, die inzwischen die restlichen Briefe durchgesehen hatte. »Ich glaube, da ist jemand gestorben. Da ist nämlich ein Kreuz auf dem Umschlag.«
Dora erschrak.
»Nein«, erklärte Klaus. »Wenn jemand gestorben wäre, dann wäre das Kreuz schwarz und nicht rot.«
»Was sagt ihr? Rot? Post vom Roten Kreuz? Hat der Suchdienst endlich geantwortet?« Dora ließ Elsbeths Schreiben fallen und nahm Clara den Brief ab. Sie unterdrückte einen Freudenschrei. Tatsächlich. Da war er endlich! Der Brief, auf den sie schon so lange wartete. Fast zwei Jahre war es her, seit sie dem Suchdienst des Roten Kreuzes geschrieben hatte, um sich nach dem Verbleib von Curt zu erkundigen. Sie wusste, dass Millionen Deutsche über diese Organisation nach vermissten Verwandten und Freunden forschten. Viele Tausend Menschen waren ausgebombt, verschleppt oder vertrieben worden. Es dauerte natürlich seine Zeit, sich um all diese Anfragen zu kümmern. Aber so lange? Zuletzt hatte sie gedacht, sie würde nie mehr eine Antwort bekommen. Und nun doch!
Sie unterdrückte den Impuls, den Umschlag sofort aufzureißen. Was, wenn darin eine schlechte Nachricht stand? Nein, es war besser, den Brief zu lesen, wenn sie allein war. Sie musste warten, bis die Kinder zur Schule aufbrachen. Denn immerhin ging es um das Schicksal von Claras Vater. Etwas so Bewegendes konnte man nicht einfach mal eben zwischen Frühstücksbrot und Schulweg besprechen.
Als sich die drei Kinder wenig später auf den Weg ins Dorf gemacht hatten, räumte Dora so schnell es ging die Küche auf. Dann rannte sie, mit den Briefen in der Hand, hinauf in ihre Kammer und warf sich aufs Bett.
Hastig riss sie den Umschlag mit dem roten Kreuz auf und faltete den Briefbogen auseinander. Sie überflog den kurzen Text, bis sie an die Stelle kam, die ihr Herz flattern ließ:
»Folgende Angaben über den Verbleib des Vermissten liegen uns vor: Der von Ihnen gesuchte Herr Curt von Thorau, geboren am 5. November 1911 in Königsberg, war zuletzt im Juli 1945 unter folgender Adresse gemeldet: Laurinstraße 93, Berlin-Ost. Ob diese Anschrift noch zutrifft, können wir nicht beurteilen.«
Dora hielt den Atem an. Endlich. Sie hatte ein Lebenszeichen von Curt. Nach all der Zeit. Und zwar aus Berlin. Schon wieder Berlin.
Wieder und wieder ließ sie ihren Blick über die Zeile wandern, in der Curts Berliner Adresse stand. Nun wusste sie, wo sie ihn suchen würde. Nach so vielen Jahren des Zweifelns und Haderns würde sie endlich erfahren, was geschehen war. Dora lächelte. Auf einmal war sie ganz ruhig. Laurinstraße 93, Berlin-Ost. Ja, damit war es entschieden. Sie würde den großen Schritt wagen. Sie würde die Aufnahmeprüfung an der Humboldt-Uni machen. Sie würde bestehen. Sie würde studieren und eine gute Tierärztin werden. Sie würde Curt finden. Sie würden glücklich werden miteinander. Das war ihr Plan. Es war Zeit, ihren Eltern davon zu erzählen.
3.
»Und dann auch noch ausgerechnet nach Ostberlin! In die sowjetische Zone!« Vera Twardy sah von der Strickarbeit in ihren Händen auf und betrachtete ihre älteste Tochter mit versteinerter Miene. »Du willst allen Ernstes zu den Russen gehen? Nach allem, was sie uns damals angetan haben?«
»Ich gehe doch nicht nach Russland, Mama. Es ist Deutschland. Ostdeutschland, ja. Aber da treiben sich längst keine zwielichtigen russischen Soldaten mehr herum wie nach dem Krieg.«
Es war früher Abend. Dora hatte den Eltern und Marianne gerade von ihren Studienplänen erzählt. Durch das offene Fenster der Dachstube drang von draußen Claras fröhliches Juchzen herein. Die Zwillinge hatten tags zuvor an dem Kastanienbaum im Hof eine Schaukel aus zwei langen Stricken und einem Holzbrett angebracht und nun machten sich die Jungen einen Spaß daraus, das Mädchen hin und her schwingen zu lassen.
»Höher! Noch höher!«, schrie Clara übermütig. Ihre vergnügte Kinderstimme und das Lachen der Zwillinge passten so gar nicht zu dem bestürzten Schweigen, das für einen Moment oben in der stickigen Kammer herrschte.
»Ich begreife dich nicht, Dora.« Vera Twardy stieß einen tiefen Seufzer aus und versank noch tiefer in den verschlissenen grünen Polstern des Sessels. Es tat Dora in der Seele weh, ihre Mutter so zu sehen. Nichts erinnerte mehr an die schöne, kultivierte und selbstbewusste Gutsherrin, die Vera Twardy einst gewesen war. Die Nöte und Entbehrungen in Kriegszeiten und die Strapazen der vergangenen Jahre hatten tiefe Linien in ihr Gesicht gegraben. Mit ihrem schlichten Kittelkleid und den dünnen grauen Haaren, die sie wie eh und je zu einem Knoten im Nacken zusammengeschlungen trug, sah sie beinahe aus wie eine Greisin, obwohl sie erst Ende fünfzig war. Während sich ihr Vater nüchtern und – zumindest nach außen hin – klaglos den neuen Lebensumständen im Westen angepasst hatte, hatte sich ihre Mutter von dem Verlust der ostpreußischen Heimat nie wieder richtig erholt. Sie konnte stundenlang schweigend in ihrem Sessel sitzen und reglos vor sich hin starren. Dann wusste Dora, dass Vera Twardy vor ihren Augen eine Welt sah, die längst untergegangen war, verschwunden hinter einem undurchdringlichen Eisernen Vorhang. Nur in Veras Fantasie, der sie sich immer häufiger hingab, existierte der Gutshof der Twardys noch in all seiner Pracht.
Einen Augenblick lang ließ Dora ihre Blicke durch die schäbige Kammer wandern, in der sie seit sechs Jahren wohnten. An der einen Seite stand das große Bett, in dem ihre Eltern schliefen und dem ein Bein fehlte. Stattdessen steckte ein Stapel Ziegelsteine darunter. Daneben war ein Schrank ohne Türen, der den Blick auf die gesamte Habe der Familie freigab: Kleider, Schuhe, Wäsche, ein paar Bücher. Mitten im Raum befand sich ein Holztisch, auf dem eine Kanne und eine Blechschüssel standen. Am Tisch saß Marianne, die gerade damit beschäftigt war, ein Loch in einem Strumpf zu stopfen. An der Wand stand der grüne Sessel ihrer Mutter. Das war alles. Durch die geöffnete Tür konnte Dora in das Zimmer blicken, das sie sich mit Clara und Marianne teilte und das auch nur mit dem Nötigsten möbliert war. Zum Schlafraum der Zwillinge führte von dort eine Leiter in den kaum schulterhohen Spitzboden unter dem Dach.
Dora kam es auf einmal so vor, als sähe sie das alles zum ersten Mal. Als sie damals hierhergebracht worden waren, hatte man der Familie gesagt, es wäre nur vorübergehend. Das war im Herbst 1945 gewesen. Aber das Einzige, das vorübergegangen ist, war mein Leben, dachte Dora jetzt von einer jähen Bitterkeit erfasst. Jahr für Jahr hatte sie gehofft, dass sich etwas verbessern würde. Dass sie eine bessere Unterkunft erhalten würden, eine bessere Arbeitsstelle. Aber alles Hoffen und Bemühen war vergeblich gewesen. Zu viele Menschen brauchten Wohnraum und Anstellung, all die Tausenden Ausgebombten, Vertriebenen und Kriegsheimkehrer. Es gab einfach nicht genügend Arbeitsplätze und Wohnungen für alle. Aber irgendwann musste dieses Provisorium doch vorbei sein. Irgendwann musste es doch wieder bergauf gehen in ihrem Leben! Das Studium in Ostberlin gab ihr die Chance dazu. Sie würde sie nicht verstreichen lassen.
»Bitte mach dir keine Sorgen, Mama.« Dora stand auf und ließ sich auf der Armlehne des Sessels nieder. Liebevoll strich sie über die altersfleckigen Hände ihrer Mutter, die reglos das Strickzeug hielten. »Der Krieg ist lange vorbei. In Berlin kann man sich frei bewegen. Es ist immer noch eine Stadt, trotz der verschiedenen Besatzungszonen. Das weiß ich von Erich. Die Bahnen sausen kreuz und quer herum, sagt er, egal ob oberirdisch oder unterirdisch, da merkt man kaum, in welchem Sektor man sich befindet. Bitte versteht mich doch! Ich möchte nicht nur von einer schönen Zukunft träumen, ich möchte sie in die Hand nehmen. Ich möchte doch den Rest meines Lebens nicht als Hilfsarbeiterin auf diesem Hof verbringen und mich den ganzen Tag von der alten Bäuerin anmeckern lassen. Ich möchte etwas schaffen, etwas leisten. Ein paar Jahre lang werde ich hart arbeiten müssen, wenn ich den Studienplatz bekomme. Aber dann – dann werde ich hoffentlich bald Tierärztin sein, und dann geht es uns allen besser.«
Josef Twardy, der gerade noch am Fenster gestanden und hinausgesehen hatte, begann, in der kleinen Stube auf und ab zu gehen, sodass die Holzdielen unter seinen Schuhen knarzten. Er konnte sich jeweils nur wenige Meter bewegen, um nicht mit dem Kopf gegen die Dachschräge zu stoßen.
»Ich begreife ja, dass du studieren möchtest, liebe Dora. Und ich bin überzeugt, dass du eine gute Tierärztin werden wirst, aber weshalb gehst du nicht nach Hannover oder wenigstens an diese neue Freie Universität in Westberlin?«
»Ich hatte mich auch dort beworben, aber von beiden Unis habe ich eine Absage bekommen, Papa. Die Unis in Westdeutschland nehmen kaum Frauen auf, zumal, wenn sie in meinem Alter sind und ein Kind haben, so wie ich. Für unsereins scheint in diesen Zeiten eher der Platz an der Seite eines Mannes vorgesehen zu sein. Aber ich möchte doch so viel mehr. Bitte versteht mich. Eine solche Chance bekomme ich nie wieder. Die Humboldt-Uni in Ostberlin, die fördert gerade die Bildung von Frauen, und sie ist schon immer eine der renommiertesten Universitäten Deutschlands gewesen, die besten Wissenschaftler haben dort gelehrt und geforscht, da möchte ich etwas lernen.«
Ihr Vater fiel ihr ungehalten ins Wort: »Etwas lernen … Wie naiv du bist! Den Kommunismus werden sie dir da beibringen!«
»Ach was, Papa. Kranke Tiere heilt man überall gleich, egal, an welches gesellschaftliche System man glaubt. So ein Studium der Veterinärmedizin hat nun wirklich nichts mit Kommunismus zu tun.«
»Wenn du dich da mal nicht täuschst«, murmelte er, aber Dora ließ sich nicht unterbrechen: »Und außerdem: In der Ostzone kann man studieren, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Da erhalten alle Studenten ein Stipendium, das hat man mir versichert. Sodass ich nebenbei gar nicht zu arbeiten brauche und mich ganz auf das Lernen konzentrieren kann. Und Clara könnte einen Platz in einem Kinderhort bekommen, während ich in den Vorlesungen sitze. Was die Möglichkeiten für Frauen angeht, sind sie sehr fortschrittlich dort.«
»Du willst Clärchen mit nach Berlin nehmen?« Die Stimme ihrer Mutter klang plötzlich heiser, so als wäre sie schwer erkältet.
Dora nickte. »Ja, Mama. Natürlich. Was denn sonst! Du weißt, dass ich sie wie meine eigene Tochter liebe, wir gehören zusammen. Man wird dort bestimmt gut für sie sorgen. Und außerdem …« Dora räusperte sich. Eine leichte Röte breitete sich auf ihren Wangen aus. »Es gibt noch einen Grund, weshalb ich nach Berlin gehen möchte, und weshalb Clara unbedingt mitkommen muss: Curt wohnt in Berlin. Jedenfalls ist das die letzte Adresse, die es von ihm gibt. Ich habe endlich Antwort vom Roten Kreuz bekommen. Ich will ihn finden.«
»Curt von Thorau?« Vera Twardy sprach jede Silbe einzeln aus. Sie schüttelte konsterniert den Kopf. »Ich wusste gar nicht, dass Clärchens Vater überhaupt noch lebt, nach all den Jahren, in denen er nichts mehr hat von sich hören lassen.«
»Ich wusste es auch nicht, aber jetzt habe ich einen Anhaltspunkt, wo ich ihn suchen kann.« Dora zog den Brief des Roten Kreuzes aus ihrer Rocktasche und las ihren Eltern den Text vor. »Bestimmt wird bald alles gut, Mama«, schloss sie, während sie das Blatt wieder zusammenfaltete.
»Ich weiß nicht, was daran gut sein soll, dass du mit dem Kind in die fremde große Stadt ziehst.« Vera Twardy sah ihre Tochter nicht an, während sie sprach. Argwöhnisch krauste sie die Stirn. Dann nahm sie ihre Strickarbeit wieder auf und ließ die Nadeln schneller klappern als vorher. »Clärchen ist auf dem Land aufgewachsen, erst auf unserem Hof in Ostpreußen und jetzt hier. Hör doch nur, wie viel Spaß sie da draußen an der frischen Luft hat. Was soll sie in Berlin? Die vielen Menschen, der Lärm, der Dreck und der Trubel der Großstadt würden sie krank machen. Zumal du den ganzen Tag an der Uni sein wirst.«
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht, Mama. Aber sie wird sich daran gewöhnen. Es ist nicht alles schlecht in der Stadt. Sie wird schnell neue Freundinnen finden, da bin ich mir sicher. Sie ist ein aufgewecktes Mädchen. Es gibt Parks und Spielplätze in Berlin. Und Kinos und Theater und einen Zoo. Und Erich ist schließlich auch da. Aber das Wichtigste ist, dass Clara endlich ihren Vater wiedersehen wird. Sie kennt ihn ja eigentlich gar nicht. Denkt doch mal, sie war noch ein Baby, als er sie zum letzten Mal im Arm gehalten hat. Ich muss ihn finden. Wie sehr wird sich Curt darüber freuen, Clara endlich wiederzuhaben.«
»Meine liebe Dora.« Josef Twardy hatte seine Wanderung durch das Zimmer beendet und blieb nachdenklich vor ihr stehen. »Wo ist Herr von Thorau denn die ganze Zeit gewesen? Der Krieg ist seit sieben Jahren vorbei. Warum hat er nie nach seiner Tochter gefragt? Er kann ja nicht mehr in Kriegsgefangenschaft gewesen sein, wenn er seit Sommer 1945 in Berlin registriert ist.«
Dora nickte langsam. »Du hast recht, Papa. Ich weiß es nicht. Das frage ich mich doch selbst. Nicht einmal bei seiner Cousine Christel hat er sich gemeldet in den vergangenen Jahren, und dabei sind die beiden doch beste Freunde.«
»Ich nehme an, er ist auch tot.« Marianne, die dem Gespräch bis jetzt wortlos gefolgt war, zuckte mit den Schultern. Sie sah nicht von ihrer Handarbeit auf, während sie sprach. »Das ist die einzig schlüssige Erklärung für sein jahrelanges Schweigen.«
»Nein!«, rief Dora schnell und sprang auf. Ihr wurde gleichzeitig heiß und kalt ums Herz. »Das kann nicht sein. Das Rote Kreuz würde doch wissen, wenn er gestorben wäre. Er lebt! Ich bin mir ganz sicher, dass er lebt.«
»Womöglich hat dieser Curt inzwischen eine andere Frau geheiratet«, bemerkte Vera Twardy kühl. »Man könnte es ihm nicht verdenken, in all dem Durcheinander der Nachkriegsjahre. Vielleicht hat er gedacht, wir wären auf der Flucht umgekommen oder für immer in Ostpreußen geblieben und er würde dich und Clärchen nie wiedersehen.«
Dora schüttelte den Kopf. »Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nein, Mama. Er liebt uns. Clara und mich, das weiß ich. Es muss irgendetwas passiert sein. Sonst hätte er uns gefunden. Ich will es wissen. Ich will, dass er mir ins Gesicht sagt, was geschehen ist.«
Dora presste die Lippen aufeinander, damit die anderen nicht hörten, wie ihre Stimme zitterte. Denn sie musste sich eingestehen, dass ihre Mutter mit ihren Überlegungen nicht ganz unrecht hatte. War es möglich, dass Curt längst eine andere liebte? Schon einmal hatte er Doras Herz gebrochen, aber damals war sie selbst schuld daran gewesen, weil sie seinen übermütigen Heiratsantrag zurückgewiesen hatte. Wie sehr hatte sie das bereut, als er ihr später Arm in Arm mit seiner Frau Wilma entgegentrat. Noch heute spürte sie den Stich in ihrem Herzen, den ihr der Anblick dieser hübschen Frau an seiner Seite damals versetzt hatte. Wie sie Wilma am Anfang gehasst hatte, und doch war sie ihr, kurz vor ihrem Tod, eine Freundin geworden. Dora schluckte. Das alles war so lange her. Nun waren sie beide frei füreinander, sie und Curt. Sie mussten sich nur finden.
»Ich gehe nach Berlin«, sagte sie und begann nun ihrerseits, durch den Raum zu marschieren. »Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich werde alles tun, um die Aufnahmeprüfung an der Uni zu schaffen.«
Josef Twardy akzeptierte es notgedrungen, dass seine älteste Tochter ihren eigenen Weg einschlagen und den Stübeckhof verlassen wollte. Er kannte Dora gut genug, um zu wissen, dass sie ihren Kopf durchsetzen würde. Schon als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, hatte er sich jedes Mal geschlagen gegeben, wenn sie ihn nur mit ihrem treuherzigen Augenaufschlag ansah.
»Zumindest deinem Sturkopf hat der Krieg nichts anhaben können«, hatte er schließlich geseufzt. Aber Dora wusste: In einem kleinen Winkel seines Herzens war er, wie damals, stolz auf ihren Mut und ihren Tatendrang.
Wenn sie nun morgens zusammen im Stall arbeiteten, stellte er ihr Fragen zu Viehhaltung und Tierzucht und wenn sie die Antwort nicht wusste, half er ihr weiter, damit Dora zumindest in diesem Bereich so gut es ging auf das Gespräch mit den Professoren vorbereitet war.
Eines Abends traf sie ihren Vater an, wie er in der Stube am Tisch saß, seinen alten kratzigen Füllfederhalter in der Hand. Er schrieb in seiner besten Schrift auf einen Bogen Papier.
»Was tust du da?«, fragte Dora.
Josef Twardy sah auf. »Ich schreibe dir eine Bestätigung, die du den Professoren vorlegen kannst. Damit die Herren wissen, was du damals auf unserem Hof geleistet hast. Du bist gut in dem, was du tust. Wenn es dir ernst ist mit dem Studium, will ich nur das Beste für dich.«
»Oh, Papa! Das ist so lieb von dir. Danke!«
Dora traten Tränen der Rührung in die Augen. Sie wusste ja, wie schwer ihrem Vater der Abschied fiel. Und doch war er ihr zuliebe bereit, über seinen Schatten zu springen.
Vera Twardy indes blieb schmallippig und sprach das Thema nicht mehr an.
Am schwierigsten war es für Dora, mit der kleinen Clara über ihre Pläne zu reden. Noch stand ja nicht fest, ob sie tatsächlich einen Studienplatz erhalten und nach Berlin gehen würde. Und ungewiss war auch, wie die Sache mit Curt ausgehen würde. Aber andererseits wollte sie das Mädchen nicht vor vollendete Tatsachen stellen, wenn sie die Aufnahmeprüfung geschafft hatte.
Es war Samstagnachmittag. Dora fand Clara am Zaun der Schafsweide, wo sie im Gras kniete und versuchte, ein paar neugierige Lämmer mit Löwenzahnblättern zu füttern. Dora setzte sich zu ihr und lehnte ihren Rücken an die Holzlatten.
»Hör zu, Schatz, ich muss nächste Woche für ein paar Tage verreisen«, sagte sie, nachdem sie Clara eine Weile beobachtet hatte. »Ich fahre übermorgen nach Berlin und bewerbe mich an der Uni für einen Studienplatz. Wenn ich ihn bekomme und ein paar Jahre fleißig lerne, werde ich Tierärztin sein.«
Clara lächelte. »Kannst du dann alle kranken Tiere gesund machen?«
Dora strich ihr zärtlich über die weichen Haare. Es waren Wilmas hellbraune Locken, die sich um Claras Kopf kringelten, doch aus ihren dunklen Augen blickte Curt sie an.
»Ja«, sagte Dora. »Das hoffe ich. Aber das heißt, dass wir weggehen müssen von hier. Wir werden im Herbst nach Berlin ziehen, wenn alles klappt, weit weg in die große Stadt.«