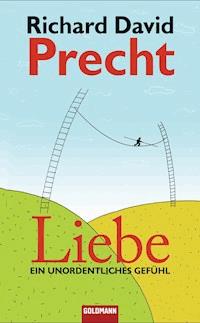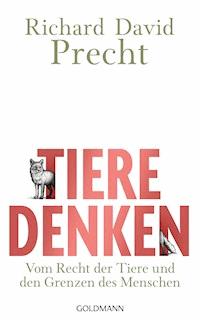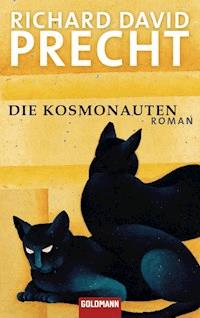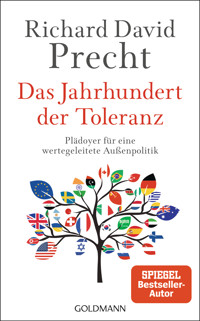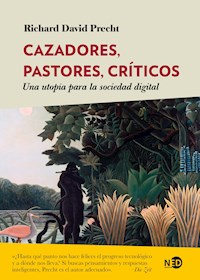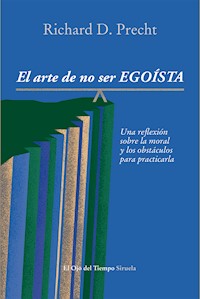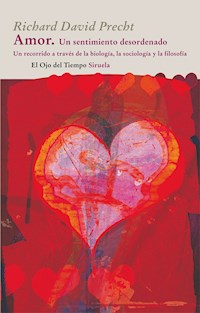8,99 €
Mehr erfahren.
Ein Buch über die Ordnung der Welt, die Macht der Phantasie und die Tragikomik des Lebens
Lilleø, eine kleine dänische Insel in der Ostsee: Für einen Sommer ist Kriminalassistent Ansgar Jørgensen auf das idyllische Eiland versetzt worden, um die Provinz kennenzulernen. Doch bereits am Tag seiner Ankunft wird er mit einem mysteriösen Todesfall konfrontiert – und der ist nicht das einzige Rätsel, das die malerische Kulisse verbirgt. Je tiefer Jørgensen in die dunkle Geschichte der Insel eindringt, desto verstörender ist das, was er entdeckt …
Ursprünglich unter dem Titel „Das Schiff im Noor“ erschienen, jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 839
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Georg Jonathan Precht Richard David Precht
Die Instrumente des Herrn Jørgensen
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Bei diesem Buch handelt es sich um die überarbeitete Neuausgabe des erstmals 1999 erschienenen Romans »Das Schiff im Noor«.
Ausgabe April 2009 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Copyright © 2009 by Georg Jonathan Precht und Richard David Precht Copyright © dieser Ausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: http://www.zeno.org - Zenodot Verlagsgesellschaft mbH Th · Herstellung: Str.
ISBN 978-3-641-19763-6V003
www.goldmann-verlag.de
Buch
Für einen Sommer wird der Kriminalassistent Jørgensen im Rahmen einer Schulungsmaßnahme von Kopenhagen auf die beschauliche Insel Lilleø geschickt. Auch wenn sein Vorgesetzter Malte Hansen nicht müde wird zu versichern, daß auf dem Eiland seit 200 Jahren kein Verbrechen mehr geschehen ist, vermutet Ansgar Jørgensen, daß Lilleø neben seiner hinreißend sommerlichen Landschaft und den gemütlichen Bewohnern doch einige Geheimnisse birgt. Woran zum Beispiel starb der Schafbauer Hans Larsen, der ausgerechnet bei Jørgensens Ankunft auf der Insel beerdigt wird? Warum spricht ein anonymer Anrufer, der sich an eine kleine Polizeistation wendet, von Mord, während der Arzt als Todesursache einen Herzinfarkt angab? Und was für eine Bewandtnis hat es mit dem Nor, einer zu Beginn dieses Jahrhunderts trockengelegten Meeresbucht, in der einst ein mysteriöses Schiff in Seenot geraten war?
Unter dem Spott von Malte Hansen und dem wachsenden Mißtrauen der Inselbewohner stellt der liebenswert-skurrile Jørgensen Zusammenhänge her, in die sich ein Sextant aus Larsens Nachlaß und die Erfindungen des Geistersehers Swedenborg paßgenau einbeziehen lassen. Die fixe Idee des Kriminalassistenten, auf Lilleø einen Mordfall aufklären zu wollen, erscheint gar nicht mehr so absurd …
Von der lieblichen Idylle weißgekalkter Dorfkirchen bis zum Jüngsten Gericht, von dem Zauber einer kleinen Bibliothek bis zu den Wirren des Napoleonischen Krieges verknüpft dieser Roman seine Fäden zu einem Teppich des Lebens, in dem sich alles zu einem überraschenden Ende zusammenfügt: ein Buch über die Ordnung der Welt, die Macht der Phantasie, den mystischen Funken der Natur und die Tragikomik des Lebens.
Autoren
GEORG JONATHAN PRECHT wurde 1969 in Solingen geboren. Er ist heute Partner im Architekturbüro Atelier 5 und lebt in Bern.
RICHARD DAVID PRECHT geboren 1964, ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Von 2011 bis 2023 war er zudem Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg. Seit seinem sensationellen Erfolg mit »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« waren alle seine Bücher zu philosophischen oder gesellschaftspolitischen Themen große Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophiesendung »Precht« im ZDF und diskutiert zusammen mit Markus Lanz im Nr.1-Podcast »LANZ & PRECHT« im wöchentlichen Rhythmus gesellschaftliche, politische und philosophische Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
Dem Andenken an Laurits T. 1925–1996
Vorbemerkung
Zehn Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erscheint unser Buch nun unter seinem ursprünglich vorgesehenen Titel »Die Instrumente des Herrn Jørgensen« und in einer leicht überarbeiteten Fassung.
Die Dankbarkeit der Autoren gilt dem Goldmann Verlag, der das Buch nun zum ersten Mal in seiner Originalversion publiziert.
Georg Jonathan Precht
Richard David Precht
Prolog
Hans Larsen wurde nur zweimal gewaschen – nach seiner Geburt und vor seiner Beerdigung, und jeder, der ihm etwas Gutes nachrufen wollte, konnte sagen, er habe diese Welt so sauber verlassen, wie er sie betreten hatte.
So war es eine ziemlich übertriebene Vorsichtsmaßnahme, daß alle, die ihn kannten und ihm das letzte Geleit gaben, den angemessenen Abstand vom Sarg nicht nach der Pietät, sondern dem Geruch bemaßen, den der Verstorbene zu Lebzeiten so reichlich verströmt hatte. Der Pfarrer wußte, daß die Totenfrau mit routinierter Gewissenhaftigkeit ihres Amtes gewaltet und sogar die doppelte Zeit für das gleiche Geld auf ihre Bemühungen verwandt hatte, um Larsen wenigstens nach seinem Ableben wie einen normalen Christenmenschen riechen zu lassen, und gab der Gemeinde mit aufmunternden Gesten vergeblich zu verstehen, daß alle, die Larsen im Leben unvorsichtigerweise einmal nahe gestanden hatten, doch näher treten mögen. Es fiel den Trauernden schwer, zu glauben, daß der Verschiedene nicht mehr derselbe sei, der er im Leben gewesen war. Sie gingen davon aus, daß eine jahrzehntelange Erfahrung sich nicht mit drei Eimern Wasser auslöschen lasse, selbst wenn Anne Kroman damit gewirtschaftet hatte, und hielten es für besser, statt angemessenem Anstand abgemessenen Abstand zu wahren.
Und während sie dort standen, die Köpfe gesenkt, erhob sich vom Kirchdach ein dunkler Schwarm Krähen und trieb mit dem Wind über Wiesen und Weiden dem Meer zu, wo ein neuer Tag anbricht und ein neues Kapitel seinen Anfang nimmt …
I.
Die Schweinswale
Die Sonne hatte sich wie schon so oft in der Geschichte langsam aus dem Meer erhoben, und ihre rötlichen Strahlen verliehen dem aufgehenden Morgen ein wenig von einem Romananfang. Der Mann im hellgrauen Trenchcoat, der an der Reling der Veteranfähre Øen stand, wischte sich den Wind aus den Haaren. Sein Blick ruhte erwartungsvoll auf dem nun immer klarer erkennbaren Relief sorgsam gespachtelter Farben in ocker und ziegelrot, das sich einem Fremden beim Anblick der Hafenstadt Leby schon von weitem bietet.
An diesem Morgen war Ansgar Jørgensen, Kriminalassistent beim Kommissariat für Gewaltverbrechen in Kopenhagen, 38 Jahre und sieben Monate alt, und es schien gutes Wetter zu geben. Die Fähre hatte gedreht und glitt nun merklich langsamer. Alles war still, nur der Dieselmotor begleitete leise tuckernd die Morgenstimmung.
Da stieß das Schiffshorn sein Signal in den Himmel, erschreckend laut in der Leere des erwachenden Tages, und als wäre dies der weckende Ruf, wurde der vor sich hindösende Hafen aus seinem Schlaf gerissen. Die Möwen schwangen sich keifend in die Luft, Autotüren klapperten, zwei Burschen im Blaumann, die wie aus dem Nichts auftauchten, hantierten am Schaltkasten des Anlegers. Auf der herangleitenden Øen donnerten die Bugtüren zur Seite, Motoren sprangen an, winkende Hände streckten sich in die Luft.
Die Fähre näherte sich nun rasch der Anlegebrücke und bremste ihren Schwung mit rückwärts laufender Schraube. Das trübe Hafenwasser sprudelte auf und verlief in flüchtigen Schaumkronen; ein brackiger Geruch zog über den Kai.
Es war ein sonniger und kühler Maimorgen des Jahres 1985. Malte Hansen hatte noch nicht gefrühstückt. Erwartungsvoll stand er mit hochgezogenen Schultern an seinem Wagen und gähnte. Sein Blick fiel auf den schmutzigen Außenspiegel des alten 12 M. Er kramte ein Taschentuch hervor, wickelte es um den Zeigefinger und begann mit der Reinigung. Zuerst zog er einen Kreis entlang der Chromfassung, ohne Erfolg. Geduldig suchte er eine weitere saubere Stelle auf dem Tuch, bespuckte sie flüchtig und begann, mit kurzen vertikalen und horizontalen Bewegungen die Spiegelfläche zu bearbeiten. Das Resultat war wenig befriedigend, der Spiegel verdreckte immer mehr. Jetzt versuchte er es mit dem ganzen Tuch und mit unwirsch kreisenden Bewegungen, aber auch das war so hoffnungslos, daß Malte einen Moment nachdenklich innehielt. Dann stopfte er wieder seinen Zeigefinger in den Lappen, kniff die Augen zusammen und malte auf der trüben Spiegelfläche kleine Schneckenmuster, Schleifen und Wellenornamente.
In diesem Augenblick stieß die Øen gegen die Fender, daß die alten muschelverkrusteten Balken knirschten und ächzten. Wie betrunken torkelte die Fähre von Pfahl zu Pfahl, bis sie endlich gegen den Anleger stieß und langsam zur Ruhe kam.
Malte Hansen war an diesem Morgen 63 Jahre und 10 Monate alt, und er hatte keine Ahnung, wie der Mann, den er hier heute morgen abholen sollte, aussah.
Zwei Autos mit deutschen Kennzeichen, ein Volvo und ein VW-Bus, rollten aus dem Schiff. Dahinter tauchte ein Trupp Pfadfinder auf und trottete mit Fahrrädern und Handkarren munter durcheinanderrufend über die Brücke. Eine Familie lief sich mit ausgebreiteten Armen entgegen. Die Fischer, breitbeinig in den aufschaukelnden Booten bei ihrer morgendlichen Arbeit, ließen für einen Augenblick ihre Netze sinken.
Malte erkannte den Kollegen aus Kopenhagen sofort. Ein großer hagerer Mann mit staksigen Beinen und Schnauzbart verließ die Fähre, der Wind verwirbelte ihm die Haare und klatschte ihm die Mantelschöße um Koffer und Beine. Nach ein paar Metern blieb er stehen und blickte suchend umher. Malte ging ihm entgegen.
»Bist du Ansgar Jørgensen? … Ich bin Malte Hansen, herzlich willkommen auf Lilleø …«
Jørgensen hatte einen Koffer abgesetzt; sie gaben sich die Hand. Er war gut anderthalb Köpfe größer als Hansen.
»Mein Wagen steht dahinten, der blaue Ford. Warte, ich nehm dir einen der Koffer ab.«
Jørgensen nickte. Er war ein wenig irritiert und fühlte sich etwas verkleidet, so mit Trenchcoat und Krawatte, neben diesem untersetzten Inselpolizisten in alten Kordhosen von unbestimmbarer Farbe und Gummistiefeln, die aussahen, als hätte er sie beim Entleeren einer Jauchegrube getragen.
»Meine Güte, hat der ein Gewicht; was hast du denn da alles mitgenommen?«
»Vor allem Bücher, da sind ein paar schwere Bücher drin.«
»Bücher? Ein Koffer voller Bücher? Wir haben hier eine große Gemeindebibliothek. Es sind wohl Krimis, was?« Malte grinste. »Bist du das erste Mal auf Lilleø?«
»Ja, dank diesem SASOWA-Erlaß, sonst wäre ich wohl nicht so bald hierhergekommen. Meine Familie stammt aus Sjælland, wir haben hier unten keine Verwandten.«
»Dieser … Erlaß …«, Malte verstaute die Koffer im Wagen und kramte in der Hosentasche, als suche er dort nach den passenden Worten, zog statt dessen aber eine Tüte mit Lakritzbonbons ans Licht.
»Willst du?«
Jørgensen griff zu.
»… die haben mir zusammen mit der Mitteilung von deiner Ankunft einen Berg Papiere zugeschickt. Da war auch eine Broschüre bei, ziemlich dick, ich habe nur mal kurz durchgeblättert, ein sehr schwieriger Stil, worum geht es da eigentlich?«
»Ach, das ist ganz einfach«, nuschelte Jørgensen. Die Bonbons verklebten ihm den Gaumen. Was blieb, war ein brennender Durst. »Also, es handelt sich dabei um eine sozialtechnische Assimilationsschulung zur Stärkung der Orientierungsleistung wahrnehmungsgeographischer Akkomodationsprozesse. Stand das bei dir nicht drauf?«
Malte sah ihn mit offenem Mund an. Jørgensen wiederholte den Satz rasch mit gleichförmiger Stimme und blickte sein Gegenüber dabei lieb und unschuldsvoll an.
»Und wofür soll das gut sein?« brummte Malte abweisend und öffnete Jørgensen die Beifahrertür.
»Es hört sich doch richtig gelehrt an und zeigt, wie wissenschaftlich der Polizeidienst geworden ist, seitdem sie im Ministerium Philosophen und Psychologen beschäftigen. Alle, denen ich diesen Text vorsage, sind erst mal verunsichert und wissen nicht, ob sie lachen dürfen oder ernst bleiben müssen.«
Malte schüttelte den Kopf und ließ den Motor an. »Und wieso kommst du gerade nach Lilleø?«
»Die Stellen wurden verlost. Ich habe richtig Glück gehabt. Eine Kollegin von der Sitte hat es zur Hafenpolizei von Angmagssalik verschlagen, Grönland.«
»Hm …« Malte machte eine Grimasse und legte den Kopf zur Seite. »Sag mal, warum wollten die in Kopenhagen euch eigentlich abservieren?«
»Abservieren ist gut«, sagte Jørgensen.
In der Tat war es ein königlicher Einfall der dänischen Polizeibehörde gewesen, ihre Beamten für einige Monate in abgelegenere Bereiche des Inselstaates zu entsenden, damit sie das Land besser kennenlernten und vielleicht auch deshalb, um zu verhindern, daß sich bei ihnen ein Weltbild festigte, in dem die Kriminalität der Hauptstadt als repräsentativ für das ganze Land galt. Die Wahrheit allerdings lag viel näher. Es gab schon seit einiger Zeit in Kopenhagen zu viele ambitionierte Nachwuchsbeamte und zu wenige, die bereit waren, auf einer der vielen kleinen Inseln und weit weg von der Hauptstadt Dienst zu tun, weswegen die Polizeidirektion unter dem Deckmantel einer Fortbildungsmaßnahme nach und nach viele ihrer Untergebenen für befristete Zeit in entferntere Distrikte schickte. Zur sozialtechnischen Assimilationsschulung.
Malte lachte laut, als Jørgensen ihm dies erläuterte.
»Na ja«, meinte Jørgensen, »für mich ist es tatsächlich mal eine Gelegenheit, das Land besser kennenzulernen. Auf Lilleø bin ich wie gesagt noch nie gewesen.«
»Dafür war ich schon mal in der Hauptstadt, vor … na, das müssen jetzt knapp zwanzig Jahre her sein. War auch so etwas wie ’ne Fortbildung. Allerdings ging es da um ökologischen Getreideanbau, na ja, was man damals so unter ökologisch verstand. Die meisten Seminarteilnehmer waren junge Leute mit verfilzten Haaren, die in ihrem Leben sicher noch keinen Spaten in der Hand gehalten haben. Aber alle hatten große Pläne im Kopf, tuschelten miteinander und waren sich einig. Ich bin mir noch nie so fehl am Platz vorgekommen. Aber Kopenhagen ist schon eine wunderbare Stadt.« Malte machte eine Geste über den Himmel. »Du hast Glück mit dem Wetter, eigentlich sollte es heute regnen.«
»Aber windig ist es, und trotzdem ist das Meer spiegelglatt und gleißend hell, viel heller als der Himmel, das erinnert mich an was.«
»So? Das ist ja eigenartig.«
»Und auch das Schiff fuhr ganz ruhig. Draußen vor Løborg habe ich Schweinswale gesehen. Weißt du, bei dieser glatten See kann man das schön beobachten, wenn ihre Rücken sich aus dem Wasser krümmen. Drei Stück waren es, herrlich!«
Malte strich sich über seine Stoppelhaare und sah Jørgensen zweifelnd an, als sei dies ein neuer wahrnehmungsgeographischer Jux.
»Schweinswale, das sind kleine Tümmler, so eine Art Delphine. Ich habe gar nicht gewußt, daß es die hier in der Ostsee noch gibt.«
Malte Hansen lebte seit 63 Jahren auf Lilleø und war unzählige Male mit den verschiedenen Fähren der Insel gefahren, aber Schweinswale hatte er noch nie gesehen.
»Ja, Ansgar, wir fahren jetzt noch nicht in dein neues Quartier nach Nørreskøbing. Ich muß vorher noch zum Torsdal-Friedhof, zur Beerdigung eines alten Bekannten, Hans Larsen.«
»Aha«, sagte Jørgensen, der nicht wußte, was er sonst dazu sagen sollte. Eine Beerdigung? Hans Larsen? Womöglich sein erster Fall hier auf Lilleø? Er kratzte sich die Waden. Was war das? Die Finger klebten, stanken nach Dieselöl. Jørgensen beugte sich nach unten. Zu seinem Entsetzen mußte er feststellen, daß seine neue Leinenhose voller Ölschlieren war. Hastig griff er sich einen Lappen und wetzte damit über den Stoff. Er rieb und rieb, und die Flecken wurden auch blasser, dafür aber immer größer. Eine leere Büchse Motoröl kollerte um seine Füße. Er musterte den Wagen. Unter dem Armaturenbrett quollen die Kabel hervor, der Motor hatte ständig Aussetzer, und die Tachonadel regte sich überhaupt nicht. Der Außenspiegel war hoffnungslos verschmiert, der Innenspiegel abgerissen, an der nackten Befestigung baumelte ein kleines Stoffpüppchen. Sein Blick flüchtete aus dem Seitenfenster, streifte den Asphalt der Landstraße, aus deren von Grün und Gräben gesäumten Rändern, regelmäßig gestreut, Kopfweiden emporwuchsen. Über die leicht gewellte Ebene erstreckten sich Felder mit strahlend gelbem Raps und grünem Korn, und weit hinten aus der Ferne hörte man das Brummen einer Propellermaschine, das rhythmisch mit dem Wind mal näher getragen wurde, mal verschwand. Dunkle Wolken sammelten sich am Horizont und überdeckten langsam die Insel.
Er hatte sich nur wenig Gedanken darüber gemacht, was ihn auf Lilleø erwartete. Seine Dienststelle hatte die komplizierte Verbindung mit Fähren, Bussen und Zug herausgetüftelt und die Fahrkarten besorgt. Die Kommentare seiner Kollegen, die ihn teils neidisch, teils feixend verabschiedet hatten, reichten von ›das schönste Stück Dänemark‹ bis zu ›total tote Hose da‹. Als Dienstkleidung empfahlen sie ihm grüne Latzhosen und Gummistiefel, denn wenn er dort wie ein Kriminaler aus der Hauptstadt rumliefe, würden ihn die Bauern sicher zur sozialtechnischen Assimilationsschulung als Vogelscheuche auf die Felder stellen. Sie hatten überhaupt viele Witzeleien über sich ergehen lassen müssen, die Probanden, die das Los getroffen hatte. In Anspielung auf den Erläuterungstext zum SASOWA-Projekt, wo die Rede davon war, daß es darum gehe, ›die Formel der Erfahrung zu sprengen‹ und ›den Panzer einer im schematischen Denken erstarrten Arbeitsroutine zu knacken, um sich den reichen Schatz menschlicher Erfahrungsfähigkeit wieder zu eigen zu machen‹, war hinter vorgehaltener Hand bald nur noch von ›unserer Panzerknacker-Bande‹ die Rede gewesen.
Aber das alles lag nun weit zurück. Die leichte Anspannung, die er noch auf der Fähre hatte, spürte er jetzt nicht mehr. Hier würde er neben der Arbeit, von der er, außer den süffisanten Entwürfen der Daheimgebliebenen, noch keinerlei Vorstellung hatte, gewiß auch Ruhe und Entspannung finden; genügend Zeit, um seinen außerdienstlichen Interessen nachzugehen.
Was würde die Insel, die zunächst noch ein weißer Fleck in seiner Wahrnehmung war, für ihn bedeuten? Oder, andersherum gefragt, welche Akkomodationsprozesse würde seine Anwesenheit bei den Einwohnern auslösen? Es hat ja immer alles seine zwei Seiten, wie sein philosophisch veranlagter Kollege Iske zu sagen pflegte. Ich komme auf eine kleine idyllische Insel und werde in einem maroden Auto erst einmal zum Friedhof gebracht, noch vor dem Frühstück …
Jørgensen grinste und dachte an gewisse englische Kriminalromane, die mit Vorliebe reizende ländliche Gefilde zum Schauplatz blutiger Ereignisse haben.
»Sag mal, dieser Mann, dieser Larsen …«
»Ja?«
»Woran ist der eigentlich gestorben?«
»Ein Herzinfarkt. Hans Larsen war ein alter Mann. Am vergangenen Sonntag haben ihn zwei junge Leute oben am Hünengrab von Eskebjerg gefunden. Die hatten ihr Boot in Torsdal liegen und waren mit dem Rad unterwegs. Das Grab befindet sich auf der Hügelkuppe oberhalb von Gammelgaard, dem Hof der Larsens. Als sie sich der Anlage näherten, entdeckten sie im angrenzenden Kornfeld eine Erhebung, die wie ein weiterer Findling aussah. Zuerst dachten sie, der gehöre noch zum Grab. Aber als sie näher herankamen, merkten sie, daß da kein Stein lag, sondern eben Hans Larsen. Sie liefen die hundert Meter runter zum Hof, aber da rührte sich niemand. Erst auf dem nächsten Hof, bei Poulsen, trafen sie jemand an. Als ich die Nachricht erhielt, fuhr ich mit Torben Sko, dem Arzt, hinauf. Der hat die Leiche untersucht. Herzinfarkt. Der Schlag traf ihn beim Ausreißen von Flughafer. Reicht das, Herr Kommissar?«
»Wurde die Leiche obduziert?«
»Obduziert?« rief Malte verblüfft. »Um Himmels willen. Warum hätte man sie obduzieren sollen? Hans Larsen war 73. Glaubst du etwa, daß er umgebracht wurde? … Nein nein, Ansgar, hier gab es seit über zweihundert Jahren keinen Mord mehr.«
»Nun, eine Obduktion hat ja nicht zwangsläufig etwas mit einem Mordverdacht zu tun. Er könnte sich doch auch mit irgend etwas vergiftet haben.«
»Vergiftet? Worauf willst du eigentlich hinaus?«
»Ich weiß, das klingt sicher etwas merkwürdig, aber wir hatten da neulich ein Seminar, in dem irgendeine Koryphäe sich darüber beklagte, wie viele Verbrechen allein dadurch unerkannt bleiben, weil die Hausärzte bei der Feststellung der Todesursache schlampig arbeiten. Ein ganz heißes Thema. Vielleicht hatte Larsen ja eine unheilbare Krankheit, vielleicht hat er sich ja auch unabsichtlich vergiftet, mit der Überdosis irgendeines Medikamentes. In dem Alter schluckt man doch meistens eine Menge Pillen.«
»Also, daß er sich umgebracht hat, womöglich noch aus Versehen, ist völlig ausgeschlossen. Mißtrauisch wie der war, hat er, soviel ich weiß, nie irgend etwas eingenommen, eben aus Angst, sich zu vergiften. Und er hat immer nur Sachen aus seinem eigenen Garten gegessen. Noch nicht einmal von Jesper Terkelsen hat er Essen angenommen, weil er befürchtete, die Möhren und Kartoffeln seien mit Pfadfinderscheiße gedüngt von den Klos des Ferienlagers auf Jespers Weiden. Jesper, du wirst ihn nachher kennenlernen, war so etwas wie sein einziger Freund, ebenfalls Junggeselle, da ging er abends schon mal hin zum Fernsehen. Jesper hatte das gar nicht so gern, denn der gute Larsen roch sehr streng, um es einmal nett auszudrücken. Und außerdem wollte er immer von Jespers Jägermeister trinken, der schien ihm unverdächtig. Dabei vertrug er überhaupt keinen Alkohol, und in den letzten Jahren ist er beim Nachhausefahren mehrere Male mit seinem Moped umgekippt. Da lag er dann am Straßenrand, bis ihn wieder jemand mit spitzen Fingern aufrichtete. Torben war öfter mal oben, wenn ihm was fehlte. Er mußte Larsen aber immer in der Scheune untersuchen, denn ins Haus ließ der keinen rein. Noch irgendwelche Verdachtsmomente? Du kannst mir schon glauben, hier passiert nur ganz selten einmal irgend etwas …«, Malte suchte nach dem passenden Wort, »… etwas Kriminalistisches.«
Er grinste und griff nach der Tüte mit den Lakritzbonbons.
Die Krähen
Gering war die Schar, die sich nach dem Trauergottesdienst auf dem Friedhof von Torsdal versammelt hatte und nun am offenen Grab neben der kleinen weißgekalkten Kirche stand. Ein Fähnlein aufrechter Wegbegleiter des Verstorbenen war es, das, über die Grube gebeugt, Hans Larsens Talfahrt mit gebührender Anteilnahme beiwohnte.
Jørgensen zählte neun Anwesende, sich selbst, Malte Hansen und den Pfarrer mitinbegriffen. Dazu kamen die beiden Totengräber, gestützt auf ihre Spaten, eine kleine und sicherlich sehr alte Frau, ein Mann mit spärlichen grauen Stoppelhaaren, leicht vorgebeugter Haltung und einer Schirmmütze in der Hand, die er unablässig zwischen den Fingern drehte. Zwei weitere Männer, der eine im gut sitzenden Sonntagsanzug, der andere mit leicht abgewetzter Jacke und Hochwasserhose, starrten, jeder für sich, nachdenklich mit gefalteten Händen zu Boden.
Ein wenig verloren wirkten sie schon, die paar alten Leute im weiten Rund des Friedhofs, weniger zahlreich als die Nebelkrähen, die mit aufgeplustertem Gefieder auf der hohen Kirchhofsmauer hockten. Kein Wunder, der Himmel hatte sich in der letzten halben Stunde nach und nach zugezogen, und nun fiel ein gleichmäßiger kühler Regen auf den Kiesweg und rann in dünnen Rinnsalen von der aufgeworfenen Erde ins offene Grab.
Jørgensen spähte vorsichtig nach einer Möglichkeit, sich unterzustellen. Den Mantelkragen hochgeschlagen, die Hände in die Taschen gebohrt, spürte er das Kitzeln der Tropfen, die an seinem Schnauzbart entlangliefen. Die Szene erinnerte ihn an einen verregneten Tag vor der Voliere im Kopenhagener Zoo, und er ertappte sich dabei, wie er die Anwesenden insgeheim als Ohren-, Wollkopf-, Kutten-, oder Kappengeier bestimmte, bis das Pietätsgefühl ihm dieses Spiel verdarb. Hatte er vielleicht sogar gegrinst? Streng rief er sich zur Ordnung, zog die Schultern hoch und bemühte sich um einen angemessenen Gesichtsausdruck. Den Bauern schien der Regen wenig auszumachen. Sie standen da, nebeneinander, sprachen nicht, sahen ins Grab hinunter, während der Regen von ihren Nasen tropfte. Ziemlich merkwürdig, wie er neben ihnen stand, der einzige Fremde unter lauter Menschen, die sich kannten. Man konnte sich schon ein bißchen überflüssig fühlen, wie ein Statist beim Film, dem man versäumt hatte, Anweisungen zu geben. Wie viele Filme beginnen mit einer Beerdigung. Die Kamera fährt von hinten auf die Gruppe der Trauernden zu, zwischen den Grabsteinen hindurch, bis das Blickfeld rechts und links von den Schultern zweier dunkler Figuren im Vordergrund ausgefüllt ist, die nur die Aussicht freilassen auf einen Mann im Trenchcoat und mit Schnurrbart, dem die regennassen Haare wie schlecht aufgehängte Gardinen beidseitig über die Stirn fallen. Aus dem Off ertönt eine Stimme: »Ich traf Ansgar Jørgensen das erste Mal bei Larsens Begräbnis …«
Minuten später hatte der Pfarrer seinen Part beendet und sah ergeben nach oben, ob wegen der Seele des Toten oder des Regens, Jørgensen wußte es nicht. Aber es war wohl tatsächlich eher der Blick eines Landmannes, der nach dem Wetter schielte, als der bekannte Augenaufschlag, der den bewußten anderen Segen aus dem fahlen Himmel erwartete.
Die alte Frau trat mit bestimmten Schritten nach vorn, nahm eine Handvoll Erde und warf sie mit einer kurzen energischen Bewegung in die Grube. Die anderen folgten ihr. Nur ein einziger blieb ein wenig länger vor dem offenen Grab stehen und murmelte etwas Unverständliches. Sein grobschlächtiges Gesicht blaß und angespannt, der schwere Atem rasselnd, knetete er eine Weile an seinen nassen roten Fingern. Dann stand er einfach nur da, allein vor dem Grab, wandte sich um und trat zurück ins Spalier der anderen. Die Totengräber schaufelten die Erde hinunter, nach und nach füllte sich die Grube. Die Beerdigung war vorbei, die Bauern wandten sich zum Gehen.
Jørgensen löste sich aus dem Abseits. Larsen geht und ich komme, dachte er, doch beide Ereignisse haben nichts miteinander zu tun. Eine zufällige Überschneidung auf dem Friedhof, Bewohner verschiedener Welten treffen zusammen, keine Berührung, ein Stelldichein im Niemandsland, im Reich der Toten, zeitlos, ohne Begegnung zwischen Lebenden und Verstorbenen. Und auch die Anekdoten über Larsen, die Malte vorhin erzählt hatte, haben sie nicht ihr eigenes Leben? Nicht länger sind sie auf ihren Urheber angewiesen; endlich befreit von der schlichten Wirklichkeit, werden sie flügge und ihn in vielfach verzerrter und ausgeschmückter Form um vielleicht zwei Generationen überleben. Sie hätten genausogut erfunden sein können.
Malte hatte alle mit Handschlag begrüßt und stand nun vor der Kirche in ein Gespräch vertieft mit einem Mann, der traurig den Kopf schüttelte und dann seine Schirmmütze mit dem Handrücken aus der Stirn schob. Nach einem flüchtigen Blick zu Jørgensen hin gingen die beiden auf ihn zu.
»Du bist der Kommissar aus Kopenhagen, der uns besucht?«
Der Mann nahm die Mütze ab und kratzte sich geschäftig am Hinterkopf.
»Kriminalassistent«, verbesserte Jørgensen.
»Ich bin Jesper Terkelsen, herzlich willkommen auf Lilleø.«
Offenbar wünschte ihm jeder hier ein herzliches Willkommen. In Kopenhagen war das nicht gerade üblich, wenn jemand vom Land zu Besuch kam. Jørgensen war sich ziemlich sicher, noch niemals eine ähnliche Begrüßungsfloskel benutzt zu haben; die Ankunft eines Kriminalbeamten aus der Hauptstadt schien für Lilleø etwas so Ungewöhnliches zu sein, daß ihn jeder zunächst unschuldig und unverdächtig im Namen der Inselbewohner willkommen hieß. Jørgensen mußte grinsen; erneut war er dabei, jene wahrnehmungsgeographischen Orientierungsgewinne zu erlangen, um deretwillen ihn seine Behörde hierher geschickt hatte.
Jesper Terkelsen betätigte sich umtriebig als Fremdenführer.
»Also, die Frau dort hinten ist Jette Hansen, sie wohnt auf Graasten, wir sind sozusagen Nachbarn. Die beiden anderen sind die Brüder des Schafbauern.«
»Schafbauer«, ergänzte Malte, »das war unser Name für den Verstorbenen. Keiner sagte Hans Larsen, wenn er von ihm sprach.«
»Das stimmt«, bestätigte Jesper. »Eigentlich ganz merkwürdig, wenn man so darüber nachdenkt, denn Bauern sind ja die meisten hier, und natürlich haben mehrere von uns Schafe, nicht nur die Brüder Larsen.«
Jesper Terkelsen hatte offensichtlich eine philosophische Ader. Kollege Iske hätte Gefallen an ihm gefunden.
»Die beiden Brüder sind Jens Christian und Axel. Jens Christian ist der da vorne, der gerade mit dem Pfarrer spricht. Axel steht dahinter.« Jesper erhob Stimme und Zeigefinger. »Den Anzug hat er mal zur Konfirmation gekriegt.« Er lachte, nahm die Schirmmütze ab und kratzte sich mit kurzen Bewegungen den Hinterkopf.
Eine eigenartige Angewohnheit, dachte Jørgensen, und ihm fiel ein, die Redensart vom verlegenen Hinterkopfkratzen schon gelegentlich in Romanen gelesen zu haben. Befriedigt nahm er zur Kenntnis, daß die damit verbundene Geste auch im wirklichen Leben vorkam. Lilleø hatte durchaus etwas zu bieten.
Sie verabschiedeten sich von Jesper und schlenderten Seite an Seite über den Kiesweg zum Ausgang. Malte erzählte Jørgensen von Axel Larsen, der jetzt allein auf Gammelgaard wohnte und der ähnlich wie sein Bruder Hans in der letzten Zeit kaum noch den Hof verlassen hatte. Die ganzen Formalitäten, vor allem das ungeklärte Erbe, wuchsen ihm schlicht über den Kopf. Malte hatte angeboten, sich darum zu kümmern. Ärgerlicherweise aber gab es vom Schafbauern kein Testament. Nicht mal eine Notiz hatte Axel gefunden, mit Hinweisen, welcher Bruder was wann bekommen sollte, und schon gar kein notarielles Schriftstück. Malte konnte sich gar nicht vorstellen, was da Spannendes zu erben wäre. Na ja, auf jeden Fall würden die beiden ernsthaft streiten. Jens, der im übrigen einen großen und prächtigen Hof besaß, hatte seinem Bruder gestern wüste Drohungen an den Kopf geworfen, in dem Sinne: wenn dieser sich alles unter den Nagel reiße, würde er ihn glatt verraten. Er wisse sich schon durchzusetzen, und er habe es satt, sich länger verarschen zu lassen.
»Axel war gestern abend noch bei mir. Ich hatte ihm angeboten, er soll ruhig vorbeikommen, wenn er Probleme hat. Es dauerte verdammt lange, bis er überhaupt mit der Sprache rausrückte. Der arme Kerl war völlig verwirrt. Er versteht nicht, was sein Bruder von ihm will. Ich bin zwar nicht gerade ein Experte in Erbschaftsrecht, aber ich weiß, an wen man sich wenden muß. Nicht direkt was Dienstliches also. Ich versuche ihm zu helfen, das ist alles.«
»›Er würde ihn glatt verraten‹ … Hast du eine Ahnung, was er damit gemeint hat?« fragte Jørgensen.
»Nein der Bursche ist manchmal etwas aufbrausend, etwas gereizt, wenn er getrunken hat. Aber im Grunde ist er ein lieber Kerl. Der macht keinen Ärger. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, was Jens damit meinte. Wir fahren heute nachmittag zu Jesper. Da werden wir noch mal über alles reden, auch über die Erbschaftsangelegenheiten.«
»Dafür seid ihr zuständig? Du und Jesper? Können die das nicht selbst regeln?«
»Ja und nein. Bei uns ist das wohl etwas anders als bei euch. Hier kennt jeder jeden und fühlt sich auch für die anderen verantwortlich. Jesper ist von unschätzbarem Wert. Der Junge weiß viel. Und keiner kannte den Schafbauern besser.«
Als sie kurz darauf den Friedhof verließen, bemerkte Jørgensen, daß ihm die alte Frau einen mißtrauischen Blick nachwarf.
Sie erreichten Nørreskøbing, und der Wagen tauchte in ein kopfsteingepflastertes Gäßchen, gesäumt von buntgestrichenem Fachwerk; Häuser ohne Stockwerk mit orangeroten Ziegeldächern, die eingesunken über altersgebeugtem Gebälk hingen.
In dieser Puppenstube werde ich nun das nächste halbe Jahr arbeiten, dachte Jørgensen, aber wohl auch in einem größeren Distrikt, vielleicht ja sogar auf der ganzen Insel. Lilleø gehörte zum Amt Grølleborg, soviel hatte er schon erfahren, Grølleborg aber lag auf einer anderen Insel. Wie viele Gemeinden mochte es hier geben? Drei Kirchtürme hatte er auf der Fahrt hierher gezählt; wie groß mochte Maltes Zuständigkeitsbereich sein? Na ja, das würde er schon noch rechtzeitig erfahren.
»So, da wären wir.« Malte zeigte auf ein rotes Backsteingebäude. Sie hatten den Ort durchquert und befanden sich nun am Hafen. Er parkte den Wagen neben einem weißen Morris Minor, auf dessen Fronttüren in großen schwarzen Buchstaben POLITI geschrieben stand.
»Mein Dienstwagen«, erklärte Malte. »Ich nutze ihn aber kaum. Zu Dienstfahrten gibt es nur selten Anlässe. Er ist mir auch zu auffällig. Aber du kannst ihn ruhig fahren, wenn du willst, es tut ihm sicher ganz gut, wenn er ab und zu mal ein bißchen bewegt wird.«
Ein Morris Minor, überlegte Jørgensen. Es mußte fast drei Jahrzehnte her sein, daß die Polizei mit solchen Wagen ausgerüstet worden war.
Die Bewölkung war aufgerissen, der Wind fegte den Himmel wieder blank. Malte reichte Jørgensen einen Koffer, ging mit dem anderen voraus und öffnete die dunkelgrüne Eingangstür. Das kleine grüne Blechschild mit der diesmal weißen Aufschrift POLITI an der Hauswand erinnerte Jørgensen daran, daß er in diesem Gebäude arbeiten und nicht die Ferien verbringen sollte. An die Tür war eine Papptafel geheftet mit den Öffnungszeiten. Verbrechen konnten hier offensichtlich nur Dienstag bis Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr, abzüglich einer zweistündigen Mittagspause begangen werden. Für unaufschiebbare Fälle war noch Malte Hansens private Rufnummer in Oldekær angegeben.
Sie betraten einen geräumigen hellgefliesten Vorraum. Geradeaus sah man durch die offenstehende Tür in ein Büro. Malte führte seinen Gast eine Treppe hinauf, die gleich rechts neben dem Eingang steil nach oben anstieg. Der Flur des oberen Stockwerks verband drei weitere Räume, markiert durch ovale weiße Porzellanschilder. Rechter Hand lag das ›Bad‹, das altertümliche Schild am Flurende verhieß eine ›Bibliothek‹.
Als Malte die Tür mit dem Schild ›Privat‹ öffnete, blickte Jørgensen in ein freundlich helles Zimmer.
»Nur herein, ich hoffe, es gefällt dir.«
Jørgensen sog die warme Luft des Raumes in vollen Zügen ein. Der leichte Geruch, der sich aus Spuren von Lack, Fensterkitt und frischer Bettwäsche mischte, versetzte ihn in seine Kindheit, als er die Sommerferien noch bei den Großeltern in der Nähe von Viborg verbrachte.
»Richte dich nur in Ruhe ein, ich mache uns inzwischen ein gutes Frühstück.«
»Danke, Malte.«
Jørgensen hatte außer einem Brötchen auf der Fähre an diesem Morgen noch nichts gegessen.
Allein im Zimmer. Jørgensen packte die Koffer aus. Von Zeit zu Zeit hörte er Malte unten in der Küche klappern. Der Raum maß etwa drei mal vier Meter, hatte weißgetünchte Wände, Holzdielen und zwei Fenster; das eine zeigte im Osten rote Ziegeldächer und üppig blühende Gärten, und durch das andere, an der Südseite, fiel der Blick auf das Meer und einen Teil der Hafenanlagen. Unter diesem Fenster stand ein Tisch mit einer Schublade. In ihr entdeckte er zahlreiche Schreibutensilien und eine aus runden Steinen zusammengeklebte Figur, grob bemalt, die wohl als Briefbeschwerer diente.
Jørgensen wechselte seine beschmutzte Hose und zog ein frisches Hemd an. Dann ließ er sich auf das Bett fallen.
Wo war er hier gelandet?
Gestern morgen hatte Anna, seine Freundin, ihn zum Hauptbahnhof gebracht. Sie würden sich nun für längere Zeit nicht sehen. Fünf Monate. Es war nämlich ein wichtiger Aspekt des Schulungsaufenthaltes, so hatte man ihm mitgeteilt, daß während dieser Zeit alle direkten Kontakte zu Angehörigen und Freunden doch bitte zu unterlassen seien, damit der Erfolg des Experiments nicht in Frage gestellt werde. Nur durch eine strenge Isolation vom vertrauten Milieu ließen sich die exakten wissenschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen, die erforderlich seien zur Erlangung sauberer und verwertbarer Daten. Daher müsse man, so schwer dies auch im Einzelfall, gerade bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen sein könne, alle Keime der Vertrautheit und Vertraulichkeit vom Operationsfeld fernhalten, damit die Probanden nicht unter Einflüssen stünden, die eine Verfälschung der zu explorierenden Orientierungsleistungen mit sich bringen könnten. Es sei durchaus so etwas wie eine sterile Laborsituation, die man dabei im Auge habe. Dies dürfe nun aber keineswegs als Dienstanweisung mißverstanden werden, sondern müsse völlig auf freiwilliger Basis geschehen, denn ohne die Aufgeschlossenheit der Probanden, die aus eigener Einsicht in die Richtigkeit dieser Maßnahme handelten, sei das ganze Unternehmen zum Scheitern verurteilt.
»Eine positive Einstellung, Herr Jørgensen, und eine freudige Mitarbeit an unserem Projekt«, hatte ihm die Psychologin mit teilnahmsvollem Lächeln auf ihren teilnahmslosen Zügen zu verstehen gegeben, »würde sich sicher nicht negativ auf Ihren weiteren beruflichen Werdegang auswirken.«
Einen Umweg hatte er noch gemacht, einen Abstecher zu Annas Eltern, wo er über Nacht geblieben war. Anschließend heute morgen die Fahrt mit dieser Uraltfähre, die wie ein alter Sonntagsanzug wohl zigmal umgeändert, erweitert, ausgebessert, angeflickt, mit neuem Kragen und Revers versehen und vielleicht sogar gewendet war und nun schon mehr als drei Generationen Passagieren und Seeleuten als schaukelnde Hülle gedient hat. Darauf war er umgestiegen in das nächste Museumsstück und mit dessen Besitzer auf dem Friedhof gelandet, zur Beerdigung eines weiteren, diesmal menschlichen Fossils. Und nun dieses Zimmer seiner Großeltern. Er mußte aufpassen, daß er der Wirklichkeit nicht entglitt.
Die Goldfliegen
Als Jørgensen am nächsten Morgen erwachte, lag er auf dem Rücken. Die Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen der nachlässig zugezogenen Vorhänge drangen, kitzelten seine Nase. Eine Weile blinzelte er mit noch lichtempfindlichen Augen in den grellen Tag und schielte dann hinüber zum Wecker.
Es war 7 Uhr 30.
Er schloß die Augen und konzentrierte sich auf die Geräusche seiner Umgebung. Draußen war Dienstag; Blätter, die im Wind raschelten. Aus der Bibliothek erklang der ruhige Schlag einer großen Uhr, ein Stockwerk tiefer vernahm er ein vorsichtiges Kratzen und Schaben.
Ein unbestimmtes, schönes Gefühl erfüllte ihn jedesmal, wenn er morgens in einem Zimmer aufwachte, das ihm noch nicht vertraut war, aber alle Voraussetzungen erfüllte, es zu werden.
Jørgensen seufzte vor Behagen.
Wenn der Sekundenzeiger die Zwölf erreicht hat, stehe ich auf, setzte er sich schließlich unter Druck, strampelte pünktlich die Decke weg und schwang seine dünnen und langen Beine aus dem Bett. Er saß auf der Kante und massierte sich mit den Handballen die Augen. Als er den Blick endlich frei hatte und die Lider sich nicht mehr alle Augenblicke zwanghaft zusammenkniffen, musterte Jørgensen noch einmal in aller Ruhe das Zimmer. Der Körper noch träge, gelähmt von einem tiefen und traumlosen Schlaf, der Geist aber wollte schon los, immerhin – die Augen, der Kopf reagierten schon folgsam.
Sein Blick fiel auf ein Bild, ihm direkt gegenüber. Es hing schräg in einem mürben Holzrahmen, der an etlichen Stellen aufgesprungen war und das Motiv nur noch notdürftig festhielt. Es war nicht das einzige Bild im Raum, an den Wänden rechts und links hingen noch zwei weitere, der karge Schmuck eines unbenutzten Zimmers; Bilder, die niemand ansah und die offenbar nur dazu dienten, den Augen auf den leeren Wänden Orientierungs- oder Ruhepunkte zu bieten, damit sie nicht ziellos und unstet umherzuschweifen brauchten. Er wollte sie betrachten, ihnen wenigstens für einen kurzen Augenblick das Gefühl geben, einen ernsthaften Betrachter gefunden zu haben. Allesamt eingefaßt in mehr oder weniger gewichtige Holzrahmen, zeigten sie unterschiedliche, durch keinen ersichtlichen Sinn miteinander verbundene Motive. Immerhin keine Kalenderbilder, stellte Jørgensen fest, verschwistert nicht durch ihren Mißbrauch für eine Monatssymbolik, die Osterlämmer, Badefreuden und weihnachtlich geschmückte Einkaufsstraßen in ein Verwandtschaftsverhältnis zwingt. Auf dem Bild vor ihm tobte eine Seeschlacht; rechter Hand, neben dem Kleiderschrank, hing ein einzelnes Schiff und links, oberhalb seines Schreibtisches, das altertümliche Porträt eines streng blickenden Mannes von höherem Stand; vielleicht ein Musiker, Händel oder Bach?
Er entschied sich für das Schiff und betrachtete es, den Oberkörper vorgebeugt wie ein Reiher kurz vor dem entscheidenden Beutestoß ins Wasser. Es war eine Zeichnung, die ein kleines, einmastiges Segelschiff darstellte. Sorgfältig mit spitzer Feder ausgeführt, aber ohne künstlerischen Anspruch, ließ sie eher an die Abbildung aus einem Fachbuch denken. Die Segel fehlten zwar, aber jede Einzelheit der Takelage war exakt wiedergegeben. Was mochte das für ein Schiff sein? Eine Bark vielleicht? Diesen Begriff hatte er schon einmal gehört. Auf der Zeichnung fehlte jeder Hinweis auf den Schiffstyp. Nur eine Jahreszahl war in die rechte untere Ecke gekrakelt worden, 18.., mehr war beim besten Willen nicht mehr zu entziffern. Jørgensen wunderte sich, warum man wohl gerade dieses schlichte Motiv in so einen monströsen Rahmen gesperrt hatte. War es ein Seemann, der das Abbild seines Schiffes immer in seiner Nähe haben wollte? Haben die Kapitäne ihre Schiffe nicht immer in Öl verewigen lassen, die Farbe zentimeterdick und speckig aufgetragen wie bei echten Schiffen? Und auf stürmischer See, wie sie stolz und mit vollen Segeln die Schaumkringel durchschneiden, die so akkurat und gleichmäßig aufgesetzt waren, als hätte sie ein Konditor mit der Sahnespritze erschaffen.
Kurz darauf stolperte Jørgensen die Holztreppe hinunter und betrat die Küche. Er deckte den Tisch, ging dann zur Bäckerei. Auf dem Rückweg hockte er sich eine Weile auf die Kaimauer, lauschte dem Glucksen der sanft anrollenden See in den großen Steinen der Hafenbefestigung und beobachtete, wie die Autofähre rhythmisch stampfend mit zitterndem Rumpf die spiegelglatte See zerteilte und immer kleiner werdend am Horizont entschwand. Wieder zu Hause, setzte er Wasser auf, schnitt drei Scheiben Brot ab und befreite eine Rumkugel aus ihrer Papierrosette. Als der Kessel anfing zu pfeifen, stimmte Jørgensen freudig ein, machte eine Kanne Tee und frühstückte.
Danach widmete er seine morgendliche Neugier jenem Raum, dessen ovales Porzellanschild ihm gestern so verheißungsvoll eine Bibliothek versprochen hatte. Und wie ein Ameisenbär die letzte Schar versprengter Termiten, leckte er mit schnellen Zungenschlägen die Schokoladenstreusel von den Fingern, erhob sich und ging die Treppe hinauf.
Oben, am Ende des Flurs angekommen, drückte er langsam die Klinke hinunter. Die Tür öffnete sich nur widerwillig dem fremden Besucher und ergab sich mit einem quietschenden Seufzer. Vorsichtig, als ob ihn drinnen jemand erwarten könnte, spähte Jørgensen durch den Spalt, und dann stand er auch schon drinnen. Der unverwechselbar muffige Geruch alter Bücher schlug ihm entgegen. Die trüben, mit längst vergilbtem Pergamentpapier beklebten und von Spinnen zugewebten Fenster tauchten die Bibliothek in ein gedämpftes Licht. Links erhob sich dunkel ein Schreibtisch, übersät mit Büchern und Papieren, überall an den Wänden türmten sich Gestelle, vollgestopft mit Literatur. Er schob die Tür zu und besah sich die andere Hälfte des altertümlichen Raumes. Im schwachen Licht schimmerten auch hier, gleich einer verwischten Kohlezeichnung, überbordende Regale im Halbdunkel. An die Wand gelehnt, auf einer niedrigen Kommode, thronte, damit sie ihren Sockel nicht auf die staubigen Dielen setzen mußte, eine große antike Standuhr. Feine Risse im emaillierten Blech des Zifferblattes überzogen ihr Antlitz mit einem Schleiernetz, schamhaft und stolz, gleich jener schönen Glücksburger Herzogin Caroline Linstow, deren Gram über das Morden der napoleonischen Heere ihr Gesicht für die Ewigkeit mit der Spur zarter Furchen durchzogen hatte. Standhaft durch die Zeit schlug ihr Puls ruhig und gleichmäßig in der Abgeschiedenheit des vergessenen Domizils. Jørgensen strich dem alten Kasten ein wenig Staub von der Wange und trat näher an das Regal heran. Braungewellte Rippen dichter Bücherrücken schuppten sich in den Borden, so als hätten sie alles Wissen, was in ihnen enthalten war, allein einander mitzuteilen. Doch die Zeit hatte sie mürbe werden lassen, Leinen und Leder faßten viele nur noch unvollständig ein, und statt die Seiten zusammenzuhalten, waren es nun die geleimten Blätter selbst, die ihre verfallende Hülle mühsam an sich drückten. Einige Elende glichen gar unförmigen Schmetterlingspuppen, die, auf eine sachte Berührung wartend, der Stunde entgegenfieberten, wo der ihnen innewohnende Geist dem Kokon geflügelt entschlüpfte und flatternd ins Freie taumelte.
Über alledem lag eine ehrfurchtsvolle Stille, als ob die Zeit selbst sich hier zur Ruhe gesetzt hätte, in dieser ungenutzten Bibliothek des Polizeihauses einer kleinen Insel irgendwo in der Ostsee. Sicher gibt es andere Bibliotheken, die noch viel schöner sind – und Jørgensen hatte einige solcher vignettenartigen Bilder in seiner Erinnerung, Büchersäle in edel poliertem Holz, von denen eine ganz andere, großartigere Wirkung ausgeht als von diesem unscheinbaren verlassenen Ort. Zum Beispiel die Nationalbibliothek in Kopenhagen oder die Bibliothèque Nationale in Paris mit ihren geschichtsträchtigen Orten, den Zellen und Cabinetts, den unendlichen Archiven, Ablagerungen einer tausendmal gewälzten Geschichte. Und dann die wundersame Bibliothek des Botanischen Museums, ein klassizistischer Bau, angefüllt nicht nur mit Büchern, sondern auch mit getrockneten Pflanzen, Blättern, Stämmen und Früchten aus den tropischen Wäldern Dänisch Westindiens. Auf zahlreichen Expeditionen errungene Schätze, Tribute aus einer fremden Welt, deren bizarre trocken braune Formen die Phantasie um so vieles mehr zu beschäftigen wissen als jedes leibhaftige Grün eines lebenden Gewächses. In staubigen Glasvitrinen, flankiert von den altertümlichen Büchern großer Botaniker wie Adanson, Holmberg, Hagerup, de Candolle, Hornemann und Schimper, dauern sie als Denkmäler ihrer eigenen Geschichte. Erinnerungen an einen fernen Kolonialgeist, dessen urwüchsiger Bart, in getrockneter Tropenflechte konserviert, still in seinem gläsernen Sarg ruhte. Aber keine dieser Bibliotheken, mochten sie auch mit noch soviel Geschichte ausgestattet sein, war dem Bild vergleichbar, das sich hier vor Jørgensens staunenden Augen auftat.
Neben dem Eingang fand er einen schwarzen Porzellanschalter. Von der Decke leuchtete schwach eine alte Schiffslaterne. Jørgensen trat ans Fenster; nur wenige milchige Konturen verrieten blaß hinter der Scheibe den Frühsommer. Auf der Fensterbank schillerten unzählige tote Goldfliegen; die eingetrockneten Beine bizarr verrenkt zu winzigen Skulpturen, lagen sie verstreut wie gestürzte Ballettänzer. Von der anderen Seite summte ein dickes Insekt gegen die Scheibe.
Er setzte sich auf den klapprigen Stuhl vor dem Tisch, und es dauerte eine geraume Zeit, bis er sich traute, die Bücher um ihn herum zu berühren. Sie lagen überall auf einer Tischplatte aus massivem Kirschbaum. Die Zeit und Tropfen von Flüssigkeit, vielleicht Tee oder Kaffee, hatten darauf runde helle Narben gezeichnet. Ein Thermometer lag auf dem Tisch, daneben stand ein kleines Glas mit eingetrockneter Tinte nebst einem altertümlichen Federhalter und einem fleckigen Lineal mit winzigem Messingknauf. Das wichtigste aber waren die Bücher, schwere Folianten ebenso wie schmale Bändchen in Pappdeckeln, paketiert zu kleineren Blocks, aufgestockt bis zur zwanzigsten Etage; manche von ihnen waren aufgeschlagen, andere mit Zetteln versehen, auf denen sich jemand mit seismographenhafter Handschrift verewigt hatte. Und obgleich oder vielleicht gerade weil die Zeit in dieser Kammer stillzustehen schien, erweckte der Arbeitstisch den Anschein, als ob noch wenige Minuten zuvor ein anderer hier gesessen hätte, jemand mit mehr Recht, die Bücher aufzuschlagen und in ihnen zu lesen – der Besitzer dieser geheimnisvollen Bibliothek, der all diese Schätze zusammengesammelt hatte, die Encyclopaedia Britannica dort drüben an der Wand, die Werke Vergils, Horaz’ und Senecas in goldgeprägten Lettern. War es wirklich der Zufall, der diese Bücher so zurückgelassen hatte, oder vielmehr eine geheime, für einen Fremden wie ihn undurchsichtige Anordnung, vielleicht ein verborgenes System? Wer mochte das gewesen sein, der als letzter hier wie er am Tisch gesessen hatte, um dann allem Anschein nach fluchtartig den Raum zu verlassen? Seine Hand tastete sich durch den Blätterteig der Bücher und legte sich auf einen Stapel großer Folianten. »Himmel und Hölle« las er auf einem der Buchrücken. Als Jørgensen die schweren Wälzer in die Ecke der Tischplatte schob, hatte er das ungute Gefühl, irgend etwas zu zerstören, ja, ihm kam der phantastische Gedanke, durch das Verrücken der Bücher eine Schandtat vollbracht, das Gewicht verschoben zu haben, das die Welt in ihrem tiefsten Inneren im Lot hält.
Jemand rief laut seinen Namen.
Kurz darauf wurde die Tür geöffnet, und Malte stand auf der Schwelle, breitbeinig, eine Pfeife im Mundwinkel.
»Ach hier bist du, hast du mich nicht rufen hören?«
Jørgensen blickte auf und legte das Buch zur Seite. »Ich war in Gedanken. Sag mal, was ist denn das hier für ein großartiger Raum? Hast du diese Sammlung angelegt?«
»Ich? Nein … einer meiner Vorvorgänger war das, Lars Christian Kirstein. Der war hier früher Polizeimeister, vor vierzig, fünfzig Jahren etwa. Ein ziemlicher Sonderling. Dort hängt ein Bild von ihm.« Malte deutete mit dem Pfeifenstiel auf eine Fotografie. Jørgensen betrachtete den Mann. Er hatte welliges nach hinten gekämmtes Haar, die lange spitze Nase selbstbewußt erhoben zu einem pfiffigen, aber gleichsam etwas freudlosen, müden Gesichtsausdruck, der abwartend hinter einem gekrümmten Messingkneifer lauerte. Der Mann erinnerte ihn ein wenig an eine Federzeichnung von Søren Kierkegaard, die er mal im Stadtmuseum gesehen hatte.
»Nutzt du diesen Raum überhaupt? Der sieht ja aus, als hätte ihn seit Jahrzehnten keiner mehr betreten.«
»Eigentlich nicht. Ab und zu brauche ich mal das Lexikon, um irgend etwas nachzuschlagen, aber das kommt selten vor, … und dann ziehe ich natürlich einmal in der Woche die Uhr auf. Kommst du runter? Ich habe Kaffee aufgesetzt.«
Jørgensen verließ die Bibliothek und zog sacht die Tür zu. Durch das offene Fenster am Ende des Flures wehte ihm der frische Maimorgen ins Gesicht.
»Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Polizist zu werden, Ansgar?«
»Tja, wie kommt man zur Polizei … Wie oft ich danach schon gefragt worden bin!«
Jørgensen war nicht auf geradem Weg zur Polizei gekommen.
»Mein Vater war Pfarrer in einer Gemeinde am Rande von Kopenhagen. Nach der Schule wußte ich nicht recht, was ich machen sollte. All die anderen Jungs wußten genau, was sie wollten, Karriere machen als Ärzte oder Juristen, den Betrieb des Vaters übernehmen oder in den sicheren Hafen des königlich staatlichen Verwaltungsdienstes einlaufen. Mein Vater hatte ständig versucht, mich für alles mögliche zu begeistern: Botanik, Jura, Medizin. Irgendwann hat er es dann doch geschafft. Er hat mich überredet, Theologie zu studieren.«
»Theologie?« fragte Malte verblüfft.
»Sechs Semester habe ich durchgehalten. Aber irgendwie war das nicht das richtige. Und dann hab ich mich erst einmal eine Zeitlang im Ausland herumgetrieben und mehrere Jahre gejobbt; auf dem Bau, als Kellner, mal in einer Meierei; dann war ich Fahrer bei Brugsen und so weiter. Schließlich hat mich ein Freund gelockt: Die Polizei ist vielseitig, du hast eine gesicherte Existenz – das übliche also.« Jørgensen stand auf und schenkte Kaffee aus.
»Dankedanke … Na, gut, wie auch immer, jetzt bist du hier, und ich muß dich irgendwie beschäftigen. Gar nicht so einfach. Aber ich habe mir was überlegt. Wenn du willst, kannst du erst einmal das Archiv neu ordnen.«
»Ein Archiv ordnen? Klingt spannend.«
»Ja, unser kleines Archiv. Eigentlich dürften die Sachen schon längst nicht mehr hier sein; die alten Akten, also alles was über dreißig Jahre alt ist, kommen normalerweise ins Landesarchiv nach Odense, und viele der ganz alten Unterlagen aus der Zeit, als wir noch zu den Herzogtümern gehörten, hätten in Schleswig archiviert werden müssen und lägen dann heute im Reichsarchiv in Kopenhagen. Aber die letzten hundert Jahre hat hier nie jemand etwas abgeführt, und der Kram stapelt sich bis zur Decke. Soweit ich weiß, hat sich von außen auch keiner dafür interessiert. Man könnte die Sachen neu strukturieren.« Malte strahlte Jørgensen erwartungsvoll an.
»Was stimmt denn nicht mit der alten Struktur?«
Malte rührte in seiner Tasse und gab noch ein weiteres Stück Zucker dazu. »Ja, also, für die bin ich verantwortlich, zum Teil wenigstens«, lächelte er verlegen. »Hab mal versucht, da ein bißchen Ordnung reinzubringen. Aber ich fürchte, das ist mir nicht so ganz gelungen.«
»Und ich soll das jetzt wieder in Ordnung bringen?« Jørgensen nickte. »Na gut.«
»Wunderbar, darauf sollten wir einen trinken. Hast du Lust auf ein Gläschen Johannisbeerwein? Das ist meine Spezialität, den habe ich selbst aufgesetzt.«
Malte stand auf und verließ das Zimmer. Kurz darauf erschien er mit einer halbvollen Flasche und zwei Aperitifgläsern, stellte sie auf den Tisch und füllte sie mit einer tiefroten Flüssigkeit.
»Skål, Ansgar! Auf gute Zusammenarbeit.«
Das Archiv war ein fensterloser Raum im Winkel zwischen Büro und Arrestzelle. Eine Kammer, völlig überfüllt, voller Ordner, Akten und allem möglichen Krimskrams. Ein kühler Raum, mit hellgrau lackiertem Holzfußboden; an den Wänden standen Regale aus einem Aluminium-Bausystem. Die Fächer quollen über von Papieren und Schriftstücken, auf dem Boden lagerten Pappkartons und Kunststoffkisten, alle randvoll und zum Teil übereinandergestapelt.
»Also«, begann Malte, »von 1960 an steht alles in den Regalen, bis auf die Sachen der drei letzten Jahre, die haben wir im Büro.« Er machte eine unsichere Geste quer durch den ganzen Raum. »Die Akten von 1930 bis 1959 sind in den Plastikkörben, und … äh … in den Kartons liegt der ganz alte Kram. Das hat früher alles mal in der Bibliothek gelegen, aber mein Vorgänger, der dieses Archiv eingerichtet hat, hat alles hier runtergeholt. Sieht allerdings ganz danach aus, als hätte er schnell das Interesse daran verloren. Kein Wunder, das Zeug geht mindestens bis zur Jahrhundertwende zurück, und vielleicht sogar noch weiter.«
Überall lagen kuriose Gegenstände, die Jørgensen kaum mit der Arbeit der Polizei in Zusammenhang bringen konnte. Er fragte sich, ob es sich hier statt einer Registratur und Asservatenkammer nicht eher um den Lagerraum eines Trödlers handelte. An ein Regal hatte jemand, vermutlich Malte selbst, kleine Pappstreifen geklebt, auf denen Jahreszahlen standen. Er las ›1982‹, in diesem Fach lagen nur wenige Akten. Malte hatte sich offensichtlich Mühe gegeben, zumindest ein Element des Regals übersichtlich zu halten, um dem Ruf der Polizei als Ordnungsmacht auf wenigstens einem Regalmeter Rechnung zu tragen.
Malte räusperte sich. »Ja, also, ich muß jetzt gehen, du weißt ja nun Bescheid, und …«, er schlüpfte in seine Jacke, »… falls du noch Fragen hast, ruf mich an, ich bin zu Hause, wir kriegen wahrscheinlich Nachwuchs. Unsere Bolette kalbt. Komm doch heute abend zum Essen vorbei. In Oldekær, der gelbe Hof am Møllevej. Vielleicht gibt es ja dann schon was zu feiern.«
Jørgensen hörte die Tür ins Schloß fallen. Er ging hinüber zum Archiv und lehnte sich an den Türrahmen. Eine Weile stand er so da, das rechte Bein hinter das linke gehakt und blickte gedankenverloren in den Raum. Dann strich er sich mit Daumen und Zeigefinger langsam über den Schnurrbart.
Die Welt stellt jede Unternehmung vor eine Alternative: vor die Alternative von Erfolg oder Mißlingen, von Sieg oder Niederlage. Die Aufgabe der nächsten Zeit würde es sein, ein Archiv zu ordnen, ein Archiv, nach dem niemand verlangte, von dem kaum einer mehr wußte, daß es existierte und das hier noch nicht einmal hingehörte.
Jørgensen hatte abgewaschen und beschloß, einen kleinen Rundgang durch sein neues Revier zu machen. Er verließ das Polizeihaus, ging zum Hafen und kaufte im Verkehrsbüro ein ›Velkommen til Lilleø‹ mit einer Karte der Insel und Ortsplänen. Anschließend setzte er sich auf die Kaimauer, studierte das Heft, und nach etwa einer halben Stunde stand er auf, ging die Vestergade bis zum Postamt, bog nach links in die Søndergade und blieb am Marktplatz stehen. In der Mitte des Platzes befand sich eine große weiße Handpumpe, die sich sogar noch betätigen ließ; ein kleines Rinnsal kroch über das Pflaster und verteilte sich im Netz der Kopfsteine.
Jørgensen setzte sich auf eine Bank. Eine schöne Stadt, an der die Zeit fast spurlos vorübergegangen war. Schmucke Häuschen, die sich allesamt ins Straßenbild schmiegten, eines noch gediegener als das andere, kombiniert in allen erdenklichen Pastelltönen. Jede Straße und Gasse war mit großen rötlichen Granitsteinen gepflastert. Die Stadt, das Wetter, die Jahreszeit, das Licht, die Straße, das alles hatte den Hauch von etwas, das bereits die Neigung hat, Erinnerung zu werden. Auch Menschen kamen vor in dieser Erinnerung, alte Menschen hauptsächlich; Menschen, die freundlich grüßten, Menschen, die bereits wußten, daß ein Kriminalbeamter aus Kopenhagen auf ihre Insel gekommen war.
Das Kalb
Am Nachmittag fuhr Jørgensen mit dem Fahrrad in seinem neuen Bezirk Streife. Er war glänzender Stimmung und gab seinen Gedanken die Zügel frei, trieb sie an, daß sie wild galoppierend sich in alle Richtungen hin zersprengten. Von Zeit zu Zeit hielt er an, legte das Rad beiseite, untersuchte einige Pflanzen und machte sich Notizen. Anna hatte ihm eine lange Liste mit Sonderaufträgen mitgegeben. Sie arbeitete im Botanischen Garten von Kopenhagen an einem umfassenden Werk, einem Atlas der Farn- und Blütenpflanzen Dänemarks. Natürlich war Lilleø für die Botaniker kein unbeschriebenes Blatt, kein weißer Fleck in der Kartierung der dänischen Vegetation, jedoch das Auftauchen neuer und das Verschwinden alter Spezies erforderte eine ständige Überprüfung der Artenliste. Der einzig sinnvolle Grund für einen solchen Zwangsurlaub, hatte Anna behauptet.
Sein Weg führte an Ellehavegaard vorbei ins Nor. Das war alles mal Wasser, hatte Malte ihm erzählt, eine flache Meeresbucht zwischen den beiden Teilen der Insel, die man vor 150 Jahren eingedeicht und trockengelegt hatte. Jesper Terkelsen stand in der Einfahrt zum Norweg und unterhielt sich mit einem alten Mann, der, die Beine leicht gespreizt, gegen das Gatter einer Pferdeweide lehnte und sich mit einem großen weißen Taschentuch den Schweiß aus dem Nacken wischte. Mit der anderen Hand stützte er sich auf einen Knotenstock, zwischen Daumen und Zeigefinger hielt er eine Baskenmütze und über dem Unterarm hing seine Jacke. Er trug ein weißes Leinenhemd mit einer dunkelgrauen Weste, die offen zu beiden Seiten seines Bauches abstand. Locker um den Hals hingen ihm die zerknitterten Enden eines altmodischen Binders. Der Mann, die Geste, das gesamte Bild kam Jørgensen irgendwie bekannt vor. Er ging auf die beiden zu und grüßte. Jesper nahm sogleich die Mütze vom Kopf.
»Dies ist Lehrer Anders Kristensen. Und dies«, er deutete flüchtig mit dem über das Handgelenk gedrehten Daumen auf ihn, »ist Kommissar Ansgar Jørgensen aus Kopenhagen.«
»Aha, ein echter Kommissar kommt uns besuchen!?« Kristensen hob die Augenbrauen.
»Kein Kommissar. Nur ein Kriminalassistent«, sagte Jørgensen.
Sie tauschten einige Sätze über das Wetter, die sich in nichts von anderen, bei anderer Gelegenheit über das Wetter getauschten Sätzen unterschieden, dann ging Kristensen den Norweg hinunter, Jesper zu einer Pfadfindergruppe, die hinten auf seinen Wiesen zeltete, und Jørgensen radelte weiter zum Drejet. Dort bog er scharf nach rechts ab und fuhr am Meer entlang nach Eskebjerg. Das Wasser warf klatschend kleine Wellen über die rundgewaschenen Kiesel, und es rullerte und kullerte so einladend, daß er Lust bekam, hier einmal schwimmen zu gehen. Nach einer Weile bog der schmale Fahrweg ab und führte einen leichten Hang hinauf. Hinter einem dichten Verhau aus Heckenrosen, Bocksdorn und Weißbuchengesträuch tauchte plötzlich ein völlig verkommenes Gehöft auf und war gleich wieder hinter den Büschen am Wegesrand verschwunden. Die Straße wurde steiler, beschrieb dann einen leichten Bogen. Schwer atmend hielt Jørgensen an. Ein blauweißes Schild wies auf eine Sehenswürdigkeit hin. Er lehnte das Rad gegen eine Weide und folgte mit langen und gebeugten Schritten dem Feldweg hügelan, gespannt darauf, was ihn oben erwartete. Der tief eingeschnittene Weg und das für diese Jahreszeit schon ziemlich hoch stehende Korn versperrten ihm die Sicht. Auf der Kuppe lagerte ein Kranz riesiger Granitblöcke. Einige der Decksteine ruhten noch auf ihrem Platz, oder zumindest sah es so aus. Erfreut nahm er zur Kenntnis, daß keinerlei Spuren picknickender Schulklassen oder Omnibustouristen zu sehen waren, die anderswo die prähistorischen Grabstätten mit Graffiti und Müll überdeckten. Eine Tafel zeigte das Bild vom ursprünglichen Ausmaß und Aussehen der Anlage und datierte sie in die Jungsteinzeit. Hier hatten vor nahezu dreitausend Jahren Menschen mit unendlicher Mühe einigen ihrer Artgenossen eine pompöse Ruhestätte verschafft. Später dann quälten andere Menschen sich damit ab, die Findlinge den Hügel wieder hinunterzuschaffen und zu zerschlagen, als Fundamente für ihre Häuser und Scheunen. Die Anlage verfiel, Wind und Regen wuschen den Erdbewurf herunter, Büsche und Bäume überwucherten sie, und die Bauern zogen ihre Furchen darum herum. Erst vor hundert Jahren wurde man wieder darauf aufmerksam. Jetzt waren es Kulturdenkmäler, die es zu erhalten galt. Aber waren das nicht inzwischen auch die Fundamente der alten Bauernhäuser geworden? Wie alt muß ein Grab sein, damit seine Zerstörung keine Schändung, sondern legitime Rohstoffgewinnung ist? Sechs Semester Theologie und dreizehn Jahre Polizeidienst hatten in Jørgensen Zweifel daran aufkommen lassen, daß die Menschen jemals von anderen Motiven als Habgier, Angeberei und einem barbarischen Sinn für das Praktische beseelt gewesen waren – wenn beseelt hier das richtige Wort ist. Er erinnerte sich an eine Vitrine im Kopenhagener Museum für Frühgeschichte. Dort war ein breiter Bronzedolch neben einer verblüffend ähnlichen Replik aus Feuerstein präsentiert. Die Legende erläuterte das so: Im achten vorchristlichen Jahrhundert, als die Händler aus dem Süden in den Norden kamen, also quasi aus der Bronze- in die Jungsteinzeit, und ihre neuen Metallwaffen feilboten, wollte die zwar jeder haben, aber nur wenige konnten sie sich leisten. Daher ließen sich die ärmeren Häuptlinge ihre Flintsteindolche im Design der Bronzeklingen anfertigen. Die Produkte waren zwar Meisterleistungen der Feuersteinbearbeitung, aber gleichzeitig als Waffen völlig unbrauchbar, viel zu zerbrechlich. Nur was Preiswertes zum Angeben, gefertigt mit einem unerhörten technischen Geschick. Jørgensen war davon außerordentlich beeindruckt gewesen; handwerkliches Können für Prestigeobjekte, bei denen der ursprüngliche Gebrauchszweck zu achtlosem Beiwerk verkommen war. Wieder mal fand er bestätigt, daß die Menschen sich seit Tausenden von Jahren im Grunde nicht geändert hatten.
Die Aussicht rundum war phantastisch, man konnte einen großen Teil der Insel überblicken, und Jørgensen rekonstruierte den Weg, den er entlanggekommen war. Er sah den Damm und folgte der Straße bis zu dem alten Hof unter ihm, auf halber Höhe des Hügels. Eine ganze Weile blickte er vor sich hin, bis ihm mit einem Mal klarwurde, wo er hier stand. Dieser Hof gehörte zweifellos den Brüdern Larsen. Hier, ganz in seiner Nähe, mußte demnach der Schafbauer gefunden worden sein. Nachdem er die Granitblöcke einige Male umschritten hatte, entdeckte er die Stelle, wo der alte Mann gelegen hatte. Das Korn war im Umkreis von drei Metern niedergetrampelt. Vor fünf Tagen hatte hier im Zentrum der Bauer zusammengekauert gelegen, umringt von ein paar Leuten; dem Arzt, Malte, den beiden jungen Leuten und vielleicht noch seinem Bruder Axel.
Zielstrebig bahnte Jørgensen sich einen Weg durch Korn und Feldrain und betrat schließlich den Innenhof. Über einen Haufen verrostetes Gerät gebeugt, stand Axel Larsen und hantierte mit einem Hammer. Als Jørgensen ihn ansprach, zuckte er zusammen und drehte sich um. Sein Blick verriet Erstaunen und Scheu.
»Guten Tag, Axel, erinnerst du dich an mich? Ich bin Ansgar Jørgensen, ich war gestern morgen auf dem Friedhof, zusammen mit Malte Hansen.«
Axels Gesicht entspannte sich, und er versuchte zu lächeln; besonders gut gelang ihm das nicht.
»Ja, ja, der Kommissar aus Kopenhagen, nicht wahr?«
Jørgensen zögerte einen Augenblick. »Ja, richtig … ich bin ein wenig spazierengegangen, kam zufällig hier vorbei und wollte mal guten Tag sagen.« Er versuchte, einen Blick in eines der Fenster zu werfen, aber vergeblich, die Scheiben spiegelten, sofern sie nicht durch Pappquadrate ersetzt waren, nur den blauen Himmel wider.
Jørgensen lächelte Axel aufmunternd an. »Es wird sicher nicht leicht werden, den Hof allein zu bewirtschaften, oder?«
»Wird schon gehen«, brummelte Axel. Er hatte offensichtlich das Interesse am Kommissar verloren und hämmerte wieder auf einer alten Pflugschar herum, daß der Rost in alle Richtungen stob.
»Auf Wiedersehen«, rief Jørgensen. Axel Larsen drehte sich nur kurz um und nickte.