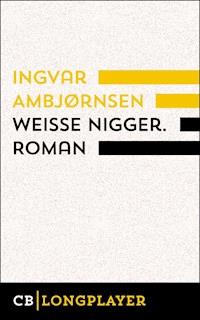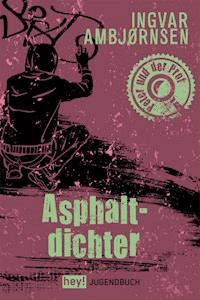3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der 56-jährige Astor blickt zurück. Es ist nun schon 34 Jahre her, dass er die wunderschöne Grete Reim kennen lernte: Astor kann die Unnahbare für sich gewinnen und die beiden heiraten. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Ähnliche
Ingvar Ambjörnsen
Die Königin schläft
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
FISCHER E-Books
Inhalt
– 1 –
Sie weiß nicht, was ich mache. Hat einfach keine Ahnung. Sie glaubt vielleicht, ich sei mit meinen Briefmarken beschäftigt. Mit Zacken zählen und Wasserzeichen studieren. Es ist fast zum Lachen. Denn nichts liegt mir ferner. Das mit den Briefmarken ist ein abgeschlossenes Kapitel, wenn ich das so ausdrücken darf. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen. Die Philatelie war für mich viele Jahre hindurch ein geliebtes Steckenpferd, aber jetzt ist Schluss damit. Ich habe Alben und Kartons ganz hinten in einen Abstellraum geschoben.
Nein, ich denke einfach nur ein wenig über die Liebe nach. Und mache mir außerdem in meinem Laptop ein paar Notizen. Und ich trinke. Vor allem Whisky. Und ein paar Bier nach dem Aufstehen. Das mit dem Alkohol weiß sie natürlich. Sie weiß, dass ich trinke, so wie ich weiß, dass sie trinkt. Aber dass ich hier Abend für Abend sitze und mich mit der Liebe beschäftige, das ist wohl ein Umstand, der sie verblüffen würde.
Und ich habe durchaus nicht vor, sie zu verblüffen. In keiner Hinsicht. Ich verstecke die Diskette in meiner Brusttasche und sage kein Wort. Nicht ein einziges Wort.
Es ist Herbst. Wir schreiben schon Oktober. Ich habe das Fenster auf Kipp gestellt und der säuerliche Duft von Fallobst und feuchtem Laub strömt herein. Der Garten ist in Dunkel gehüllt. Weiter hinten sehe ich die Lichter der Küstenstraße, die sich am schwarzen Fjord entlangzieht. Ab und zu höre ich ein Auto, das weiter im Inneren der Bucht zum Ort oder aus dem Ort unterwegs ist; Gummireifen auf feuchtem Asphalt. Den ganzen Tag habe ich vom Leuchtturm draußen im Meer das Nebelhorn hören können, doch jetzt ist dieser klagende Ton endlich verstummt. Wir haben Glück gehabt, als wir uns dieses Haus gekauft haben. Gut, wir hatten auch Geld genug in einer Zeit mit niedrigen Preisen. Wir hatten die Wahl. Trotzdem hätten wir es schlechter treffen können. Dieses Haus kommt mir gewissermaßen richtig vor, und ich weiß, dass Grete das auch so sieht. Hier haben wir Licht und Luft, trotz der Küstenstraße auf der einen und der Eisenbahn auf der anderen Seite. Das Geräusch des spärlichen Verkehrs wirkt auf mich beruhigend. Ich fühle mich nicht so einsam, wenn ich höre, wie alle diese Menschen dauernd von einem Ort zum anderen unterwegs sind. Und bei Grete ist es so, dass sie besser schreibt, wenn es eine Geräuschkulisse gibt, sie hat die Stille noch nie ertragen können. Und hier sitzen wir nun, ich hier, sie dort, in einem an die hundert Jahre alten Haus im Schweizer Chaletstil, und befassen uns mit der Liebe. Oder mit ihrem Zerrbild. Ich bin mir da nicht sicher. Wir sitzen da und trinken und träumen. Wenn der Alkohol uns irgendwann in der Nacht in die Bewusstlosigkeit zu holen droht, verziehen wir uns in unsere Einzelzimmer. Ich liebe sie, aber vom ersten Stock herunter. Und ich glaube im Grunde, dass sie mich liebt. Da unten im Erdgeschoss.
Sie war wie eine Offenbarung, wenn ich mich ein wenig schwülstig ausdrücken darf. Oder, um noch eins draufzulegen und doch bei der Wahrheit zu bleiben: Sie rauschte unter vollen Segeln in mein Leben. Naja. Ich sehe ja selbst, wie ich von den Klischees beeinflusst bin, die sie zur Millionärin gemacht haben. Aber trotzdem – als ich Grete Reim zum ersten Mal sah, war mir auf fast mystische Weise klar, dass ich vor einem Wendepunkt in meinem Leben stand.
Es war ganz kurz nach dem Johannistag. 1959. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt. Zusammen mit zwei Kollegen aus der Bank hatte ich für eine Woche unten bei Nevlunghavn ein kleines Ferienhaus gemietet. Keine großartigen Sommerferien, würden wir heute wohl denken. Aber damals waren wir jung und ehrgeizig und es waren gute Zeiten. Denen, die «es zu etwas bringen wollten» (wie man damals sagte), standen alle Möglichkeiten offen. Eine Woche Sommerferien – mehr verlangte niemand. Die Arbeit wartete. Wir sollten das Haus, das die Nazis in Schutt und Asche gelegt hatten, schließlich wieder aufbauen.
Aber genug davon. Zurück zu jenem Samstag. Ein glühender Sommerabend. Wir hatten frische kleine Makrelen gegessen, die wir uns morgens am Landesteg gekauft hatten. Wir waren sonnenverbrannt und satt und nach ein paar Drinks auf der Veranda vielleicht ein wenig aufgekratzt. Gegen sechs sollte am Hafen Tanz sein, und natürlich gingen wir hin. Wir waren drei junge Männer, wir waren in unserem besten Alter, und bisher hatte keiner von uns Anker geworfen.
Ich kann mich an die Veranstaltung selbst nicht mehr erinnern, und das kann ja auch egal sein. Aber in der Dämmerung, in dem Moment, als die Sommernacht sich über den Fjord und die weiter draußen gelegenen Inselchen senkte, entdeckten wir das große Segelboot, das vom Meer her auf uns zusteuerte. Dieser Anblick war an sich nichts Besonderes. Boote kamen und Boote gingen. Es ist wohl eher so, dass ich diesem Bild im Nachhinein eine größere Bedeutung beimesse, als es in Wirklichkeit hatte. Aber auf jeden Fall war es ein großes, prachtvolles Boot, und ich meine mich noch an das Knattern der Segel erinnern zu können, als es an die Mole bei der Fischfabrik glitt.
Und dort, ganz vorn am Bug, stand Grete Reim. Mit wehenden blonden Haaren wie eine Galionsfigur aus Fleisch und Blut. Sie war die schönste Frau, die ich je gesehen hatte.
Und hier kommt sie doch tatsächlich wieder angesegelt. Ich sehe sie, als ich mir Feuer gebe, ich sehe sie über der Flamme. Erst halb versteckt durch den Rhododendron unten am Zaun, dann in ihrer ganzen Pracht und mit wehenden hellen Gewändern in der herbstlichen Dunkelheit. Sie steht dort unten und hält sich an den grünen ledrigen Blättern fest. Redet ein wenig mit sich selbst, so wie ich sie kenne. Ein paar beruhigende Worte, ehe sie die Überquerung der düstren Gartenfläche antritt. Ganz ruhig jetzt, Grete. Das hast du schon häufiger geschafft. So ähnlich. Sie kehrt zurück von ihrer Busenfreundin, Elisabeth Hansson mit zwei s. Der Kapitänsfrau im Nachbarhaus. Der Frau mit den Krampfadern, den schlechten Nerven und dem Mann weit draußen auf den blauen Wogen. Die wartet und mit sich selbst Sherry trinkt. Oder mit meiner Frau, wenn sich das so ergibt. Nur verhält es sich mit Grete so, dass Sherry nicht mehr anschlägt. Sie spielt schon lange nicht mehr mit Puppen. Deshalb wird, wer suchet, eine Flasche mit klarem Schnaps finden, irgendwo am Weg, der auf das Nachbargrundstück führt. Dort steht sie in einsamer Majestät bei Sonne und Regen, und das wird sich niemals ändern. Wenn eine Flasche leer ist, wird sie durch eine volle ersetzt. Auf diese Weise erhält das Leben eine gewisse Kontinuität. Ein großer Schluck direkt aus der Flasche, nein, zwei. So bezwingt meine Frau die Grenzen. In sich selbst oder ganz einfach zwischen zwei Grundstücken mit Fjordblick. Ich trinke ihrer Gestalt dort unten in dem dunklen Garten zu. Flüstere ein fast lautloses «Prost» und lasse den braunen Schnaps durch meine Gurgel gleiten. Und dann ist Tiger zur Stelle. Lautlos neben mir auf dem Schreibtisch.
Er hat den Sprung vom Bücherregal herüber gewagt. Er mustert mich forschend, dann streckt er sich und setzt sich auf die Fensterbank. Und jetzt sind wir zwei, die hier sitzen und auf das Elend draußen blicken. Plötzlich lässt der Wind Regentropfen gegen die Fensterscheibe prasseln – sie wird jetzt loslassen müssen. Grete Reim ist keine, die sich die Frisur ruinieren lässt, nicht einmal, wenn die Promille in ihrem Blut pochen. Sie spielt gern die Rolle der eleganten Dame. Und ich kann sie verstehen. Ich glaube, sie macht das Richtige. Denn wenn sie die letzten Reste von Stolz über Bord wirft, dann hätte sie damit auch den Boden aus dem Schiff gesprengt. Dann geht sie mit schläfrigem Grunzen unter. Sie nimmt Rücksicht. Sie weiß, dass mein eigener Schiffbruch mir genügt.
Jetzt lässt sie los! Tiger und ich behalten sie genau im Auge. Zuerst einen Schritt gen Norden, dann einen Schritt gen Süden. Ihr Kleid weht im Wind, und jetzt bricht der Regen wirklich los, jetzt kommt der Wolkenbruch, sie läuft in einem schwachen Bogen durch den Garten, es sind kurze Schritte mit betäubten Füßen, den Oberkörper vorgebeugt, die Arme seitwärts ausgestreckt, weiße Wimpel in der Dunkelheit. Es kann gut gehen, es kann sehr gut gehen, aber nein! Sie streift ganz leicht den Johannisbeerstrauch, und das bringt sie aus dem Gleichgewicht; das reicht schon aus, wenn die Uhr elf zeigt und der Rausch ansteigt, und da haben wir den Goldfischteich mit dem kleinen Pinkelheinrich aus Beton, da hilft alles nichts, sie wollte diesen Teich unbedingt dort anlegen, jetzt holt sie diese Entscheidung mit torkelnden Schritten ein. Und mit hochhackigen Schuhen landet sie im grünen Schleim der uns weggestorbenen Fische, rutscht aus, kippt um, ihre Beine liegen in der Spinatsuppe und ihr schwerer, breiter Körper auf dem Rasen.
Nun heißt es ruhig Blut bewahren. Denn das hier haben wir im Kurs gelernt. Das war sogar in Verbindung mit ihrem ersten und einzigen Klinikaufenthalt. Damals, als ich noch die Kontrolle hatte oder zumindest die Fähigkeit, mir das einzubilden. Auf jeden Fall war mir die Rolle des Verantwortungsbewussten in unserer Beziehung übertragen worden. Nicht ich war in elendem Zustand in einem Hotelzimmer in Hønefoss aufgefunden worden. Ich trat in dieser Klinik ebenso verlegen und verzweifelt wie vielleicht ein Dutzend anderer Ehepartner beiderlei Geschlechts an. Wir waren alle nicht mehr die Jüngsten, wir gehörten einer Generation an, der es nicht leicht fiel, sich über alles Mögliche «auszusprechen», und wir hatten auch nicht vor, uns daran zu gewöhnen. Die ganze Veranstaltung fiel für uns allesamt ausgesprochen peinlich aus. Kranke und Angehörige wurden wie eine Bande von etwas begriffsstutzigen Kindern behandelt, und wir, die also die Verantwortlichen sein sollten, mussten uns sagen lassen, wir könnten nie im Leben einen Alkoholiker daran hindern, sich Alkohol zu besorgen. Ich weiß noch, wie ich mit dem Lachen kämpfte, meine Güte, welche Sensation für Menschen, die teilweise seit Jahrzehnten mit Trinkern zusammenlebten! Außerdem verfügte ich ja über breite Erfahrung im Befriedigen eigener Bedürfnisse. Das Einzige, was ich von diesem Seminar für Angehörige mitbrachte, war, nie mehr hinter sturzbetrunkenen Partnerinnen herzulaufen, um Stürze oder Verletzungen zu verhindern. «Das hat keinen Zweck», sagte der Therapeut. «Sie nehmen damit Ihrem Partner die Verantwortung für sein Leben, während Sie sich Ihr eigenes ruinieren. Mehr kommt dabei nicht heraus.»
Also schenkte ich mir noch einen soliden Whisky ein. Fast einen Dreifachen. Ich steckte mir eine neue Zigarette an und kraulte Tiger hinter dem rechten Ohr. Unten im Gras hatte meine Frau jetzt den Autopiloten eingeschaltet und steuerte konzentriert über den Rasen auf Haus und Verandatreppe zu. Auf den Knien.
Großer Gott! Großer Gott im hohen Himmel! Blicke in Gnaden auf uns herab, die wir hier unten auf Erden umherkriechen! Die auf bloßen Knien oder auf Knien bedeckt von triefnasser Seide zu tausend Kronen den Meter umherkriechen! Wir würden so gern aufrecht und pfeifend durch den Garten gehen.
Der Regen wird immer noch stärker. Er kommt mir fast vor wie ein Wasserfall. Es ist so ein Regen, der die Blätter von den Bäumen schlägt und Frauen, die auf Knien im Gras liegen, den Kleiderstoff in die Haut presst.
Tiger jammert.
«Aber du kannst dir doch denken, dass ich sie holen gehe», sagte ich.
Was leichter gesagt ist als getan, natürlich. Whisky ist ein komischer Stoff. Hier sitzen wir, ganz klar im Kopf, ganz klar. Aber wenn wir aufstehen, kommen uns die Wände entgegen. Das geht vorbei. Das weiß ich. Nur noch zwei, drei Gläser, dann legt es sich. Ich trinke trotz allem nach einem Muster, bei dem um drei Uhr Schluss ist. Das ist heute nicht anders als an jedem anderen Abend. Aber es ist jetzt erst elf und die Treppe steil. Schrecklich steil. Ich werde mich gegen das Geländer lehnen und mich in die Dunkelheit hinabsinken lassen müssen. Der Kater kommt hinterher, maunzend wie ein eifriger Sekundant.
Ich reiße die Verandatür auf. Die Regentropfen prasseln wie Hagelkörner auf die Treppenstufen. Sie steht jetzt kurz vor dem Aufgeben, das kann ich sehen. Ihr Kopf hängt zwischen den kräftigen Schultern, sie vertieft sich in den Anblick der Grashalme, und sie bebt am ganzen Leib. Sie ist wie eine Botin von der Front. Sie hat den weiten Weg von Flandern zu Fuß zurückgelegt und jetzt kann sie nicht mehr. Viel zu melden hat sie auch nicht. Nur Tod und Blödsinn.
Innerhalb weniger Sekunden bin ich bis auf die Haut durchnässt. Packe sie unter den Armen und will sie ins Stehen hochziehen, in die Anständigkeit. Und höre das Knacken, ehe ich das Messer zwischen meinen Rückenwirbeln spüre.
Dann knien wir gemeinsam. Wir knien vor unserem Zuhause und von der offenen Verandatür her betrachtet uns ein getigerter Kater.
Sie fragt, ob ich sie liebe. Ich verstehe so gut, was sie vor sich hinnuschelt, ich habe schon längst gelernt, ihre Sprache zu deuten, wenn sie auf dieser Frequenz sendet.
«Ja», sage ich. «Ich liebe dich. Du bist meine Taube. Aber ich habe mir gerade das Rückgrat gebrochen, und deshalb glaube ich, dass wir beide ein Glas brauchen könnten.»
Und wir lachen ein bisschen. Wie sollten wir sonst auch überleben.
– 2 –
Ich hätte niemals gedacht, dass aus uns beiden ein Paar werden könnte. Ich war ein etwas schüchterner junger Mann, während sie sofort zum Mittelpunkt jeder Versammlung wurde. Alles, was sie sagte oder tat, geschah mit einer natürlichen Autorität. Sie fiel einfach auf. War intelligent, beredt und schön. Sie war der Traum vieler Männer.
Und da standen wir. Auf der Mole, an jenem Sommerabend im Jahre 1959. Karl, Einar und ich. Und vom Fjord her kamen Grete Reim und Mannschaft. So zu denken schien ganz selbstverständlich. Dass die anderen jungen Leute, die jetzt eifrig die Segel einholten und den großen Segler an eine freie Stelle bugsierten, ihre Mannschaft waren. Sie selbst rührte keinen Finger, sie stand einfach da und sonnte sich in ihrer eigenen Schönheit. Braun wie eine Spanierin, aber mit blonden Locken, in denen der Wind, der Glückliche, ein wenig spielen durfte. Sie lächelte. Karl, der Mutigste unter uns, hob eine Hand zum Gruß. Und sie winkte eifrig zurück.
«Kennst du sie?», fragte Einar verblüfft.
«Nein», antwortete Karl. «Aber das würde ich gern ändern. Oder was meinst du, Astor?»
Ich meinte in diesem Moment rein gar nichts. Ich schwieg.
Karl rannte los und fing die an Land geworfene Trosse auf. Danach half er beim Vertäuen des Bootes.