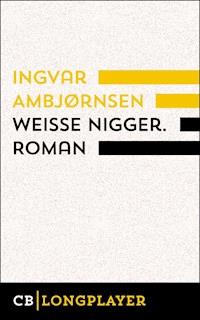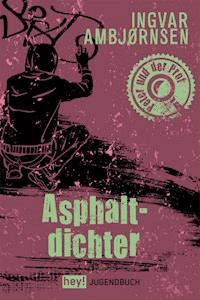3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Sommer in Hamburg: Die Stadt stöhnt unter einer Hitzewelle. Jeden Nachmittag geht eine Mutter mit ihrem Sohn auf einen Spielplatz im Park. Doch sie sind nicht allein. Jemand beobachtet sie. Und plötzlich ist der kleine Junge verschwunden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Ähnliche
Ingvar Ambjörnsen
Innocentia Park
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
FISCHER E-Books
Inhalt
Wir danken NORLA für die Unterstützung der Übersetzung aus dem Norwegischen.
Es ist so heiss, dass sogar die Hunde aufgehört haben, zu pissen
Ich bekomme entsetzliche Rückenschmerzen von diesem Sessel. Tag um Tag sitze ich darin, und mein Rücken verschlimmert sich mehr und mehr. Da sitzt du gut, sagt sie, und ja, sage ich, hier sitze ich gut. Das ist ein guter Sessel, sagt sie. Denk doch nur: fast zehntausend Euro!
Ja, denk doch nur, denke ich. Fast zehntausend Euro. Das bedeutet einen Rabatt von fünf Riesen. Diese Sessel kosten um die fünfzehntausend, es ist irgend so ein spanisches Designerteil, Morano? Mireno? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin fast sicher, dass sie sich diesen Rabatt erschlafen hat, und ganz sicher, dass wir keinerlei Rabatt benötigen. Sie hat mit Morano, Mireno oder Maro geschlafen, weil sie Lust dazu hatte. Weil sie beide Lust dazu hatten. Ich wünschte, das hätte zu etwas anderem geführt als zu diesem Sessel. Zu einer obskuren Geschlechtskrankheit vielleicht, einer ungeplanten Schwangerschaft oder wenigstens einem harmlosen Geschenk. Aber nicht zu diesem Sessel. Anfangs habe ich nur darin gesessen, wenn sie dabei war, wenn sie zu Hause war, ich bin schließlich ein höflicher Mensch. Später habe ich dann angefangen, ihn auch zu benutzen, wenn ich allein war. Ich habe mich einfach hineingesetzt und gespürt, wie mein Rücken wehtat, wie dieses auserlesene Design mich langsam fertig machte.
Dann fing ich an zu gehen.
Der unbequeme Stuhl hat mich zum Gehen gebracht.
Gehen hilft.
Das hier wird ein entsetzlicher Tag werden. Die Hitze liegt jetzt seit fast fünf Wochen wie eine Fieberhand über der Stadt. Siebenunddreißigfünf. Achtunddreißig. Noch vor zwei Jahren haben wir die Klimaforscher ausgelacht, heute braten wir auf den Autodächern Spiegeleier, sogar hier oben in Norddeutschland. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Witziger Gag. Fritz Heller versucht, die unter uns, die resigniert haben, aufzumuntern, uns, die glauben, dass alles zum Teufel geht. Fritz Heller brät Spiegeleier auf dem Dach eines silbergrauen Porsche, während er mit den Passanten Witze reißt. Und den ganzen Tag, alle Tage, hören wir das Geschrei der Sirenen, der Rettungswagen, die Alten und Herzkranken brechen zusammen, sterben in der Warteschlange in der Post oder auf dem Weg zum Supermarkt, brechen mit einem erstaunten Schnaufen zusammen. Was sagen die Fachleute? Drei Liter Wasser pro Tag? Fünf? Ich trinke und trinke, und wenn ich ein seltenes Mal auf die Toilette gehe, gibt es nur ein paar Tropfen, einen schlaffen Spritzer. Ja, ich habe schon daran gedacht, gestern erst habe ich daran gedacht, als ich den Innocentia Park von Süden her betrat. Ich dachte: Es ist so heiß, dass sogar die Hunde aufgehört haben, zu pissen. Ein Hund hatte an einer der alten Eichen sein Hinterbein gehoben, er stand nur da und starrte konzentriert vor sich hin, und sein kleiner Rumpf zuckte, aber nicht ein Tropfen kam heraus. Ich blieb stehen und musterte dieses seltsame Phänomen, den Hund, der presste und presste, und das Ergebnis, das sich nicht einstellte. Am Ende ließ er sein Hinterbein wieder herunter, kratzte im braun verbrannten Gras herum und verschwand dann kläffend im Gebüsch. Über den Baumwipfeln im Park der Unschuld, über den dunkelgrünen Baumkronen hinten im Innocentia Park, sehe ich das Sonnenlicht langsam die Mauer des nächststehenden Blocks hinunterwandern, langsam, langsam, Millimeter für Millimeter, die scharfe Lichtklinge befindet sich irgendwo zwischen dem zwölften und dem elften Stock, sie wird Straße und Pflaster erst gegen halb neun erreichen, also in einer Stunde. Dann werde ich in einem anderen Sessel an einem anderen Ort sitzen, dann werde ich mich im Büro befinden mit Ausblick auf den Hafen, ich werde dort sitzen und auf den Hafen blicken, auf die vielen Kräne, die Schiffe, die die Elbe hoch und die Elbe hinunter und über die Elbe hin und her stampfen. Ich stehe aus dem unbequemen Sessel auf, aus dem Geschenk zum Fünfzigsten, dem Geschenk meiner Frau an mich zum Fünfzigsten. Mein Rücken tut weh und ich wandere im Zimmer hin und her, über den Perserteppich, hin und her, quer durch die beiden Zimmer, vom Büfett im Esszimmer zum Kamin im Wohnzimmer, dem Raum mit dem unbequemen Sessel. Ich trinke Mineralwasser in langen Zügen aus der Literflasche, »The Queen of Table Waters«, den ersten Liter des Tages, es werden noch drei oder vier folgen, ich werde trinken und trinken, bis ich dann ins Bett gehe, und dann werde ich wach daliegen, splitternackt und wach, während dieses viele Wasser in Form von süßlich duftendem Schweiß aus meinen Poren quillt. Ich werde ganz still liegen, nein, ich werde schwitzend daliegen und mich von einer Seite auf die andere wälzen, von links nach rechts, von rechts nach links, dann auf den Bauch, auf den Rücken, in Embryohaltung, rechts, links, rechts, links. Warum mache ich das überhaupt? Warum gehe ich gegen Mitternacht ins Bett, wo ich doch weiß, dass es zu heiß zum Schlafen ist, dass ich mich hin- und herwälzen werde, bis das erste Licht durchs Fenster fällt und die Vögel in den Bäumen im Innocentia Park zu singen beginnen? Weil ich so entsetzlich müde bin. Weil es mich zu müde macht, in dem unbequemen Designersessel zu sitzen und zu lesen oder Musik zu hören, zu müde, um fernzusehen, zu müde, um aus dem Haus zu gehen, denn ich bin schon den ganzen Tag gegangen, vier, vielleicht fünf Stunden waren es sicher, ebenso viele Stunden wie Liter Wasser. Bei dieser Hitze.
Der Festanschluss klingelt, ich gehe nicht dran.
Ich schalte mein Mobiltelefon aus.
Ich leere die Flasche, gehe in die Küche und stelle sie in den Kasten neben dem Kühlschrank.
Im Wohnzimmer nehme ich dann eine Banane aus der Schüssel auf dem Fernsehtisch. Ich bleibe am Fenster stehen und esse die Banane, sie ist mein Frühstück. Im Moment ist zum Frühstück Obst angesagt, Apfel, Kiwi, Mango, Banane und Ananas, sogar Erdbeeren, an schwerere Kost ist nicht zu denken, nicht einmal ein weich gekochtes Ei mit einer Scheibe Toast könnte ich hinunterbringen, solange diese Hitzewelle anhält.
Herr Haß steht unten in der Auffahrt und wienert seine Windschutzscheibe. Die Sonne lässt seinen blanken Schädel glänzen. Und die Windschutzscheibe funkelt, die immer blanker und blanker wird, während Herr Haß mit Schwämmen und Waschlappen und allerlei Bürsten und verschiedenen Putzmitteln und immer neuen Eimerfüllungen heißen Wassers am Werk ist. Herr Haß legt all seine Energie in diese Arbeit, einen wütenden Willen und eine heftige Entschlossenheit unter der glänzenden Kopfhaut, einer Idee von einer mehr als sauberen Windschutzscheibe, weitergeleitet in die braun gebrannten muskulösen Arme, die großen Hände, die die Waschlappen packen, den Eimer, die Lappen und Bürsten und die Schwämme und Flaschen und Tuben mit der auserlesenen Chemie. Ich kann keine Windschutzscheiben putzen, ich habe noch nie das geringste Interesse an dieser Kunst besessen, ich überlasse das und überhaupt die Autowäsche anderen, ich bezahle dafür, aber Herr Haß weiß, was er tut, er reibt und schrubbt, er geht nicht, er joggt nicht, er wienert seine Windschutzscheibe. Jeden einzelnen Tag.
Die bloße Vorstellung, dass jemand, zum Beispiel ein bekannter Fernsehclown, auf die Idee kommen könnte, auf dem Dach über dieser Windschutzscheibe ein Spiegelei zu braten!
Wieder klingelt der Festanschluss, ich gehe nicht dran.
Ich lasse das Mobiltelefon ausgeschaltet.
Ich gehe hinaus in die Diele. Hier ist es wunderbar kühl. Keine Fenster. Ein schwacher Luftzug kommt unter der Tür durch. Ich betrachte mich in dem großen Spiegel, dem gerahmten mannshohen Spiegel, den Renate und ich von ihren Eltern zur Hochzeit bekommen haben, ich weiß noch, dass ich dieses Geschenk ein wenig armselig fand, trotz des vergoldeten Rahmens und der gewaltigen Größe. Ich meine, ein Spiegel, eine Badewanne, ein Kühlschrank, das kauft man sich selbst, das sollte man sich kaufen, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie das neue Heim aussehen soll, in dem man nun in Zweisamkeit hausen wird (bis die Kinder kommen). Als ich da im Halbdunkel stehe und mich in diesem Spiegel betrachte, den ich nie gemocht habe, machen das trübe Licht und die Tatsache, dass ich meine Brille noch nicht aufgesetzt habe, das Bild ein wenig unklar, verschwommen, ein lässig ausgeführtes Ölgemälde. Ein Mann in sandfarbenem Anzug und hellblauem Hemd. Rötlicher Schlips, als hinge zwischen Hals und Hosenbund ein Lachsfilet. Die dunklen Haare sind im Nacken hell, ich muss sie schneiden lassen, oder ich könnte sie wachsen lassen und mir so einen kleinen Rattenschwanz zulegen wie Harald einen hat, nein, lieber schneiden.
Was ist los mit meiner Nase? Ich trete dichter an den Spiegel heran.
Nichts.
Ich gehe die Treppe hinunter und bleibe in der Bibliothek für einen Moment stehen. Vor dem Fenster ist Herr Haß am Werk, jetzt bin ich so nah, dass ich die schwarzen Haare auf seinen Unterarmen und seinem Handrücken sehen kann. Schwarze Haare auf kupferbrauner Haut, er sieht aus wie ein bulliger Türke, und der Seifenschaum fließt aus dem Schwamm in den Kies, er drückt den Schwamm zusammen, und es fließt und spritzt und ich denke, jetzt ist es gleich so weit und der Wagen verwandelt sich in einen großen weißen Frauenkörper, der nach mehr schreit, und Herr Haß gibt mehr und mehr und gibt und gibt mit dem seifenspritzenden Schwamm in den großen braunen Händen, ja, da ist es gut, und dort, und ja, hier auch noch ein bisschen und danke und amen.
Ich öffne die Tür.
Sofort ist er auf der Hut. Erstarrt mitten in einer gleitenden Kreisbewegung. Gerade hat er versucht, den rechten Seitenspiegel zum Orgasmus zu bringen, immer wieder hat er den Seifenschaum rülpsenden Schwamm kreisen lassen, bis er mich in der Tür hört, dann ist Schluss, dann erstarrt sein mir zugekehrter breiter T-Shirt-Rücken. In dieser Haltung verharrt er nun einige Sekunden wie festgefroren, in Stein gehauen, in Bronze gegossen, um sich dann langsam und lächelnd umzuschauen, und jetzt sagen wir es gleichzeitig, wir sagen: »Naaaa?«
Worauf ich die Straße überquere und den Innocentia Park von Norden her betrete.
Es ist ein netter und übersichtlicher Park. Ein grünes Oval zwischen den Villen, ich brauche genau fünf Minuten, um ihn einmal zu umrunden. Zur Straße hin steht ein äußerer Kreis aus hoch gewachsenen Bäumen, wunderbaren Riesen, sie dämpfen die Geräusche der Stadt, halten Wache über denen, die hier drinnen wandern oder die einfach auf einem Hocker sitzen oder auf dem Rasen schlafen. Diese Bäume wachen, sie haben den Feuersturm überlebt, auf sie ist Verlass. Innerhalb dieses Kreises zieht sich der schmale Spazierweg hin, ich gehe hier jeden Tag. Im Moment gehe ich zum Beispiel geradewegs nach Süden, auf den südlichen Eingang zu, ich gehe zwischen den Baumreihen, zwischen dem äußeren und dem inneren Kreis aus Bäumen, ich gehe vorbei an den leeren Bänken, es ist so still, es ist noch keine acht. Oben bei den Spielgeräten auf der anderen Seite der Rasenfläche kann ich einen hell gekleideten Jogger sehen, der vor einem Baum Dehnübungen macht, sonst aber niemanden. Schon komisch, denke ich, keine Hunde, keine Hundebesitzer, aber hier ist kein Tag wie der andere. Was für ein blödsinniger Gedanke, wo ist schon ein Tag wie der andere? Bald kann der Park aussehen wie ein Hundezwinger, mit Gekläff und Gebell, mit Pfiffen und scharfen Befehlen, bald? Von einer Sekunde zur anderen. Ich gehe gegen den Uhrzeigersinn, gehe immer gegen den Uhrzeigersinn, unten beim Südeingang gehe ich nach links, den sanften Hang hoch, vorbei an dem längst still gelegten Pissoir, das zwischen Bäumen und Büschen steht, und den Hang hoch, bis er zum Spielplatz und der riesigen, ja, gigantischen Eiche hin abflacht. Hoch über mir durchstreift ein Flugzeug den Himmel, ein kleines einmotoriges Flugzeug mit einem langen Banner hinter sich, einer Reklame für Mineralwasser, trinkt Mineralwasser, Geld aus dem Fenster geworfen, wir trinken Mineralwasser, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, wir gießen uns damit voll, ohne dass irgendwer uns darum zu bitten braucht, in den Brauereien wird jetzt auch nachts gearbeitet. Und ich denke, dort oben, dort hoch oben, bin auch ich gewesen, nicht in einem Flugzeug mit einem Banner im Schlepp, sondern in einem Luftballon, geformt wie (wirklich, so war das!) ein Sessel, ein riesiger grüner Sessel, dort oben in einem winzig kleinen Korb unter einem grünen Sessel. Der Jogger läuft jetzt die nördliche Kurve hinab. Er hat sich gebückt und gedehnt, jetzt joggt er wieder, und während ich ihm folge, denke ich daran, dass ich den Innocentia Park von oben gesehen habe, und dass dieser Anblick etwas mit mir gemacht hat, dass er eine entscheidende Bedeutung für mein Leben haben sollte.
Es ist ein Sommermorgen vor fünf Jahren, ein Sommermorgen wie dieser, ein früher Morgen, aber in einem anderen Park. Ich befinde mich im Stadtpark, zusammen mit Vera von Halle, einer Journalistin vom Hamburger Abendblatt, sie ist auf die Idee gekommen, dass wir uns just hier aufhalten sollen, just in diesem Moment. »Ich hole Sie um sieben Uhr ab«, sagt Vera von Halle am Vorabend am Telefon. »Ich hole Sie morgen früh um sieben ab, ich habe da eine Idee, Sie leiden doch wohl nicht unter Höhenangst«, und ich antworte, dass dem nicht so ist. Am folgenden Tag, also an diesem Sommermorgen vor fünf Jahren, holt sie mich mit einem Taxi ab und lässt den Fahrer dann zum Stadtpark weiterfahren. Zwanzig Minuten darauf haben wir unser Ziel erreicht, und ich kann sehen, dass der Ballon, der uns über die Stadt tragen soll, gerade mit Heißluft gefüllt wird. Damit ist ein ganzes Team beschäftigt, junge Leute, alle unter der kundigen Leitung dessen, an den ich Minuten später und von dann an für immer als den Wuuuschmann denken werde. Wir steigen langsam auf. In regelmäßigen Abständen zieht der Wuuuschmann am Hebel und die Flamme schnellt in das Sesselinnere hoch, füllt es mit immer mehr Heißluft. Eine feine Brise weht von Ost nach West, bald segeln wir über den Hausdächern, hoch, hoch ins Blaue.
Es ist ganz still. Der Verkehrslärm verklingt, und es wird so still. Das fällt mir als Erstes auf. Die Tatsache, dass es hier oben ganz still ist, überrumpelt mich geradezu, damit hatte ich nicht gerechnet. Eine totale Stille, nur unterbrochen vom brausenden Wuuusch! der Flamme. Anfangs gibt es nicht viel zu sagen, es ist so schön, aber schließlich erzählen wir uns dann gegenseitig, wie schön es ist, wie schön und still es gerade ist. Später tut sie, was getan werden muss, das ist ihre Aufgabe, sie macht es nicht zum ersten Mal, aber jetzt macht sie es wieder, sie interviewt mich, und ich sehe schon fast die Überschrift vor mir, »Herr über die Stadt« oder ein ähnlicher Pisskram. Und apropos Pisskram: Ich muss pissen. Natürlich muss ich das. Wir segeln über die Alster, sehen die Segelboote, die dort unten die blaue Fläche durchpflügen, und sie fragt und ich antworte. Es ist ein Porträtinterview für die Sonnabendausgabe, sie ist freundlich und sanft, zweimal ist sie mir schon um einiges energischer auf den Leib gerückt. Jetzt sind Friede, Freude und lauer Wind angesagt, jetzt soll der Mensch Thomas Mader im Mittelpunkt stehen, der Knabe von der Hallig in der Nordsee. Sie scheint zu vergessen, dass sie eigentlich für Immobilienspekulanten und ähnliches Gelichter nur wenig übrig hat. Und ich erzähle. Während wir über Rotherbaum und Harvestehude in Richtung Hoheluft schweben, erzähle ich von Sturm und Stille, von plötzlicher Springflut, von den Kühen, die sich in der entsetzlichen Nacht 1962 mit Wasser bis zum Bauch an die Hauswand pressen. Ich übertreibe, ich sage, dass mein Vater sie am Ende ins Haus geholt hat, in den Flur, und dass wir glaubten, sterben zu müssen, Mensch und Tier, es ist eine glatte Lüge, eine Lüge, die sich in der Zeitung gut macht. Mein Vater, der kurz vor Armageddon das Vieh ins Haus holt, hat etwas Rührendes, das gebe ich ihr also. Und während ich hier stehe und mich in das hineinlüge, was ich mir als die Herzen der Menschen vorstelle, während wir uns die ganze Zeit weiterhin Hoheluft nähern, während ich hier stehe und mich über erdichtete Details aus meiner frühen Kindheit verbreite, sehe ich, wie sich unter uns der Innocentia Park erstreckt, und damit bin ich verkauft.
Ich kann es nicht erklären. Schon am selben Abend versuche ich, Renate auseinander zu setzen, was mir dort oben widerfahren ist, aber das bringt nichts. Es gelingt mir nicht. Und vielleicht ist es gerade, weil ich die Kontrolle verliere, weil ich stottere und stammele, dass sie sich öffnet, dass sie verspricht, sich die Sache immerhin zu überlegen. Denn sie ist es nicht gewöhnt, mich so zu sehen, sie sieht mich jetzt mit neuen Augen, sie sieht einen neuen Thomas mit großen Lücken in seiner Argumentationskette, einen Mann, der am Ende einfach den Versuch aufgibt, zu erklären, warum er seine letzten beiden Jahrzehnte am Rand dieses Parks verbringen will, dem Innocentia Park, einer grünen Nische mitten im Herzen Hamburgs. Und Renate denkt über die Sache nach, das tut sie wirklich, an den folgenden Tagen ist sie still, ein wenig geistesabwesend, und ich lasse sie in Ruhe mit ihren Gedanken. Es ist verlockend, die ganze Wahrheit zu sagen, dass ich jedenfalls in die Stadt ziehen werde, egal, ob mit ihr oder ohne sie, aber ich schweige, kein Wort, und im Grunde möchte ich ja doch, dass sie mitkommt. Und als sie dann ihren Entschluss gefasst hat, als sie sich einverstanden erklärt, sind ihre Argumente genauso, wie sie daran gewöhnt ist, dass meine es sind, rational, vernünftig, die Villa in Blankenese ist einfach lächerlich groß, jetzt, wo Bernhard endlich ausgezogen ist. Dazu kommt eine kräftige, ja, dramatische Veränderung im Alltag in Form eines kürzeren Weges zur Arbeit (ich kann den Tag um anderthalb Stunden erweitern, wie sie sagt), und was läuft im Grunde schon draußen in Blankenese, es läuft doch alles in der Stadt, wirklich alles, in Blankenese passiert gar nichts, da steht die Zeit still, Blankenese ist im Grunde seit fast neunzehn Jahren eine einzige große Enttäuschung. Dass nicht ein einziges dieser Argumente in meinem Hinterkopf auch nur auf Stippvisite gewesen ist, erwähne ich klugerweise nicht, ich eigne mir diese Argumente vielmehr an, mache sie zu meinen, bringe sie zum Glühen. Und als wir uns über diese Änderung in unserem Leben geeinigt haben, ganz ohne Diskussion oder Streit irgendwelcher Art, ohne ein böses Wort, ohne eine Träne, bringt sie den erlösenden Satz, setzt das eigentliche Siegel unter den Pakt, sagt den Satz, der uns beide vor Lachen losbrüllen lässt, kaum, dass er ausgesprochen ist, einen Satz, den wir in den folgenden Tagen und Wochen zahllose Male wiederholen werden, diese Wörter, die sich in just dieser Reihenfolge aneinander fügen: Aber glaubst du, dass da drinnen irgendwas zu verkaufen ist?
Ich gehe vier Runden. Schnell. In regelmäßigen Abständen höre ich den Atem des rotgekleideten Joggers, der mich einholt und an mir vorbeizieht. Es wird jetzt wirklich heiß. Ich schwitze. Auf einer Bank unten an der östlichen Längsseite hat ein älterer Mann Platz genommen, er wippt mit dem Fuß, hat ein Bein über das andere geschlagen. Als ich den südlichen Ausgang erreiche, nach der Hälfte der fünften Runde, breche ich aus, gehe auf die Straße hinaus, zu den vielen Geräuschen, dem Dröhnen von Automotoren, jemand ruft: »He, komm her!« Aber ich bin nicht gemeint, niemand ruft mich, es wäre einfach unvorstellbar, dass jemand mich rufen könnte, es wäre einfach durch und durch unpassend. Und während ich auf den Grindelberg zugehe, diesen großen Fluss aus Glas und Gummi und Stahl, diese Ein- und Ausfahrtsader, denke ich abermals an den Sommermorgen vor fünf Jahren, als ich in diesem Aufsehen erregenden Ballon, der also grün war und die Form eines Sessels hatte, über der Stadt schwebte.
Ich musste dringend pissen und hatte viel zu erzählen.
»Am Ende hat Vater die Kühe ins Haus geholt«, sage ich. »Vier Färsen und ein Kalb. Ihm blieb nichts anderes übrig. Ich werde es nie vergessen. Wir glaubten doch alle, dass wir sterben müssten. Dass jetzt Schluss wäre.«
Der Wuuuschmann zieht am Hebel.
Sie macht sich Notizen und sagt etwas darüber, dass das auf einen kleinen Jungen doch einen unauslöschlichen Eindruck gemacht haben muss, dass man solche Bilder für den Rest des Lebens mit sich herumträgt, und dann lächelt sie plötzlich strahlend, so strahlend, dass ihre großen gelben Pferdezähne in ihrem unschönen Mund zu sehen sind. Mir geht auf, dass ihr eine journalistische Idee von Dimensionen gekommen ist, und sie fragt: »Und so hat es vielleicht angefangen?«
Ich tue so, als ob ich das nicht verstanden hätte, obwohl ich die Pointe sofort erfasst habe, und dann kommt der geniale Spruch, auf dem sie das gesamte Interview aufbauen wird. Der Junge, der zusammen mit Mutter und Vater und den Kühen in der Stube steht, in dieser entsetzlichen Sturmnacht, der Springflutnacht, in der engen Stube in dem winzigen Haus weit draußen auf dem Meer, Todesangst in aller Augen. Hier geht es ihm auf, unbewusst zwar noch, aber hier wird ein Keil in das Kindergemüt geschlagen. Der Wunsch, irgendwann Platz und Raum zu haben, unbegrenzt Platz und Raum, ein Wunsch, der sich einige Jahrzehnte später in etwa dreihundert Mietshäusern, Fabriklokalen, Hotels, Parkhäusern und Einfamilienhäusern niederschlagen wird. Und ich bringe es nicht übers Herz, ihr nicht von Herzen zuzustimmen, ich sage, ja, so ist es, so kann es jedenfalls sein, es würde mich nicht überraschen, wenn Sie Recht hätten. Ich habe mir das noch gar nicht überlegt, aber jetzt haben Sie mich auf etwas gebracht, ich glaube, Sie haben Recht. Und ich denke weiter, was für ein schönes Bild, was für eine auserlesene Lüge, das hier werden sie lesen, dieses Bild werden sie sich aneignen, alle, die mich im tiefsten Herzen hassen, den Wohnhai in spe, der Angst hat, mitten zwischen den warmen Kuhleibern sterben zu müssen, ganz zu schweigen von dem Kalb, bestimmt hatte er die Arme um den Hals des Kalbes geschlungen, der kleine Knabe.
Ich habe jetzt die lange Strecke erreicht. Die Fünfundvierzigminutenstrecke, die mich von Hoheluft durch die Schlankreye über den Schlump zum Hafen führt, zur grauen Elbe hinunter, zu meinem Büro, zum Schauplatz meiner täglichen Fron. Langsam machen die Endorphine sich bemerkbar, ich gleite in den guten, leicht berauschten Rhythmus, von dem ich in gewisser Weise inzwischen abhängig bin. Es kommt vor, dass es mich überkommt, wenn ich zum Beispiel im Fernsehen einen Film sehe oder die Zeitung lese, dass ich dann denke, jetzt muss ich los, ich bin sogar schon mitten in der Nacht aufgestanden und einfach nur gegangen und gegangen und gegangen. Warum also mache ich dem unbequemen Sessel eigentlich Vorwürfe? Der hat mich wahrscheinlich vor mindestens einem Infarkt gerettet, vielleicht auch vor einem Schlaganfall, ohne diesen Sessel könnte ich längst tot sein, ohne die von ihm produzierten Rückenschmerzen. Die Sonne steigt und mit ihr die Temperatur. Ich bin nicht an Hitze gewöhnt, ich bin gewöhnt an den Umgang mit den kalten Winden von der Nordsee, mit Regen, Regen, Regen, Springflut und Orkan, und jetzt merke ich, auf halbem Weg zum Hafen, jetzt fühle ich, dass wir heute einen vorläufigen Rekord aufstellen werden, heute wird Gott der Herr die Temperatur auf vierzig hochdrehen. Ich öffne meinen Schlips, stecke ihn in die Jackentasche, ich ziehe die Jacke aus, trage sie über der Schulter, sie hängt an meinem rechten Zeigefinger. Der Schweiß strömt aus meinen Achselhöhlen, es ist unmöglich, bei dieser Hitze elegant bleiben zu wollen, es ist mir ein Rätsel, warum ich das überhaupt versuche.
Ausblick
In der Rezeption sitzt Bernt Pech. Er sitzt so da wie der alte Mann im Innocentia Park, zurückgelehnt, ein Bein über das andere geschlagen, er wippt mit dem Fuß und starrt mit leerem Blick den Computerbildschirm an. Ein kleiner Mann mit schütteren Haaren unter dem riesigen Bild von Glomser, dem Ölgemälde, das Tjade Glomser im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg gemalt hat, es zeigt einen Tanker im Dock von Blohm & Voss. Bernt Pech hat schon lange vor meiner Zeit hier im Hause unter diesem Gemälde gesessen.
»Guten Tag, Herr Pech«, sage ich. Wir duzen uns auch nach allen diesen Jahren noch nicht. Ab und zu spiele ich mit dem Gedanken, ihm das Du anzubieten, aber diesen Gedanken verdränge ich dann sofort wieder, es würde ihn erschüttern, so ein Vorschlag würde ihn bis ins Mark erschüttern.
»Guten Tag, Herr Mader. Heute wird es wieder heiß, ja, noch heißer, haben sie im Radio gesagt. Und in Madrid schneit es. Was ist denn bloß los?«
»Niemand weiß, was los ist«, sage ich und strecke die Hand nach Zeitungen und Post aus. Jetzt ist Pech für diese Dinge zuständig, nachdem ich die Neue Ordnung eingeführt habe, die in den anderen Büros hier im Haus und in den umliegenden Redaktionen leicht ironisch als »der dramatische Rationalisierungstrick« bezeichnet wird. Es ist dramatischer, als sie denken, egal, wie viel sie wissen und ahnen.
Er mustert meine Achselhöhlen, natürlich tut er das, er sieht die Schweißringe, die bis zur Mitte der Rippen reichen, dann wendet er sich ganz schnell ab, denn das war ein unprofessioneller Blick, und das weiß er.
»Ich bringe gegen Mittag alles nach unten«, sage ich. Es ist jetzt jeden Tag dasselbe. Anzug und Hemd in die Reinigung. Ich habe vier Garnituren in ständiger Rotation zwischen zu Hause, Büro und Reinigung.
Er nickt. »Der Hellgrüne hängt oben.«
Wieder und wieder habe ich gesagt, dass er das Paket aus der Reinigung hier unten behalten kann, dass er es nicht heraufzubringen braucht, dass ich es selbst mitnehmen kann, aber es bringt nichts, er ist eine Dienernatur.
Im Fahrstuhl nach oben, während ich abwechselnd das schweißnasse Hemd im Spiegel und die wechselnden roten Zahlen betrachte, habe ich eine Vision. Ich stelle mir vor, wie der Fahrstuhl den neunten Stock erreicht, dann aber einfach weiter und weiter fährt, das Dach durchbricht wie eine Mondrakete und mit gewaltigem Gebrüll in den Kosmos hinausfliegt. Major Tom to ground control, und dann löst sich alles auf, ich und die Fahrstuhlrakete, und alles wird zu Farben, Farben, die miteinander verschwimmen. Ist es gesund, so viel zu laufen, wenn es so heiß ist wie jetzt? Ich schließe die Augen. Bald darauf höre ich, wie die Fahrstuhltüren sich öffnen, und ohne die Augen zu öffnen, gehe ich hinaus auf den Gang. Nicht ein Geräusch. Mit der rechten Hand ziehe ich die Schlüssel aus der Hosentasche, mit der linken suche ich die Wand, taste danach und finde sie. Finde dann die richtige Tür. Der Schlüssel gleitet so wunderbar leicht ins Schloss, ja, diese Sache mit Metall in Metall spricht mich an, Metall, das zu Metall passt, Perfektionsarbeit, dass alles stimmt, zumindest hier, der Schlüssel im Schloss zu meinem Büro.
Ich gehe hinein und höre, wie die Tür hinter mir zugleitet.
Dann öffne ich die Augen.
Also, was soll man sagen? Dass die Zeit vergeht und alles sich verändert? Hier hingen die Mäntel. Hier hingen die Jacketts. Die Türen zu Küche und Toilette stehen offen, ich kann die nackte Tischplatte vor dem Fenster und einen Teil des Kühlschranks sehen. Auch die Doppeltür zur weiten Bürolandschaft steht offen. Es ist so still. Nur die elektrische Klimaanlage rauscht leise. Fast so, als schwebte ich in einem Ballon zweihundert Meter über den Hausdächern. Ich lege Post und Zeitungen ins Regal, hänge die Jacke auf, knöpfe mein Hemd auf und lasse es auf den Boden fallen. Ich ziehe mich aus und gehe in die Küche. Der Kühlschrank ist gefüllt mit Bier und Mineralwasser, vor allem Mineralwasser. Es bringt nichts, vor Sonnenuntergang Bier zu trinken, am besten ist es, überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Alle paar Tage teilen Renate und ich eine Flasche Rosé, immer nach zehn Uhr abends. Ich trinke große Schlucke aus einer bereits geöffneten Flasche, wenig Kohlensäure, aber eiskalt. Dann gehe ich mit der Flasche in der Hand ans Fenster, o Herrgott, dieser Ausblick, von dem ich nie genug bekommen kann, ich bekomme ihn niemals über, ab und zu träume ich nachts davon, oder ich sehe ihn vor mir, wenn ich die Augen schließe, egal, wo auf der Welt ich mich befinde, in London, Paris, New York oder zum Beispiel in Rødby oder in der Lüneburger Heide. Ich brauche bloß die Augen zu schließen, dann taucht die Elbe auf, die Docks, der überdimensionale Metallwald aus Kränen, ab und zu denke ich an Bäume, an Wald, andere Male an Dinosaurierskelette, Imitationen aus Stahl, die Löcher in den Himmel reißen, der jetzt diesig ist, der im Winter jedoch nachmittags die seltsamsten Farben zeigt, von orange bis seegrün, königsblau, rot wie Blut. Und unten, auf der anderen Seite des Johannisbollwerks, die urbane Uferpromenade mit der wogenden Menschenmenge, den vertäuten Fahrzeugen, den schwimmenden Restaurants, den Schleppern, Fähren, und über dem Johannisbollwerk, auf dem Rücken einer kilometerlangen Stahlkonstruktion über dem dichten Autoverkehr, die U 3, die U-Bahn-Linie 3, von Barmbek ins Zentrum, oder vom Zentrum nach Barmbek, Abfahrt alle vier Minuten. Eine endlose Schlange aus Wagen, hin und her, her und hin, vom frühen Morgen, bis es fast wieder Morgen ist. Tausende von Gesichtern hinter den Fenstern, und ich denke: Hinter diesen Gesichtern, hinter jedem einzelnen Gesicht gibt es so viele Gedanken und Vorstellungen, so viel Haß, so viel Gebete um Liebe und Glück, es ist so leicht, sich in Träumen zu verlieren, sich in alles Mögliche hineinzuträumen, wenn man hier oben steht.
Die Dusche hat Klaus Klaasen durchgesetzt, das muss man ihm lassen, sollte ich wohl sagen, da es fast unmöglich ist, sich vorzustellen, wie es jetzt ohne Dusche hier wäre. Als wir aus dem engen Büro am Jungfernstieg hergezogen sind, bestand er darauf, dass wir in der größeren Personaltoilette eine Dusche einbauen müssten, dort sei Platz genug. Ich sagte Nein, ich fand, wenn die Leute ins Büro kämen, dann kämen sie doch meistens aus der Dusche. Die anderen Angestellten waren seiner Meinung, aber ich war meiner Sache sicher, wie immer, wenn ich die Mehrheit gegen mich habe, und es gab keine Dusche. Aber dann gab es doch eine, aus Gründen, die in diesem Bericht nichts zu suchen haben, ich begnüge mich mit der Bemerkung, dass Klaus Klaasen und die übrigen Angestellten wenn nicht Recht hatten, dann doch zumindest nicht ganz Unrecht, und dass ich jetzt, bei dieser grausamen Hitzewelle, eine gewisse, nein, eine große Freude darüber verspüre, dass sie sich durchgesetzt haben. Also gehe ich unter die Dusche, die damals so umstrittene Dusche, drehe das kalte Wasser auf, das durchaus nicht kalt ist, sondern eher pisswarm, und schwebe in meinen Gedanken wieder über die Hausdächer. Es geht um diese Ballonfahrt vor fünf Jahren, ich stehe da und mich interviewt Vera von Halle vom Hamburger Abendblatt, und ich bin kurz davor, mich zu bepissen, die Lage ist jetzt ernst, der Augenblick der Wahrheit rückt näher. Und während sie Notizen macht, während Vera von Halle schreibt, signalisiere ich dem Wuuuschmann, gebe ihm ein Signal (hochgezogene Augenbrauen, ein in Richtung Penis zeigender Finger), eine Hinwendung von Mann zu Mann, über ein praktisches Problem körperlicher Natur, das eine Lösung finden muss. Er zeigt auf einen Eimer. Kommt nicht in Frage, ich schüttele den Kopf, nein, nein, nein, das ist einfach ausgeschlossen, hier in einen Eimer zu pissen, in Gesellschaft von Vera von Halle vom Abendblatt, nicht, wenn man Thomas Mader heißt, das geht einfach nicht. Andererseits kann ich mir auch nicht in die Hose pissen, das geht auch nicht, in beiden Fällen würde sie es sehen, eine Stunde nach der Landung würde die ganze Stadt davon wissen, schneller, als sie in der Zeitung darüber schreiben könnte. Stell dir vor, Thomas Mader hat da oben in einen Eimer gepisst, er hat sich einfach in die Hose gepisst, der mächtige Thomas Mader. Aber dann, als freundliche Geste Gottes, sehe ich die Lösung selber, sehe ich eine Möglichkeit, mich ehrenhaft aus der Klemme zu ziehen. Der Bastkorb, in dem wir uns befinden, hat einen Spalt in fast der richtigen Höhe. Ich gebe meinem Freund, dem Wuuuschmann, noch ein Zeichen, doch er zuckt nur mit den Schultern und lächelt. Ich zeige irritiert auf die Journalistin, zeige auf Vera von Halle, kapiert er denn nicht, begreift er nicht, dass wir hier zusammen tätig werden müssen, dass ich ihn brauche? Doch. Als Vera von Halle sich mit einer neuen Frage auf den schmalen Lippen zu mir umdreht und ich kurz vor dem Aufgeben, der Kapitulation bin, packt der große Mann, der Wuuuschmann, der Kapitän, ihre linke Schulter, kommen Sie, ich muss Ihnen etwas zeigen, sehen Sie nur! Blitzschnell ergreife ich die Gelegenheit beim Schopfe, denn ich habe nur diese eine Chance, öffne meinen Hosenschlitz und ziehe meinen Schwanz heraus. Ich muss mich auf Zehenspitzen stellen, um ihn durch den Spalt im Bastkorb zu bugsieren. Es ist schrecklich unbequem, aber das hilft nichts, ich lasse es laufen, lasse den Strahl los, da stehe ich und pisse auf die Stadt, pisse auf die Stadt unter mir. Und es will einfach kein Ende nehmen. Es gibt kein Ende. Aus dem Augenwinkel sehe ich meinen Freund zeigen und erklären, und Vera von Halle reckt den Hals. Ich stehe da auf Zehenspitzen und beuge mich über den Bastkorb und gebe vor, die Aussicht zu bewundern, die ganze Zeit mit dem Schlauch draußen im Wind, dem Strahl, der sich nach etwa einem Meter auflöst, sich in Tropfen verwandelt, große Tropfen, die zu kleineren zerrissen werden, Urin, der auf dem Boden landen wird, auf Häusern und Menschen, als feiner Nieselregen. Nun gut. Er gibt sich alle Mühe, ich kann ihm keine Vorwürfe machen, aber nach ein oder zwei Minuten ist dort unten einfach nichts mehr, was Vera von Halles Interesse fesseln könnte. Sie hat eine Aufgabe zu erledigen, sie ist hier oben, um mich zu interviewen. Deshalb kehrt sie an ihren Platz zurück, wo sie sich zum Glück von mir abwendet (der Wind weht ihr die Haare ins Gesicht), als sie den Faden wieder aufnimmt, und ich stehe da und pisse und pisse und äußere mich über mein Studium in Hamburg und Zürich. Das geht gut. Ich erzähle zwei Anekdoten aus dieser Zeit, die sie zum Lachen bringen, und als meine Blase endlich leer ist, zeige ich in die Luft, und sie richtet den Blick auf etwas, was sie vielleicht für ein Flugzeug oder einen seltenen Vogel hält, während ich die Absätze in den Boden des Korbes bohre und den Schwanz einhole, meine Ehre rette. Den Reißverschluss kann ich immer noch hochziehen, im Moment hat das Zeit, ich bin jetzt so erleichtert, dass ich ein Lied anstimme. Und ich bin ein guter Sänger, ich habe einen klangvollen Bariton, das hat sie nicht gewusst, das weiß fast niemand, und ich lese Überraschung in ihrem Blick, Überraschung und Anerkennung, als ich »Wir lagen vor Madagaskar« singe, von Anfang bis Ende, ohne auch nur eine einzige Strophe zu überspringen. Das wird ein schönes Sonnabendporträt, denke ich an jenem Sommermorgen vor fünf Jahren, mehrere Tage ehe mir aufgeht, dass der Wuuuschmann ein Klatschvetter ist.
Ich verlasse die Dusche und gehe in die Küche, ohne mich abzutrocknen, öffne eine neue Wasserflasche und gehe weiter ins Büro, das fast überwältigend wirkt, seit ich die früheren Angestellten, ihre Schreibtische, Schreibtischsessel, Computer und anderen Müll ausgeräumt habe. Ich habe nur meine eigenen Büromöbel in der gegenüberliegenden Ecke des Raumes behalten, dazu die Sitzgruppe aus Leder, den Fernseher, den Großbildschirm. Außerdem habe ich eine Stereoanlage Marke Bang & Olufsen installiert, sie hat ungefähr dasselbe gekostet wie eine Kreuzfahrt einmal um die Welt.
Und während ich triefend über das Parkett wandere, die Wasserflasche in der Hand und immer weiter tropfend, träume ich, dass alles noch so ist, wie es war, ja, vor meinem inneren Auge ist jetzt alles so wie früher. Ich sehe Klaus Klaasen und Catharina Mester in leisem Gespräch vor dem Schreibtisch der Letzteren stehen, Klaus mit dem roten Becher in der Hand, immer diesen roten Becher, Kaffee, literweise. Catharina hat den Kopf schräg gelegt und sieht zu ihm auf, sie sind vertraulich, obwohl sie meines Wissens nicht miteinander schlafen, aber sie duzen sich und haben auch privat miteinander zu tun. Sie plaudern, ehe es mit der Arbeit losgeht, und es kann vorkommen, dass sie über ein Theaterstück sprechen, das sie am Wochenende gesehen haben, vielleicht haben sie sich im Schauspielhaus »Ein Mittsommernachtstraum« angeschaut, mit Gatten und Gattin natürlich, oder sie waren zum Beispiel im Kino. Ich sehe auch Beate Ullrich, nein, sie ist nicht mit Jan verwandt, dem berühmten Radsportler (sie hat diese Frage ja so satt), ich sehe sie jetzt deutlich vor mir, so, wie ich sie an mehreren tausend Morgen gesehen habe, Beate Ullrich, schon in die Zahlen vertieft, gebeugt über den Computer in dieser schrecklichen Arbeitshaltung, die wir ihr nicht abgewöhnen können. Rainer Wallach? Am Kopierer, um diese Tageszeit immer am Kopierer, das ist sein festes Morgenritual, er kann nichts anderes anfangen, solange er seine Schicht am Kopierer nicht absolviert hat, und wenn der ein seltenes Mal defekt ist, ist er glücklich, denn dann kann er ihn reparieren. Stephan Barnhold liest die Zeitung, er liest mit großer Würde die »FAZ«, breitbeinig im Sessel, die »FAZ« vor ihm aufgeschlagen wie ein Segel, und als ich hereinkomme, faltet er sie lächelnd zusammen. Ich grüße. Guten Tag, Herr Klaasen, guten Tag, Frau Mester, guten Tag, Frau Ullrich, Herr Wallach und Herr Barnhold, ich wünsche einen guten Tag! So vergehen die Tage, die Wochen und die Jahre. Bis zu dem Tag, an dem ich ihnen kündige und alle ihrer Wege gehen, mit einem Händedruck, der so golden war, dass sie sich nur verbeugen konnten, kein Mucks von irgendwem, es war nicht billig, aber jetzt stehe ich nackt im Büro, habe eine alte Phantasie verwirklicht, ich bin splitternackt und habe sogar eine halbherzige Erektion beim Gedanken an Catharina Mesters Hintern. Das Telefon klingelt. Ich gehe hin, nehme das schnurlose Telefon und gehe damit ans Fenster. Ich drücke auf Grün und schaue hinaus auf die Elbe, ein Tanker fährt langsam nordwärts, und natürlich ist es Elisabeth.
»Hier ist Elisabeth«, sagt sie. »Ich habe versucht, dich zu Hause anzurufen.«
Dazu kann ich ja nicht viel sagen.
Mir fällt immerhin auf, dass meine heraufziehende Erektion einen Knick erlitten hat.
»Bist du noch da?«
»Natürlich bin ich noch da.«
»Wie gesagt, ich habe versucht, dich zu Hause anzurufen. Und per Handy.«
Sie weint.
»Na gut«, sage ich. »Ich gehe also davon aus, dass ich nicht zu Hause war. Und mein Mobiltelefon ausgeschaltet hatte.«
»Es geht ihm so schlecht, Thomas. Es geht ihm richtig schlecht, wirklich. Er liegt bloß da und …«
»Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Sie mich nicht duzen dürfen«, sage ich. »Solange Sie nur verlobt sind.«
»Ach, Herrgott! Lieber Herr Mader, Ihr Sohn ist krank. Er antwortet nicht, wenn ich ihn anspreche. Er schläft und schläft nur so, mit heruntergelassenen Jalousien. Schon seit über einer Woche.«
»Haben Sie bei ihm Fieber gemessen?«
Sie verstummt. »Soll das ein Witz sein?«
»Sie müssen versuchen, ihn zu wecken. Dann antwortet er vielleicht.«
»Sie müssen das ernst nehmen, Herr Mader! Das verlange ich ganz einfach von Ihnen. Wenn ihn diese Schwermut überkommt, dann ist die Lage ernst. Dann kann es schief gehen, und ich bin mit ihm allein.«
»Gut«, sage ich. »Dann setze ich mich ins erste Flugzeug nach Málaga. Versuchen Sie so lange, ihn zum Trinken zu bringen!«
»Können Sie mir bitte Renates Mobilnummer geben?« Das kreischt sie fast.
»Sie meinen Frau Mader?«
»Ich meine seine Mutter!«
»Nein«, sage ich. »Tut mir Leid. Nach zweiunddreißig Jahren als Bernhards Mutter hat sie sich endlich eine Geheimnummer zugelegt. Es wurde höchste Zeit, ja, es war möglicherweise sogar schon zu spät. Ich fürchte, unsere Ehe würde darunter leiden, wenn ich Ihnen die Nummer gäbe.«
Jetzt weint sie. »Aber was soll ich denn machen?«
»Lassen Sie sich einen guten Rat geben«, sage ich. »Jetzt packen Sie das Allernotwendigste in eine Tasche und verlassen die Wohnung. Und auf der Straße werfen Sie dann den Schlüssel so weit fort, wie Sie überhaupt können, und dann gehen Sie ganz schnell in die entgegengesetzte Richtung.«
»Na gut. Ich sehe ein, es war blöd von mir, an Ihre Gefühle appellieren zu wollen.«
»Blöd ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich würde eher sinnlos sagen.«
»Wie hat es nur so weit kommen können? Wie könnt ihr so … böse sein?«
»Wir wollen doch lieber über etwas anderes sprechen«, sage ich. »Wie ist denn die Wassertemperatur am Mittelmeer?«
Die Verbindung wird unterbrochen.
Schwermut! Dass ich nicht lache! Ja, jetzt lache ich tatsächlich dermaßen, dass es im fast leeren Büro widerhallt. Ich gehe zur Stereoanlage und lege »Seven days of falling« vom Esbjørn Svensson Trio ein, und Sekunden darauf strömt »Ballad for the Unborn« aus den Lautsprechern. Ich denke an die Abtreibung, zu der es leider nie gekommen ist, wir hätten ihn aus ihrer Gebärmutter kratzen sollen.