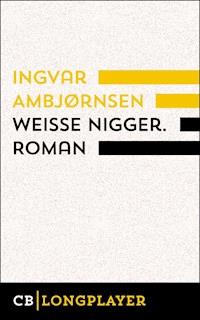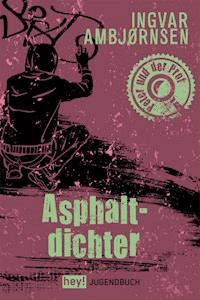Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der unnachahmliche Ambjørnsen-Sound in einem Setting wie von T.C. Boyle! In den Wäldern Nordnorwegens lebt eine wilde Gemeinschaft von Aussteigern, alten Hippies, Kleinkriminellen und verkrachten Existenzen: Sune, Ende 30, hat dort sein Revier, lebt von Fischfang und Jagd, quartiert sich in leerstehenden Ferienhäusern ein, hinterlässt den Besitzern Nachrichten und streicht zum Dank dort auch schon mal eine Wand. Jan und Wanda betreiben einen Biobauernhof und gehören außerdem zu einem Netzwerk, das abgelehnten Asylbewerbern weiterhilft. Über dieses Netzwerk läuft dem verwilderten Sune eine junge Vietnamesin zu: Vale, eigentlich Minh Hai, die zwei Männer zu vergewaltigen versucht haben. Vale hat sich heftig gewehrt, einen der Männer getötet und den anderen sowie sich selbst schwer verletzt. Die Polizei sucht Vale und auch Sune, den man bei einem Bootsdiebstahl beobachtet hat. Beide müssen weg aus dem Revier … Mit diesem Roman knüpft Ambjørnsen an sein fulminantes Debüt "Weiße Nigger" an und erreicht eine neue Höhe seiner literarischen Qualität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ingvar Ambjørnsen
DIE NACHTTRÄUMT VOM TAG
Roman
Aus dem Norwegischenvon Gabriele Haefs
Die Originalausgabe des vorliegenden Bucheserschien unter dem Titel Natten drømmer om dagenbei Cappelen Damm, Oslo 2012
Die Übersetzung aus dem Norwegischenwurde durch NORLA finanziell unterstützt.
Die im Roman zitierten Passagen vonJ. Anker-Poulsen wurden vonGabriele Haefs ins Deutsche übertragen.Die Zitate von Cecilie Løveid stammenaus dem Gedichtband Gartnerløs(Kolon, Oslo 2007), mit freundlicherGenehmigung der Autorin, undwurden ebenfalls von Gabriele Haefs insDeutsche übersetzt.Die Passagen aus Karl Ove Knausgård,Alles hat seine Zeit, wurden zitiert nach derÜbersetzung von Paul Berf (btb, 2009).Die Krimis von Alexander Irgensentstammen der Phantasie des Autors.
Edition Nautilus Verlag Lutz SchulenburgSchützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburgwww.edition-nautilus.deAlle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2013Deutsche Erstausgabe Februar 2014Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburgwww.majabechert.deDruck und Bindung:Freiburger Graphische Betriebe1. AuflagePrint ISBN 978-3-89401-788-0E-Book EPUB ISBN 978-3-86438-150-8E-Book PDF ISBN 978-3-86438-151-5
Inhalt
Teil I September 2010
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Teil II
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Das Leben in meiner Brust war eine ganz besondere Welt,ein eigenes Blut, ohne Verwandtschaft mit den anderen.
Halldor Laxness
Teil ISeptember 2010
1
In der Dämmerung kam ich aus den weiten Mooren, und als ich abwärts ging und mich Veggli näherte, sah ich zwischen den Zwergbirken das Dach der Hütte; es war bedeckt mit Grassoden und herbstfarbenem Moos. Ich wartete, bis es ganz dunkel geworden war. Dann verschaffte ich mir Zutritt auf die beste Weise: mit dem Schlüssel, den ich unter dem Stein vor der Tür fand.
Da verstecken sie ihn ja gern. Da, oder oben auf der Türleiste oder unter großen Blumentöpfen, falls sie solche draußen stehen haben. Es gibt noch ein Dutzend andere Verstecke. Ich kenne sie alle.
Ich blieb ganz still im Windfang stehen, nachdem ich die Tür aufgeschlossen hatte. Es roch nach Tannenholz und grüner Seife, aber nicht nach Menschen. Es war eine Hütte nach meinem Geschmack. Schlicht und übersichtlich. Zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit einer Kochecke. Ein kleines Badezimmer ohne Dusche. Im Wohnzimmer ein offener Kamin.
Ganz still. Nur der Wind in den Bäumen; jetzt, gegen Abend, legte er sich. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, für einige Minuten so stehen zu bleiben und zu horchen. Mich mit dem Ort vertraut zu machen.
Ich hatte Hunger. Ich wusste, dass mir eine wache Nacht bevorstehen würde, wenn ich nichts zu essen fände.
Auf dem Küchentisch stand ein Messingleuchter mit einem Kerzenstummel, ich zündete die Kerze mit dem Zippo an. Ging dann mit der Kerze zum Küchenschrank an der Wand. Dort war nicht viel zu holen, nur einige trockene Kekse und Teebeutel, aber im unteren Schrankteil fand ich Konservendosen und zwei Tüten Kartoffelpüree.
Ich machte Feuer im Kamin und drehte dann weiter meine Runde. Eine halbvolle Flasche Calvados in einem Eckschrank. Vier Pils in dem winzigen Keller unter der Kochnische.
Mir stand ein guter Abend bevor.
Diesmal hatte ich lange durchgehalten. Es kann gut sein, dass sie glaubten, jetzt hätten sie mich. Den ganzen Winter und Frühling. Den ganzen Sommer. Aber als die Schule anfing, wurde ich in einen anderen verwandelt, und dann ging ich einfach. Jetzt stand halb Hüttennorwegen leer. An den Wochenenden musste ich ein bisschen aufpassen. Ansonsten war alles offen. An diesem Tag war ich durch das Gebirge gegangen und später durch die Moore hinunter ins Tal, und der einzige Mensch, den ich gesehen hatte, war mein Spiegelbild, wenn ich an einem Bach meinen Durst löschte. In so tiefer Einsamkeit unterwegs zu sein, machte mich glücklich. Es machte mich zu dem, der ich sein wollte.
Und alle diese leeren Räume, die nur dastanden und auf mich warteten … Sie zogen mich heftig an, ich konnte nicht die richtigen Worte finden, wenn ich danach gefragt wurde. Danach, warum ich es nicht lassen konnte.
In mir war etwas, das in ihnen nicht war.
Ich aß. Frikadellen in brauner Soße mit Kartoffelpüree. Ich hatte kaltes Wasser aus dem Bach mitgebracht. Später würde ich Calvados trinken, aber nur wenig.
Nach dem Essen rauchte ich erst einmal.
Ich dachte, jetzt hätten sie mich sehen sollen. Und dann: Jetzt sehen sie mich nicht mehr. Jetzt bin ich im Verborgenen. In dem, von dem ich nicht will, dass sie es begreifen.
Aus dem Hüttenbuch:
1. September 2010
Svend und ich sind seit dem vorigen Freitag hier. Nur wir beide. Svend hat sich um das Holz gekümmert, und ich habe so gut ich konnte versucht, in der Wildnis hinter dem Schuppen Ordnung zu schaffen. Das Wetter war die ganze Zeit gut, wenn auch kühl nachts, wir mussten die Heizkörper im Schlafzimmer einschalten. Es ist ein trauriger Gedanke, dass die Kleine nie wieder mit uns herkommen wird!
Siw
Siw. Ich gehe in den Windfang. Dort hängt eine Strickjacke, an der ich ein wenig schnuppere. Wald. Und an einem Nagel: ein Schlüssel an einem Bindfaden, mit einem Holzschildchen, auf dem »Schuppen« steht. Als ich auf die Türschwelle trete, merke ich, dass der Wind sich gelegt hat, aber jetzt höre ich stattdessen das Rascheln winzig kleiner Regentropfen, die auf Blätter und Gras fallen. Im Schuppen finde ich Svends sorgfältig vom Boden bis zur Decke aufgestapeltes Holz, dazu die Axt im Hackklotz. Eine kleine Motorsäge, Öl und Benzin, jeweils in einem Plastikkanister. Ich trage acht bis zehn Holzscheite ins Haus, dann habe ich alles, was ich heute Abend brauche. Ich brauche mir auch sonst keine Sorgen zu machen. Das ist so ein Ort. Sicher. Hier oben im Tal liegen die Hütten weit auseinander. Und noch seltener sind die Menschen um diese Jahreszeit.
Der Apfelschnaps ist wunderbar. Ein runder, feiner Geschmack. Ich lasse ihn in der Mundhöhle ruhen, ehe ich ihn hinunterschlucke. Trinke immer nur einen winzigen Schluck. Ich habe irgendwo gelesen, dass die französischen Bauern den Calvados nur aus den sauersten Apfelsorten herstellen. Dennoch scheint es ihnen gelungen zu sein, das Sonnenlicht zu destillieren.
Es gibt hier keine Bücher. Das ist so in manchen Hütten, aber es kommt selten vor. Im Hüttenbuch steht nur Gefasel. Das ist in der Regel so. Ich sitze da und rauche und lese alte Illustrierte, sie stammen vom Beginn der achtziger Jahre und sind gefüllt mit Berichten, die angeblich von der Wirklichkeit normaler Menschen handeln. Ich bringe das nicht. Es ist doch immer dasselbe. Drogen. Untreue. Ungewollte Schwangerschaften.
Ich lese die Comics und beschäftige mich ungefähr eine Stunde lang mit Kreuzworträtseln.
Danach denke ich an Siw. Die mit dem w meine Assoziationen in Richtung Schweden losschickt. Auch wenn die Zeilen im Hüttenbuch keinen Zweifel daran lassen, dass sie Norwegerin ist. Ich denke, dass sie hier gesessen hat. Ich denke immer so. An die Frauen, die vor mir hier waren. Ich weiß nicht, warum das so ist, und es interessiert mich auch nicht.
Als ich schlafen gehen will, bleibe ich im Schlafzimmer stehen und mustere die beiden Betten. Versuche zu erraten, wer wo schläft. Das andere Schlafzimmer ist für Gäste, es gibt keine Bettwäsche. Die nackten Decken sind zusammengefaltet. Hier, im Zimmer, das dem Wohnzimmer und der Wärme näher ist, ist das Bett bezogen. Blaue und weiße Karos. Zwischen den schmalen Betten steht ein einfacher Nachttisch. Den teilen sie sich. Die Schublade ist leer. Geleert. Nur ein gelber Knopf, vermutlich von einem anderen Bettbezug.
Ich setze mich vorsichtig auf das rechte Bett. Hier. Das ist Siws Bett. Ein schwacher Parfümduft, als ich das Gesicht in das weiche Kissen schmiege.
Ich bin total erledigt. Zum Umfallen müde.
Trotzdem liege ich noch eine Weile wach. Das ist immer so in der ersten Nacht an einem neuen Ort. Offenbar muss mein Gemüt sich auf die Hütte und die Landschaft einstimmen. Ich liege in der Dunkelheit und spüre, wie der Schlaf sich anschleicht, es ist wie ein schwerer Rausch, der durch mein Blut zieht, ich weiß, wenn ich hineinsinke, wird er sein wie warme feuchte Wolle; ich nenne ihn »Morphiumschlaf«, auch wenn gerade dieser Schlaf die reinste, gesündeste aller Varianten ist, hervorgebracht durch viele Stunden mit dem Rucksack auf den Schultern.
Hier liege ich nun und erlebe wieder diese Landschaft, durch die ich gegangen bin. Die Herbstfarben oben in den Bergen und weiter unten an den Hängen. In diesem Herbst hat es viel geregnet, ja, seit Mitte August, überall raunen Bäche und Wasserfälle. Heute hatte ich meistens Sonne, und Wald und Moore dampften, der Wind hatte die tiefhängende Wolkendecke aufgerissen und die Wolken wie veränderliche Flickenteppiche die Hänge hochgejagt, halb durchsichtige Phantasiefiguren, zaubrisch und wundersam.
Aber Vögel habe ich fast nicht gesehen oder gehört. Auch darüber denke ich nach. Dass es ein stiller und seltsamer Tag war.
Ich denke nicht an die Stadt. Wenn Bilder aus der Stadt kommen, verdränge ich sie. Das ist überhaupt nicht erstaunlich. Es ist einfach. Die Bilder, die ich an mich heranlasse, sind die, die ich aus der Zeit holen kann, in der ich unterwegs war. Oder Vorstellungen dessen, was mich erwartet. Und natürlich pure Phantasien.
Ich kann sie doch in der Bettwäsche riechen, wenn ich so hier liege.
Am nächsten Tag schlafe ich lange, ab und zu bin ich halb wach, ich lausche einige Sekunden lang auf Stimmen, dann versinke ich wieder im Schlaf. Aber um elf Uhr stehe ich auf. Mir fehlen Eier. Und Brot. Immer fehlt einem irgendwas. Das ist eine gute Übung. Das Schlimmste ist, wenn einem alles fehlt. Das aber passiert mir nur selten. Ich lasse das Wasser kochen, und während der Tee zieht, esse ich eine halbe Dose Bohnen in Tomatensoße. Es gibt noch drei. Und eine Dose dicke Fleischsuppe. Ich kann noch einen Tag und eine Nacht hier bleiben. Mindestens. Das macht sich bezahlt. Ruhe zu halten und alles aufzuessen. Es bringt einen schönen Rhythmus, an den ich mich halten kann, so von Hütte zu Hütte. Etwas gibt es fast überall. So ist eben der Hüttennorweger. Er ist ein Eichhörnchen. Ein Kleiber. Ein Sammler.
Aber mir fehlt etwas Brauchbares zu lesen. Allerdings lässt sich auch dafür meistens Abhilfe schaffen.
Ich gehe mit dem Teebecher auf die Veranda. In der nächtlichen Dunkelheit hat die nicht viel hergemacht, aber für mich allein wirkt sie geräumig.
Der Wald dampft. Es wird ein warmer Herbsttag werden. Durch die Zweige sehe ich einen kleinen See glitzern, vielleicht ist es nur ein Tümpel.
Von hier aus kann ich die Dächer von zwei weiteren Hütten weiter unten am Hang sehen. Ich stelle den leeren Becher auf einen niedrigen Schiefertisch und gehe fünfzig Meter den Hang hoch. Lehne mich an die Felswand und zünde die erste Zigarette an. Ich sehe zweihundert Meter weiter im Osten eine weitere Hütte.
Also drei. Da muss ich mich mal umschauen.
Hier oben sind jetzt keine Menschen. So etwas spürt man. Bei so etwas habe ich mich noch nie geirrt.
Es gibt reichlich Pilze. Vor allem Steinpilze und verschiedene Milchlinge. Ich sammele meinen Hut voll, dazu eine halbe Papiertüte mit dicken Blaubeeren.
Ich stelle mein Mittagessen auf den Küchentisch.
Dann drehe ich meine Runde.
Ich hatte im Halbdunkel am Vorabend Glück. Keine der drei Nachbarhütten ist eine Schlüsselhütte. Ich suche nie länger als zehn Minuten. Wenn ich in dieser Zeit den Schlüssel nicht gefunden habe, ist es wenig wahrscheinlich, dass er überhaupt vorhanden ist.
Von mir aus. Ich will da jetzt ja auch gar nicht rein.
An diesem Abend nehme ich mir die eine vor, und die beiden anderen sind morgen früh an der Reihe. Danach werde ich so weit in Richtung Notodden gehen, wie ich überhaupt nur kann.
2
Ich schwebe. Ich schwebe in einem Weiher unten auf der Erde, und über mir wölbt sich der Himmel mit dahintreibenden Schönwetterwolken. Hoch über allem anderen Leben liegt ein Mäusebussard in der warmen Luftströmung, die noch immer aus dem Septemberwald aufsteigt, von Fels und Stein, die der Sommer aufgewärmt hat.
Ich säubere mir die Nägel mit einem spitzen Stöckchen, das ich aus einem Bach gefischt habe. Entferne schmale grüne Ränder. Ich habe mir ein kaltes Bier aus dem Keller geholt, und dort habe ich einen halben Eimer Farbe gefunden, dazu Rollen, die in einem großen Eimer eingeweicht waren.
Warum nicht? Ich habe den ganzen Tag, und der Südwand könnte eine Farbschicht nicht schaden. Ich brauche drei Stunden, und dann kann ich auf der Veranda sitzen, mit kellerkaltem Bier und Drehtabak, wie ein ganz normaler Arbeiter. Oder zum Beispiel wie ein Neffe, der hier oben ist, um für ein Examen zu büffeln, und der sich vielleicht ein wenig nützlich machen will. Ich kenne diesen Neffen ziemlich gut. Ab und zu ist es gar nicht schlecht, ihn zu haben.
Es ist kalt. Ich muss mich dazu zwingen, im Wasser zu bleiben. Es ist ein reiner, feiner Zustand an der Grenze zum Schmerz. Zu Mittag habe ich gebratene Pilze mit Sand und gehackten Kräutern gegessen. Gebirgsminze und Fieberklee. Die Blaubeeren müssen noch warten. Ich habe Zucker – und noch immer einen guten Schluck Calvados.
Ich drehe mich auf den Bauch und schwimme acht bis zehn Züge durch diese kleine Pfütze. Vielleicht dreißig Meter. Als ich ausatme, schaue ich in die stumme Finsternis unter mir. Ich weiß, wie es dort unten auf dem Grund aussieht. Vor langer Zeit versunkene Baumstämme, gesättigt vom Wasser, unbekannte Tiefen aus Schlamm und altem Moor. Und das Sonnenlicht, das jetzt den Wasserspiegel zum Glitzern bringt, als ich hindurchbreche und meine Lunge mit neuer Luft fülle. Vogelsang. Die summende Geschäftigkeit der Insekten. Danach stehe ich nackt auf einer schwimmenden Halbinsel aus Grassoden und spüre, wie der Boden unter mir wogt. Ich reibe mich mit zwei Handtüchern ab, die ich von Siw geliehen habe. Lege den Deckel zurück auf den Seifenbehälter.
Und dann höre ich aus weiter Ferne den Donner. Ich sehe nicht die geringste dunkelblaue Wolke, aber der Donner ist da.
Als die Dunkelheit kommt, nehme ich die Hütte, die am weitesten entfernt liegt. Vielleicht dreihundert Meter Weg durch den Wald. Wenn es hier oben dunkel ist, ist es so gut wie ausgeschlossen, dass noch irgendwer herkommen wird. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Es ist weit zum Parkplatz. Hierher kommen nur echte Hüttenmenschen. Sie tragen ihre Nahrung auf dem eigenen Rücken den Hang hoch. Ich gehe mit der Kopflampe durch den Wald. Der blauweiße Lichtstrahl tanzt in den Blättern und über die schwarzen Stämme.
Ich mache es kurz und bündig. Ich verpasse dem Schloss eine mit Svends Axt. So, wie das hier ist, wäre es Unsinn, lange daran herumzufummeln. Und nur betrunkene Jugendliche schlagen Fenster ein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wieder bleibe ich hinter der Tür ganz still stehen. Hier führt sie direkt ins Wohnzimmer. Ich habe es heute schon durch das Fenster gesehen. Und hier gibt es ein Bücherregal.
Aber zuerst gehe ich alle Schränke und Schubladen durch. Keine Waffen irgendwelcher Art. Zwei schöne Messer, die lasse ich liegen. Messer gibt es überall.
Im Geräteschuppen, der hier in der Hütte eingebaut ist, hängt ein Räucherschinken. Den schneide ich ab und verstaue ihn in meinem Leinenrucksack. Ich nehme auch eine kleine Schachtel mit selbstgebundenen Fliegen mit. Die sind gut gelungen. Wer die gemacht hat, ist wirklich tüchtig.
Konserven: Ich sacke zwei mittelgroße Dosen rote Bohnen ein. Im Büffet gibt es eine große Weinauswahl, ich lasse alles stehen, nehme mir aber eine Flasche Morgan Rum, von der erst ganz wenig getrunken worden ist. Ich schleppe nur Schnaps durch den Wald und über die Berge.
Das Bücherregal ist eine Enttäuschung. Krimis und alte Ausgaben des Straßenatlas Norwegen.
Und eine kleine Biografie von Harald Schönhaar. Das Titelbild stammt von Erik Werenskiold und zeigt, wie König Gryting nach dem Fiasko von Orkdalen vor König Harald geführt wird.
Dieses Buch nehme ich mit.
Ehe ich durch den Wald zurückgehe, schlage ich zwei sechszöllige Nägel durch die Tür und in den Türrahmen, damit nicht etwa Unbefugte aus einer Laune heraus hier eindringen können.
Später lese ich über Harald Schönhaar. Ich erfahre, dass er mit seiner Mutter Ragnhild auf einem der Höfe seines Großvaters in Sogn weilte, als sein Vater, Halvdan der Schwarze, im Randsfjord durch das Eis brach und ertrank. Ein Zug aus durchtrainierten Kriegern wanderte dann aus den Tälern von Valdres durch die Berge, um den kleinen König heimzuführen. Sie brauchten in jeder Richtung fünf Tage, denn es war Winter. Ich denke, diese Strecke kenne ich. Diese Strecke bin ich im Sommer gegangen, allein und mit wenig Gepäck. Fünf Tage. Gut gemacht, wenn es denn stimmt. Ob mit einem kleinen Knaben oder ohne.
Und ohne es zu wissen, habe ich einen Samen ausgestreut. Einen Keim.
In der Nacht trinke ich mehr als unbedingt nötig. Ich rede mit Fålme. Er ist für ein anderes Tempo geschaffen als ich. Wird von einer Unruhe getrieben, die mir fremd ist. Er will noch heute nach Westen. Ich bitte um eine Nacht Frist.
Ich träume mich in eine Stadt aus Eisen. Ich trage einen uniformähnlichen Mantel, blaugrau, knöchellang, er erinnert mich an den Ersten Weltkrieg, einen Verband trage ich noch dazu. Meine ganze linke Hand ist in blutige Lumpen gewickelt. Es ist kalt. Ich gehe über einen Bürgersteig aus rostigen Eisenplatten, die mit riesigen Bolzen und Schrauben am Boden befestigt sind, auf diese Weise werden auch die Häuser zusammengehalten, ich scheine mich durch einen gefrorenen Albtraum aus Eisen und Stahl zu bewegen. Und die Türen und Fenster sind zugeschweißt, alles verriegelt und verrammelt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nach einem Stück quicklebendigen Fleisches suche. Und dass ich hinein muss. Aber alles ist mit breiten Schweißnähten verschlossen, sie erinnern an Operationsnarben, verrostete Wundkrusten, und ich stolpere über Bolzen und Muttern, über unebene Fugen und Abschlüsse, ich komme nur mühsam voran, und es ist Nacht, ich suche nach lebendem Fleisch und nach Schutz vor einem elektrischen Wind, der um die Ecken peitscht, sodass der Funkenregen über die halbe Straße geschleudert wird.
Und ich habe große Angst vor etwas, von dem ich nicht weiß, was es ist, und das noch weiter weggetreten ist als ich selbst. Etwas, das sich mit gewaltiger Wucht bewegt. Es ist nicht Fålme, es ist etwas anderes, etwas Heftiges, Sonderbares.
Um kurz nach sechs breche ich die beiden anderen Hütten auf, in der ersten gibt es nur zwei Dosen Makrele in Tomatensoße, in der anderen finde ich in einem Kleiderschrank ein Schrotgewehr. Es ist eine nagelneue Beretta 686 Silver Pigeon.
Keine Muni.
3
Noch immer gibt es alten, unberührten Urwald. Es ist, wie eine lebende Kathedrale zu betreten. Nur die Erfahrungen der Zeiten, peinlich genau eingezeichnet in Jahresringen, verborgen hinter bärtiger Rinde. Hier in dieser Tiefe haust ein seltsamer zweigeschlechtlicher Geist, Tvi. Für dieses Wesen mache ich gern einen Umweg. Obwohl, was heißt schon Weg … Hier gibt es nur Tierfährten auf dem von dickem Moos bedeckten Waldboden.
Ich war schon in ziemlich jungem Alter hier. Ich bin dann viele Male wiedergekommen. Meistens in Gedanken. Wenn es Kampf und Streit gab. Oder nachts, wenn ich nicht schlafen konnte. Dann habe ich mich über halb unsichtbare Pfade phantasiert, zu geheimen Lichtungen und stillen Waldseen. Menschenlos, aber voller Leben, Vögel und Insekten, das Geräusch eines Sommerwaldes: das Summen von Wespen und Fliegen, große lila Käfer, wie fliegende Edelsteine zwischen den grauschwarzen Baumstämmen, über gärende Sümpfe und Senken. Und es musste ein alter, rätselhafter Elch hier stehen und an einem dunklen Gebüsch kauen, und das Glucksen der großen Vögel musste widerhallen. Der Sommer musste zum Herbst werden, mit Reif und erstem Frost im verwelkten Weidenröschen. Ich konnte alles ganz deutlich sehen. Den Schnee, der an einem frühen, frühen Wintermorgen hier im Wald fiel. Und das Geräusch der Bäche im Frühling. Balzende Auerhähne.
Ich lag in meinem Bett und wusste, wenn ich erst alt genug wäre, würde ich hierhin gehen. Allein, niemals mit jemand anderem.
Auf einem Absatz an einer Felswand habe ich einmal eine primitive Schutzhütte gebaut. Vom Waldboden her war nichts zu sehen, und es war schwer, dort hinzugelangen, wenn man nicht jeden Schritt kannte.
Dorthin will ich jetzt.
Die Wolken legen ein gewaltiges Tempo vor, sie jagen über den Himmel, es rauscht im Wald unter mir, aber hier oben, wo ich liege, ist es fast ganz still. Die Felswand über mir beugt sich vor, und der Boden fällt schräg ab, die Schutzhütte, die ich gebaut habe, ist fast eine Höhle und keine große Leistung. Oder: Die Leistung kann darin liegen, eine solche Stelle zu finden.
Sie zu sehen. Das tun nur wenige.
Es war niemand hier seit meinem letzten Besuch im Herbst, unmittelbar, bevor der Schnee einsetzte. Ich kann meine eigenen Spuren sehen. Die Reste des Feuers. Die Kippen.
Ich mache mir innen vor der Felswand ein Feuer; hier zieht der Rauch auf natürliche Weise an einem Spalt entlang ab, und ich denke, wie schon so oft, ich bin nicht der Erste, der hier wohnt. Oder sitzt und darauf wartet, dass der Sturm sich legt. Ich koche Bouillon, gebe Pilze hinein, die ich unterwegs gesammelt habe. Esse aus dem Topf, während ich auf den duftenden Tannenzweigen liege. Ich denke, dass ich hier in Ruhe liegen bleiben darf, bis mir Tvi begegnet ist, dass ich vorher nicht weitergehen kann. Ich habe eine ganze Garnitur solcher Vorstellungen, die ich pflege und hüte. Sie bringen ein System in ein ansonsten nur lose geerdetes Dasein. Als ich jünger war, habe ich mir Religionen gemacht. Damit habe ich schon längst aufgehört.
Mir fehlt Brot. Und Eier. Das ist alles. Es ist gut, im Wald zu liegen und zu sehen, wie das Licht über den Baumwipfeln schwindet, während einem Brot und Eier fehlen. Wenn man will, kann man es zu einer regelrechten Besessenheit treiben, wenn einem unter solchen Umständen etwas fehlt. Man kann sich selbst aufstacheln, wenn einem so etwas Freude macht. Man kann denken: frisches, grobes Brot, mit einer dicken Schicht Butter. Echte Bauernbutter. Es ist noch die Frage, ob das Brot nicht sogar warm ist. Ja. Lauwarmes Graubrot, das die fette Bauernbutter schmelzen lässt. Und was die Eier angeht: so ein gelbes Dotter! Hat man jemals so ein gelbes Dotter gesehen? Nein. Denn das hier ist der Weltrekord. Gekocht … lächelnd. Oder Spiegelei. Das Messer, das durch das gelbe Dotter gezogen wird. Welches dann im Bratfett verrinnt. Und nun wieder her mit dem Brot. Dem warmen Brot, das das flüssige Dotter aufsammelt, hat man im ganzen Leben auf Erden schon jemals ein so goldenes Gelb gesehen, nein, nie!
Oder man kann sich damit abfinden, dass man eben ohne Eier und Brot auskommen muss, bis der Wald einen loslässt und man sich wieder der Zivilisation nähern kann.
Ich finde, beide Möglichkeiten haben etwas für sich.
Es macht Spaß, so zu spielen.
Es wird ganz dunkel, während ich hier liege. Ich denke nicht an die Stadt, und ich denke nicht an die Zukunft. Ich liege nur auf einem Felsabsatz und lausche dem Wind in den Baumwipfeln unter mir.
Dann bekomme ich einen grauen Tag mit Nieselregen in der Luft. Hier oben habe ich gelernt, stundenlang stillzusitzen. Jetzt tue ich das. Ein Rabe kommt vorbei und macht ein bisschen Gewese um etwas, das wie ein Knochen aussieht. Verliert ihn und holt ihn sich wieder. Springt mit dem Knochen im Schnabel die Felswand entlang. Über eine alte verdorrte Kiefer. Legt den Kopf schräg und schaut zu mir auf. Kluges Kerlchen. Wenn ich in der Stadt bin, spreche ich mit den Krähen. Hier draußen schweige ich mit dem Raben. Beide sind Mystiker. Sie haben ihre Projekte, die wir nicht durchschauen können. Die Komplexität des Krähengerichts. Der schwarze Abgrund im Blick des Raben.
Kein Tvi.
Wasser gibt es hier oben nicht. Ich habe eine Plastikkanne, und als der Kaffeedurst groß genug wird, klettere ich mit der Kanne im Leinenrucksack nach unten.
Nass. Glatt. Schwierig.
Die Tierfährte, der ich hierher gefolgt bin, zieht sich noch einen halben Kilometer ostwärts zu einem namenlosen See hin. Unterwegs finde ich wunderschöne Sträuße aus Pfifferlingen, sie sind nass, ich muss sie braten, sowie ich wieder oben bin. Ein Geschenk. Ich schneide sie sofort, das ist das Gesetz auf der Fährte. Hund sein. Nicht warten. Sofort zuschlagen.
Der Waldboden ist weich und federnd, ich gehe mit wiegendem Schritt weiter. Großer schwerer Tannenwald mit schwarzen Bärten an allen Ästen, überwuchert von Flechten und Moosen jeglicher Art und in allen Farben; alles feucht und duftend, ich kann stehen bleiben und die Augen schließen und dermaßen intensiv anwesend sein, dass mir fast schwindlig wird. In die Hocke gehen und mit der Hand über den Boden fahren. Mehrere Zentimeter alte Tannennadeln, ehe man die Erde erreicht, und die ist groß, sauer und fett.
Es ist so still. Fast kein Vogelsang. Ein Specht arbeitet tief drinnen im Wald an einem verdorrten Stamm.
Der Weiher ist so gut wie zugewachsen. In zehn Jahren wird hier Moor sein. Früher gab es hier Biber, das ist dem Wald um den Weiher anzusehen, aber die Spuren der Biberzähne sind längst grau geworden, ja, fast schwarz. Ich setze mich auf eine umgestürzte Birke, halb versteckt vom Moos, und drehe mir eine Zigarette. Wir schreiben September, da ist es wohl Herbst, aber ich erlebe den Spätsommer. Insekten, die über dem Wasser summen. Diese seltsame Sattheit, die das Wesen des Spätsommers ausmacht, das Gefühl von Überfluss, Beeren und Früchten ist noch vorhanden. Und es ist warm. Ich streife mein Hemd ab und leuchte bestimmt auf, es war ein verunglückter Sommer.
So auf einem toten Baumstamm sitzen und rauchen. Fålme quälen, der wenig Zeit hat und weiter will. Ich fülle die Plastikkanne mit Wasser und gehe zurück.
Tvi kommt ganz ohne Vorwarnung, als ich mich der Stelle nähere, wo ich die Pilze geschnitten hatte. Ich bin in meine Gedanken versunken, das hatte ich gedacht: Jetzt ist die Landschaft eine andere, und Pilze finde ich überall. Danke übrigens, Gott. Ich falle zurück in alte Gewohnheiten. So ist es mit mir und Gott. In Bezug auf ihn finde ich immer noch etwas Neues, und er selbst ist jetzt beständiger; ich habe zudem den Eindruck, dass er im Großen und Ganzen Nachsicht mit mir hat. Sieh an, sage ich, da hast du doch wahrlich noch einen Pilz hingestellt, und sogar einen Trompetenpfifferling, das ist großzügig und angemessen. Man dankt für das Auge, das sieht, und für die Finger, die dem Willen gehorchen. Dankt zudem ein wenig für den eigenen Starrsinn. Für Fålme, der keine Ruhe gibt. Und für das in mir, was ihn in Schach hält.
Aber was ist also los mit Tvi? Spüre ich sie, ehe sie sich physisch offenbart? Nein, erst einmal habe ich die Hände voll zu tun mit einer Ringeltaube, die aus einem Haselstrauch bricht, sicher hat sie dort meditiert. Seltsam, diese Vorliebe dieser großen unbeholfenen Vögel, die sich am liebsten auf einem dünnen Zweig niederlassen. Nicht ich habe diese Taube aufgescheucht, es muss der Tod gewesen sein, denke ich, denn sie jagt kreuz und quer zwischen den Baumstämmen umher, und kaum habe ich an den Tod gedacht, da kommt sie auch schon wie ein Torpedo angeschossen, schräg von oben, sie hat in einer Tanne gesessen oder die Beute auf einer ihrer unsichtbaren Jagdfährten am Himmel erspäht, es ist das große alte Weibchen, ein furchterregender Schatten, der in einem fast unvorstellbaren Tempo durch den Wald jagt, in die trockene Vegetation aus Reisig und Gestrüpp, aber dabei streift sie keinen einzigen Zweig, es ist nicht zu fassen, es geht so schnell, es ist die Allnatur, die mir eine ihrer grandiosesten Artistinnen geschickt hat, die personifizierte Tötungsmaschine des tiefen Waldes, Accipiter gentilis, den Hühnerhabicht, und dieser Anblick jetzt wird kaum je einem Menschen zuteil. Ausgerechnet ich stehe hier auf dem Pfad, als der Habicht die Taube schlägt, und ich zucke zusammen, als das dunkle Waldestief von Hunderten von hellen Federn gefärbt wird, die in der Luft hängen bleiben.
An einem Zweig: ein Blutstropfen, bereits von einer Fliege gefangen.
4
Der alte Schienenstrang zieht sich wie schwarze Streifen durch den grauen Kies, zwischen den Schwellen wachsen kleine Bäume und Büsche. Wann ist hier der letzte Zug gefahren? Vor zehn Jahren? Oder zwölf? So in etwa. Die Natur nimmt im Laufe eines dermaßen erbärmlichen Zeitraums viel zurück. Noch ein Jahrzehnt, und der Wald hat fast alles verschlungen. Es ist sehr schwer, die Bahnlinie entlangzugehen. Man findet zwischen den Schwellen keinen richtigen Rhythmus. Dennoch gehe ich im Mondschein hier entlang. Nicht weil ich wenig Zeit hätte, sondern weil ich Kräfte spare. Ich will in dieser Nacht nämlich noch weit. Bis zum Bahnhof Thorbu. Im Gehen verfluche ich das Schrotgewehr, das ich gestohlen habe. Oder ich freue mich darüber. Es ist eine Last. Und ein zusätzliches Kapital. So ist es ja immer. Kein Grund, groß zu jammern.
Und der Mond scheint auf mich herab. Das denke ich. Dass ich der einzige Mensch unter Sonne und Mond bin. Der Wald und die stillgelegte Bahnstrecke ruhen in einem bläulichen Licht. Dann kommt eine Wolke und knipst das Licht aus. Oder ein Tunnel. In einem der langen Tunnel unten am Fluss mache ich Rast. Koche auf der Gasflamme Kaffee. Sitze ganz still und bin im Berg. Es ist ein schlechter Berg. Aufeinandergepackter Kies. An einzelnen Stellen kann ich ihn mit den Händen ausgraben. Und das gibt mir ein Gefühl von Gefahr.
Ich sitze im Berg, mit bitterem Kaffee in der Tasse, und denke an Onkel Arve. Der seinen Verstand an eine Waldfee in Oksladalen verlor. Ich bin zweien von dieser Sorte begegnet, und Onkel Arve war derjenige, den das nicht die Sprache gekostet hatte. Er konnte von der inneren Glut des Berges erzählen, vom Licht, das von den glatten Felswänden strahlte, in Höhlen, die am Morgen aller Zeiten geformt worden waren, und von den Jahren aus Blei und Eisen, und von Silber und Gold, aber vor allem von der Glut des Berges, honigfarben, mit grünen und blauen Sprenkeln; er war zu der Überzeugung gelangt, dass das Wesen der Waldfee in dieser Glut ruhte, in diesem Licht, es war nicht so, wie ich geglaubt hatte, dass sie nackt umherlief und ihren Kuhhintern schwenkte, aber es war dennoch Erotik im Spiel, mehr als ich oder sonst irgendwer mir auch nur vorstellen könnte. So ging es mir als Kind. Wenn alles um mich herum zusammenbrach. Dann legte ich mich hin und ging in den Berg hinein. In diese seltsame Glut aus erstarrtem Magma. Ich lag auf einem Felssims, tief in mir selbst, mit den Händen vor den Augen. Vieles davon, was Onkel Arve erzählte, kam mir bekannt vor. Mit vielem war ich vertraut.
Er sagte: Es war im Oktober. Ich war in den Bergen, um Schafe zusammenzutreiben. Als ich in Oksladalen ganz oben ankam, stand eine Frau unter einem Felsvorsprung. Gut ausgerüstet war sie, wie Frauen in Telemark das ja oft sind, aber seltsam angezogen, etwas an ihrer Jacke und ihrem Rock erinnerte an eine andere Zeit, und die Haare strömten wie ein blonder Wasserfall über ihre Hüften. Zu ihr ging ich, als ob der Weg mich hinlenkte, als ob sie zum Weg würde, sie sagte, eine Stunde weiter nach Osten stünden drei Schafe in einer Geröllhalde.
Und da standen sie auch. Sie waren auf einer Felsplatte im Bach gefangen.
Beim Abstieg wurde es kalt. Es fing an zu schneien. Riesige Flocken.
Da sah ich sie wieder. Sie war weiter den Hang hinuntergegangen. Hier gab es eine Mulde, eine tiefe Senke, ich hatte dort schon oft Schutz gesucht.
Da stand sie.
Doch als ich unten ankam, wandte sie sich ab, und da sah ich ihren Kuhhintern und ihre Augen, als sie sich umschaute …
Sie waren gelb, sagte Onkel Arve. Er hatte Luchse gejagt, am Siljansee, und wusste, womit er diese Augen vergleichen konnte.
Aber das Leben in den Bergen – ja, was war das? Was war das, gekleidet in Menschenwörter und die Ausdrücke der Vernunft? Es war etwas anderes, aber zugleich Vertrautes. Wie Bäume, die im Wasser auf dem Kopf standen, und Blut, das durch leere Augenhöhlen rann. Milch zwischen Bäumen. Musik, die aus offenen Wunden und Mündern strömte, Zähne, die steile Hänge hochliefen, aber vor allem das pochende Herz des Berges.
Er wurde nie wieder derselbe.
Er wurde ein anderer. Er wurde der aus dem Berg. In lustiger Runde war er nichts mehr wert, bei Trauer auch nicht viel. Er saß in einer Ecke, wie ein Greis aus irgendeinem Märchen. Was er dort oben in Oksladalen auch gesehen oder erlebt haben mochte, so ging es mit ihm weiter.
Ich bin so müde. Es ist ein halber Kilometer bis zum Ausgang, und ich denke, das wird in der Dunkelheit wirken wie zehn, denn so kommt es mir vor, das weiß ich. Ich sehe vor mir Onkel Arve, der noch lebt und der unten im Pflegeheim herumsitzt und sabbert. Sein Lachen auf dem leeren Gang, wo die Krankenpflegerinnen in abgenutzten Holzschuhen vorübereilen, tripp trapp, ihre verlockenden Hintern und die strammen Waden. Tief im Kopfberg, und mit einer Aussicht auf trockene Brotkanten, an denen Reste von Kavli-Kaviar und Ziegenkäse festkleben wie Sekrete irgendeines unglückseligen Bergsteigers, der zu Tode stürzte, und der seit langem als Monster in Daunenjacke tiefgefroren unten am Seil hängt. Es tut alles so weh. Es ist alles so verzweifelt. Ich meine – der ganze Kosmos, der ganze unendliche Tod, und dann das hier. Was das Leben sein soll. Ich quäle mich mit diesen Bildern.
Aber als ich in den Mondschein an der Flussmündung komme, geht es mir besser. Fast hätte ich ein Liedlein angestimmt. Ja, nur ein ganz kleines, natürlich.
Ich schlage mein Wasser ab und drehe mir eine Zigarette. Das ist gar nicht so schlimm. Es ist ziemlich gut.
Gegen fünf kann ich den verdammten Schienenstrang dann endlich verlassen, dieses Unglück von Leiter im Kies; so ein Gang über den Schienenstrang ist anstrengender, als die meisten sich klarmachen, aber solche Dinge weiß ja kaum noch jemand. Aber auf diese Weise kommt man durch den Wald, und das noch dazu schnell. Jetzt überschreite ich die rostige Linie, die im Morgengrauen dort liegt, und steige die Böschung zu der alten Bahnhofstraße hinunter, ein grauer Streifen, der aus dem Tannenwald und parallel zur stillgelegten Bahnlinie bis nach Thorbu führt. Und im Gehen denke ich, dass hier oben jetzt so vieles stillgelegt ist, die Bahnlinie, die Straße, auf der ich gehe, und das alte Bahnhofsgebäude, das mein Ziel ist – dass alles sozusagen doppelt stillgelegt und abgeschlossen ist, seit Thor in den Wald gegangen ist und sich erhängt hat, weil er sein eigenes Kind nicht beschützen konnte, das Leben, das er selbst in Gang gebracht und dessen Schutz ihm die Natur zur Aufgabe gemacht hatte.
Ich träume oft von Thorbu. Von dem Bahnhof, wie er war, ehe die neue Strecke gebaut wurde, lange bevor Thor und Elna dort eingezogen sind, damals, als Tag und Nacht Züge kamen und abfuhren, zu allen Jahreszeiten. In einem solchen Traum stehe ich an dem kurzen Bahnsteig, ganz hinten in einem altmodischen Waggon, ich stehe draußen auf dem Metallgitter und sehe den Schienenstrang unter meinen Füßen rückwärts segeln, es ist Nacht, wie jetzt, Mondschein, tiefe blaue Schatten in dem dunkelroten Tannenwald, und mit einem Gefühl, dass etwas hinter mir her ist, hinter dem Zug, etwas von nicht gerade erbaulicher Art ist dabei, mich einzuholen. Mich? Nicht uns? Nein. Mich. Ich bin der einzige Fahrgast, ich bin überhaupt der einzige Mensch an Bord, hier gibt es keinen Lokführer und keinen Schaffner, keinen alten Mann mit Pfeife und Zeitung, keine Jugendlichen, die sich in ihrem eigenen Spiegelbild in der Fensterscheibe wegträumen, keine stillende Mutter, niemanden auf der Flucht, niemanden auf dem Heimweg, keine Karten spielenden Betrunkenen, keine Wanderprediger oder Handelsreisende, keinen Bauern, der mit üblen Wunden am Bauch aus der Stadt zurückkehrt. Niemanden. Nur mich, der ganz hinten steht und sieht, wie die Zeit zermahlen wird, rückwärts geschleudert, eine Lawine aus Bäumen, leere Häuser ohne Licht in den Fenstern, heruntergekommene Hofplätze mit nackten Fahnenstangen. Und dieses Etwas, das irgendwo hinter mir auf der Bahnlinie unterwegs ist, etwas Gelbes und Giftiges.
Die Erleichterung, auf den Bahnsteig steigen und sehen zu können, dass es hier Menschen gibt. Andere. Unter die ich mich mischen kann. Es ist mitten in der Nacht, aber die Betonfliesen auf dem Bahnsteig leuchten, eine kühle, selbstleuchtende Glut, und dasselbe wundersame Licht strömt auch aus den Wänden des alten Bahnhofsgebäudes, aus den verwitterten Brettern: gelb und golden – die Lampe, die runde Lampenkuppel über der Tür zum Wartezimmer, strahlt rot, eine elektrische Blutapfelsine. Und ich kann das freundliche Lachen des Stationsvorstehers hören, aus dem offenen Fenster im ersten Stock, über der großen Bahnhofsuhr; ein entgegenkommendes und einladendes Lachen, geschmiert mit Pfeifenrauch und schwarzem Kaffee, gestählt vom Blasen in die Trillerpfeife und vom »Zug nach, Zug aus« auf Bahnsteig eins oder zwei, ein seltenes Mal auf drei oder vier. Dort steht er und grinst unter seiner roten Uniformmütze. Hinter ihm brennt das Zimmer, es ist die Küche, hinter ihm hängt eine Schöpfkelle aus Blech, in einem Schleier aus Feuer.
Ja, so kann ich träumen.
Vor Sonnenaufgang bin ich da, den Kopf halb betäubt von eingebildeten Erinnerungen an diesen Bahnhof tief im Wald, wo ich in meiner Kindheit und frühen Jugend so oft ein- und ausgestiegen bin, später dann allein, endlich allein. Denke ich jetzt, denn ich war so ein feiner kleiner Knabe, der Jahr um Jahr auf die Einsamkeit gewartet hatte, darauf, unbegleitet kommen und gehen zu dürfen. Als das Alleingehen dann endlich losging, war es genau wie erwartet, es war groß und kostbar, das verriet ich aber nicht.
Das Haus hat zwei Stockwerke, die gelbe Farbe hat etwas Mattes, etwas Verwehtes, sicher liegt es daran, dass sie in den Träumen so oft leuchtet, schwelt wie ein halb erloschenes Feuer. Und während die alten Bretter im Traum eine glatte Oberfläche haben, fast wie Lack, sind sie in der Welt des Wachens rau, mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter, als ich daran denke: Es ist einfach entsetzlich, mit dem Fingernagel über diese Fläche zu fahren, aber ich kann es mir nie verkneifen, ich tue es jedes Mal, wenn ich mit dem Zug herkomme, es ist das Erste, was ich tue, sowie ich auf dem Bahnhof stehe, beim bloßen Gedanken daran bekomme ich schon eine Gänsehaut, und dann tue ich es wieder, ich kann es einfach nicht lassen.
Auf dem Bahnsteig ist das Gras durch die Risse zwischen den Betonplatten geschossen. Dünne feine Grashalme, und hier und da ein Huflattich. Die große Birke hinten beim Fahrradständer hat einen Ast verloren, der liegt halb über dem Dach, die Bruchfläche leuchtet, wird langsam grau, das Laub verwelkt, ist aber noch grün.
Ich gehe über die Bodenplatten und lege die Hand auf die alten Bretter. Fahre mit den Nägeln der rechten Hand über die matte Farbfläche, ich spüre es bis tief ins Rückenmark.
Ich lege die Hand an die Stirn und schaue in den verlassenen Wartesaal.
Kann etwas verlassener sein als ein Wartesaal, in dem niemand mehr auf jemanden oder etwas wartet? Da ist die graue Bank mitten im Raum, auf der sie gesessen haben. Und da ist der geschlossene Fahrkartenschalter, wo die gepressten Pappfahrkarten unter dem Glas durchgeschoben wurden, zuerst das Geld in die eine Richtung, dann die Fahrkarte in die andere. Der zerstörte Fotoautomat hinten bei der Tür zur Toilette, der alte Drehstuhl halb versteckt von dem grauen Vorhang, den wir vorgezogen haben, ehe wir Geld einwarfen und auf das kurze Aufblitzen warteten, drei, vielleicht vier eifrige Gesichter, wir pressten uns in den engen Raum, viermal Blitzen, für jedes Gesicht einmal, und die Wartezeit, die langen Minuten, ehe der feuchte Streifen aus Passfotos unten in das Fach fiel. Der scharfe Geruch des Fixiermittels, chemischer Mutterkuchen, Gebärmuttersekret.
Während ich hier stehe, lugt die Sonne auf der anderen Seite des Hauses über die Hügel, das Licht fällt über die Bodenbretter, und ich sehe, wie abgenutzt sie sind.
Die Tür ist abgeschlossen. Das weiß ich, probiere es aber trotzdem.
Gehe um das Haus herum. Auch die Tür, die zur steilen Treppe zur Wohnung des Bahnhofsvorstehers führt, ist abgeschlossen.
Ich zögere ein wenig. Ich bin so müde und erschöpft, so bettschwer und erledigt, aber diese Schlösser gehören nicht mir und die Tür zu dem kleinen gepflasterten Wendeplatz auf der anderen Seite auch nicht.
Also breche ich das Schloss vor der Kellerluke auf. Das ist rasch erledigt. Es ist fast nicht zu sehen. Altes Eisen. Ich reibe ein wenig rötliche Erde über die Bruchstellen, dann lasse ich mich in die nach Schimmel riechende Unterwelt sinken. Ich brauche nur das Licht, das durch eine Art durchsichtige Gardine hinten bei der Treppe fällt, die zum Büro des Stationsvorstehers und dann weiter hoch zu seinen privaten Gemächern führt.
Das Büro. Der Schreibtisch mit dem Karussell aus Stempeln, die Schale mit Kugelschreibern und Bleistiften, die alte Remington-Schreibmaschine, sonst nicht viel, nur eine leere Bank unter dem Fenster.
Ich gehe nach oben in die Wohnung. Der Gang. Die Küche, das Wohnzimmer und die beiden Schlafzimmer. Das enge Badezimmer neben der Speisekammer.
Es riecht nach Staub. Und ein wenig nach Kloake. Ich lasse in der Küche das Wasser ins Spülbecken laufen. Ich denke, dass das Haus selbst hustet und sich räuspert, als ob es um Atem ränge, es sind die Luftblasen in den Rohren, die an der Wand nach unten führen. Dann fließt das Wasser still und gleichmäßig. Als es eiskalt ist, reibe ich mir noch einmal das Gesicht damit ein und stille meinen Durst.
Danach drehe ich die Runde. Hier gibt es genügend Konservendosen. Und die Gefriertruhe ist noch dazu halbvoll.
Im Badezimmer knie ich mich ans Ende der Badewanne und entferne am Abfluss zwei Fliesen. Hebele sie vorsichtig mit der Klinge des Küchenmessers hoch. Schiebe die Hand in den Hohlraum unter der Badewanne.
Finde es nicht. Taste und wühle. Finde es doch.
Danach lege ich mich in Thors ungewaschene Bettwäsche, die nach ihm riecht, und nach einer anderen Zeit.
Der erste Morgenzug fährt auf den neuen Gleisen den Hang herunter.
Ein langgedehntes Heulen.
5
Ich dachte mir das so: Wenn ich Thor hieße und die Zeit eine andere wäre, würde ich jeden Tag aus dieser Bettwäsche aufstehen, so wie ich es nun ja auch an jedem Tag tat, und ich wäre in die kleine Küche gegangen und hätte Kaffee gekocht, vielleicht etwas gegessen, während ich auf die Geräusche des stillgelegten Bahnhofs gelauscht hätte, das heißt, auf einen Wind, der draußen durch die Baumwipfel strich, ehe ich eine oder zwei rauchte und ins Büro des Stationsvorstehers hinunterginge, um die Zeitung zu lesen.
Aber ich hieß nicht Thor, und die Zeit war auch nicht anders, als sie eben war, und deshalb blieb ich liegen und dachte daran, wie er hier oben gelebt hatte, in dem, was dann seine eigene Endzeit gewesen war. Wie sich in ihm alles zusammengezogen hatte.
Ganz abgesehen davon, dass das Zimmer der Kleinen – naja, nicht aufgeräumt war, aber Kleider, Möbel und Spielzeug waren entfernt worden –, war alles so wie damals, als Thor am Leben und unglücklich gewesen war. Ich hörte Blonde on Blonde, das auf dem Plattenspieler gelegen hatte, als ich gekommen war, er wechselte immer nur zwischen den beiden Scheiben des Doppelalbums und nahm keine neue heraus. Abends stand ich am Wohnzimmerfenster und sah mir die Züge an, die unten am Hang unter mir vorbeifuhren, die langen Filmstreifen, rasche Blicke in die Zugfenster, wo Menschen saßen und schliefen oder miteinander redeten, lasen oder auf mitgebrachten Rechnern schrieben, während ich Sad eyes lady of the Lowlands und Visions of Johanna hörte. Und alle die anderen Museumsstücke.
In der Küche machte ich nie Licht. Dort stand ich und schaute hinaus in die Dunkelheit. Hinunter auf den mit Steinen belegten Vorplatz.
Aber sie kamen nicht. Ich überprüfte das Telefon, es war tot wie beim letzten Mal, es war also so, wie es sein sollte und wie ich es haben wollte, aber es ist schon seltsam. Nicht, dass die Tage lang geworden wären, das heißt, das wurden sie ja, aber ich wollte wieder in den Wald. Es irritierte mich, dass diese Typen waren, wie sie eben waren. Dass sie irgendwo grinsend saßen, die Beine auf den Tisch gelegt, während sie Zettel mit dem Datum vom Kalender rissen, sie zusammenknüllten und in die lose Luft schnippten, oder sie sich aus purem Jux in die Nasenlöcher steckten.
Aber na gut. Es regnete viel während dieser Tage. Ich lag trocken und warm in dem streng und säuerlich riechenden Bettzeug. Genug zu essen. Nichts zu trinken. Das fand ich gut. Ich lebte natürlich in der falschen Zeit. Daran konnte es doch keinen Zweifel geben. Sogar die Musik, die ich hörte, passte nicht dazu. Blonde on Blonde war der Soundtrack zu Onkel Arves Leben. Der Mann im Berg. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, der allerletzte dokumentierte Fall von Waldfeenwalzer in Norwegen.
Ich fand im Eckschrank in der Küche eine von Thors Pfeifen, dazu eine alte Dose mit halbtrockenem Amphora. Das schmeckte mir. Die Pfeife war eine leicht gebogene Lillehammer, und wenn ich im dunklen Fensterglas mein Spiegelbild sah, dachte ich: Hier haben wir doch wirklich den Stationsvorsteher persönlich. Den Mann, der das Kursbuch auswendig kann und der mit seiner edlen und doch maskulinen Erscheinung den Frauen auf dem Bahnsteig weiche Knie macht. Als Andenken hatte Thor die Mütze des längst verstorbenen Bahnhofsvorstehers im Gang an die Wand gehängt, zusammen mit der Trillerpfeife und der grünen Schnur. Ich setzte die Mütze auf und ließ die Finger über den glatten Schirm wandern. Ging ins Wohnzimmer und knipste alle Lampen aus. Öffnete das Fenster über der großen toten Uhr. Ja. Hier ist die Zeit vergangen. Oder in etwas ganz anderes getrieben worden. Ich sog den süßen Rauch ein und blies große blaue Wolken in den kalten Herbstabend hinaus.
Gegen elf Uhr kommt dann Morten Bruvik. Ich höre seinen Wagen schon aus der Ferne. Das einzige Licht, das bei mir brennt, ist die Stearinkerze auf dem Küchentisch, ich blase sie aus, und gehe in das geplünderte Zimmer der Kleinen. Ein feuchtkalter Nebel hängt über dem Kiesweg, er verstärkt das Licht der Autoscheinwerfer, bläst es zu großen gelben Rosen auf. Ich denke eine Weile, dass sie es sind, aber so ist es nicht, ich sehe Morten Bruvik unten auf dem gepflasterten Platz aus dem Wagen steigen, ich stehe zwei Meter von der Fensterbank entfernt, außer Sichtweite.
Höre, wie er unten an der verschlossenen Tür rüttelt. Seine Schritte um das Haus. Er versucht es auch am hinteren Schloss.
Warum sitzt du nicht in deinem Büro und siehst dir im Internet Pornos an? Was machst du hier?
Stehe ganz still und warte auf das Geräusch seiner Füße auf der Treppe. Es ist sein Beruf, sich um Schlösser wie das zu kümmern, das ich zerbrochen habe. Aber jetzt? Fast Nacht?
Er kommt nicht.
Er lehnt mit dem Hintern an der Motorhaube und dreht sich eine Zigarette. Steht da unten und raucht. Macht sich an seinem Mobiltelefon zu schaffen.
In jüngeren Jahren träumte er von einer Laufbahn als gefährlicher Psychopathen-Sheriff, so einem, von dem wir in den Büchern von Stephen King lasen. So ein Typ, der dich durch die halbe Wüste von Nevada verfolgt und dich erst wenige Millimeter vor dem Nervenzusammenbruch an den Straßenrand winkt. Der auf einem Zahnstocher herumkauend und mit einer dunklen Panoramasonnenbrille vor den Augen verlangt, dass du das Fenster herunterkurbelst und Führerschein und Wagenpapiere vorzeigst. Ehe die Hölle sich über dein kleines Leben senkt wie ein blauschwarzer Tornado.
Aber zu seiner großen Enttäuschung stellt Morten Bruvik fest, dass er so gut wie kein Talent zur Gemeinheit hat, und dass das Leben als Dorfpolizist in Telemark im Grunde vielleicht auch nicht so ganz schlecht ist. Er wohnt noch immer bei seinen alten Eltern, die er in seinen Freiwachen mit Gesang und Tanz unterhält, das behaupten jedenfalls mit Wonne die, die gemeiner sind als er.
Ich habe ihn seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, damals, als ich zuletzt vermisst gemeldet war.
Jetzt würde ich lieber nicht mit ihm reden.
Auf halber Höhe seiner Zigarette wird er angerufen, er setzt sich ins Auto und fährt auf derselben Straße zurück, die er gekommen ist.
Ich liege wach im Bett und warte.
Höre: Zug aus Hjuksebø in wenigen Minuten …
Fahre um kurz nach vier aus dem Schlaf hoch, es ist noch immer stockdunkel, ein Motor arbeitet irgendwo draußen in der Nacht, ich weiß, dass sie es sind, und nicht noch einmal Morten Bruvik.
Es gibt hier irgendwo einen Zusammenhang, aber der interessiert mich nicht. Als ich Morten Bruvik sah, wusste ich, dass sie kommen würden.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Ich ziehe mich an, rasch und achtlos, mache aber kein Licht – und als ich in die Küche komme, liegt der Platz vor dem Haus leer im Mondschein, sie sind so vorsichtig, dass ich es fast komisch finde. Und als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, sehe ich den Wagen hinten bei der Kurve, halb versteckt hinter dem alten Fahrradschuppen.
Ich setze mich und gebe mir Feuer. Gieße kalten Kaffee in die Tasse.
Nach einer Viertelstunde höre ich Schritte auf der Treppe. Ich hätte sie nicht gehört, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er kommen würde. Dass er bald kommen müsste. Das ist so eine Eigenschaft, die er hat. Über die geredet wird. Dass er sich fast lautlos bewegen kann, trotz hundert Kilo Anabolimasse.
Ich habe keine Angst. Das denke ich jetzt. Dass ich keine Angst habe.
Der Tür zum Gang gegenüber ist sogar Jack Hallstein hilflos, sie quietscht, und da hat er offenbar keine Lust mehr, Hirschfuß zu spielen. Ich höre seine Stiefel auf dem Gang, und dann füllt er die Türöffnung so ungefähr ganz aus.
»Aber was sitzt du hier so tatenlos im Dunkeln herum? Ich wollte gern einmal ein Erwachsener und ein Kind nach Notodden, bitte. Wir setzen uns ins Wohnzimmer.«
Als ich hineinkomme, hat er den Kerzenstummel schon mit seinem Zippo-Imitat aus Vietnam angezündet, es riecht nach Benzin. Er lässt sich auf das verschlissene Sofa sinken und zieht die Knie bis an die Brust. »Nein, verdammt.«
Ich zeige auf den Sessel. »Der da ist besser.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: