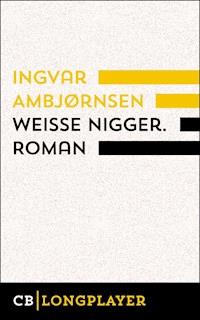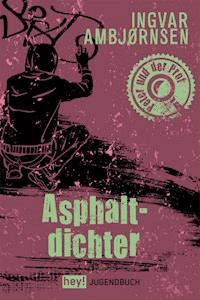4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Peter und der Prof
- Sprache: Deutsch
Wer glaubt, weiß nicht – und wissen wollen es Peter und der Prof immer ganz genau! Den Heilsversprechen der verschiedenen Religionen schenken sie deshalb nur wenig Vertrauen. Als eine besonders gläubige Schulkameradin aus dem Fenster stürzt, geht die Polizei von einem Selbstmordversuch aus. Doch Peter und der Prof halten diese Theorie vor allem für eines: unglaubwürdig! Der Prof streckte die Hand aus. Mir fiel auf, dass sie leicht zitterte. Sie fasste seine Hand und ließ nach einer Weile ihren rechten Zeigefinger auf dieser feuchten Unterlage kreisen. Ich bereute bitterlich, dass ich nicht in meine eigene Zukunft investiert hatte. »Du hast eine deutliche und lange Lebenslinie«, begann sie. »Wenn du es gut mit dir meinst, dann kannst du ein langes Leben leben.« »Er frisst zu viel«, rutschte es aus mir heraus. »Er bekommt wahrscheinlich einen Herzinfarkt, noch ehe er vierzig ist.« Die Wahrsagerin auf dem Osloer Jahrmarkt nehmen Peter und der Prof entgegen ihrer sonstigen Überzeugung durchaus ernst, denn die »Dame aus Kairo« prophezeit den Freunden einen neuen Fall, bei dem es um Leben und Tod geht. Den Tod ihrer Schulkameradin? Während Katja schwerverletzt im Krankenhaus liegt, untersuchen die Freunde die Umstände ihres Sturzes. Auf der Suche nach kriminalistischer Erleuchtung begibt sich Peter schließlich in die Fänge einer dubiosen Sekte, die sich »Das Licht des Lebens« nennt. Und schnell bestätigt sich seine Vermutung: Wo Licht ist, da fällt auch Schatten … »Wahrheit zu verkaufen« ist der vierte Band der Jugendkrimi-Reihe Peter und der Prof – Vertrauen ist gut, Ermitteln besser! Aus dem Norwegischen übersetzt von Gabriele Haefs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ingvar Ambjørnsen
Wahrheit zu verkaufen
Peter und der Prof
Copyright © 1991, Ingvar Ambjørnsen
Übersetzt von Gabriele Haefs
Copyright der überarbeiteten eBook-Ausgabe © 2014 bei Hey Publishing GmbH, München
Die Norwegische Originalausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Sannhet til salgs« im J.W. Cappelens Forlag, Oslo
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Sarah Borchart, ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © Christine Poppe
ISBN: 978-3-942822-81-7
Wahrheit zu verkaufenn ist der vierte Band der Jugendkrimi-Reihe Peter und der Prof. Eine Auflistung weiterer Titel finden Sie am Ende des Buches (bitte hier klicken).
Ingvar Ambjørnsen im Internet:
www.ingvar-ambjoernsen.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Wer glaubt, weiß nicht – und wissen wollen es Peter und der Prof immer ganz genau! Den Heilsversprechen der verschiedenen Religionen schenken sie deshalb nur wenig Vertrauen. Als eine besonders gläubige Schulkameradin aus dem Fenster stürzt, geht die Polizei von einem Selbstmordversuch aus. Doch Peter und der Prof halten diese Theorie vor allem für eines: unglaubwürdig!
Der Prof streckte die Hand aus. Mir fiel auf, dass sie leicht zitterte. Sie fasste seine Hand und ließ nach einer Weile ihren rechten Zeigefinger auf dieser feuchten Unterlage kreisen. Ich bereute bitterlich, dass ich nicht in meine eigene Zukunft investiert hatte.
»Du hast eine deutliche und lange Lebenslinie«, begann sie. »Wenn du es gut mit dir meinst, dann kannst du ein langes Leben leben.«
»Er frisst zu viel«, rutschte es aus mir heraus. »Er bekommt wahrscheinlich einen Herzinfarkt, noch ehe er vierzig ist.«
Die Wahrsagerin auf dem Osloer Jahrmarkt nehmen Peter und der Prof entgegen ihrer sonstigen Überzeugung durchaus ernst, denn die »Dame aus Kairo« prophezeit den Freunden einen neuen Fall, bei dem es um Leben und Tod geht. Den Tod ihrer Schulkameradin? Während Katja schwerverletzt im Krankenhaus liegt, untersuchen die Freunde die Umstände ihres Sturzes.
Auf der Suche nach kriminalistischer Erleuchtung begibt sich Peter schließlich in die Fänge einer dubiosen Sekte, die sich »Das Licht des Lebens« nennt. Und schnell bestätigt sich seine Vermutung: Wo Licht ist, da fällt auch Schatten …
Würstchen auf Grönland
Die Junihitze ließ die verdreckte Luft über dem Kessel von Oslo zittern. Man konnte sie fast sehen. Aber natürlich: Es waren nur die Abgase von Autos und Bussen, und die Hitze ließ den ganzen Schmutz über Hausdächern und asphaltierten Bürgersteigen vibrieren. Der Prof und ich waren unterwegs zum Grönland-Platz. Hatten den Alten ein paar zerknüllte Scheine abgeknöpft. Normalerweise war das schwer, zumindest in meiner Familie, aber die Hitzewelle, die die Stadt in den letzten vier Tagen heimgesucht hatte, hatte meine Eltern schlaff und nachgiebig gemacht. Als ich früher an diesem Tag etwas von Kohle gemurmelt hatte, hatte mein Vater mich bloß trübe angestiert und auf seine Brieftasche gezeigt, die auf der Fensterbank lag. Ich wusste, dass sie ausnahmsweise etwas anderes enthielt als eine zerknüllte Monatskarte für die Straßenbahn, denn er arbeitete seit kurzem in Ammerud als Postbote. »Nimm ruhig«, sagte er müde. »Schließlich schufte ich ja für dich und Klein-My.« Er nahm einen tiefen Schluck aus seinem Bierglas und schleuderte mit geübter Bewegung seine einen halben Meter langen Haare in den Nacken. »Verschwende die Kohle aber bloß nicht für Markenklamotten und anderen Quatsch.« Er grinste unter seinem Bart und blies sich Bierschaum vom Schnurrbart. Er hatte tatsächlich Geld genug, um so große Sprüche zu klopfen, ohne dass das allzu peinlich wirkte. Mein Alter macht gern seine Witze mit mir. Findet mich zu ordentlich. Zu spießig, wie er sagt. Kapiert nicht, dass ich nicht so herumwuseln will wie er. Mit Löchern in beiden Hosentaschen und Schulden bis über beide Ohren.
Aber das ist schon in Ordnung. Auf seine Weise ist er ja okay. Reichlich wirr im Kopf, aber okay. Er hat es noch nie geschafft, irgendeinen Job länger als zwei Monate durchzuhalten, aber zum Kranich - mir hat nie etwas gefehlt. Das hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass meine Mutter immer mit beiden Füßen auf festem Boden steht, aber trotzdem. Ich habe meinem Vater immer geglaubt, wenn er sagte, dass er sein Bestes tut. Auch wenn das nicht sehr viel ist im Vergleich dazu, was andere Väter fertigbringen. »Eines Tages …« sagte mein Vater. »Eines schönen Tages werdet ihr sehen …« Der Alte glaubt wirklich an die Zukunft. Tag für Tag kann er mäuschenstill im Sessel sitzen und sich Lou Reed anhören, während er felsenfest davon überzeugt ist, dass der »schöne Tag« sich irgendwo in der Zukunft versteckt.
»Der Prof und ich wollen kurz mal nach Grönland«, erklärte ich und hielt hundertfünfzig Kronen hoch. »Da unten ist heute Abend so eine Art Rummel.«
»Schön. Nehmt Klein-My mit.«
»Zum Henker, nein!« sagte ich. »Das geht einfach nicht, das müsste dir doch klar sein.«
Klein-My unterbrach plötzlich ihre Lego-Bauerei und fing an zu heulen. Sie ist drei Jahre alt, und jetzt hatte sie ihren Namen gehört und verstanden, dass sie bei irgend etwas nicht dabei sein durfte. »Du Schwein!« schrie sie hinter ihrem Tränenstrom und schmiss einen roten Baustein nach meinem Hosenbein. »Schwein, Schwein, Schwein!«
»Da siehst du, was du angerichtet hast«, sagte ich zu meinem Vater und versetzte dem Baustein einen Tritt mit dem rechten dicken Zeh. Aus irgendeinem Grunde gelang mir ein Volltreffer, und der Stein saß plötzlich dem Alten mitten im Gebiss. Vater spuckte Lego und fuchtelte mit den Armen. »Was soll denn das, zum Teufel? Spielst du jetzt etwa Fußball? Hast du mit diesem Unfug angefangen?«
»Keine Panik«, antwortete ich. »Aber sie kann einfach nicht mit kommen.« Um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen, fügte ich hinzu: »Der Prof und ich haben zwei andere Damen eingeladen. Außerdem wollen wir Schnaps trinken und ganz lange ausbleiben.« Er murmelte irgend etwas Unverständliches und nahm Klein-My auf den Schoß. Knutschte sie mit seinem Biermaul ab und sah mich anklagend an: »Guck dir den da an, Klein-My. Der einzige Bruder, den du hast. Und jetzt verlässt er uns!«
Natürlich fing sie daraufhin wieder an zu heulen wie ein durchgebranntes Feuerwehrauto. Und als Vater sich aufspielte und brüllte: »Jetzt nimmt er unser Geld und verlässt uns!« konnte ich einfach nur noch abhauen. Als ich die Treppe zum Prof hinunterlief, der einen Stock unter uns wohnt, fragte ich mich, was ein normaler Mensch wohl denken würde, wenn ich ihm verriete, was sich innerhalb der vier Wände der Familie Pettersen in der Bentsebrugata 12 in Torshov in Oslo so abspielt. Beim bloßen Gedanken daran lief ich schon rot an.
Der Prof stöhnte und fiel langsam zurück. Wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn und schnitt Grimassen. »Hast du da unten eine Verabredung oder was? Ich meine, willst du irgendwo nicht zu spät kommen?«
Der Prof isst gern. Das sieht man. Und er merkt es, wenn er sich bewegt.
»Nein«, antwortete ich. »Aber es wäre doch nett, wenn wir vor morgen früh da unten ankämen. Heute Abend ist sicher mehr los.« Der Prof muss ab und zu einen auf den Hut kriegen. Und leider ist das nur in solchen physischen Zusammenhängen möglich. Viel leicht ist das gemein, aber ich weiß keine andere Möglichkeit. Der Prof ist Fachmann für alle Aktivitäten, die sich oberhalb des Kragens abspielen, um es mal so zu sagen. Reden und denken und so. Selbst die Lehrer müssen passen, wenn der Prof sich über alles verbreitet, was er gelesen und gehört hat. Es gibt einen Ausdruck, »reif für sein Alter sein«. Ich finde, der Prof ist überreif, ja, manch mal ist er direkt angefault. Es ist nicht normal, wenn ein Fünfzehnjähriger weiß, wie der letzte Chef von Polens kommunistischer Partei hieß. Oder wenn er eine Ahnung davon hat, wer um 1945 die besten Krimis in den USA geschrieben hat.
Aber so ist der Prof. Der einzige Grund, warum ich es mit ihm aushalte, wenn er seine Vorträge hält, ist, dass er außerdem auch noch ein unnormal guter Kumpel ist. Außerdem gehört er irgendwie einfach zu mir. Genau wie meine Eltern und Klein-My. Wir wohnen fast seit unserer Geburt im selben Haus, und wir haben schon im Sandkasten im Hinterhof miteinander herumgetobt und gekämpft.
Ich spurtete über die Straße. Legte ordentlich los und ließ ihn weit hinter mir. Raste um eine Ecke herum und stürzte in einen kleinen pakistanischen Laden. Außer mir keine Kundschaft. Ich bekam sofort zwei Eis und warf das Geld dafür auf den Tresen. Ich stand schon an der Ecke bereit, als der Prof eine halbe Minute später angekeucht kam und glaubte, mich verloren zu haben. »Hier!« Ich hielt ihm das Eis unter die Nase und traf ihn damit fast ins rechte Auge. Mit einem Grunzen riss er das Eis an sich und fetzte das Papier herunter. Glotzte mich ein paar Sekunden lang wütend an, dann grinste er und schlug die Zähne in den Schokoladenguss.
Den Rest des Weges legten wir in aller Ruhe zurück, der ganze Unfug hatte uns nämlich allen beiden Seitenstiche eingebracht. Rummel, hatte ich zu meinem Vater gesagt. Das war vielleicht etwas übertrieben. Aber jedenfalls gab es Buden mit Würstchen und Zuckerwatte, Schießbuden, Ballwerfen auf Pyramiden aus Blechdosen, ein Riesenrad, Autoscooter und noch viel mehr, was Geld kostete und Spaß machte. Ein Sommervergnügen für alle die unter uns, die nicht genug Geld hatten, um aus der Stadt herauszufahren und einen kurzen Ausflug zur Hütte oder eine kleine Spritztour mit dem Segelboot zu unternehmen.
»Unterhaltung für das Volk aus den Arbeitervierteln«, wie der Prof sagte. Ich war nicht ganz seiner Meinung, denn die Menschenmenge setzte sich aus allen möglichen Leuten zusammen. Alles, von den Pennern, die auch sonst mit ihren Flaschen hier herumhingen, bis zu den gesitteten Familien, bei denen alt und jung ihren Sonntagsstaat angelegt hatten. Mir war es wurschtegal, woher all diese Leute kamen und wohin sie nachher gehen würden. Es war ein Samstagabend im Juni - und ich war hier, um mich zu amüsieren.
»Ich fang mal mit ein paar Metern Bratwurst an«, erklärte der Prof und drängte sich an einer Würstchenbude aggressiv vor.
»Bist du sicher, dass das so gescheit ist?« fragte ich und folgte ihm mit einem Grinsen, das sicher eher boshaft ausfiel. »Natürlich bin ich sicher!« antwortete er, ohne sich umzudrehen. Er war vorne angekommen und legte los mit seiner Bestellung. »Gib ihm 'ne doppelte Portion Krabben mit Majo!« rief ich dem Pakistaner zu, der hinter dem Tresen am Werk war. »Dieser Mann kommt direkt aus einer Hungersnot! Aber das brauch ich ja wohl kaum zu sagen, das siehst du sicher selber.« Der Pakistaner grinste mich kreideweiß über den Kopf des Prof hinweg an, und ich konnte gewissermaßen hören, wie der Prof bis mindestens zehn zählte, um sich nicht auf dem Absatz umzudrehen und mir ordentlich eine reinzusemmeln.
Er bekam seine Wurst, blechte und drehte sich um. »Ab und zu bist du kindischer als unbedingt nötig«, sagte er. »Mal beißen?«
»Aber sicher.« Ich riss den Schnabel auf, und der Prof schmierte mein ganzes Gesicht mit Krabben in Majo ein. Der Pakistaner hatte wirklich auf meinen Rat gehört. Hatte eine doppelte Portion gegeben.
»Wie du bestellt hast«, erklärte der Prof korrekt. Er erledigte die halbe Wurst mit einem Bissen. »Hier!« Er reichte mir ein schmutziges Taschentuch.
»Na gut«, erwiderte ich. »Heute Abend sind wir also empfindlich.« Ich wies die Sommererkältung des Prof weit von mir. Der Pakistaner hatte meine Notlage erkannt und bekam einen Lachanfall, reichte mir aber trotzdem einen Stapel Servietten. »Das wäre das«, sagte der Prof. Er schnappte sich eine von meinen Servietten und wischte sich die fettigen Finger ab. »Was jetzt? Riesenrad? Autoscooter?«
»Schießbude«, antwortete ich.
»Unterdrückte Aggressivität«, erklärte der Prof und nickte besserwisserisch. »In Ordnung. An der Schießbude kannst du sie ja auf harmlose Weise rauslassen.« Wir mussten uns anstellen, um schießen zu dürfen. Ein Haufen angetrunkener Mannsbilder schickte den sechs Zielscheiben farbenfrohe Pfeile und schien endlose Mengen von Zehnern in den Taschen zu haben. Es war das reine Wunder, dass der Typ hinter dem Tresen nicht zwei Löcher in den Ohren und eins in der Stirn davontrug. Am Ende kamen ihre Frauen und nervten von Essen und mehr Bier, und deshalb kam die Reihe an uns. »Ellbogen aufstützen verboten!« teilte ich dem Prof mahnend mit. »Wer verliert, schmeißt eine Runde Cola und Wurst. Meterweise Wurst.« Er nickte ernst. Ich steckte einen Pfeil mit gelbem Federbusch ins Gewehr und jagte einen zweiten hinterher, fast ohne das zu registrieren. Der Prof leckte sich mit der Zungenspitze hoch oben im rechten Mundwinkel, dann drückte er ab und erzielte einen Sechser. Auf meiner Zielscheibe. »Danke!« sagte ich.
So ging es weiter. Der Prof hatte einfach keine Ahnung. Aber er nahm alles bewundernswert gelassen hin, als wir wieder zur Würstchenbude gingen. 35:4 für Peter Pettersen. »Im Wilden Westen hättest du einfach keine Chance gehabt«, sagte ich mit vollem Mund. »Gib's zu!«
Er sah mich ernst an. »Stimmt. Aber das ist trotz allem kein Problem. Bei Peter Pettersen sieht es schlimmer aus, der hat nämlich keine Ahnung von Mathe und Englisch. Wie willst du denn die Gegenwart in Norwegen überleben?«
Wie gesagt, dem Prof ist nur auf physischer Ebene beizukommen. Aber ich lerne es nie. Ich wollte gerade eine passende Antwort zusammenbrauen, irgendeinen guten Spruch, der ihm den Wind aus den Segeln nehmen würde, als eine Stimme gleich neben meinem rechten Ohr losbrüllte:
»Alles über die Zukunft! Wer möchte schließlich nicht wissen, was ihm oder ihr in diesen unsicheren Zeiten bevorsteht? Wer will nicht wissen, aus welcher Richtung der Wind weht? Jetzt ist das möglich! Die Frau aus Kairo, die berühmte Wahrsagerin, liest Ihnen Ihr Schicksal aus der Hand. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, solange sie hier in Oslo ist. Es kostet nur siebzig Kronen und kann Ihr Leben ändern! Ein Besuch bei der Frau aus Kairo kann Ihr Leben auf den Kopf stellen, kann Einsicht und Klarheit vermitteln!«
Der Typ mit dem Sprachrohr verstreute weiter seine Phrasen in die Menge, und ich zwinkerte dem Prof zu. »Auch das noch. Hier wird heute Abend aber wirklich einiges geboten! Die Frau aus Kairo!«
»Leih mir siebzig Eier!« erwiderte der Prof. »Ich bin pleite.«
Die Frau aus Kairo
Vor dem Wagen der Frau aus Kairo stand eine Schlange. Massenhaft Leute wollten etwas über ihre Zukunft erfahren. Ich war leicht genervt, weil wir so öde herumhängen mussten, aber ich musste mir auch eingestehen, dass ich neugierig war. Siebzig Eier für den Prof. In Ordnung. Aber ich wollte dabei sein, wollte hören, was diese Frau aus Kairo zu erzählen hatte. Ich weiß nicht, aber vielleicht dachte ich mir, dass ich in der Zukunft von Prof auch eine gewisse Rolle spielen würde.
»Wusste ja gar nicht, dass du dich für so was interessierst«, sagte ich, als wir uns endlich der Treppe zum Wagen näherten. »Ich interessiere mich für alles«, erwiderte der Prof. »Für absolut alles. Das Leben ist seltsam.«
»Niemand weiß etwas über die Zukunft«, sagte ich. »Das ist bloß Beschiss und Quatsch. Rausgeschmissenes Geld.«
»Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber das kann ich nur auf eine Weise herausfinden, und dazu muss ich der Dame einen Besuch abstatten.«
»Okay«, sagte ich. »Aber wenn du die siebzig Eier in ihre Büchse steckst, dann kann ich sehen, dass unsere nächste Zukunft weder Cola noch Würstchen enthält.«
»Ich bin satt«, erwiderte der Prof. »Und neugierig.«
Wir kamen an die Reihe. Ein seriöser Herr mit Schlips und Kragen verließ den Wagen mit einem verwirrten Grinsen, vielleicht hatte er erfahren, dass er sehr bald noch eine Million verdienen würde. »Ich soll sagen, dass du gleich reingehen kannst«, sagte er zum Prof. »Bringt das denn was?« fragte ich.
»Himmel!« sagte er und verschwand schwankend in der Menschenmenge. »Himmel, Himmel!«
Der Prof sah mich an. »Alles klar, Pettersen. Jetzt werden wir ja sehen.«
Das erste, was wir sahen, als wir den Wagen betraten, war ein dunkles Zimmer. An den Wänden hingen viele Darstellungen verschiedener Sternbilder. Stier und Jungfrau und der ganze Verein. Und eine Menge Plakate, die erzählen konnten, dass die Frau aus Kairo ganz schön herumgekommen war. Wenn ich ihnen glauben wollte, dann hatte sie in fast ganz Europa den Leuten die Zukunft vorhergesagt. Kopenhagen. Warschau. Berlin. Amsterdam. Erst nach einigen Sekunden hatten meine Augen sich genügend an die Dunkelheit gewöhnt, um die Frau aus Kairo zu entdecken. Sie saß ganz hinten im Wagen, an einem mit grünem Samt bezogenen Tisch.
Die Frau aus Kairo war schön. Sehr schön. Ich schätzte sie auf Ende Dreißig, und sie hatte lange rabenschwarze Haare und fast ebenso schwarze Augen. Von solchen Frauen konnte ich phantasieren, wenn ich nachts allein war - und das war ja schließlich fast immer der Fall.
»Zwei?« fragte sie, als der Prof ihr das Geld reichte. »Es ist mein Geld«, erklärte ich. »Ich betrachte es als eine Investition in die Zukunft meines Freundes.«
Sie lächelte. Ich konnte meinen Blick nicht von ihrem Lächeln wenden.
»Setzt euch.« Sie zeigte auf zwei Hocker vor dem Tisch. Und zum Prof sagte sie: »Ich würde gern einen Blick auf deine linke Hand werfen.« Wenn die aus Kairo ist, kann sie sich dort aber nicht lange auf gehalten haben, dachte ich. Höchstens zwei Stunden nach ihrer Geburt. Wenn sie sprach, dann wirkte es wahrscheinlicher, dass sie aus Kragero in Südnorwegen kam.
Der Prof streckte die Hand aus. Mir fiel auf, dass sie leicht zitterte. Sie fasste seine Hand und ließ nach einer Weile ihren rechten Zeigefinger auf dieser feuchten Unterlage kreisen. Ich bereute bitterlich, dass ich nicht in meine eigene Zukunft investiert hatte. »Du hast eine deutliche und lange Lebenslinie«, begann sie. »Wenn du es gut mit dir meinst, dann kannst du ein langes Leben leben.«
»Er frisst zu viel«, rutschte es aus mir heraus. »Er bekommt wahrscheinlich einen Herzinfarkt, noch ehe er vierzig ist.« Der Prof blickte mich genervt an, während die Frau aus Kairo vorsichtig lächelte. »Ihr seid zwei komische Vögel!«
»Kann schon sein«, sagte ich. »Aber können Sie wirklich in die Zukunft schauen? Dann sind Sie jedenfalls auch ganz schön komisch.«
»Halt die Klappe!« fauchte der Prof.
»In gewisser Hinsicht kann ich das«, antwortete sie ungerührt. »Aber die Zukunft ist nicht festgelegt. Wir Menschen haben einen freien Willen, nicht wahr? Und in diesem Willen liegt unsere Zukunft. Was ich sehen kann, wenn ich in einer Hand lese, ist im Grunde, welche Möglichkeiten es gibt. Und manchmal …« sie warf mir einen vieldeutigen Blick zu, »kann ich auch etwas Konkretes sehen. Ereignisse, die mit großer Wahrscheinlichkeit im Leben eines Menschen eintreffen werden. Und jetzt sehe ich ganz klar, dass es kein Zufall ist, dass ihr beide heute Abend zusammen hergekommen seid. Ihr steht euch sehr nahe.« Das hätte ja wirklich jeder Idiot erraten können, dachte ich. Aber sowohl der Prof als auch ich nickten höflich. »Wie heißt du?« fragte sie den Prof.
»Ich werde Prof genannt«, antwortete er. »Das können Sie auch.«
»Na gut«, meinte die Frau aus Kairo. »Hier kann ich sehen, dass du in deinem Leben viel reisen wirst, Prof. Was hast du für ein Sternbild?«
»Stier.«
»Aha. Dann wirst du wahrscheinlich in Verbindung mit deinem späteren Beruf viel reisen. Denn eigentlich hast du eher Sinn für Gemütlichkeit, du sitzt am liebsten in deinem Sessel, wenn ich mich nicht sehr irre.«
»Stimmt«, sagte der Prof.
Ich war immer noch kein bisschen beeindruckt. Dass der Prof gern auf seinem Hintern saß, hätte jeder Heini erraten können. »Aber gleichzeitig bist du ganz schön abenteuerlustig. Du hast schon spannende Erlebnisse gehabt, und du wirst in Zukunft noch mehr Spannendes erleben.«
Jetzt spitzte ich die Ohren. Der Prof und ich hatten wirklich ein paar reichlich dramatische Geschichten erlebt. Und davon konnte diese Frau ja wohl kaum eine Ahnung haben. »Geht es vielleicht ein bisschen konkreter?« fragte der Prof. »Können Sie mir sagen, in was ich das nächste mal hineinrutschen werde?« Er lächelte schief. »Ich habe wirklich ein paar spannende Sachen erlebt. Mehr als mir lieb war, um ganz ehrlich zu sein.«
»Etwas steht unmittelbar bevor«, sagte sie, ohne mit der Wimper zu zucken. »Ja, es hat sogar schon angefangen.« Ihre Stimme klang jetzt fern, und ich hatte den unheimlichen Eindruck, dass sie wirklich in die Zukunft sah. »Ja, es ist schon im Gang …«
»Im Gang!« wiederholte der Prof aufgeregt.
»Ja. Du sitzt hier bei mir. Und hier fängt es an.« Sie machte eine Pause, und wir saßen stumm da. Plötzlich sagte sie: »Und diesmal geht es um Leben und Tod, junger Mann.«
»Um meinen eigenen Tod?« flüsterte der Prof. »Nein. Du hast noch einen langen Weg vor dir.« Ich schluckte und starrte meine eigene linke Hand an. Sie fuhr fort: »Ich weiß auch nicht, ob einer von den Menschen, mit denen du täglich zusammen bist, sterben wird, aber das Erlebnis, das jetzt auf dich wartet, hat etwas mit dem Tod zu tun. Du wirst vorsichtig vorgehen müssen. Irgendwo in deiner Nähe ahne ich nämlich starke Kräfte, mit denen du kämpfen musst. Geh sparsam mit deinen Kräften um und suche in dir selber Halt. Es kann sein, dass du sie alle brauchen wirst, und es wird nicht ungefährlich sein. Aber du brauchst keine Angst zu haben, du bist stark genug, um mit allem fertig zu werden, was dir jetzt bevorsteht.« Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut, und ich konnte dem Prof ansehen, dass es ihm auch nicht anders ging. Vielleicht war die Art, wie sie sprach, entscheidend, ihr langsamer, psalmodierender Tonfall. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass das alles kein Bluff war.
Den Rest der Zeit, für die wir bezahlt hatten, brauchte sie für praktische Ratschläge und Tipps. Vieles davon war von der Sorte, die es beim Vertrauenslehrer gratis gibt, und deshalb fand ich es etwas übertrieben, dafür siebzig Eier geben zu sollen. Aber ich hatte diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht, als sie mich mit einem seltsam durchbohrenden Blick ansah und mir die Scheine über den Tisch zuschob. »Nimm sie nur.«
Ich lief knallrot an, und der Prof sah mich leicht gereizt an, als ob auch er meine Gedanken gelesen hätte. »Nein, wirklich nicht …« lehnte ich ab.
»Nimm sie«, sagte sie mit derselben ruhigen Stimme. »Es ist richtiger so. Ich kann es nicht näher erklären, aber tu, was ich dir sage. Und wenn die Aufgabe kommt, dann übernehmt ihr auch die.«
»Aber worin besteht denn diese Aufgabe?« wollte der Prof wissen. »Das sehe ich nicht deutlich«, antwortete sie schlicht. »Aber sie liegt direkt vor euch. Ihr werdet sie erkennen, wenn ihr vor ihr steht. Aber jetzt müsst ihr gehen, draußen wartet etwas auf euch.« Ich raffte mein Geld zusammen und murmelte etwas davon, dass es so doch wirklich nicht gemeint gewesen war, und der Prof gab Pfötchen und verabschiedete sich höflich. Dann taumelten wir hinaus in den Sommerabend. »Ich fass es nicht«, murmelte der Prof auf dem Heimweg. »Aber diese Frau hatte einfach etwas an sich. Oder hat sie mich ganz schnöde hypnotisiert?«
»Keinen Schimmer«, antwortete ich. »Ehrlich gesagt. Aber ich bin auch ganz schön wirr im Kopf. Und ich glaube an solchen Quatsch einfach nicht!«
»Na gut«, sagte der Prof. »Wir werden's ja sehen. Sie hat schließlich gesagt, dass uns irgendwas unmittelbar bevorsteht.« Wir gingen weiter. Keiner von uns sagte ein Wort, bis wir fast zu Hause angekommen waren.
»Komm doch mit rauf«, sagte ich, als wir ins Haus gingen. »Dann geb ich dir die Krimis zurück, die ich von dir geliehen habe. Zwei davon waren zu hoch für meine arme Birne. Hab nicht mal die Hälfte gerafft.«
»Ich nehme an, das war Le Carrey, was du nicht kapiert hast?« fragte der Prof.
»Stimmt. Der war zu verwickelt.«
»Du hast einfach keine Ahnung, Peter Pettersen. Der ist der beste Spionage-Autor der Welt. Ohne Konkurrenz. Niemand darüber, niemand daneben, wie es bei der Tour de France heißt!«
»Du sollst dich nicht über Leute lustig machen, die dümmer sind als du«, sagte ich und fummelte am Schlüssel herum. Die folgende Begegnung mit dem Heim meiner Kindheit war ein ziemlicher Hammer, um es harmlos auszudrücken. Die übliche Hippie-Idylle, die absolute Spezialität meiner Familie, war wie weggeblasen. Auf dem Wohnzimmersofa saß, zusammen mit meiner Mutter, mein Klassenkamerad Tom Karlsen. Und er hatte gerade erst einige Liter geweint, das war deutlich zu sehen. Dick geschwollene Augen, rot und scheußlich.
Hier muss irgendwas wirklich heftiges passiert sein, dachte ich. Denn Tom Karlsen war eigentlich nie der Typ gewesen, der sich aus purer Langeweile hinsetzt und losheult. Und schon gar nicht mit der Mutter eines Klassenkameraden. Wir nannten ihn oft »K.-o.-Karlsen«, er ist so ein Typ, der sich groß aufspielt und den Schnabel weit aufreißt. Ich war seit dem ersten Schultag mindestens fünfzehnmal von ihm verprügelt worden, und dabei gehörte ich noch zu denen, die mit ihm am besten auskamen.
»Was ist denn hier los?« fragte ich. »Hat Mutter sich wieder danebenbenommen?« Niemand lachte.