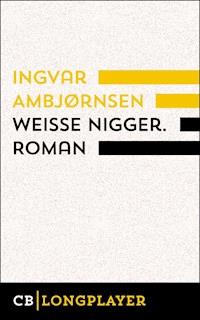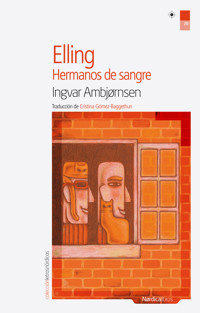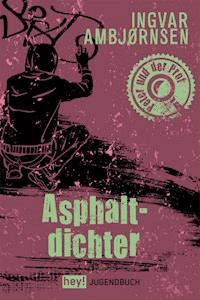9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
14 Originalgeschichten erstklassiger Autorinnen & Autoren, und ein spannendes literarisches Städteporträt: »Hamburg Noir« ist eine tiefschwarze Liebeserklärung an eine facettenreiche Stadt und eine spannende literarische Reise von Hamburgs Norden in die City und auf den Kiez, von Hamburgs Süden über das Heiligengeistfeld und Altona bis in das wohlhabende Blankenese und den Hamburger Yachthafen. Abwechslungsreiche Literatur, die vielstimmig von den Schattenseiten der Gesellschaft erzählt, von einer dunkel schillernden Gegenwart voller ungewöhnlicher Milieus abseits der üblichen Touristenpfade. Unberechenbar, spannend und überraschend. Mal lakonisch, mal magisch-realistisch, mal tragisch oder komisch. So vielschichtig wie die Stadt selbst. Die Reihe »Hamburg Noir« ist nach »Berlin Noir«, »Paris Noir« und »USA Noir« der vierte Band einer Reihe von erstklassigen Noir-Anthologien. Jede der Originalgeschichten spielt in einem anderen Viertel einer Stadt oder, wie bei »USA Noir«, in unterschiedlichen Städten eines Landes. So entstehen packende literarische Porträts mit ungewöhnlichen, breit gefächerten Einblicken. »Das Konzept der Noir-Reihe überzeugt.« Christian Endres
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Hamburg Noir« ist eine tiefschwarze Liebeserklärung an eine facettenreiche Stadt und eine spannende literarische Reise von Hamburgs Norden in die City und auf den Kiez, von Hamburgs Süden über das Heiligengeistfeld und Altona bis in das wohlhabende Blankenese und den Hamburger Yachthafen.
Abwechslungsreiche Literatur, die vielstimmig von den Schattenseiten der Gesellschaft erzählt, von einer dunkel schillernden Gegenwart voller ungewöhnlicher Milieus abseits der üblichen Touristenpfade. Unberechenbar, spannend und überraschend. Mal lakonisch, mal magisch-realistisch, mal tragisch oder komisch. So vielschichtig wie die Stadt selbst.
Über den Herausgeber und die Reihe
Jan Karsten arbeitet als Verleger, Lektor, Übersetzer und Redakteur in Hamburg. Zusammen mit Zoë Beck betreibt er den CulturBooks Verlag.
Jan Karsten (HG.)
Hamburg Noir
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Herausgebers
»Hamburg ist am Tage eine große Rechenstube und in der Nacht ein großes Bordell.« So pointiert brachte der Spötter Heinrich Heine vor gut 200 Jahren die prägenden Pole der Hansestadt Hamburg auf den Punkt: der freie Handel und die Freizügigkeit des Nachtlebens. Hinter dem Spott verbirgt sich die bis heute bestehende Realität Hamburgs als Stadt merkantiler, moralischer und sozialer Gegensätze. Oder wie Ingvar Ambjørnsen einmal schrieb: »Kaufen und Verkaufen, dachte ich. Darum dreht sich doch alles. Und ich dachte an alle, die nichts zu verkaufen hatten und sich folglich auch nichts kaufen konnten und die sich dennoch mit ihren blühenden Neurosen und farbenfrohen Psychosen dort draußen festkrallten.« (Die mechanische Frau, 1991)
Als im 8. Jahrhundert sächsische Siedler am Rande der damals bekannten Welt die Hammaburg errichteten, taten sie es in einer geografisch bestechenden Lage, eingebettet zwischen den Flüssen Alster und Bille, im Rücken das mittelosteuropäische Hinterland und vor sich die Elbe, diesen mächtigen Strom, Lebensader der Stadt und Garant ihres Aufstiegs.
Schon bald ein reger Handelsplatz wuchs die Stadt erst langsam und dann im Laufe des Mittelalters immer rasanter an. Nach der Gründung der Neustadt 1188 und dem Ausbau des Hafens wurde Hamburg zusammen mit Lübeck zum Motor der Hanse, zum Ausfalltor zur Nordsee und nach Westeuropa und schließlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts zur bedeutendsten Handelsstadt Europas und zum gewichtigen Seehandelszentrum, das alle Erdteile miteinander verband.
In dieser Zeit vor dem kommerziellen Flugverkehr war Hamburg buchstäblich das Tor zur Welt. Jeder, der aus Nordeuropa in andere Länder oder die Neue Welt jenseits des Atlantiks aufbrechen wollte, musste dies von Hamburg aus tun. So war die Hansestadt sehr früh schon ein kosmopolitischer Schmelztiegel aus vielen unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen. Inzwischen haben fast 40 Prozent der hier lebenden Menschen ihre Wurzeln in über 170 Ländern.
Und auch heute noch ist der Hamburger Hafen einer der umschlagsgrößten der Welt. Mit seinen Schiffen und Kränen, seinem Menschengewimmel, den Möwenschreien, den Geräuschen und Gerüchen der Werften und Löschdocks und Lagerhallen ist er seit je identitätsstiftender Fixpunkt der Stadt. Ein Fixpunkt, der in der Geschichte immer wieder neue Metamorphosen durchlaufen hat: von den Koggen der Hansezeit über die Großsegler und Stückgutfrachter bis zu den modernen Containerriesen. Gerade wird mit der HafenCity rund um die 866 Millionen Euro teure Elbphilharmonie ein neues Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen.
Das ist die eine Seite der Stadt, wie sie sich in touristischen Hochglanzbroschüren präsentiert, von dem maritimen Breitwandpanorama an den Landungsbrücken über die charakteristischen Kontorhäuser im Unesco-Weltkulturerbe der historischen Speicherstadt und den herausgeputzten Nobelkaufhäusern rund um die Binnenalster, diesen glitzernden See im Herzen der Stadt, bis zu den Rotlichtklischees des Vergnügungsviertels St. Pauli.
Hamburg Noir möchte die weniger ausgeleuchteten Bereiche der Stadt in Augenschein nehmen, abseits der Superlative, die sich Hamburg als »schönste Stadt der Welt« so gern ans Revers heftet.
Zwar hat Hamburg keine exorbitant hohen Kriminalitätsraten, der Index liegt irgendwo zwischen dem von Chennai, Melbourne, Bangkok und San Diego, aber das Verbrechen war trotzdem nie die Ausnahme von der Regel, sondern stets integrativer Bestandteil der Stadtgeschichte. Da gibt es die skrupellosen Entscheidungen der Mächtigen, die ganz logisch mit einer Handelsstadt verschlungenen Verbrechen wie Schwarzmarkthandel und Schmuggel von Gütern aller Art (erst 2021 wurden im Hafen 16 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von bis zu 3 Milliarden Euro sichergestellt, der größte europäische Fund aller Zeiten) und nicht zuletzt die ganz alltägliche Drogen- und Beschaffungskriminalität und die sich meist unter der Wahrnehmungsschwelle abspielenden Verteilungskämpfe des organisierten Verbrechens, nicht nur im Rotlichtviertel.
Und dann sind da natürlich die ganz normalen Begleiterscheinungen des menschlichen Lebens, die Obsessionen und die folgenschweren Entscheidungen, die wir aus Liebe, Gier oder Eifersucht, aus Not und Notwendigkeit, aus Verzweiflung, Hass oder Wut treffen.
Denn Hamburg war immer auch ein Ort der Gestrandeten: der ausgemusterten Seeleute, der schief Abgebogenen, der gescheiterten Glücksritter und Traumjäger. Bereits im Mittelalter war die Stadt geprägt durch soziale Gegensätze. Reiche Reeder-Dynastien und wohlhabende Kaufleute auf der einen und Massenarmut, Hunger und Not auf der anderen Seite. So trafen die Kriege und Katastrophen der Neuzeit die Ärmeren ganz besonders: als etwa während der französischen Besatzung ab 1806 alle Hamburger, die nicht nachweisen konnten, genug Lebensmittel für vier Monate im Haus zu haben, die Stadt verlassen mussten und sich schließlich durch Flucht und Tod die Bevölkerungszahl halbierte. Oder als 1892 in den Gängevierteln, den damals größten Slums Europas, in denen die von der Hoffnung auf ein besseres Leben angelockten Menschen unter mittelalterlichen Bedingungen auf engstem Raum beieinander lebten, ein Cholera-Ausbruch mehr als 8500 Todesopfer forderte.
Andererseits zeigte sich bei aller Ungleichheit die Stadt Hamburg insgesamt im Umgang mit ihren Katastrophen meist pragmatisch und resilient. Als der Große Brand 1842 ein Drittel der Altstadt, inklusive Rathaus und Nikolaikirche, zerstörte, führte dies zu einem Modernisierungsschub und zu den breiten Straßen und modernen Gebäuden, die das Bild der Innenstadt zum Teil noch heute prägen.
Seine ganze Widerstandskraft, seinen ganzen Willen zum Überleben und Wiederaufbau benötigte Hamburg dann nach den verheerenden Bombenangriffen während des Zweiten Weltkriegs. Im Sommer 1943 starben bei den bis dahin beispiellosen Angriffen britischer und amerikanischer Bomber innerhalb von zehn Tagen mehr als 34 000 Menschen. Der Feuersturm der »Operation Gomorrha« zerstörte die Hälfte des Hamburger Wohnraums, ganze Stadtteile verwandelten sich in apokalyptische Trümmerlandschaften – nur der Turm des Michel blieb unversehrt. Wer die Bilder von damals sieht, kann kaum glauben, dass Hamburg nur 15 Jahre später wieder eine pulsierende Großstadt war. Bei allem Abriss, bei allem Auf- und Neubau bewahrte sich Hamburg doch stets seinen unverwechselbaren Charakter. So prägen nach wie vor die Türme der fünf charakteristischen Hauptkirchen die Skyline der Innenstadt, auch weil bis heute – einem ungeschriebenen, aber ehernem Gesetz folgend – kaum ein modernes Gebäude die 132 Meter hohe Michelspitze überragt.
Und noch immer zählt der Industrie- und Wirtschaftsstandort Hamburg zu den reichsten Regionen Deutschlands und ist das Zuhause der meisten Millionäre des Landes. Ein äußerst ungleich verteilter Reichtum, wie sich an den vielen verschiedenen Gesichtern der Hansestadt ablesen lässt: von den Kapitänshäusern und Villen mit Elbblick in Blankenese über die fast ländlichen Vororte, die sozialen Brennpunkte südlich der Elbe und im Nordosten, in denen teilweise jedes zweite Kind unterhalb der Armutsgrenze lebt, bis zu den urban verdichteten Hotspots in Altona, St. Georg und St. Pauli.
Hamburgs ambivalente, über die Jahrhunderte gewachsene Identität findet vielfältigen Widerhall in den Geschichten der vorliegenden Anthologie, die einige der besten und bekanntesten Autorinnen und Autoren Hamburgs versammelt, Spitzenkräfte der deutschen Krimi- und Literaturlandschaft, mehrfach ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis, dem Hubert-Fichte-Preis und vielen anderen. Relative Newcomer und etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit einem teils Jahrzehnte umspannenden Werk. Wie Ingvar Ambjørnsen, der Mitte der Achtzigerjahre aus Norwegen nach Hamburg kam und in vielen seiner Romane den gesellschaftlichen Dropouts und Kleinkriminellen, den Prostituierten und Säufern so einfühlsam wie schonungslos eine Stimme gab. Wie Frank Göhre, eine der prägendsten Figuren der deutschsprachigen Kriminalliteratur, der Wirklichkeit und Fiktion zu schnell geschnittenen, assoziations- und dialogreichen Gesellschaftsstudien verdichtet und mit seinem milieustarken Werk eine viele Dekaden umfassende alternative Chronik der Hansestadt entwirft, die immer wieder deutlich macht, wie sehr politische und unternehmerische Macht, kleinkriminelles Milieu und Organisierte Kriminalität miteinander verschlungen sind.
Nora Luttmer nimmt uns mit in das sehr internationale Gewerbegebiet von Rothenburgsort, wo Tante Lien ihr kleines vietnamesisches Restaurant betreibt und ein stiernackiger Schutzgeldeintreiber das austarierte soziale Gefüge zwischen ghanaischen Händlern, senegalesischen Tagelöhnern, zwischen Afghan Bazar, Stehimbiss und Import-Export-Libanon bedroht.
Hamburg als Einwanderungsstadt der täglichen Ankünfte führt uns Jasmin Ramadan vor Augen, deren gerade in der Hansestadt angekommene sudanesische Kunststipendiatin auf der Suche nach einer verschwundenen Frau, in deren Wohnung sie wohnen darf, an einem unerwarteten Ort eine Ersatzfamilie findet: in einer Eimsbütteler Eckkneipe.
Es ist kein Wunder, dass in einer Hafenstadt Kneipen eine zentrale Rolle spielen: die Bars und Szeneläden, die Kaschemmen und Absturzkneipen an den Landungsbrücken oder auf dem Kiez, oft rund um die Uhr geöffnet und manchmal die einzige Konstante im Leben ihrer Besucher. So wie in Tina Uebels Nachruf auf das Clochard, eine Kiez-Institution, in der diejenigen einen Platz fanden, die sonst nirgendwo einen Platz finden, und die den Lockdown während der Pandemie nicht überlebt hat.
Doch nicht nur die Kneipen bestimmen den Rhythmus auf dem Kiez, Hamburg ist schon lange neben einer Feier- auch eine Musikmetropole. Hier wurde Johannes Brahms geboren, hier haben die Beatles ihre Karriere begonnen, hier locken die Musicals massenweise Besucher an den drittgrößter Musical-Standort der Welt. Aber vor allem haben die vielen kleinen Clubs (nicht nur) rund um die Reeperbahn die musikalischen Subkulturen der letzten Jahrzehnte geprägt, sei es Swing – während der Nazizeit unter sehr realer Lebensgefahr – Jazz, Rock ’n’ Roll, Punk, Avantgarde-Pop oder Hip-Hop.
Und so steuern passenderweise zwei Autoren Geschichten bei, die auch als Musiker seit Jahrzehnten bekannt sind. Bela B Felsenheimer erzählt mit viel schwarzem Humor von Kleindealern und Türstehern auf St. Pauli und einem Problem namens »Rocken Roll«, und Timo Blunck inszeniert ein tief in der Hamburger Geschichte wurzelndes »Grusical« als Parodie auf die Musical-Boomtown Hamburg, Serienkillerromane und den neuen Kochfetischismus der Mittelschicht.
Wie sich scheinbar ganz harmlose Begegnungen zu einer immer größeren Bedrohung verdichten können, zeigt Brigitte Helbling. Bei ihr erfahren wir von dem japanischen Aikido als Kunst, mit Gefahren umzugehen – wenn auch ganz anders als gedacht. Bei Kai Hensels Coming-of-Age-Erzählung im Schaustellermilieu ist es das Aufeinandertreffen zweier Jugendlicher auf dem Hamburger Dom, das für die etwas verunsichernde Erkenntnis sorgt, dass ein Verbrechen zu begehen nicht immer etwas Schlimmes sein muss.
In »Der Auftrag« macht sich Katrin Seddig mit literarischen Mitteln auf die Suche nach dem Wesen der Stadt. Wenn sie ihre Heldin durch eine fast expressionistische Stadtlandschaft voller infernalisch lärmender Ausfallstraßen, Zerfall und Großbaustellen flanieren lässt, in denen das »Neue, Schöne, Saubere« das »Alte, Versumpfte, Zugewachsene« verdrängt und überschreibt, dann ist das ein Echo vergangener Trümmerlandschaften, denn: »Das Wesentliche der Stadt ist tödlich.« Und natürlich ist Seddigs Geschichte ein Hinweis auf die Gentrifizierung als ständigen Begleiter einer Stadt, in der immer wieder darum gestritten wird, wer denn nun das Gesicht ihrer Quartiere bestimmt, die Menschen, die dort leben, oder einmal mehr Finanzinvestoren und Immobilienspekulanten.
Von dem Absturz eines modernen Finanzhais, der seine Private-Equity-Firma durch die Investition in Crypto-Währungen in den Sand gesetzt hat, erzählt Till Raether cool und lakonisch. Ein tiefer Fall, der den Verlierer des Crypto-Crashs auf die südliche Seite der Elbe führt, in die wenig glamourösen Industriehafenausläufer hinter dem modernsten Containerterminal Europas, wo Menschen in ausrangierten Lagerhallen leben, den unregistrierten Zwischenräumen der Stadt.
Egal wo in Hamburg man sich befindet, das Wasser ist nie weit entfernt. So auch bei Matthias Wittekindt, der seinen Kommissar Manz als jungen Beamten in den Siebzigerjahren im Osten Hamburgs ermitteln lässt, wo in einem Nebenarm der Elbe die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, nicht weit entfernt von einem Segelflug-Club, in dem alteingesessene Hanseaten ihre Wochenenden verbringen.
Noch weiter in die Vergangenheit führt uns Robert Brack, nämlich zurück ins Altona von vor 100 Jahren. Damals noch unabhängig, war es eine Schlafstadt für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den Hamburger Fabriken unter widrigen Umständen Tabak und andere Waren weiterverarbeiteten, die der Handel Tag und Nacht in die Stadt spülte. Lebendig und anschaulich erzählt Brack von Zigarrendrehern und Zigarettenstopferinnen, einer tragischen Liebe in patriarchalischen Zeiten und von einer aufrührerischen Arbeiterschaft, die den alltäglichen Drill auf dem »Exerzierplatz des Kapitalismus« gründlich satthat.
Wie sehr auch in der Gegenwart Klassengegensätze das Schicksal der Menschen bestimmen, zeigt Zoë Beck. Vor der Kulisse der Elbchaussee und des Hamburger Yachthafens inszeniert sie den Filz der so oberflächlichen wie abgründigen modernen Hamburger Unternehmer in einer Funken schlagenden Mikrodramedy, die auf bösartig-beiläufige Weise vor Augen führt, wie sehr auch heute noch Geld das Lösungsmittel ist, das alle Probleme zum Verschwinden bringt und Existenzen vernichtet, fast unbemerkt.
Die 14 Geschichten sehen hin, wo gute (Kriminal-)Literatur immer schon hingesehen hat: Sie führen in weniger bekannte Milieus und Lebenssituationen und immer wieder auch zu den Unangepassten, den Gestrandeten, den Machtlosen, die durch die Raster der Handelsstadt gefallen sind. So vielfältig wie die Hintergründe der Mitwirkenden, so unterschiedlich sind die Perspektiven auf die Metropole als bunte Menschenansammlung in einem hoch lebendigen Millionenstadtgetümmel, das wir hier breit gefächert vor Augen geführt bekommen. Zwischen Wasser und Schnaps, zwischen Macht und Ohnmacht, zwischen Traum und Wirklichkeit.
Jan Karsten
Hamburg, Juni 2023
Teil 1
Die AmeisenstraßeVon Nora LuttmerRothenburgsort
Der Geruch von Zimt und Sternanis erfüllte die Luft. Heute stand phở bò auf der Mittagskarte. Nudelsuppe mit fein geschnittenen Rinderbruststreifen. Kaum jemand bestellte etwas anderes. Und das trotz der Hitze. Draußen herrschten für Hamburg ungewöhnliche 35 Grad, und mit jedem Gast, der kam oder ging, drückte heiße Luft in das kleine Bistro.
Lien stand hinter dem Tresen, wie immer in einem eng anliegenden schwarzen Oberteil mit Stehkragen, die Haare zu einem strengen Dutt aufgesteckt, und mischte Fruchtsäfte. Fast alle Plätze waren besetzt. Für einen Moment schloss sie die Augen und lauschte dem Wirrwarr der Stimmen, diesem Durcheinander der Sprachen, deren Klang sie liebte, ohne sie zu verstehen.
Vor einem Jahr war sie mit ihrem Bistro aus der Innenstadt hierher in die Billstraße umgezogen, mitten ins Gewerbegebiet von Hamburg-Rothenburgsort. Eine Straße mit Kopfsteinpflaster und aufgesprungenem Asphalt, auf der abends die Lkw in doppelten Reihen parkten. In Schuppen und Werkhallen hatten sich Großhändler niedergelassen. Nichts, was es hier nicht gab: alte Waschmaschinen, Matratzen, Hi-Fi-Anlagen, Fahrräder, Röhrenfernseher, Kühlschränke, Kronleuchter, Trödel aller Art. Und Dinge, die hierzulande längst als Schrott ausgemustert waren. Ein Großteil davon wurde nach Afrika verschifft.
Alle hatten sie für verrückt erklärt, dass sie ihren Laden in bester Lage hinter den Deichtorhallen hierfür aufgab. Für Rothenburgsort, dieses vergessene Viertel, das geprägt war von Industrie, den Ausläufern des Hafens mit Anlegern und Schrottplätzen – und der Elbe und ihren Zuflüssen.
In der Innenstadt hatte sie zwölf Euro für eine Schale phở nehmen können, hier nur noch 5,90 Euro.
Aber sie war mittlerweile 66 Jahre alt, und sie hatte keine Geduld mehr für gestresste Innenstadt-Gäste, hippe Kreative, frustrierte Büromenschen. Es war ihr alles zu viel geworden.
Hier draußen, nur zwölf Busminuten und doch eine ganze Welt von der Innenstadt entfernt, war es entspannter, unaufgeregter. Hier fühlte sie sich wohl.
Lien hatte das Bistro von einem Polen übernommen. Der Gastraum war nicht groß, hatte aber eine breite Fensterfront zum Gewerbehof raus. Gegenüber war Mohammeds Import-Export-Libanon, wobei alles, was er verkaufte, ›Made in China‹ war. Schaukelpferde, Waschzuber, Eimer, Kunstrollrasen am Meter, Klobrillen … Alles Plastik. In leuchtenden Farben.
Das Bistro hatte Lien belassen, wie es war: offene Küche hinter dem Tresen, weiße Wände, Tische mit Resopalplatten, schlichte Stühle. Sie glaubte, das Einzige, was zählte, war das Essen, nicht irgendwelcher dekorativer Schnickschnack. Nur der kleine Schrein mit den Figuren von thầntài und thổ địa, dem Heiligen des Wohlstands und dem kleinen Erdgott, ließen darauf schließen, dass es sich um ein vietnamesisches oder zumindest ein asiatisches Bistro handelte. Er stand auf dem Boden neben der Eingangstür.
Die Mittagszeit war um. Langsam leerten sich die Tische. Die Gäste zahlten, dankten mit einem Nicken, gingen. Lien griff nach einer der grünen Mangos, die sie heute Morgen gekauft hatte, ging um den Tresen herum und legte sie auf den Schrein. Dann goss sie für thần tài und thổ địa auch noch etwas Schnaps in kleine Tässchen und zündete Räucherstäbchen an.
Als sie sich wieder aufrichtete, sah sie durch die Scheibe einen Mann auf der anderen Seite des Hofs stehen, gedrungen und bullig. Er rauchte und sah zu ihr herüber.
Ma quỷ – Geister und Dämonen, fluchte Lien. Sie merkte, wie ihre Hände klamm wurden, das Blut ihr in den Schläfen hämmerte. Unbehagen breitete sich in ihr aus, und Wut. Ja, vor allem Wut. Der Mann da draußen wartete nur darauf, dass der letzte Gast das Bistro verließ. Dann würde er zu ihr rüberkommen, seine Forderung stellen. Ihr die Summe nennen, die sie bei ihm abzuliefern hatte.
Die Schutzgelderpresser, die seit Wochen Unruhe in der Gegend stifteten, arbeiteten zu zweit. Bisher war der hier noch nicht bei ihr gewesen, immer nur der andere. Erst letzte Woche wieder. Erik hatte er sich genannt, wobei er sicherlich anders hieß.
Vor wenigen Tagen hatte das Fahrradlager am Ende der Straße gebrannt. Die Rettungskräfte konnten das Übergreifen auf umliegende Gebäude nur mit Mühe verhindern. Niemand wusste sicher, ob das Feuer auf das Konto der beiden ging. Aber das war auch egal. Solange es nur alle glaubten, festigte es die Macht, die sie ausübten.
Lien sah zu dem Mann hinüber, erwiderte seinen Blick. Ihre Augen funkelten zornig, aber das konnte dieser Kerl auf die Entfernung natürlich nicht sehen. Am liebsten hätte sie einfach abgeschlossen. Nur war das leider auch keine Lösung.
Mit einem Seufzen griff sie nach dem Reisstrohbesen, der in der Ecke neben dem Schrein stand, und während ihr letzter Gast noch aufaß, fegte sie schon einmal die Essensreste zusammen, die über Mittag runtergefallen waren. Die Borsten schrappten mit einem harten Kratzen über den PVC, der hier vorne ausgelegt war. Lien erwischte auch ein paar Ameisen, die hektisch hin und her krabbelten, als hätten sie sich verirrt und fänden nicht zu ihren Artgenossen zurück.
Und dann, wie sie es vorausgesehen hatte, betrat der Mann das Bistro. Genau in dem Moment, als ihr letzter Gast ging.
Breitbeinig und mit vor der Brust verschränkten Armen baute er sich vor ihr auf. Sie roch seinen Zigarettenatem, in den sich der beißende Geruch scharfer Seife mischte. Lien schätzte ihn auf 25, höchstens 30 Jahre. Sein Gesicht war breit, fleischig. Er trug weiße Turnschuhe, wie alle heutzutage, Jeans und ein schwarzes Shirt, unter dem sich seine Muskeln abzeichneten. Im Fitnessstudio antrainierte Muskeln, dachte Lien, die nach etwas aussahen, aber zu nichts zu gebrauchen waren, außer zum Stemmen von Gewichten. Ein Schlangentattoo wand sich um seinen Unterarm. Seine blonden Haare klebten verschwitzt an seinem Kopf, Schweiß-perlen hingen ihm auf der Oberlippe, seine Haut glänzte rot.
Die Hitze stand ihm nicht.
»Wir haben bereits geschlossen«, sagte Lien wie nebenbei, als kenne sie nicht den eigentlichen Grund seines Kommens.
»Du schuldest mir 800 Euro. Für den letzten Monat«, sagte er mit rauer, heiserer Stimme. Er rauchte hörbar zu viel.
»Ach. Dann sind Sie der Kollege von Erik?«, sagte sie so, als sei Erik ein Freund.
»Kollege?« Der Mann schnaubte. »Ich bin Eriks Boss.«
»Ich hab Erik das Geld gegeben«, sagte sie. »Letzte Woche erst.« Lien lächelte so, wie sie dachte, dass der Mann es von ihr erwartete. Asiatinnen lächelten doch immer. Sogar wenn ein Schutzgelderpresser auf der Matte stand. Was für ein Blödsinn.
Der Mann trat jetzt von einem Bein auf das andere, seine Kiefer mahlten. »Is nicht bei mir angekommen.«
»Das kann doch nicht sein. Fragen Sie ihn! Ich habe es ihm ganz bestimmt gegeben.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Du gibst mir das Geld. 800, keinen Cent weniger.«
»Aber … ich kann doch nicht doppelt zahlen.«
»Dein Pech.«
»Das ist zu viel«, sagte Lien in dem Versuch, die Forderung vielleicht doch noch abzuwenden. Oder zu mindern. »Das habe ich nicht.«
»Dann besorg’s. Ich gebe dir zwei Tage.« Sein Ton erlaubte keine Widerrede.
Sie nickte vage. »Ich sehe, was ich tun kann.«
Er sog die Luft lautstark durch die Nase ein, seine Schultern hoben sich, sein Brustkorb wurde breiter. Er plusterte sich auf.
»800 Euro. Übermorgen.«
Damit drehte er sich um und ließ sie stehen.
Schwer atmend sah Lien zu, wie er sich langsam über den Gewerbehof entfernte. Einmal noch schaute er sich nach ihrem Bistro um. Ob er schon überlegte, wie er es am besten in Brand stecken sollte?
Was hatten seine Ahnen nur für Hundescheiße gefressen?
Das hier war ihr Reich und ihr Leben.
Konnte nicht einmal etwas problemlos vonstattengehen? Sie wollte doch einfach nur in Frieden ihren Laden betreiben. Ohne fremde Hilfe. Ohne Abhängigkeiten. Und verdammt noch mal ohne irgendwelche selbst ernannten Schutzgelderpresser im Nacken.
Kaum war der Mann verschwunden, stürmte Mohammed, ihr Hofnachbar, von hinten durchs Lager ins Bistro. Und mit ihm wehte ein unangenehmer Geruch in den Gastraum. Abgestandenes Wasser, Algen … So zumindest erklärte Lien ihn. Niemand wunderte sich weiter. Das Lager hatte einen Zugang zum Billekanal, und bei der Hitze konnte der ganz schön riechen, weshalb Lien immer darauf achtete, dass nach hinten raus alles geschlossen war.
»Tür zu«, rief sie nun auch sofort.
Aber Mohammed, der Lien mit seiner großen massigen Gestalt und dem freundlichen runden Gesicht immer an einen Bären denken ließ – einen nicht-bissigen Bären –, war viel zu aufgeregt, um zu reagieren. »Tante Lien«, stammelte er völlig atemlos. Obwohl er kaum jünger als sie war, nannte er sie Tante. Eine Respektsbezeichnung. »Bei dir war er also auch.« Es war eine rhetorische Frage, natürlich hatte Mohammed beobachtet, wer sich da vor ihrer Tür herumgedrückt hatte.
»Er hat gedroht … meiner Tochter was anzutun«, redete Mohammed auch schon weiter, so schnell, dass sich seine Worte überschlugen und Lien Mühe hatte, ihn zu verstehen. »Wenn ich nicht zahle. Aber ich … so viel … schon wieder … es … wie soll ich das nur zusammenkriegen.«
Er schloss die Augen, und Lien ahnte, welche Bilder sich in seinem Kopf abspulten. Bilder davon, was passieren würde. Sie legte Mohammed eine Hand auf den Arm.
»Die reden nur«, sagte sie, ohne es selbst zu glauben. Aber irgendwie musste sie ihn ja beruhigen. Sie mochte Mohammed, und er tat ihr leid.
Er presste die Lippen zusammen, ganz blass. In seinen Augen lag die pure Angst. »Doppelt zahlen«, stammelte er verzweifelt. »Was können wir dafür, wenn dieser Erik einfach mit unserem ganzen Geld abgehauen ist?«
»Hat er das gesagt?«, fragte Lien überrascht. »Dass Erik abgehauen ist?«
Mohammed schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. »Das hab ich so gehört, draußen … Alle reden darüber …«
Natürlich. Was die Gerüchte anging, war es hier wie auf dem Dorf.
»Was soll ich nur machen?«
»Da kannst du nichts tun. Sieh nur zu, dass du das Geld zusammenbekommst«, sagte Lien. »Für deine Tochter.«
Was für ein erbärmlicher Ratschlag. Einknicken, sich unterordnen, aufgeben.
Aber was sonst sollte sie Mohammed sagen? Dass alles gut werden würde?
Mohammed trottete mit hängendem Kopf davon, wieder, ohne die Lagertür hinter sich zu schließen. Bevor sie heute zum Abend öffnete, würde sie noch mal gut durchlüften müssen. Aber nicht jetzt, noch war es draußen zu heiß. Und die Hitze würde den Geruch nur verstärken.
Lien nahm ihren Besen und fegte weiter. Es war fast meditativ: Die Bewegung, mit der sie den Besen über den Boden zog. Das immer selbe kratzende Geräusch.
Als sie mit dem Gastraum fertig war, machte sie im Lager weiter.
Auch dort hinten zu fegen, hatte sie sich zur täglichen Angewohnheit gemacht. Zwischen Reissäcken, Kisten mit Nudeln, 10-Liter-Flaschen Fischsoße und sonstigen Vorräten, die sie für ihre Küche brauchte, marschierten kleine schwarze Ameisen. Hier eine Ameisenstraße, dort eine Ameisenstraße, schön geordnet in Reih und Glied.
Mit dem Besen fuhr sie quer durch die Tierchen, die sofort auseinanderstoben. Sie schaffte es, einige in die Kehrschaufel zu fegen, die mit dem langen Stiel, sodass sie sich nicht bücken musste. Die anderen Ameisen sammelten sich wieder, marschierten weiter, als sei nichts gewesen. Sie wiederholte das Spiel. Aber es waren zu viele. Diese verfluchten Ameisen würden ihr noch zum Verhängnis werden.
Sie hatte versucht, die Löcher zu stopfen, durch die sie in den Raum gelangten. Erfolglos. Wenn sie einmal da waren, fanden sie immer einen Weg. Um die Säcke herum, unter den Kisten hindurch, an den Flaschen vorbei, bis unter die schwere Kühltruhe. Absolut zielsicher. Vielleicht war sie ja auch ein bisschen wie eine Ameise, dachte Lien. Zielsicher war sie auf jeden Fall. Allerdings marschierte sie nicht in Kolonne, sondern alleine. Immer alleine.
Sie hatte mal irgendwo gelesen, dass Ameisen zu den sehr frühen Leichenbesiedlern gehörten und sich vom Keratin in den Wimpern, Augenbrauen und den oberflächlichen Hautschichten ernährten. Was für eine Vorstellung.
Einen Tag später
Es war nicht viel los. Nur hin und wieder kam jemand herein, um schnell etwas zum Mitnehmen zu bestellen. Das Thermometer war am Mittag wieder auf über 30 Grad gestiegen. Zum Abend hin kühlte es nur geringfügig ab. Der Ameisen war Lien immer noch nicht Herr geworden.
Als sie das Bistro abschloss, war es längst dunkel draußen. Sie musste aufpassen, dass sie auf dem unebenen Kopfsteinpflaster nicht umknickte.
Wie jeden Abend ging sie zu Fuß nach Hause. Sie wohnte mittlerweile im Stadtteil, in einem, wie sie fand, etwas seelenlosen Neubau, rosa gestrichen, als hätte jemand händeringend versucht, dem Haus mit der Farbe Leben einzuhauchen. Aber dafür war sie ganz in der Nähe der Elbe, keine dreihundert Meter vom Fluss entfernt. Nachts hörte sie die schwerfällig tuckernden Motorengeräusche der Frachter und das metallische Quietschen der Züge, wenn sie über die Elbbrücken fuhren. Das mochte sie sehr.
Trotz der späten Stunde waren in der Billstraße noch fast alle Ladenrollos hochgezogen. Das für Hamburg so selten gute Wetter musste genossen werden, und sei es mit einem Klappstuhl vor dem Geschäftstor. Niemand wollte nach Hause in seine engen vier Wände. Auch Lien eigentlich nicht, aber sie war müde, und spätestens um fünf Uhr musste sie schon wieder auf dem Großmarkt sein, sonst wäre das beste Gemüse weg.
Vor dem Stehimbiss Deutsche China Küche standen senegalesische Tagelöhner, aßen billigen Reis mit Soße und tranken ihr Feierabendbier. »Hey Lien«, grüßten sie sie. Hin und wieder waren sie auch bei ihr zu Gast. Lien grüßte zurück.
Ein paar Meter weiter räumten mehrere Frauen die Lagerhalle von Jakobus, einem Ghanaer, nach dem abendlichen Gottesdienst auf. Sie schoben Verkaufstische zurück an ihren Platz und stapelten die Stühle in einer Ecke. Auch sie grüßten. Lien war keine Christin, nahm aber trotzdem manchmal an ihren Gottesdiensten teil. Es gab ihr ein Gefühl von Zugehörigkeit, und gleichzeitig lief sie nicht wie in der vietnamesischen Pagode Gefahr, dass man versuchte, sie zu eng einzubinden. Etwas, das sie nicht wollte. Sie war Einzelkämpferin, in allen Bereichen ihres Lebens. Auch ein Grund, warum sie das Bistro alleine betrieb, ohne Aushilfen. Denen musste man sowieso mehr hinterher sein, als dass sie eine Entlastung wären. Und im ghanaischen Gottesdienst war sie willkommen, aber doch auch eine Außenstehende, die man in Ruhe ließ.
Beim Afghan Bazar bog sie links in den Ausschläger Billdeich ab und dann noch mal links auf den Billhorner Deich. Die wenigen Straßenlaternen warfen mehr Schatten, als dass sie Licht spendeten. Hier war es um diese Uhrzeit mit Abstand dunkler und unbelebter als in der Billstraße, aber ein Kribbeln im Nacken verriet ihr, dass sie nicht alleine war. Jemand folgte ihr.
Sie streckte sich, ging erhobenen Hauptes weiter, drehte sich nicht um. Es brauchte nur die matte Spiegelung eines Kioskfensters, um ihr Gefühl zu bestätigen. Hinter ihr ging eine bullige, gedrungene Gestalt. Der namenlose Schutzgelderpresser. Es wunderte sie nicht wirklich. Sie hatte sich schon gedacht, dass er seiner Forderung noch einmal Nachdruck verleihen würde. Einfach, weil es ihm Spaß machte, andere einzuschüchtern, Angst zu verbreiten.
Er bewegte sich leichtfüßig und mit einer Geräuschlosigkeit, die Lien auch einmal eigen gewesen war, die sie aber mit dem Alter eingebüßt hatte. Dennoch, gespürt hatte sie seine Anwesenheit trotzdem. Eine Tatsache, die ihr eine gewisse Genugtuung verschaffte.
Sie ging an einer Gruppe Jugendlicher vorbei, die auf einer Bank saß und weder sie noch ihren Verfolger beachtete. Er war jetzt dicht hinter ihr, zog aber nicht weiter auf. Ihr war klar, dass sich das noch ändern würde.
Obwohl sie ihre gut gepolsterten Gesundheitsschuhe trug, schmerzte ihre Hüfte beim Gehen. Ein altes Leiden. Sie versuchte, es zu ignorieren. Bloß keine Schwäche zeigen. Weit hatte sie es nicht mehr. Nur noch durch die Grünanlage mit dem Hochbunker und dann rechts.
Die Außenwände des Bunkers waren von Flechten, Pilzen und Moos überzogen. Eine Ratte rannte im Schein einer Laterne an der Bunkerwand entlang. Auf einem der städtischen Mülleimer hüpften zwei Krähen und hackten mit ihren Schnäbeln auf eine mit was auch immer gefüllte Plastiktüte ein. Ihre Krallen schabten über das Metall. Der Weg war übersät mit leeren Dosen und fauligen Bananenschalen. Lien machte einen großen Schritt darüber hinweg und hätte fast aufgeschrien. Mit der Bewegung war ein stechender Schmerz durch ihre Hüfte geschossen, und sie musste mehrmals tief ein- und ausatmen, bis es wieder erträglich war. Eine Hand in den Rücken gestemmt, um den Schmerz abzufangen, ging sie weiter. Jetzt humpelte sie.
Und ihr Verfolger nutzte ihre Schwäche.
Er machte einen Schritt neben sie. »Schmerzen?«, fragte er. Es klang hämisch.
Sie ignorierte ihn, humpelte weiter.
Er packte sie am Arm, riss sie herum, sodass ihre Blicke sich trafen. Das Weiß seiner Augen war gerötet wie bei einem kranken Bullterrier. Ein amüsiertes Lächeln zuckte um seinen Mund. Er war wirklich einer, der es genoss, anderen Angst zu machen, dachte Lien. Da war er wie ihr Bruder, Hung, den alle nur den Gnädigen nannten, obwohl er alles andere als das war. Zu DDR-Zeiten hatte Hung als Vertragsarbeiter in einer Produktionsstätte für Glühlampen bei Karl-Marx-Stadt gearbeitet, nach dem Fall der Mauer dann wie so viele andere in Berlin geschmuggelte Zigaretten verkauft. Aber er war schnell in der Hierarchie aufgestiegen. 1992 war er schon einer der großen Bosse gewesen. In den späten Neunzigerjahren dann, als die Berliner Polizei verstärkt gegen vietnamesische Banden vorging, setzte er sich nach Tschechien ab, wo er sich als seriöser Geschäftsmann etablierte. Mit Marktbuden, Bistros, Import-Export. Aber er hatte weiterhin seine Finger in allen möglichen illegalen Geschäften.
Lien hatte darüber nachgedacht, ihren Bruder zu bitten, ihr wegen der Schutzgeldsache zu helfen.
Doch Schwester hin oder her – seine Unterstützung funktionierte wie ein lebenslanges Franchising-System. Man hörte nie mehr auf zurückzuzahlen. Und das wollte sie nicht.
Sie musste es alleine regeln.
»Ich besorge das Geld«, sagte sie und drehte ihren Arm aus der Umklammerung. Morgen würde sie einen dicken blauen Fleck haben.
»24 Stunden«, sagte der Mann und ging ganz gemächlich, ganz selbstsicher davon. Und sie stand zitternd da, mit schmerzender Hüfte. Sie ballte die Hände zu Fäusten, versuchte, ihre Wut zu unterdrücken. Was nahm dieser Kerl sich bloß heraus. Hier die ganzen sozialen Geflechte durcheinanderzubringen, zu meinen, alles mal so eben mit seinem Furcht einflößenden Gehabe aufmischen zu können. Es ärgerte sie unglaublich. Nach Hause konnte sie so jetzt jedenfalls nicht. Sie musste erst mal runterkommen, durchatmen.
Also ging sie am Bunker vorbei bis zum Entenwerder Fährhaus, einem kleinen Fachwerkhaus, das mit all seinen Anbauten und Verschlägen an eine Hexenhütte erinnerte. Gleich dahinter lag die Elbe.
Die Weiden an der Uferböschung zeichneten sich dunkel gegen den mondhellen Himmel ab, ein Frachter schob durch die Fahrrinne. Das Dröhnen seines Motors hallte zu ihr herüber. Wasser schwappte, irgendwo kläffte ein Hund. Möwen schrien. Nicht einmal sie schliefen bei der Hitze. Drüben auf der anderen Flussseite leuchteten die gelblichen Lichter der Industrieanlagen, in dessen Schein sich der Rauch der Schornsteine in dichten Säulen in den Himmel schraubte, um sich dann langsam in der Dunkelheit zu verlieren. Nur wenige Meter vom Ufer entfernt trieb ein kleines Boot. Nicht mehr als ein schwankender Schemen in der Nacht.
Lien atmete tief durch und sog den vertrauten, leicht modrigen Geruch des Schlicks ein. Und langsam beruhigte sie sich wieder. Die Elbe hatte diese Wirkung auf sie. Dieser Fluss, der sich so stoisch dahinschob. Seine unbändige Kraft unter der dunklen Oberfläche verborgen, aber deutlich spürbar.
24 Stunden später
Es war fast Mitternacht, und sie war alleine im Bistro, als er den Laden betrat.
»Deine Frist ist abgelaufen«, sagte er. Ein Spruch wie aus einem Film.
Lien nickte.
Sie hatte schon auf ihn gewartet.
Sie schloss die Kasse auf, hob die Münzbox hoch, nahm den vorbereiteten Geldumschlag heraus, reichte ihn dem Mann.
Er griff danach, setzte sich ihr gegenüber an den Tresen.
Während er nachzählte, stellte sie das Gas unter dem Topf mit der Rinderbrühe an, den sie extra für ihn zur Seite gestellt hatte, holte das Fleisch aus dem Kühlschrank und nahm das Messer vom Magnetstreifen an der Wand.
Sie schloss die Augen, konzentrierte sich ganz auf das Messer in ihrer Hand. Sie liebte diesen Moment, in dem die Klinge durch das Rindfleisch glitt, fast widerstandslos. Lien hatte das Messer vor Jahren aus Vietnam mitgebracht. Es war handgeschmiedet. Der Holzgriff war vom langen Gebrauch schon ganz schwarz und abgegriffen.
Sie sah wieder den Mann an, stellte sich vor, wie der weiche Stahl durch seinen Hals glitt wie durch Butter. Er würde nicht schreien, dafür würde ihm mit durchschnittener Kehle die Luft fehlen.
»Mit schön viel Fleisch«, sagte er. Es klang wie ein Befehl.
»Natürlich«, antwortete sie so unterwürfig wie möglich. Sollte er sich doch in seiner Selbstsicherheit suhlen.
Wenn er auch nur eine Ahnung hätte, wer sie war.
Dann würde er sie vielleicht nicht so unterschätzen.
1972 war Lien nach Deutschland gekommen, in die damalige DDR. Sie war für ein Studium ausgewählt worden – als demobilisierte Soldatin. Was das anging, waren die Kommunisten schon zu ihrer Jugendzeit ziemlich modern gewesen. Oder pragmatisch – wie man’s auffasste. Sie hatten alle genommen, die für ihre Sache waren. Auch die jungen Mädchen.
Sie war bei der Frauenjugendbrigade gewesen, an der Front aufgetreten, um die Soldaten zu motivieren. ›Lauter singen als die Bomben‹. Nach drei Wochen an der Front war sie die einzige Überlebende der Truppe. Danach war sie an die Waffe gewechselt. Damals hatte sie schnell gelernt zu töten. Ohne zu zögern und ohne Mitleid. Obwohl es ihr, wenn sie heute darüber nachdachte, von Anfang an nicht schwergefallen war. Ihr Ziel war es, zu überleben, alles andere zählte für sie nicht. So ist es im Krieg gewesen, und so war es heute noch.
Sie schnitt weitere Rinderbruststreifen ab und legte dann mit einem gewissen Bedauern das Messer beiseite. Sie war zu alt, der Mann noch jung. Sie wäre nicht mehr schnell genug. Er würde sich wehren.
Sie nahm eine Schüssel aus dem Regal, warf eine Handvoll gekochter Reisnudeln hinein, gab Sojasprossen dazu und legte das rohe, frisch aufgeschnittene Fleisch obenauf. Mit einer großen Kelle schöpfte sie dampfende Fleischbrühe darüber, wodurch das hauchdünn geschnittene Fleisch sofort garte. Das Ganze bestreute sie mit Frühlingszwiebeln, Sojasprossen und den kleinen Blättern von vietnamesischem Koriander. Bevor sie die Schüssel auf den Tresen stellte, gab sie noch etwas Knoblauchessig dazu und drückte eine geviertelte Limone über der Brühe aus.
Der Mann nahm den Löffel, schlürfte vorsichtig von der Brühe. Nickte anerkennend. Immerhin. Es schmeckte ihm.
Jetzt war es Lien, der ein amüsiertes Lächeln um den Mund zuckte.
Sie stellte zwei Gläser und die Flasche rượu thuốc zwischen ihn und sich. »Selbst eingelegter Kräuterschnaps. Ein altes Familienrezept. Immer gut«, sagte sie und schenkte ein. Sie wollte mit ihm anstoßen.
Der Mann sah das Glas an, dann sie, dann wieder das Glas. Er zögerte. Er fragte sich, was da wohl drin war. Er war misstrauisch. Klug von ihm. Aber zu spät.
Lien hob ihr Glas. »Auf die Gesundheit!«, sagte sie und trank. Der Schnaps war scharf und brannte im Rachen.
Nun griff auch der Mann nach dem Glas, doch es rutschte ihm aus der Hand, noch bevor er es an den Mund geführt hatte. Mit einem Klirren zersprang es auf dem Boden.
Wäre er mal besser schon bei der phở misstrauisch gewesen. Nicht erst beim Schnaps.
Auch ein altes Familienrezept, das Gift, schnell und äußerst wirksam.
Der Mann riss erschrocken die Augen auf, wankte – sogar im Sitzen. Und begriff. Panik lag in seinem Blick, in diesem letzten Bruchteil der Sekunde, bevor sich seine Pupillen nach oben drehten und nur noch das Weiß zu sehen war. Schaum kam aus seinem Mund. Er sackte zusammen, sein Oberkörper fiel auf den Tresen, der Kopf schlug in die phở. Die Schüssel zerbrach.
Was für eine Schweinerei.
Lien beugte sich nah zu ihm vor, legte ihre Finger an seinen Hals, suchte den Puls. Er war schon schwach. »Gier führt stets ins Unglück«, flüsterte sie ihm ins Ohr, schenkte sich noch ein Glas ein, trank.
Dann ging sie um den Tresen herum, stieß den mittlerweile toten Mann vom Hocker.
Mit einem dumpfen Laut ging er zu Boden.
Lien packte ihn an den Füßen, schleifte ihn durch den Gastraum nach hinten. Sein lebloser Körper war höllisch schwer. Noch schwerer als der von Erik. Der Schmerz pochte in ihrer Hüfte. Jeder Atemzug stach in ihrer Lunge. Verdammt, sie war langsam wirklich zu alt für so was.
Im Lagerraum musste sie erst mal verschnaufen. Den Rücken vorgebeugt, die Hände auf die Knie gestützt, stand sie da. Um ihre Füße wuselten die Ameisen. Diesmal nicht ganz so geordnet wie sonst.
Ob die den Tod riechen konnten? Auf jeden Fall bogen sie von ihrem üblichen Weg ab und krabbelten auf den neuen Leichnam zu.
Lien wartete, dass ihr Atem wieder gleichmäßig ging, dann stemmte sie sich mit beiden Händen gegen die Kühltruhe und schob. Das Schrappen von Metall auf Beton jagte ihr eine Gänsehaut über die Arme. Krrr, krrr, krrr. Ein Stück noch, ein kleines Stück noch, dann hatte sie es geschafft.
Die Bodenluke lag frei.
Direkt unter dem Lager verlief ein gemauerter Schacht, etwa ein Meter Durchmesser, leicht geneigt, durch den Regenwasser von der Straße in den Kanal abgeleitet wurde. Und auch wenn Lien mal ihr Lager mit dem Schlauch aussprühte, floss das Wasser dorthin ab. Durch Rillen in der Luke. Sehr praktisch.
Mit einer extra dafür angefertigten Eisenstange, die vorne leicht gebogen war, zog sie den Deckel hoch und drückte sich sofort den Arm vor Mund und Nase. Es stank wirklich erbärmlich. Fürs Erste würde sie die Rillen wohl verschließen müssen. Gips, Silikon, Beton, irgendwas würde ihr schon einfallen. Das Natron, das sie im Großhandel bestellt hatte, war immer noch nicht geliefert worden. Und die kleinen Päckchen, die sie im Supermarkt bekommen hatte, reichten eindeutig nicht aus, um den Geruch auch nur annähernd zu neutralisieren.
Von wegen abgestandenes Wasser und Algen. Es war der süßliche Geruch von Verwesung. Schon verwunderlich, dass bislang niemand das erkannt hatte und alle ihre Erklärung mit dem angrenzenden Kanal schluckten. Aber gut, wenn man nie mit dem Tod zu tun gehabt hatte …
Sie sah in den Schacht, konnte nichts als Schwärze erkennen. Erst als sie mit der Taschenlampe ihres Smartphones hineinleuchtete, sah sie die Ameisen. Und Erik. Sie fluchte. Der Verwesungsprozess war noch nicht sonderlich weit fortgeschritten. Und so, wie er da lag, war kein Platz mehr für seinen toten Freund. Lien holte ihren Besen, schob den Stiel in den Schacht und drückte. Sie spürte das aufgedunsene Fleisch, wie es nachgab. Aber sie rutschte immer wieder ab, und Dutzende Ameisen kamen ihr über den Holzstiel entgegen. Sie schlug sie weg. Das fehlte ihr jetzt noch, dass die Viecher auch auf ihr rumkrabbelten und sie mit ihrem ätzenden Urin bepinkelten.
Aus der Küche holte sie sich die große Suppenkelle mit dem langen Stiel. Die hatte mehr Ansatzfläche, allerdings musste Lien sich dafür auf den Boden knien, um näher an den Leichnam ranzukommen. Wirklich, in ihrem Alter. Der Schmerz aus ihrer Hüfte zog mittlerweile bis in die Zehenspitzen runter, sie versuchte, ihn so gut es ging zu ignorieren. Der zweite Tote musste verdammt noch mal auch in diesen Schacht rein, irgendwie.
Den nächsten Schutzgelderpresser, der in der Billstraße aufschlug und sie und ihre Nachbarn bedrohte, würde sie im Wald erschießen, am besten da, wo es Moor gab, wo er direkt rücklings hineinfiel und versank. Ohne so einen Kraftakt hier. Sie war fix und fertig. Und klatschnass geschwitzt, ausgerechnet sie, die sonst nie schwitzte.
Mit der Kelle schaffte sie es schließlich, Erik ein Stück zur Seite wegzudrücken, weiter in das Rohr hinein. So weit, dass nur noch Schultern und Kopf zu sehen waren. Das würde reichen. Da würde Eriks aufgepumpter Boss jetzt draufpassen.
Schwerfällig stemmte Lien sich vom Boden auf, zerrte den zweiten Toten das letzte Stück zur Luke, schob ihn die Füße voran hinein. Kurz verkanteten sich seine Schultern, und sie dachte schon, sie müsste ihn wieder nach oben ziehen, aber dann trat sie nach und mehrere Fußtritte später sackte er das Stück nach unten, das es brauchte, um den Bodendeckel über ihm zu schließen.
Jetzt musste sie nur noch hoffen, dass die beiden Kumpane da in ihrem Schacht sich bis zum Herbst, wenn die ersten Starkregen drohten, so weit zersetzt hatten, dass das Regenwasser zum Kanal hin abfließen konnte. Nicht dass jemand auftauchte, um das verstopfte Rohr zu begutachten.