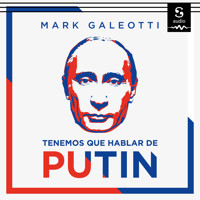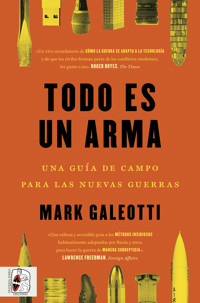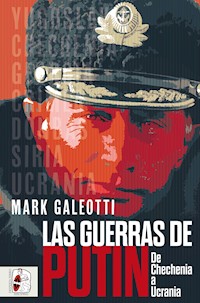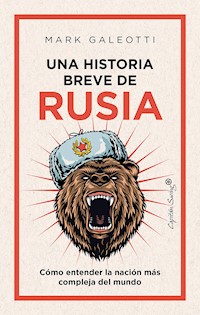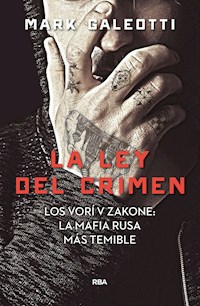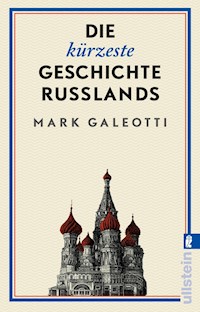
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Russland ist eine der mächtigsten Nationen der Erde, mit einer imposanten Kultur, aber auch einer langen Geschichte von Krieg und Frieden, Leid, Katastrophen und blutigen Revolutionen. Der Russland-Experte Mark Galeotti widmet sich in seiner Erzählung diesem komplexen Land, das einen entsetzlichen, für den Westen unverständlichen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Er durchleuchtet die russische Geschichte von ihren Anfängen mit der Kiewer Rus über den Aufstieg und Fall der Romanows, schildert die kommunistische Revolution unter Lenin und den stalinistischen Terror bis in die heutige post-sowjetische Autokratie Putins. Kann man dieses Land je verstehen? Mark Galeotti liefert die wichtigsten historischen Eckpunkte und Einblicke in die Entwicklung dieses so rätselhaften wie spannenden Landes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die kürzeste Geschichte Russlands
Der Autor
MARK GALEOTTI, geboren 1965, ist ein britischer Historiker, Experte für russische Sicherheitspolitik und profunder Kenner der Putin-Ära. Er leitete lange Zeit das Zentrum für Europäische Sicherheit am Institut für Internationale Beziehungen in Prag und war zuvor Professor für Internationale Beziehungen an der New York University.
Das Buch
Russland ist eine der mächtigsten Nationen der Erde, mit einer imposanten Kultur, aber auch einer langen Geschichte von Krieg und Frieden, Leid, Katastrophen und blutigen Revolutionen. Der Russland-Experte Mark Galeotti widmet sich in seiner Erzählung diesem komplexen Land, das einen entsetzlichen, für den Westen unverständlichen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Er durchleuchtet die russische Geschichte von ihren Anfängen mit der Kiewer Rus über den Aufstieg und Fall der Romanows, schildert die kommunistische Revolution unter Lenin und den stalinistischen Terror bis in die heutige post-sowjetische Autokratie Putins. Kann man dieses Land je verstehen? Mark Galeotti liefert die wichtigsten historischen Eckpunkte und Einblicke in die Entwicklung dieses so rätselhaften wie spannenden Landes.
Mark Galeotti
Die kürzeste Geschichte Russlands
Aus dem Englischen von Stephan Pauli
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH 2022© 2021, 2022 by Mark GaleottiAlle Rechte vorbehalten.Titel der englischen Originalausgabe: A Short History Of Russia, erstmals erschienen 2021 bei Ebury Press, UK.Redaktion: Heike WolterAlle Karten: Helen SterlingUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenSatz: KCFG – Medienagentur, NeussTitelabbildung: GettyImages / DigitalVision Vectors / © Grafissimo
ISBN 978-3-8437-2868-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Einführung
1. »Lasst uns nach einem Fürsten suchen, der über uns herrsche.«
2. »Um unserer Sünden willen kamen unbekannte Volksstämme.«
3. »Autokratie von Gottes Gnaden«
4. »Geld ist die Schlagader des Krieges.«
5. »Ich werde eine Autokratin sein. Das ist mein Beruf.«
6. »Orthodoxie. Selbstherrschaft. Volkstümlichkeit«
7. »Das Leben ist besser, das Leben ist lustiger geworden, Genossen.«
8. »Russland ist wieder auf die Beine gekommen.«
Ein Schlusssatz
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Einführung
Widmung
Russland ist ein Land mit einer gewissen Zukunft; nur seine Vergangenheit kann nicht vorhergesagt werden.– Sowjetisches SprichwortEinführung
Das älteste Buch in Russland spricht mit mehr als einer Stimme. Es brüllt und wimmert, murmelt und klagt, lacht und flüstert, betet und brabbelt in immer leiseren Tönen. Im Juli 2000 entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen in einem der historischen Viertel einer der geschichtlich bedeutsamsten Städte Russlands – Nowgorod, einst bekannt als »Großmächtiger Herr Nowgorod« oder »Nowgorod, die Große« – drei Holztafeln, die mit Wachs überzogen und zu einem Buch zusammengebunden waren. Laut Radiokarbonmethode und anderer Datierungsverfahren stammen sie aus der Zeit zwischen 988 und 1030 n. Chr. In die Wachstafeln wurden zwei Psalmen geritzt. Doch handelt es sich um ein Palimpsest, ein Dokument, das immer wieder verwendet, über Jahrzehnte mehrfach überschrieben worden war und bei dem frühere Schriftzeichen weiterhin zu erahnen waren. Erst die akribische Arbeit des russischen Linguisten Andrei Salisnjak deckte eine verwirrende Abfolge von Schriftzeichen auf, die einst zu Tausenden in das Wachs geritzt worden waren: Man findet die »spirituelle Anleitung eines Vaters und einer Mutter für den Sohn«, den Anfang der Apokalypse des Johannes, eine Liste des kirchenslawischen Alphabets und sogar eine Abhandlung »Über Jungfräulichkeit«.
Und das ist absolut passend.
Palimpsest-Volk
Russland ist ein Land ohne natürliche Grenzen, es lässt sich nicht auf einen einzigen Stamm oder ein Volk zurückführen, es besitzt keine wirklich zentrale Identität. Schon seine reine Größe ist verblüffend – über elf Zeitzonen erstreckt es sich von der europäischen Festungsregion Kaliningrad, die heute vom Rest des Heimatlandes abgeschnitten ist, bis zur Beringstraße, gerade einmal 82 Kilometer von Alaska entfernt. Bedenkt man obendrein, wie unzugänglich viele seiner Regionen sind und wie verstreut seine Bevölkerung lebt, versteht man, warum seine Herrscher alles daransetzten, die zentrale Kontrolle über das Land zu bewahren, und warum ihnen schon der Gedanke, sie zu verlieren, einen so großen Schrecken einjagte. Einmal traf ich einen (pensionierten) KGB-Offizier, der zugab: »Wir dachten immer, es gehe um alles oder nichts; entweder wir hielten das Land fest im Griff, oder es würde auseinanderfallen.« Ich vermute, seine Vorgänger, seien es zaristische Offiziere oder frühe mittelalterliche Fürsten, hatten so ziemlich dieselben Sorgen – und ganz gewiss auch Putins Funktionäre, allen Fortschritten der modernen Kommunikation zum Trotz.
Seine Lage an der Scheidelinie zwischen Europa und Asien bedeutet auch, dass Russland für alle das immerwährende »Andere« ist. Für Europäer ist es Asien und für Asiaten Europa. Seine Geschichte wurde von außen geformt. Fremde überfielen das Land, von den Wikingern bis zu den Mongolen, vom Deutschritterorden ebenso wie von Polen, Napoleons Franzosen und Hitlers Deutschen. Selbst wenn es nicht von feindlichen Armeen bedrängt wurde, wurde es doch von äußeren Kräften beeinflusst. Ob es sich nun um kulturelles Kapital oder technologische Innovationen handelte, immer begab es sich auf die Suche jenseits der eigenen Grenzen. Zudem hat es das Fehlen eindeutiger Begrenzungen mit beharrlichen Expansionsbestrebungen beantwortet, wodurch es neue ethnische, kulturelle und religiöse Identitätsschichten hinzugewann.
Russen sind demzufolge ein Palimpsest-Volk, Bürger einer Patchwork-Nation, die in allen Lebensbereichen so gut wie immer auf externe Einflüsse verweist. Ihre Sprache belegt dies. Ein Bahnhof etwa heißt woksal, nach dem Londoner Bahnhof Vauxhall, wohl Ergebnis einer unglücklichen Übersetzungspanne während des Besuchs einer vor Ehrfurcht ergriffenen russischen Delegation im England des 19. Jahrhunderts. Allerdings sprach die russische Elite damals Französisch, weshalb sie ungeachtet des englischen Bahnhofs die bagasch in ihre kuschet lud. Im damals russischen Odessa trugen die Straßen italienische Namen, weil dies die gemeinsame Handelssprache im Schwarzmeerraum war. Und seit der Zeit, als Stalin versuchte, die sowjetischen Juden zur Umsiedlung nach Birobidschan an der chinesischen Grenze zu überreden, ist Jiddisch dort die Lokalsprache. Im Kasaner Kreml steht eine orthodoxe Kathedrale neben einer Moschee, während im hohen Norden Schamanen Erdölpipelines segnen.
Natürlich sind alle Völker mehr oder weniger Verbindungen unterschiedlicher Religionen, Kulturen und Identitäten. In einem Zeitalter, da das Lieblingsgericht der Briten Curry ist, die Académie française weiterhin einen vergeblichen Kampf gegen Fremdwörter in der französischen Sprache führt und mehr als einer von acht US-Bürgern im Ausland geboren wurde, ist dies allein noch nichts Besonderes. Doch sind es drei Dinge, die an Russlands Geschichte auffällig sind. Als Erstes die schiere Tiefe und Vielfalt seiner dynamischen, elsternartigen Aneignung äußerer Einflüsse. Zum Zweiten die besondere Art und Weise, wie sich die unterschiedlichen Schichten übereinandergelegt und so genau dieses Land mit seiner spezifischen Kultur geschaffen haben. Mögen auch alle Länder Amalgame sein, so unterscheiden sie sich doch sehr durch die Zutaten und die Art, wie sie miteinander vermengt werden. Das Dritte ist die russische Antwort auf ebendiesen Prozess.
Weil sie sich ihrer fluiden, vielfach gekreuzten Identität durchaus bewusst – oft peinlich bewusst – waren, schufen die Russen eine Reihe nationaler Mythen, in denen diese entweder verleugnet oder gepriesen wurde.
Wie ich im ersten Kapitel noch detailreicher ausführen werde, wurde die Gründung dessen, was wir heute Russland nennen, tatsächlich durch eine nationale Ad-hoc-Geschichte verschleiert: Die Unterwerfung durch fremde Wikinger wurde so umgeschrieben, als hätten die Eroberten ihre Eroberer selbst eingeladen. Seither gab es eine wahre Flut solcher Legenden, sei es darüber, wie Moskau zugleich christlich und zum »Dritten Rom« wurde, die Wiege der wahren Christenheit (nachdem das erste von Barbaren geplündert worden und das »Zweite Rom«, Byzanz, an den Islam gefallen war), oder sei es der heutige Versuch des Kremls, Russland als letzte Bastion traditioneller gesellschaftlicher Werte und ein Bollwerk gegen eine von Amerika dominierte Weltordnung in Szene zu setzen.
Zurück in die Zukunft
Die Mongolen eroberten die Rus im 13. Jahrhundert, und als ihre Macht schwand, erfanden sich ihre tüchtigsten Kollaborateure, die Moskauer Fürsten, als größte Helden ihrer Nation neu. In der Hoffnung, genau die Zukunft zu schaffen, die ihnen vorschwebte, überarbeiteten russische Herrscher ein ums andere Mal die Vergangenheit, typischerweise, indem sie sich für ihre Zwecke bei kulturellen oder politischen Mythen und Symbolen bedienten. So vereinnahmten diese Zaren etwa die Symbole des ruhmreichen Byzanz, doch blickte der Doppelkopfadler in ihrem Fall sowohl nach Westen als auch nach Süden. Über die Jahrhunderte sollten Russlands vielschichtige Beziehungen zum Westen eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Zuweilen hieß dies, neue Ideen und Werte zu übernehmen und anzupassen. Peter der Große etwa befahl seinen Untertanen, ihr Kinn nach europäischer Mode zu rasieren (oder eine eigens eingeführte »Bartsteuer« zu entrichten); die Sowjets begründeten eine ganze Gesellschaft auf ihrem Verständnis einer Ideologie, die Karl Marx auf Deutschland und Großbritannien anzuwenden gedachte. Manchmal wiederum galt es, westliche Einflüsse entschlossen und bewusst abzuwehren, selbst wenn man hierfür die Vergangenheit neu definieren musste, etwa durch Ignorieren aller archäologischen Hinweise, wonach die Ursprünge des Landes auf seine Eroberung durch die Wikinger zurückgehen. Doch hieß dies nie, den Westen zu ignorieren.
Heute hofft eine neue Elite, ein Narrativ zu finden, das es ihr erlaubt, sich die angenehmen Aspekte des Westens herauszupicken – iPhone und Londoner Penthouse abzüglich einer progressiven Einkommenssteuer und des Rechtsstaats –, und dabei sich und ihr Land so zu definieren, wie es den eigenen Bedürfnissen entspricht. Sie ist dabei nicht immer erfolgreich und macht sich damit nicht nur Freunde, allerdings: Mit der Zeit fragte sich diese Oberschicht immer weniger, wo ihr Platz in der Welt ist, und immer mehr, wie die Welt sie behandelt. Dies ist der Kern jener Dynamik, die zum Aufstieg Wladimir Putins und seiner Verwandlung von einem eigentlich weltoffenen Pragmatiker in einen nationalistischen Kriegsherrn führte, der 2014 die Krim annektierte und in der Südostukraine einen nicht erklärten Konflikt schürte, bis er schließlich 2022 mit einer groß angelegten Invasion begann. Russland ist heute ein Land, in dem die Neuschreibung der Geschichte nicht nur ein weitverbreitetes Hobby darstellt, sondern zu einem eigenen Industriezweig geworden ist. In Ausstellungen kann man die Grundlinien heutiger Politik bis ins Mittelalter zurückverfolgen, als entsprängen sie einem einzigen, ununterbrochenen Entwicklungsprozess. Die Regale der Buchhandlungen ächzen unter revisionistischen Geschichtswerken, und Schulbücher werden auf Linie mit den neuen Glaubensgrundsätzen gebracht. Statuen von Lenin stehen Schulter an Schulter mit jenen von Zaren und Heiligen, als ob sich die jeweiligen von ihnen verkörperten Vorstellungen von Russland nicht widersprächen.
Das Grundthema dieses Buches ist also, die Geschichte dieses faszinierenden, bizarren, ruhmreichen, verzweifelten, ärgerlichen, blutigen und heldenhaften Landes vor allem durch zwei miteinander verknüpfte Aspekte zu erforschen: wie aufeinanderfolgende Einflüsse jenseits seiner Grenzen die Palimpsest-Nation Russland geformt haben und wie sich Russen mithilfe einer Reihe kultureller Konstruktionen damit arrangierten, ihre Geschichte schrieben und überschrieben, um die eigene Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu beeinflussen. Und wie dies im Gegenzug nicht nur ihr fortwährendes Projekt der Nationenbildung, sondern auch ihre Beziehungen zur Welt zu prägen begann. Dieses Buch wurde nicht für Spezialisten geschrieben, sondern für alle, die sich für die Hintergründe eines Landes interessieren, das zugleich als wirres Relikt eines alten Weltreichs abgeschrieben und als existenzielle aktuelle Bedrohung für den Westen wahrgenommen wird.
Indem ich eintausend Jahre einer ereignisreichen und oft blutrünstigen Geschichte zu diesem kurzen Buch verdichte, zeichne ich sie unvermeidlich mit groben Zügen. Am Ende eines jeden Kapitels stelle ich weiterführende Literatur vor, die wissenschaftlicher vorgeht und hilft, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich habe mir in diesem Buch nicht vorgenommen, alle Details russischer Geschichte umfassend zu behandeln. Vielmehr möchte ich den wiederkehrenden Aufstiegen und Untergängen dieser außergewöhnlichen Nation nachgehen und untersuchen, wie die Russen selbst diese Geschichte verstanden, erklärt, mythologisiert und umgeschrieben haben.
Weiterführende Lektüre: Für einen ersten Überblick über Russlands tausendjährige Geschichte gibt es viele gute Bücher, die ich aufgrund ihrer besonders eleganten Herangehensweise oder ihres eigentümlichen Stils empfehlen könnte. Ich will mich auf wenige beschränken. Geoffrey Hoskings Russian History: A Very Short Introduction (Oxford University Press 2012) ist genau das, was sie behauptet zu sein: eine sehr kurze Einführung in die Geschichte Russlands. Eher journalistisch als wissenschaftlich geschrieben, erweist sich Martin Sixsmiths Russia: A 1000-Year Chronicle of the Wild East (BBC 2012) als lebendiger und lesbarer Überblick. Nataschas Tanz. Eine Kulturgeschichte Russlands (Berlin Verlag 2003) von Orlando Figes konzentriert sich vor allem auf die letzten beiden Jahrhunderte, stellt aber nichtsdestotrotz eine Glanzleistung dar. Wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt, dann gilt dies für eine Landkarte mindestens genauso, und Martin Gilberts Routledge Atlas of Russian History (Routledge 2007) stellt eine äußerst nützliche Sammlung dar. Geschichte ist auch in Ziegeln und Steinen eingeschrieben, und Catherine Merridales brillantes Buch Der Kreml. Eine neue Geschichte Russlands (Fischer 2015) macht den Moskauer Kreml zum Hauptdarsteller der Geschichte Russlands.
Ein Hinweis zur Sprache
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus dem Russischen zu transkribieren. Ich habe mich entschieden, russische Wörter so wiederzugeben, dass sie ihrer Aussprache möglichst nahekommen, außer in Fällen, in denen sich bestimmte Schreibweisen so sehr etabliert haben, dass eine Neuschreibung verwirren würde. Sprache ist an sich politisch, wie auch die Art, wie wir über etwas sprechen, vorgibt, wie wir über etwas denken. Dies wurde insbesondere in der postsowjetischen Zeit deutlich, als Staaten mit ihrer Unabhängigkeit vom Zentrum auch ihre linguistische Autonomie geltend machten. Dies gilt insbesondere für die Ukraine: Heute wird der Name ihrer Hauptstadt als Kyjiw wiedergegeben. Ich wähle für die Stadt vor 1991 dennoch weiter die Bezeichnung Kiew, keinesfalls um das Recht der Ukraine auf Eigenstaatlichkeit zu bezweifeln, sondern um darauf hinzuweisen, inwieweit die Stadt einmal Teil einer größeren slawischen und russischen politischen Ordnung war. Außerdem bilde ich den Plural russischer Wörter, indem ich ihnen statt des korrekten -i oder -y ein -s oder -en anhänge. Puristen bitte ich um Verzeihung.
1. »Lasst uns nach einem Fürsten suchen, der über uns herrsche.«
Chronik
862?
Ankunft Rjuriks, Geburt der neuen Nation der Rus
882
Oleg erobert Kiew und verlegt seine Hauptstadt von Nowgorod dorthin
980
Wladimir der Große wird Großfürst von Kiew
988
Wladimir ordnet die Bekehrung zum orthodoxen Christentum an
1015
Wladimirs Tod löst innerdynastische Kämpfe aus
1036
Jaroslaw der Weise kontrolliert alle Länder der Rus
1054
Jaroslaws Tod löst innerdynastische Kämpfe aus
1097
Fürstentag von Ljubetsch
1113
Wladimir Monomach wird auf Bitten der Kiewer Bevölkerung Großfürst
Wiktor Wasnezow: Die Ankunft Rjuriks am Ladogasee (1909)
Wiktor Wasnezows Darstellung von Fürst Rjuriks Ankunft an den Ufern des Ladogasees ist ein Klassiker ganz eigener Art. Die Nestorchronik aus dem zwölften Jahrhundert, die beste Einzelquelle zu dieser Zeit, erwähnt Scharmützel, in denen verstreute slawische Stämme im späteren Russland gegen die »Waräger« – ihr Name für skandinavische Wikinger – gekämpft haben, um sie aus ihrem Land zu vertreiben. Doch als die Tschuden und Merja, die Radimitschen und Kriwitschen und all die anderen Clans und Stämme versuchten, sich selbst zu regieren, kamen dabei nur neue Kriege heraus. Da sie sich weder über Rangordnung und Protokoll noch über Territorien und Regionen einig wurden, wandten sie sich erneut an die Waräger und erbaten von ihnen einen Fürsten: »Unser Land ist groß und reich, doch gibt es darin keine Ordnung. Kommt und herrscht über uns.«
So gelangte Rjurik (reg. 862?–879) an die Macht, dessen Nachkommen die Dynastie der Rjurikiden begründeten, die bis ins 17. Jahrhundert über Russland herrschen sollte. Wasnezow zeigt ihn, wie er mit Brüdern und Gefolge von Bord eines typischen Wikinger-Langschiffs mit Drachen-Bug geht. In der Hand hält er eine Axt, um zu betonen, dass er ein Kriegsfürst ist. Am Ufer des Ladogasees wird er mit Tributen und buchstäblich offenen Armen von einer Delegation seiner neuen Untertanen empfangen.
Das Historiengemälde ist detailreich und plastisch. Bis hin zu den konischen Helmen der Wikinger und den traditionellen Stickereien auf den Kleidern der Slawen hält es sich genau an die Legende. Wie die dargebotenen Tribute eine Brücke zwischen dem neuen Herrscher zu seinen neuen Untertanen schlagen, ist von formvollendeter Symbolik. Es ist aber auch sehr, sehr falsch.
Die Ankunft der Rjurikiden
Es gab tatsächlich einen Rjurik, womöglich handelte es sich um Rörik von Dorestad, einen ehrgeizigen dänischen Emporkömmling, dessen Überfälle den Frankenkönig Ludwig den Frommen so sehr erzürnten, dass er ihn 860 verbannen ließ. Dies stimmt praktischerweise mit dem Zeitpunkt von Rjuriks Ankunft am Ladogasee – der im Allgemeinen auf die Zeit zwischen 860 und 862 geschätzt wird – und seinem Verschwinden aus westlichen Chroniken überein. Skandinavische Raubhändler wussten schon seit Langem von den Ländern der Slawen, nicht zuletzt aufgrund ihrer Suche nach neuen Handelsrouten nach Miklagard, in die »Große Stadt« – die oströmische Hauptstadt Konstantinopel (Byzanz), das heutige Istanbul – weit im Süden. Immerhin bestand die Leibgarde des byzantinischen Kaisers, die Warägergarde, aus skandinavischen Söldnern. Warum also sollte Rörik von Dorestad, nachdem er von zu Hause vertrieben worden war, nicht in diesem Gebiet ein neues Fürstentum errichten? Zunächst ließ er ein Fort am Ladogasee bauen, wo er und seine Männer gelandet waren, und schon bald übernahm er einen Handelsposten landeinwärts und ließ ihn zu einem Stützpunkt ausbauen, den er Holmgard nannte und der als Nowgorod (»Neue Stadt«) bekannt werden und zu einem der großen Zentren des alten Russlands aufsteigen sollte. Nur scheint es leider an Belegen dafür zu fehlen, dass er eingeladen wurde.
Rjuriks Abenteuer war lediglich Teil einer größeren Abwanderungsbewegung von Skandinaviern in Richtung Süden und Osten. Manchmal traten sie als Händler in Erscheinung, öfter fielen sie in feindliche Gebiete ein und bekämpften nicht nur die Einheimischen, sondern schonten sich auch gegenseitig nicht. Der arabische Chronist des zehnten Jahrhunderts, Ibn Rustah, sollte später einmal, zugegebenermaßen leicht übertrieben, berichten, dass sie einander und den Völkern um sich herum misstraut hätten, weshalb etwa ein Mann nicht habe austreten können, ohne dass drei bewaffnete Kameraden ihn begleiteten. Doch trotz aller Gefahren wurden sie von diesen Gebieten unwiderstehlich angezogen.
Im Süden und Osten befanden sich die weiten Ebenen der Steppe, der Einflussbereich verschiedener Turkstämme, Nomaden und ehemaliger Nomaden wie der Bulgaren und Chasaren. Sie verlangten zwar Tribut von den benachbarten slawischen Stämmen wie den Polanen (das Volk der Ebene), die südlich von Kiew lebten, doch weder eroberten noch besiedelten sie deren Einzugsgebiete. Weiter im Südwesten lag Konstantinopel, das die Slawen Zargrad nannten, »Kaiserstadt«. Deren Handelsstationen erstreckten sich bis zum Schwarzen Meer, doch fehlte es ihr an Willen, Armeen oder Interesse, weiter nördlich vorzudringen. Im Westen waren die Magyaren und westslawische Völker wie die Böhmen dabei, ihre eigenen festen Staatengebilde zu gründen, die teilweise von den Deutschen beherrscht wurden.
Kurz gesagt, dies war ein Gebiet, in dem viele Stämme lebten und kleine Siedlungen existierten – die Skandinavier nannten es Gardarike, »Land der Burgen« –, das jedoch ohne Herrscher auskam. Breite, reißende Flüsse, insbesondere die Düna und der Dnjepr, die Wolga und der Don, fungierten als regelrechte Wasserstraßen, wichtige Routen für raubende wie handelnde Waräger, deren flachbödige Schiffe weit flussaufwärts fuhren und auf den relativ kurzen Abschnitten zwischen zwei Flüssen getragen oder gezogen wurden. Man konnte zum Beispiel wie Rjurik entlang der Newa vom Finnischen Meerbusen bis zum Ladogasee segeln und von dort zur Quelle der Wolga, dem längsten Fluss Europas, vorstoßen. Nach einer lediglich fünf bis zehn Kilometer langen Landpassage – Portage – war es den Reisenden möglich, den gesamten Weg Richtung Süden bis zum Kaspischen Meer zu segeln. In diesen Gebieten gab es Wälder und Bernstein, Felle und Honig, aber auch die lukrativste Ware überhaupt: Sklaven. Vor allem aber gab es Handelsrouten nach Konstantinopel und direkt nach »Serkland« – Seidenland –, wie man die muslimischen Gebiete des Ostens nannte. Skandinavier hatten bereits früher von den Stämmen aus dem Nordwesten Tribute in Form von Gütern und Silber gefordert, bis Aufstände im Jahr 860 sie dazu zwangen, ihre hölzernen Festungen aufzugeben und nach Hause zurückzukehren, doch gab es keinen ersichtlichen Grund, warum sie von dort länger als nötig wegbleiben sollten.
Tatsächlich hatten in der Zeit, als Rjurik in Nowgorod siedelte, zwei weitere Wikinger-Abenteurer, Askold und Dir, mit ihren Männern die südwestslawische Stadt Kiew eingenommen und sie zum Ausgangspunkt ihres ehrgeizigen, wenngleich erfolglosen Raubzugs nach Konstantinopel gemacht. Andere hatten Gleiches bereits versucht, als etwa ein halbes Jahrhundert zuvor Abenteurer aus Skandinavien an der südlichen Schwarzmeerküste auf Beutezug gingen. Die Slawen nannten diese warägischen Eroberer die Rus (wahrscheinlich nach den Ruotsi, dem finnischen Wort für Schweden), und damit waren die Länder der Rus geboren.
Kiewer Rus
Auf Rjurik folgte dessen Feldherr Oleg (reg. 879–912), der anstelle Igors, Rjuriks jungem Sohn, regierte. Oleg erwies sich als ebenso tüchtig wie rücksichtslos. Er tötete sowohl Askold als auch Dir und eroberte im Jahr 882 Kiew. Daraufhin verlegte er seine Hauptstadt aus dem kalten nördlichen Nowgorod an den Dnjepr, und Kiew sollte über Jahrhunderte die beherrschende Stadt der Rus bleiben. Die wahre Geburtsstunde der Rjurikiden schlug, als Igor (reg. 912–45) Oleg um das Jahr 912 als Fürst von Kiew ablöste. Mit der Zeit begannen die skandinavischen Rus und ihre slawischen sowie anderen Untertanen, untereinander zu heiraten, und ihre Kulturen vermischten sich. Dies wurde durch beträchtliche Gemeinsamkeiten ihrer heidnischen Religionen erleichtert: So war etwa Perun, der slawische Gott des Donners, dem skandinavischen Thor sehr ähnlich. Und so entstand entlang der Hauptschifffahrtsrouten, in den von hölzernen Palisadenzäunen geschützten Städten und Dörfern, die Festungen und Handelsstationen zugleich waren, eine neue Nation.
Eine Mischung aus Eroberungen, Handel, Siedlungen und Allianzen führte dazu, dass die Macht Kiews wuchs. Das Byzantinische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel konnte sich zwar mehrerer Raubzüge erwehren, doch sicherte sich Kiew in den Jahren 907 und 911 Verträge, in denen das Reich den Emporkömmling wenn nicht ebenbürtig, so doch als eine Macht behandelte, die Respekt verdiente. Slawische Stämme wie die Sewerjanen und die Drewlanen wurden unter Kiews Kontrolle gebracht, wenngleich nicht ohne Verluste. (Igor sollte in den Kämpfen gegen Letztere getötet werden, wofür seine Witwe Olga später blutige Rache übte.)
Doch blieben die Rus nicht ohne Herausforderer. Sie waren Eroberer, Piraten und Händler nicht nur aus Habgier, sondern auch aus der Not heraus. Im Süden wuchs eine neue nomadische Macht heran, die Petschenegen, von deren zunehmenden Angriffen ab 915 die Nestorchronik ausführlich berichtet. Sie hatten es insbesondere auf die Stromschnellen des Dnjepr abgesehen, also jenes Flusses, der für die Handelsbeziehungen und damit den Wohlstand der Rus von zentraler Bedeutung war und dessen Niederungen die Petschenegen für ihre Sommerweiden und als Jagdgründe nutzten. Weit südöstlich von Kiew erstreckten sich neun Granitrücken über den Fluss. Wenn der Fluss im Frühjahr zur Schneeschmelze anschwoll und über seine Ufer trat, waren diese Dämme von Wasser bedeckt, doch zu anderen Jahreszeiten bildeten sie Barrieren, die Reisende dazu zwangen, ihre Boote aus dem Wasser und über Land zu ziehen. Dann waren die Rus besonders anfällig für Angriffe der Petschenegen. Fürst Swjatoslaw selbst (reg. 945/960–72) wurde mit nur etwa 30 Jahren getötet, als er versuchte, einen ihrer Überfälle bei den Stromschnellen abzuwehren. Sein Schädel endete als Trinkbecher der Nomaden. So wie die Rus von slawischen Stämmen und, wo immer möglich, benachbarten Völkern Schutzgelder erpressten, sahen sie sich wiederholt gezwungen, ihrerseits die Petschenegen auszubezahlen.
Swjatoslaw war ein Kriegsfürst mit an Arroganz grenzendem Selbstvertrauen. Sein ältester Sohn und kurzzeitiger Nachfolger Jaropolk scheint hingegen so unsicher gewesen zu sein, dass er selbst vor einem Brudermord nicht zurückschreckte. Er tötete Oleg (der zugegebenermaßen womöglich als Erster zugeschlagen hatte) und vertrieb seinen anderen Bruder Wladimir aus dessen Bastion Nowgorod. Allerdings sollte Wladimir 980 mit einer Armee warägischer Söldner zurückkehren, Jaropolk töten und selbst den Thron besteigen. Anschließend machte er sich daran, den Lauf der russischen Geschichte zu verändern.
Wladimir der Große
Wladimir (reg. 980–1015) sollte sich als Gründer eines Imperiums erweisen. War Swjatoslaw noch der klassische Warägerfürst, ein kampfeslustiger Krieger und Räuber, der sich selbst in die Riemen legte, wenn er in der Hoffnung auf Beute nach Zargrad segelte, so war Wladimir ein Planer und Politiker, der danach strebte, die Rus über ihre Wikingerwurzeln hinauszuführen. Unter seinem Befehl weitete die Kiewer Rus ihre Herrschaftsgebiete aus, indem sie die Petschenegen bekämpfte, andere Stämme unterwarf, Städte einnahm und den Wolgabulgaren zusetzte. Um Kiew ließ er Verteidigungsanlagen ausbauen oder neu errichten, darunter die mächtigen Schlangenwälle – nach ihrer Fertigstellung im elften Jahrhundert sollten sie sich über Hunderte von Kilometern erstrecken –, mit denen die Stadt vom Süden her gesichert wurde. Bei Belgorod und Perejaslaw wurden entlang des Dnjepr neue Städte samt befestigten Häfen gegründet. Eine ganze Reihe von Festungen wurde errichtet, um die Petschenegen in Schach zu halten. Die traditionellen Holzwälle wurden nun mithilfe griechischer Baumeister aus Zargrad durch ungebrannte Ziegelsteine verstärkt.
Der Grund, warum neue Techniken und Technologien aus Konstantinopel importiert wurden, war Wladimirs schicksalhafte Entscheidung, zum Christentum zu konvertieren – und die Elite und Untertanen der Rus zu zwingen, es ihm gleichzutun. Dabei gab es keine frühen Anzeichen für derartige Ambitionen vonseiten Wladimirs. Vielmehr hatte er zuvor befohlen, auf einem der Hügel Kiews einen heidnischen Tempel mit großen hölzernen Götzen zu errichten, die auf die Stadt hinabblicken sollten. Auch schien er regelmäßige Ausschreitungen gegen Christen achselzuckend hinzunehmen. Doch im Jahr 988 befahl Wladimir, die heidnischen Götzen abzutragen, und ließ die Bevölkerung Kiews sprichwörtlich mit Spießruten zur Zwangstaufe in den Dnjepr treiben. (Tatsächlich sollten Christentum und Heidentum noch über Jahrhunderte nebeneinander existieren, da Ersteres Letzteres nur sehr langsam verdrängte.) Religion und Staatsmacht schmiedeten erstmals jenes enge Bündnis, das Russland bis heute bestimmt.
Warum hat Wladimir das getan? Einer nicht unumstrittenen Legende zufolge sandte er Boten mit dem Ziel aus, die Attraktivität der Hauptreligionen seiner Zeit abzuschätzen. Das Judentum wurde abgelehnt, da die Juden aus ihrer Heimat vertrieben worden waren und er dies als Beleg dafür sah, dass Gott nicht auf ihrer Seite stand. Die römisch-katholische Religion wurde abgewiesen, weil es ihm unvorstellbar war, dass ein Großfürst von Kiew sich der Autorität des Papstes unterwerfen könnte. Der Islam wurde aufgrund seines Alkoholverbotes verschmäht, wozu Wladimir angeblich bemerkte: »Das Trinken ist die Freude der gesamten Rus. Wir können ohne dieses Vergnügen nicht existieren.« (Einige Stereotype lassen sich anscheinend bis weit in die Vergangenheit zurückverfolgen.) Stattdessen ließ er sich vom byzantinisch-orthodoxen Christentum überzeugen, nachdem seine Gesandten von der Eucharistie im überkuppelten Kirchenschiff der gewaltigen Hagia-Sophia-Kathedrale geschwärmt hatten: »Wir wussten nicht, ob wir im Himmel waren oder auf der Erde. Denn auf Erden gibt es keine solche Pracht und keine solche Schönheit, und uns fehlen die Worte, sie zu beschreiben. Wir wussten nur, dass hier Gott unter den Menschen lebt, und ihr Gottesdienst ist herrlicher als die Zeremonien anderer Völker.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.