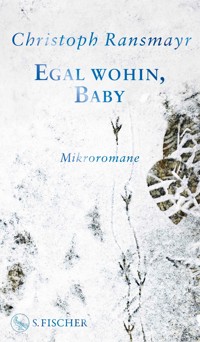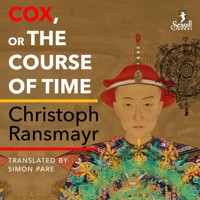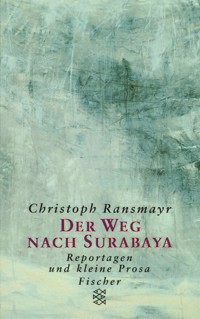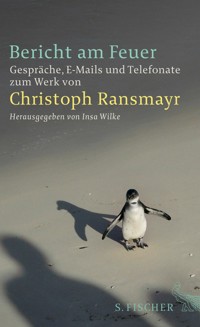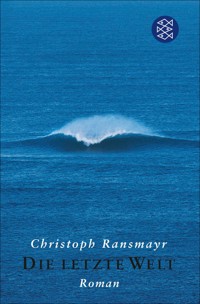
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christoph Ransmayrs großer Roman ist ein Klassiker der deutschen Gegenwartsliteratur. ›Die letzte Welt‹ ist ein phantastisches Spiel um die Suche nach dem verschollenen römischen Dichter Ovid und einer Abschrift seines Hauptwerks, der legendären ›Metamorphosen‹. Als Christoph Ransmayrs Roman ›Die letzte Welt‹ 1988 erschien, wurde er von der Kritik gefeiert wie kaum ein anderer – wegen seiner poetischen, rhythmischen Sprache, wegen seiner stilistischen Eleganz, auch wegen seiner bildmächtigen Traum- und Albtraumwelten. Er wurde bisher in 29 Sprachen übersetzt. In diesem Roman ist die Verbannung des römischen Dichters Ovid durch Kaiser Augustus im Jahre 8 n. Chr. der historisch fixierte Ausgangspunkt einer phantasievollen Fiktion. Der Römer Cotta, sein – durch Ovids ›Briefe aus der Verbannung‹ – ebenfalls historisch belegter Freund, macht sich in Tomi am Schwarzen Meer auf die Suche: nach dem Verbannten, denn in Rom geht das Gerücht von seinem Tod, als auch nach einer Abschrift der ›Metamorphosen‹, dem legendären Hauptwerk Ovids. Cotta trifft in der »eisernen grauen Stadt« Tomi jedoch nur auf Spuren seines Freundes, Ovid selbst begegnet er nicht. Er findet dessen verfallenes Haus im Gebirge, den greisen Diener Pythagoras und, je komplizierter und aussichtsloser sich die Suche gestaltet, immer rätselhaftere Zeichen der ›Metamorphosen‹ – in Bildern, Figuren, wunderbaren Begebenheiten. Bis sich zuletzt Cotta selbst in der geheimnisvoll unwirklichen Welt der Verwandlungen zu verlieren scheint: die Auflösung dieser »letzten Welt« ist wieder zu Literatur geworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Die letzte Welt
Roman
Über dieses Buch
»Einer der schönsten Romane unserer Gegenwartsliteratur.« Volker Hage, ›Die Zeit‹
Christoph Ransmayrs Roman ›Die letzte Welt‹ ist ein phantastisches Spiel um die Suche nach dem verschollenen römischen Dichter Ovid und einer Abschrift seines Hauptwerks, der legendären ›Metamorphosen‹.
Als Christoph Ransmayrs Roman ›Die letzte Welt‹ 1988 erschien, wurde er von der Kritik gefeiert wie kaum ein anderer – wegen seiner poetischen, rhythmischen Sprache, wegen seiner stilistischen Eleganz, auch wegen seiner bildmächtigen Traum- und Albtraumwelten. Er wurde bisher in 29 Sprachen übersetzt.
In diesem Roman ist die Verbannung des römischen Dichters Ovid durch Kaiser Augustus im Jahre 8 n. Chr. der historisch fixierte Ausgangspunkt einer phantasievollen Fiktion. Der Römer Cotta, sein – durch Ovids ›Briefe aus der Verbannung‹ – ebenfalls historisch belegter Freund, macht sich in Tomi am Schwarzen Meer auf die Suche: nach dem Verbannten, denn in Rom geht das Gerücht von seinem Tod, als auch nach einer Abschrift der ›Metamorphosen‹, dem legendären Hauptwerk Ovids. Cotta trifft in der »eisernen grauen Stadt« Tomi jedoch nur auf Spuren seines Freundes, Ovid selbst begegnet er nicht. Er findet dessen verfallenes Haus im Gebirge, den greisen Diener Pythagoras und, je komplizierter und aussichtsloser sich die Suche gestaltet, immer rätselhaftere Zeichen der ›Metamorphosen‹ – in Bildern, Figuren, wunderbaren Begebenheiten. Bis sich zuletzt Cotta selbst in der geheimnisvoll unwirklichen Welt der Verwandlungen zu verlieren scheint: die Auflösung dieser »letzten Welt« ist wieder zu Literatur geworden.
»Innerhalb der Literatur gibt es wenige derart schön geschriebene Bücher.« Péter Esterházy
»Leichte Bettlektüre bietet Christoph Ransmayr nicht, in der Literaturgeschichte aber wird seine ›Letzte Welt‹ ihren festen Platz haben.« Anthony Burgess, The Observer
»Künstler können sie vernichten, nicht aber ihre Kunst - das ist die Parabel, die uns Christoph Ransmayr erzählt.« Salman Rushdie, The Independent
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Christoph Ransmayr, 1988
Alle Rechte S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Ziffernzeichnungen von Anita Albus
Coverabbildung: Tungsten/Nikon
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403205-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Ein Ovidisches Repertoire
[Dank]
Andreas Thalmayr gewidmet.
Ein Orkan, das war ein Vogelschwarm hoch oben in der Nacht; ein weißer Schwarm, der rauschend näher kam und plötzlich nur noch die Krone einer ungeheuren Welle war, die auf das Schiff zusprang. Ein Orkan, das war das Schreien und das Weinen im Dunkel unter Deck und der saure Gestank des Erbrochenen. Das war ein Hund, der in den Sturzseen toll wurde und einem Matrosen die Sehnen zerriß. Über der Wunde schloß sich die Gischt. Ein Orkan, das war die Reise nach Tomi.
Obwohl er auch tagsüber und an so vielen, immer entlegeneren Orten des Schiffes aus seinem Elend in die Bewußtlosigkeit oder wenigstens in einen Traum zu flüchten versuchte, fand Cotta auf dem Ägäischen und dann auch auf dem Schwarzen Meer keinen Schlaf. Wann immer seine Erschöpfung ihn hoffen ließ, drückte er sich Wachs in die Ohren, band sich einen blauen Wollschal vor die Augen, sank zurück und zählte seine Atemzüge. Aber die Dünung hob ihn, hob das Schiff, hob die ganze Welt hoch über den salzigen Schaum der Route hinaus, hielt alles einen Herzschlag lang in der Schwebe und ließ dann die Welt, das Schiff und den Erschöpften wieder zurückfallen in ein Wellental, in die Wachheit und die Angst. Niemand schlief.
Siebzehn Tage mußte Cotta an Bord der Trivia überstehen. Als er den Schoner an einem Aprilmorgen endlich verließ und sich auf der von Brechern blank gespülten Mole den Mauern von Tomi zuwandte, moosbewachsenen Mauern am Fuß der Steilküste, schwankte er so sehr, daß zwei Seeleute ihn lachend stützten und dann vor der Hafenmeisterei auf einem Haufen zerschlissenen Tauwerks zurückließen. Dort lag Cotta in einem Geruch nach Fisch und Teer und versuchte das Meer zu besänftigen, das in seinem Inneren immer noch tobte. Über die Mole kollerten verschimmelte Orangen aus der Ladung der Trivia – Erinnerungen an die Gärten Italiens. Es war kalt; ein Morgen ohne Sonne. Träge rollte das Schwarze Meer gegen das Kap von Tomi, brach sich an den Riffen oder schlug hallend gegen Felswände, die jäh aus dem Wasser ragten. In manchen Buchten warfen die Brecher von Schutt und Vogelkot bedeckte Eisschollen an den Strand. Cotta lag und starrte und rührte keine Hand, als ein dürres Maultier an seinem Mantel zu fressen begann. Als die See in seinem Inneren flacher wurde, Woge für Woge, schlief er ein. Nun war er angekommen.
Tomi, das Kaff. Tomi, das Irgendwo. Tomi, die eiserne Stadt. Mit Ausnahme eines Seilers, der dem Fremden ein unheizbares, mit grellfarbigen Wandteppichen ausgestattetes Zimmer im Dachgeschoß seines Hauses vermietete, nahm hier kaum jemand von der Ankunft Cottas Notiz. Erst allmählich und ohne die üblichen Ausschmückungen begann dem Fremden ein Gerede zu folgen, das zu anderen Zeiten vielleicht Anlaß zu feindseligen Gesten gegeben hätte: Der Fremde, der dort unter den Arkaden stand und fror; der Fremde, der an der rostzerfressenen Bushaltestelle den Fahrplan abschrieb und auf kläffende Hunde mit einer unverständlichen Geduld einsprach, – dieser Fremde kam aus Rom. Aber Rom war in diesen Tagen ferner als sonst. Denn in Tomi hatte man sich von der Welt abgewandt, um das Ende eines zweijährigen Winters zu feiern. Die Gassen waren laut vom Getöse der Blechmusik und die Nächte vom Geplärr der Festgäste – Bauern, Bernsteinsucher und Schweinehirten, die aus den verstreuten Gehöften und den entlegensten Hochtälern des Gebirges gekommen waren. Der Seiler, der auch an Frosttagen barfuß war und seine grauen Füße nur zu besonderen Anlässen in Schuhe tat, in denen er dann knarrend durch die Stille seines Hauses ging, er trug in diesen Tagen Schuhe. In den dunklen, schiefergedeckten Höfen zwischen den Terrassenfeldern vor der Stadt wurde süßes Brot mit Safran und Vanille gebacken. Über die Saumpfade der Steilküste zogen Prozessionen. Schneeschmelze. Zum erstenmal seit zwei Jahren waren die Geröllhalden, die zwischen Felsrücken, Schroffen und Graten aus den Wolken herabflossen, ohne Schnee.
Von den neunzig Häusern der Stadt standen damals schon viele leer; sie verfielen und verschwanden unter Kletterpflanzen und Moos. Ganze Häuserzeilen schienen allmählich wieder an das Küstengebirge zurückzufallen. Und doch zog durch die steilen Gassen immer noch der Rauch aus den Öfen der Erzkocher, die der Stadt ein minderes Eisen bescherten – das einzige, woran hier niemals Mangel geherrscht hatte.
Aus Eisen waren die Türen, aus Eisen die Fensterläden, die Einfriedungen, die Giebelfiguren und schmalen Stege, die über jenen Sturzbach führten, der Tomi in zwei ungleiche Hälften teilte. Und an allem fraß der salzige Wind, fraß der Rost. Der Rost war die Farbe der Stadt.
In den Häusern mühten sich früh alternde, stets dunkel gekleidete Frauen ab und in den Stollen hoch über den Dächern, hoch in den Abhängen, staubige, erschöpfte Männer. Wer hier zum Fischen hinausfuhr, der fluchte auf das leere Wasser, und wer ein Feld bestellte, auf das Ungeziefer, den Frost und die Steine. Wer in den Nächten wachlag, glaubte manchmal Wölfe zu hören. Tomi war so öde, so alt und ohne Hoffnung wie hundert andere Küstenstädte auch, und es erschien Cotta seltsam, daß an diesem vom Meer und vom Gebirge gleichermaßen bedrängten Ort, der so sehr in seinen Bräuchen, den Plagen der Kälte, der Armut und schweren Arbeit gefangen war, überhaupt etwas geschehen konnte, worüber man in den entrückten Salons und Cafés der europäischen Metropolen sprach.
Jenes Gerücht aus der eisernen Stadt, dem er dann so lange gefolgt war und dem gewiß noch andere folgen würden, hatte Cotta auf der Glasveranda eines Hauses an der römischen Via Anastasio erreicht; ein Geplauder zwischen Begonien und Oleander. Die Bilder aus Tomi, Bilder von raucherfüllten Gassen, überwucherten Ruinen und Eisstößen, waren an jenem Winterabend gerade gut genug gewesen, um eine Neuigkeit zu verbrämen, die ohne diesen Schmuck wohl zu dürr und unbewiesen geklungen hätte. Das Gerücht hatte sich dann ausgebreitet wie das Rinnsal auf der abfallenden Straße zur Mole, hatte sich verzweigt, war da und dort rascher und vielgliedriger geworden, anderswo zum Stillstand gekommen und versiegt, wo man solche Namen nicht kannte: Tomi, Naso oder Trachila.
So war dieses Gerücht verwandelt, weiter ausgeschmückt oder abgeschwächt und manchmal sogar widerlegt worden und war doch immer nur der Kokon für einen einzigen Satz geblieben, den es in sich barg wie eine Larve, von der niemand wußte, was aus ihr noch hervorkriechen würde. Der Satz hieß, Naso ist tot.
Die ersten Antworten, die Cotta in Tomi bekam, waren wirr und oft nur Erinnerungen an alles, was hier jemals seltsam und fremd gewesen war. Naso …? War das nicht der Verrückte, der gelegentlich mit einem Strauß Angelruten auftauchte und selbst bei Schneegestöber noch in einem Leinenanzug auf den Felsen saß? Und am Abend trank er in den Kellern, spielte Harmonika und schrie in der Nacht.
Naso … Das war doch der Liliputaner, der im August in einem Planwagen in die Stadt kam und nach Einbruch der Dunkelheit über die weiße Rückwand des Schlachthauses Liebesfilme dröhnen ließ. Zwischen den Vorstellungen verkaufte er Emailgeschirr, blutstillenden Alaunstein und türkischen Honig, und zur Musik aus seinen Lautsprechern heulten die Hunde.
Naso. Erst in der zweiten Woche nach seiner Ankunft stieß Cotta auf Erinnerungen, die er wiedererkannte. Tereus, der Schlachter, der selbst die Stiere überbrüllte, wenn er ihnen eine lederne Blende vor die Augen band und ihnen so den letzten Blick auf die Welt nahm; und Fama, die Witwe eines Kolonialwarenhändlers – sie nagelte an die Regale ihres Ladens stets Girlanden aus Brennesseln, um ihren halbwüchsigen, fallsüchtigen Sohn daran zu hindern, nach rot verpackten Seifen, Konservenpyramiden und Senfgläsern zu greifen. Wenn sich der Fallsüchtige die Finger an diesen Girlanden verbrannte, schrie er so gellend, daß man in den Nachbarhäusern die Fensterläden klirrend zuschlug … Tereus, Fama oder auch Arachne, eine taubstumme Weberin, die dem Fremden alle Fragen vom Mund las und dazu den Kopf schüttelte oder nickte – sie erinnerten sich wohl, daß Naso der Römer war, der Verbannte, der Dichter, der mit seinem griechischen Knecht in Trachila hauste, einem aufgegebenen Weiler vier oder fünf Gehstunden nördlich der Stadt. Publius Ovidius Naso, haspelte der Fallsüchtige den von seiner Mutter bedeutsam ausgesprochenen Namen einige Male nach, als Cotta an einem Regentag im Halbdunkel von Famas Laden stand.
Gewiß, Naso, der Römer. Ob er noch lebte? Wo der begraben war? Ach, gab es denn nun auch ein Gesetz, das einen zwang, sich um einen Römer zu kümmern, der in Trachila verkam? Ein Gesetz, nach dem man Rede und Antwort stehen mußte, wenn ein Fremder nach dem Verbleib eines anderen fragte? Wer an dieser Küste lebte, der lebte und starb im Verborgenen unter den Steinen wie eine Assel. Was Cotta schließlich erfuhr, war nicht viel mehr, als daß man am Ende der Welt nicht gerne mit einem sprach, der aus Rom kam. Auch Lycaon, der Seiler, blieb schweigsam. In einem Brief, der die Via Anastasio Monate später erreichte, stand: Man mißtraut mir.
An einem der letzten Apriltage machte sich Cotta auf den Weg nach Trachila. Auf einem von Muscheln übersäten, unter jedem Schritt klingenden Strand kreuzte er eine Prozession, die einen Allmächtigen, dessen Namen er nicht kannte, um fruchtbare Felder anrief, um Fischschwärme, Erzadern und eine ruhige See. Die Prozession zog ihn ein Stück mit sich fort; einige der Andächtigen erkannte er auch unter der Aschenmaske, die ihre Gesichtszüge entstellte. Der Seiler war unter ihnen. Dann wandte sich Cotta ab und stieg auf einem von Wermut und Schlehdorn gesäumten Serpentinenpfad durch die Halden. Als er hoch im Geröll für einen Augenblick innehielt und in die Tiefe blickte, war die Prozession nur noch ein wirrer Zug gesichtsloser Wesen. Stumm krochen sie über den Strand; winzig flatterten ihre Fahnen, winzig war der Baldachin über dem Karren, an dem eine schwarze Rotte zerrte und schob. Die Böen machten den Gesang, den Jammer der Anrufungen und das Geklirr der Zimbeln unhörbar. Dort unten versuchten sich die Bewohner Tomis mit einem Himmel auszusöhnen, der ihnen nicht gnädig war. Im Dunst wurden sie eins mit der grauen Küste. Cotta war endlich allein. Er durchquerte die schmale Heide eines Hochtales, strauchelte durch den alten Bruchharsch im Schatten der Felswände und hatte immer das Meer tief und still unter sich. Hier war Naso gegangen. Das war Nasos Weg.
Nun ließen die Kare keinen anderen Blick mehr zu als auf den nächsten Schritt; sie wurden so steil, daß Cotta manchmal nur auf allen vieren vorankam. Und dann lag plötzlich ein steinerner Hund vor ihm, ein grob zugehauenes, zerschlagenes Standbild ohne Hinterläufe. Schwer atmend richtete sich Cotta auf. Er stand zwischen Ruinen.
Trachila: Diese eingebrochenen Mauern aus Kalkstein, Erkerfenster, aus denen Föhren und Krüppelkiefern ihre Äste streckten, diese geborstenen, in rußgeschwärzte Küchen, in Schlafkammern und Stuben gesunkenen Dächer aus Schilf und Schiefer, und die im Leeren stehengebliebenen Torbögen, durch die hindurch nur noch die Zeit verflog – das mußten einmal fünf, sechs Häuser gewesen sein, Ställe, Scheunen …
Und aus dieser Wildnis ragten Steinmale auf, Dutzende schlanker Kegel, mannshoch die größten, die kleinsten reichten Cotta kaum bis an die Knie. An den Kegelspitzen flatterten Stoffähnchen, Fetzen in allen Farben, es waren in Streifen geschnittene und gerissene Kleider, und als Cotta an einer der kleineren Steinmale herantrat, sah er, daß die Fähnchen Schriftzeichen trugen, alle waren sie beschrieben. Sachte zog er an einem blaßroten, gebleichten Streifen. Der Stoff war so zwischen die Steine geflochten, daß der Kegel zerfiel, als er das Fähnchen an sich nahm, um es zu entziffern. Die Steine kollerten einige von den Wurzeln einer Kiefer gesprengte Stufen hinab, und Cotta las: Keinem bleibt seine Gestalt.
Ein Sandrinnsal, das den Steinen nachgeflossen war, erstarrte. Es war wieder still. Und Cotta sah das inmitten der Verwüstung heil gebliebene Dach, auf dem Dohlen saßen, sah das Haus zwischen den Ruinen. Er ging darauf zu, auf die äußerste Entlegenheit zu, und begann noch im Gehen zu schreien, schrie seinen und Nasos Namen, immer wieder, schrie, daß er aus Rom gekommen sei, aus Rom hierher. Aber es blieb still.
Das Tor zum Innenhof war nur angelehnt. Er stieß es auf und blieb einen Augenblick später, den Arm noch vorgestreckt, wie von einem großen Schrecken gerührt stehen: Dort, in einem hellen Winkel des Hofes, in der Kälte dieses Gebirges, zwischen Schneeresten und gefrorenen Pfützen, stand sanft und grün ein Maulbeerbaum; sein Stamm war gegen das Wild gekalkt, und der Schnee in seinem Schatten war blau gefleckt vom Saft abgefallener Beeren.
Wie einer, der das Dunkel fürchtet, im Dunkeln zu pfeifen und zu singen beginnt, begann Cotta wieder nach Naso zu rufen, durchquerte den Hof im Schutz seiner Stimme, betrat einen Laubengang, endlich das Haus des Dichters. Alle Türen standen offen. Die Räume waren menschenleer.
Vor den kleinen Fenstern blähten sich Leinenvorhänge und gaben im Rhythmus der Windstöße den Blick frei über das Dickicht eines Gartens, hinab in die milchweiße Tiefe. Unter diesem Weiß mußte das Meer liegen. Von Nasos Tisch sah man das Meer. Der Herd war kalt. Zwischen verkrusteten Töpfen, Teegläsern und Brotresten rannten Ameisenzüge. Auf den Borden, auf den Stühlen, auf einem Bett lag feiner, weißer Sand, der auch unter den Schritten knirschte, Sand, der von der Decke und den Wänden rieselte.
Cotta durchwanderte das Steinhaus zweimal, dreimal, betrachtete die Feuchtigkeitsflecken auf dem Verputz, eine römische Straßenansicht unter Glas im schwarzen Holzrahmen, strich über Buchrücken und sprach ihre Titel aus, aber rief keine Namen mehr, ging wieder auf die Treppe zu, die in das Obergeschoß führte, und hielt immer noch achtlos das Stoffähnchen fest, das ihm nun ein Luftzug aus der Hand nahm und gleich wieder fallen ließ. Cotta bückte sich danach und starrte plötzlich in das nahe Gesicht eines Mannes. Im Dunkel unter der Treppe kauerte mit angezogenen Knien ein alter Mann, der auf das Stoffähnchen zeigte und in Cottas Atemlosigkeit hinein, bring das zurück, sagte.
Cotta spürte sein Herz toben. Naso, stammelte er. Der Alte griff mit einer raschen Handbewegung nach dem Fähnchen, zerknüllte es, warf es Cotta ins Gesicht zurück und kicherte: Naso ist Naso, und Pythagoras ist Pythagoras.
Eine Stunde nach seiner Entdeckung hockte Pythagoras immer noch unter der Treppe. Vergeblich sprach Cotta ihn an, vergeblich wiederholte er seine Fragen. Pythagoras, der Knecht Nasos, war keiner Anrede mehr zugänglich, verfiel aber manchmal in hastige, leise Selbstgespräche ohne Gebärden, schimpfte Cotta dann einen Aasfresser, der sich von den Leichen seiner Verwandten ernähre und seine treuesten Dienstboten erschlage, kicherte, schwieg, begann von neuem und irgendwo, verfluchte diesmal einen Diktator in der Ägäis, der es mit den Ziegen trieb, bevor er ihnen das Kreuz mit eigenen Händen brach, wurde auch freundlich, klatschte einmal sogar vergnügt in die Hände und pries das Wunder der Seelenwanderung; er selbst habe schon in den Gestalten eines Salamanders, eines Kanoniers und einer Schweinehirtin gehaust, auch ein Kind ohne Augen habe er jahrelang sein müssen, bis dieser heillose kleine Körper endlich von einer Klippe gefallen und ertrunken sei.
Cotta machte keine Einwände mehr, hörte stumm zu. In das Reich dieses Alten schien kein Weg zu führen. Erst später, irgendwann in der langen Stille der Pausen, in denen Pythagoras schwieg, begann er doch wieder zu reden – zuerst so halbherzig, wie man mit Idioten spricht und nur, um vielleicht doch noch an das Vertrauen des Alten zu rühren. Aber schließlich begriff Cotta, daß er erzählte, um diesem wüsten Gerede aus dem Dunkel die Ordnung und die Vernunft einer vertrauten Welt entgegenzusetzen: Rom gegen die Unmöglichkeit eines Maulbeerbaumes im Schnee vor dem Fenster; Rom gegen die in der Einöde hockenden Steinmale, gegen die Verlassenheit von Trachila.
Er beschrieb dem Knecht die Stürme seiner Reise und die Traurigkeit in den Tagen des Abschieds, sprach vom bitteren Geschmack der wilden Orangen aus den Hainen von Sulmona und geriet immer tiefer in die Zeit, bis er schließlich wieder vor jenem Feuer stand, das er vor neun Jahren in Nasos Haus an der Piazza del Moro hatte brennen sehen. Aus einem Balkonzimmer, in das Naso sich eingeschlossen hatte, wehte dünner Rauch. Ascheflocken stoben aus den offenen Fenstern, und im Hausflur, zwischen Gepäckstücken und dem Lichtmuster, das die Spätnachmittagssonne auf dem Marmorboden hinterließ, saß eine Frau und weinte. Es war Nasos letzter Tag in Rom.
So wie der Tod auch unzugängliche Häuser manchmal öffnet und dann nicht nur Verwandte und Freunde einläßt, sondern auch die zur Trauer Verpflichteten, die Neugierigen und sogar gleichgültige Fremde, so war in diesen Tagen auch das hinter Zypressen und Schirmföhren verborgene Haus an der Piazza del Moro von der Nachricht aufgesprengt worden, daß Naso in die Verbannung mußte. Auch wenn die Ängstlichen vom Unheil verscheucht worden und ferngeblieben waren, herrschte auf den Treppen und im Salon doch das Gedränge eines Trauerhauses. Die Abschiednehmenden kamen und gingen, und mit ihnen kamen und gingen Losverkäufer, Bettler und Straßenjungen, die Lavendelsträuße feilboten und von den Tischen die Gläser und aus den Vitrinen das Silber stahlen. Niemand kümmerte sich darum.
Blaß und mit schwarzen Händen öffnete Naso damals erst nach vielen Besänftigungen die Tür zu seinem Arbeitszimmer: Ein blauer Teppich lag dort unter der Asche wie beschneit; auf einem Tisch, dessen Intarsien sich unter der Glut zu Holzlocken eingerollt hatten, blätterte der Luftzug in einem verkohlten Packen Papier; gebündelte Hefte und Bücher lagen glosend auf den Regalen und in den Nischen; ein Stapel brannte noch. Naso mußte mit dem Feuer an seinen Schriften vorübergegangen sein, wie ein Küster mit dem Docht von einem Kandelaber zum anderen geht; er hatte seine Notizen und Manuskripte einfach an den Orten angesteckt, an die er sie in einer sanfteren Zeit stets mit viel Bedacht gelegt hatte. Naso war unversehrt. Seine Arbeit Asche.
Pythagoras hatte den Kopf auf die Knie gelegt und schien nichts zu hören und nichts zu verstehen von dem, was Cotta erzählte. Cotta rückte einen Stuhl an das Dunkel unter der Treppe, saß dann schweigend da und wartete darauf, daß der Knecht ihm in die Augen sah.
Gewiß, das Feuer an der Piazza del Moro hatte nur Nasos Handschriften verzehrt. Was von seinen Elegien und Erzählungen veröffentlicht, gefeiert und angefeindet worden war, lag damals längst geborgen in den Depots der Staatsbibliotheken, in den Häusern seines Publikums und in den Archiven der Zensur. In einem noch am Tag seines Erscheinens beschlagnahmten Zeitungskommentar aus Padua hieß es sogar, Naso habe dieses Feuer nur entfacht, um ein Fanal zu setzen gegen das Verbot seiner Bücher und seine Vertreibung aus der römischen Welt.
Aber es gab so viele Deutungen: Eine Bücherverbrennung – da habe einer aus Wut und Verzweiflung und ohne Besinnung gehandelt. Ein Akt der Einsicht – da habe einer den Sinn der Zensur erkannt und selbst Hand an das Zweideutige und Mißratene gelegt. Eine Vorsichtsmaßnahme. Ein Geständnis. Eine Täuschung. Und so fort.
Die Verbrennung blieb über allen Mutmaßungen so rätselhaft wie der Grund für die Verbannung. Die Behörde schwieg oder flüchtete sich in leere Reden. Und weil ein Manuskript, das man lange in sicheren Händen geglaubt hatte, auch über die Jahre verschwunden blieb, begann man in Rom allmählich zu ahnen, daß das Feuer an der Piazza del Moro keine Verzweiflungstat und kein Fanal, sondern tatsächlich eine Vernichtung gewesen war.
Cyparis, der Liliputaner, kam um die Mittagszeit aus den Staubwolken der Küstenstraße, aus dem ersten, kalten Staub des Jahres. Im Geschirr seines Planwagens zwei Falben, kam Cyparis das Meer entlang wie in allen Jahren zuvor, schrieb mit der Peitsche fauchende, wirre Zeichen in die Luft und schrie dazu die Namen von Helden und schönen Frauen gegen Tomi: So kündigte der Liliputaner schon von weitem die Lust, den Schmerz und die Trauer und alle Leidenschaften jener Lichtspiele an, die er in der Dunkelheit der nächsten Tage über den abblätternden Kalk der Schlachthausmauer flimmern lassen würde. Cyparis der Filmvorführer kam. Aber es war Frühjahr. Im Keller des Branntweiners oder im Glutschein einer Esse, in Famas Kolonialwarenladen oder im Zwielicht eines Speichers, da und dort in Tomi unterbrach man, was man eben tat, trat vor die Tür oder öffnete das Fenster und blickte dem langsam heranwehenden Staub ratlos entgegen. Der Vorführer. Cyparis kam zum erstenmal im Frühjahr und nicht im August.
Wie in allen Jahren zuvor, mit einem langen Strick an den Planwagen gebunden, trottete auch diesmal ein müder, abgezehrter Hirsch dem Gespann hinterher. Der Liliputaner führte diesen Hirsch in den Dörfern der Küste stets als das Königstier seiner Heimat vor, die nach seinen Erzählungen irgendwo im Schatten des Kaukasus lag; er ließ das Tier zu klirrender Marschmusik auf der Hinterhand tänzeln, zog nach einem solchen Kunststück den schweren Schädel des Hirsches oft zu sich herab, flüsterte ihm in einer seltsamen, zärtlichen Sprache ins Ohr und verkaufte alljährlich das abgeworfene Geweih an den Meistbietenden in den Dörfern, an irgendeinen Trophäensammler, dem die Abwurfstangen dann zum Wahrzeichen und Skelett einer unerfüllbaren Jagdleidenschaft wurden. Denn in den unwegsamen, dornigen Wäldern dieses Küstenstriches gab es keine Hirsche.
Auf dem Platz vor Famas Laden scharten sich Alte und Müßige, auch einige Aschengesichter aus der Strandprozession und rußige, scheue Kinder um das Gespann des Vorführers. Battus, Famas Sohn, roch an den dampfenden Flanken der Pferde und strich ihnen mit der flachen Hand den Schaum von den Nüstern. Warum so früh, sprach und fragte es aus der Schar, während Cyparis die Falben ausschirrte, warum nicht zur gewohnten Zeit? Und die Satteldecke da, die schöne Malerei auf der Plane und das Messing am Zaumzeug, alles anders und neu? So schön alles.
Cyparis führte die Rösser an eine steingefaßte Tränke, aus der Bleßhühner aufflogen, warf dem Hirsch Kastanien und eine Handvoll getrockneter Rosenknospen vor und blieb bei allen Verrichtungen ganz und wie immer in seinem leichten Gerede, einem Tonfall, der in der eisernen Stadt fremd war: Was brauche sich einer wie er, Cyparis, den Vorschriften der Jahreszeit zu beugen und mit seiner Ankunft den Sommer abzuwarten? Der Sommer warte doch im Gegenteil auf ihn. Dort, wo Cyparis erscheine, da sei immer August. Und lachte. Das Zaumzeug, habe er auf dem Jahrmarkt in Byzanz gegen drei Vorführungen eingetauscht, eine Kostbarkeit. Und dort habe ihm ein Kulissenmaler auch die Wagenplane mit dem Tod eines griechischen Jägers verziert, Actaeons Tod, eines Idioten, der sein idiotisches Ende zwischen den Fängen seiner eigenen Schweißhunde gefunden habe. Das Tiefrote hier, über den Faltenwurf der Plane Verspritzte, das Leuchtende, das sei alles Jägerblut. Und lachte.
So oder ähnlich kannten die meisten Bewohner Tomis den Liliputaner. Der sprach immer in Geschichten, gleichgültig, ob die Rede von seinem Woher und Wohin war oder von der zarten Mechanik jenes schwarzen, mattschimmernden Projektors, der in einer mit Tüll ausgeschlagenen Kiste verwahrt lag, der Maschine, in die Cyparis ganze Schicksale einspannen und sie dann surrend in die bewegte Welt überführen konnte, ins Leben. Alljährlich erstand so auf Tereus’ Mauer unter den Handgriffen des Liliputaners eine Welt, die den Menschen der eisernen Stadt so fern ihrer eigenen erschien, so unerreichbar und zauberhaft, daß sie noch Wochen, nachdem Cyparis wieder in der Weitläufigkeit der Zeit verschwunden war, keine anderen Geschichten besprachen als Versionen und Nacherzählungen der nun für ein weiteres Jahr wieder erloschenen Lichtspiele.
Cyparis liebte sein Publikum. Wenn der Projektor nach langwierigen Vorbereitungen das Antlitz eines Helden ins Riesenhafte vergrößerte und die Schlachthausmauer zum Fenster in Urwälder und Wüsten wurde, dann saß der Liliputaner geborgen in der Dunkelheit und betrachtete die Gesichter der Zuschauer im blauen Widerschein. In ihrem Mienenspiel meinte er manchmal die Macht und die Unerfüllbarkeit seiner eigenen Sehnsüchte wiederzuerkennen. Cyparis, der selbst aufgerichtet nur den Gebeugten, den Krüppeln und auf die Knie Gezwungenen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand und dem ein Hofhund groß wie ein Kalb war, sehnte sich in diesem Dunkel nach Schlankheit, nach Größe und Erhabenheit. Aufragen wollte er. Und Cyparis, der sein Gespann durch mehr Städte und durch die Hochmoore und Einöden tiefer in die Fremde geführt hatte, als sich ein Erzkocher in Tomi auch nur vorzustellen vermochte, sehnte sich dann nach der Tiefe der Erde und gleichzeitig nach der Höhe der Wolken, nach einem unverrückbaren Ort unter einem unverrückbaren Himmel. Manchmal schlief er während der Vorführung über solchen Sehnsüchten ein und träumte von Bäumen, von Zedern, Pappeln, Zypressen, träumte, daß er Moos auf seiner harten, rissigen Haut trug. Dann sprangen ihm an den Füßen die Nägel auf, und aus seinen krummen Beinen krochen Wurzeln, die rasch stark wurden und zäh und ihn tiefer und tiefer mit seinem Ort zu verbinden begannen. Schützend legten sich die Ringe seiner Jahre um sein Herz. Er wuchs.
Und wenn Cyparis dann, vom Klingen einer leergelaufenen Spule oder vom Schlagen eines gerissenen Zelluloidstreifens geweckt, hochfuhr, spürte er in seinen Gliedern noch das feine Knirschen von Holz, die letzte, leichte Erschütterung eines Baumes, in dessen Krone sich ein Windstoß gefangen und besänftigt hatte. In diesen wirren Augenblicken des Erwachens, in denen er an seinen Füßen noch den Trost und die Kühle der Erde empfand und mit seinen Händen doch schon nach Spulen, Flügelmuttern und Lichtern griff, war Cyparis, der Liliputaner, glücklich.
In Tomi gab es an großen Häusern nur das Schlachthaus und eine finstere, aus Sandsteinblöcken aufgetürmte Kirche, deren Schiff mit feuchten Papierblumenkränzen, modernden Bildern, verrenkten, wie unter furchtbaren Torturen erstarrten Heiligenfiguren und einer eisernen Erlösergestalt geschmückt war, die im Winter so kalt wurde, daß den Andächtigen, die ihr verzweifelt die Füße küßten, manchmal die Lippen daran festfroren. Das Schlachthaus und diese Kirche ausgenommen, gab es aber in Tomi keinen Saal und keinen Raum, der das Publikum des Vorführers oder gar seine prachtvollen, gewaltigen Bilder zu fassen vermocht hätte.
Und so saßen am Abend dieses seltsam milden Apriltages, zu einer Zeit, zu der ebensogut ein Eissturm aus Nordost an den Fensterläden hätte reißen und das Glas noch tief im Inneren der Häuser zum Klirren bringen können, die Menschen von Tomi hinter dem Schlachthaus auf Holzbänken im Freien und warteten auf den Beginn des ersten jener Dramen, die ihnen Cyparis einen ganzen Nachmittag lang angekündigt hatte. Aus einem Lautsprecher, der mit Draht ins Geäst einer Kiefer gebunden war, knisterte der Lärm von Zikaden. Die Zuschauer saßen dicht aneinandergedrängt; viele von ihnen waren in Roßhaardecken gehüllt, und der Atem aus ihren Mündern verflog wolkig und weiß wie im Winter – aber der Projektor war wie in den Sommernächten der vergangenen Jahre von panischen Faltern umschwärmt; wenn einer am heißen Glas zu Tode kam, stieg eine Rauchlocke auf, und die Krämerin meinte in der Wildnis des Himmels ein Sternbild des Sommers zu erkennen. Endlich wurde es auf Tereus Mauer’ licht. Es war also August:
Ein langsamer, schweifender Blick glitt tief ins Land hinein, strich über Pinienwälder hinweg, über dahinrollende, schwarze Hügel, die Dächer von Gehöften, dann über die langen Kämme einer Brandung, schwang sich den Sicheln der Strände nach und näherte sich im tiefen Schatten einer Allee, nun wieder gleitend, einem Palast, der wie ein erleuchtetes, festliches Schiff in der Nacht lag; Kuppeln, Arkaden, Freitreppen und hängende Gärten. Der Blick wurde sorgfältig und musterte gelassen die Pilaster und Gesimse einer Fassade, als plötzlich an seinem äußersten, undeutlichen Rand eine schmale Fensteröffnung erschien. Wie von einem jähen Sog erfaßt, flog der Blick auf dieses Fenster zu und kam in einem schwach erleuchteten Gelaß auf dem Antlitz eines jungen Mannes kurz zur Ruhe, auf einem Mund, und der Mund sagte: Ich gehe. Nun senkte sich der Blick, wandte sich ab, dorthin, wo eine Frau an eine Tür gelehnt stand. Sie flüsterte, bleib. Battus stöhnte, als er die Tränen in ihren Augen sah. Fama zog ihren Sohn zu sich heran, legte ihm eine Hand auf die Stirn, beruhigte ihn. In den Gärten des Palastes waren die Zikaden laut und Zitronenbäume schwer von Früchten. Aber die Hitze der Glutbecken, die man hinter das Schlachthaus getragen hatte, nahm allmählich den Geruch von Blut und Jauche an. Die Traurigen auf Tereus’ Mauer, das mußten hohe Menschen sein. Fama fragte zweimal nach ihren Namen, obwohl sie im Knacken und Rauschen der Lautsprecher längst gefallen waren: Sie hieß Alcyone, und Ceyx er. Und sie nahmen so zärtlich und traurig Abschied voneinander wie an der Küste der eisernen Stadt noch kein Mann von seiner Frau.
Warum der Herr dort oben fortging, wollten die Zuschauer dieses Abends nur widerwillig verstehen; sie murrten und machten dem Vorführer abfällige Zeichen. Sie sahen die Liebenden einander umarmen und halten, sahen sie in leichten Gewändern und dann auch nackt auf dem Kalk und begriffen nur, daß der Schmerz in dieser von Gobelins gedämpften Kammer groß war. Dann wußten sie sich eins mit Alcyone, wenn sie ratlos waren, daß einer fortgehen konnte, wo er liebte.
Gewiß, Ceyx, der Herr über diesen Palast, über das nächtliche Land und die Wachfeuer, die hinter Palisaden und in den Höfen loderten, sprach wohl von seiner großen Verwirrung und seiner Hoffnung auf den Trost des Orakels, sprach von einer Pilgerfahrt nach Delphi … oder war es ein Feldzug, ein Krieg? Ach, er sprach vom Zwang einer Reise über das Meer. Er ging fort. Alles andere war ohne Bedeutung.
Als die Nachricht von Ceyx’ Abschied die Enge der Kammern und Gänge verließ und die Höfe erreichte, wurde es laut. Betrunkene Stallburschen rannten Weibern nach, denen sie zuvor Roßwut in die Suppe und in den heißen Gewürzwein getan hatten, und glaubten nun, dieser Sud, ein Liebestrank, würde ihnen in der Dunkelheit endlich zutreiben, was am Tag vor ihnen floh. Von den Wehrgängen herab war das Lachen der Posten zu hören, die sich alle Bedrohungen mit tiefen, brennenden Zügen aus einer von Unterstand zu Unterstand weitergereichten Ballonflasche aus dem Sinn spülten. In einem der Ställe brach um die Mitternacht Feuer aus; die Flammen wurden dem Palast gerade noch verheimlicht und von den Schweinehirten erstickt. Das Gesinde, der ganze Hofstaat, hatte begonnen, sich von seinem Herrn, seinen Gesetzen und Ordnungen zu lösen, als wäre er längst fort und verschollen.
Bis tief in diese Augustnacht hinein hatte der Glanz von Ceyx’ Macht gereicht, hatte allein die Blendkraft dieses Glanzes genügt, um das Gefüge seiner Herrschaft zu erhalten. Stumm hatten die Posten gewacht und die Knechte stumm gehorcht. Aber nun begann dieses Gefüge spröde zu werden, ja zu zerfallen, als ob auf jeder Palisade, jeder Schanze und Mauerkrone die Ahnung aufgepflanzt worden wäre, daß der Herr diesmal für immer fortging.
Ceyx schien nun nicht einmal mehr die Kraft zu besitzen, seine Frau zu trösten: Sechs, sieben Wochen vielleicht, flüsterte er schläfrig und barg sein Gesicht an Alcyones Schulter, einige Wochen, dann werde er glücklich zurück sein; glücklich und unversehrt. Und Alcyone nickte unter Tränen. Schwarz und schön und federleicht hob und senkte sich eine Brigantine im schimmernden Wasser des Hafenbeckens; an der Reling rauchten Pechfackeln, und unter Deck klirrten manchmal die Ketten schlafender Tiere. Erschöpft schlief Ceyx in Alcyones Armen ein.
Als Tereus eine Zote in das Bild dieser Ruhe grölte, blieb ihm die Zustimmung versagt; niemand lachte. Es hieß ihn aber auch keiner schweigen, als er den Unglücklichen dann eine Litanei von Ratschlägen zubrüllte. Tereus war jähzornig und ertrug keinen Widerspruch. Man hatte ihn an diesem Tag, es war Schlachttag gewesen, stundenlang im blutigen Schaum des Baches arbeiten sehen. Im seichten Schwemmwasser schlug er Stieren den Schädel ein. Wenn sein Beil dem gefesselten Vieh krachend zwischen die Augen fuhr, wurde jedes andere Geräusch so nebensächlich, daß selbst das Rauschen des Baches für einen Augenblick auszusetzen und sich in Stille zu verwandeln schien. Nach solchen Tagen, wenn er über und über besudelt seinen Lastwagen mit säuberlich zerhackten Kadavern belud und sich am Bach die Hunde um Eingeweidefetzen balgten, war Tereus so müde, unberechenbar und wütend, daß ihn mied, wer ihn meiden konnte. Dick und blaß, versunken in die Vorführung des Abschieds, saß Procne auch an diesem Abend neben ihm, seine Frau. Der Schlachter verschwand manchmal tagelang aus Tomi, und es war ein schlecht gehütetes Geheimnis, daß er Procne dann mit irgendeiner namenlosen Hure, die nur ein Schäfer einmal hatte schreien hören, oben in den Bergen betrog. Allein Procne schien nichts zu ahnen. Kränklich und ohne Klagen begleitete sie ihren Gemahl durch ein häßliches Leben und tat, was er von ihr verlangte. Ihr einziger Schutz gegen Tereus war eine zunehmende Dickleibigkeit, ein mit Salben und ätherischen Ölen gepflegtes Fett, in dem diese ehemals zarte Frau allmählich zu verschwinden schien. Tereus schlug sie oft wortlos und ohne Zorn wie ein ihm zur Schlachtung anvertrautes Tier, so als diente jeder Schlag allein dem Zweck, einen kümmerlichen Rest ihres Willens und den Ekel zu betäuben, den sie vor ihm empfand. Schon am Hochzeitstag der beiden hatte man in Tomi böse Zeichen gesehen. Auf dem First ihres Hauses saß damals groß, unbeweglich und ohne Scheu ein Uhu, der Unglücksvogel, der allen Brautleuten eine finstere Zukunft verhieß. Endlich schwieg Tereus.
Alcyone war neben ihrem schlafenden Mann wie erstarrt. Sie wachte mit offenen Augen und wagte keine Bewegung, um dem Schläfer keinen Anlaß zu geben, sich aufseufzend, träumend von ihr abzuwenden. Nun war sie allein mit den Bildern ihrer Angst. Und Cyparis’ Projektor machte jedes dieser Bilder sichtbar, die sie selbst den ganzen vergangenen Abend lang beschworen hatte, um Ceyx zum Bleiben zu bewegen oder wenigstens seine Einwilligung zu erreichen, daß sie ihn begleitete und mit ihm unterging. Alcyone sah ein nächtliches Meer und einen Himmel wie in Trümmern, Wogen und Wolken zu einem tosenden Einerlei zusammengeworfen, das sich im Rhythmus ihrer Atemzüge zu Gebirgen erhob und niederstürzte. Dann rauschten von den Steilhängen Gischtlawinen herab. Alcyone sah regenschwere, zerreißende Segel, seltsam genau jede Naht, jeden Faden des Tuches. Lautlos brach ein Mast. Dann schäumte ein Sturzbach über die Bordtreppe ins Dunkel des Zwischendecks hinab, so heftig wie die Kaskaden des Baches in Tomi. Baumstarke Wasserarme griffen durch die Luken ins Innere des Schiffes, und eine Bö schleuderte einen Albatros hoch über den Untergang hinaus, brach ihm irgendwo oben die Schwingen und warf einen Klumpen Fleisch und Federn ins Wasser zurück. Als der Horizont unter Blitzen für einige Augenblicke wieder erschien, war seine ehemals sanfte, ruhige Linie von Wellenkämmen gezackt wie ein Sägeblatt, das an einem im Holz verborgenen Eisenstück zuschanden geworden war. Über den Sägezähnen rauchte nun ein neuer, ein schwarzer Himmel empor, der rasend näher kam und sich endlich über allem schloß, was nicht von allem Anfang an zum Meer gehört hatte. Das Schiff sank. Und was zuvor über Bord gegangen war oder sich fürs erste hatte retten können, folgte ihm in langsamen, dann schneller und schneller werdenden Spiralen in die Tiefe nach. Am Ende wirbelte in den Strudeln und Wassertrichtern nur noch der Sand des Grundes. Es war eine grandiose Lächerlichkeit:
Die Zuschauer auf den Holzbänken kannten die Stürme des Schwarzen Meeres und hatten sich im Fortgang der Katastrophe längst darüber verständigt, daß über Tereus’ Mauer doch nur die Bilder einer schlechten Täuschung brausten, daß dieser Ozean dort oben in Wahrheit wohl nur laues, in einem Bottich aufgewühltes Wasser war und das gesunkene Schiff kaum größer als ein Spielzeug. Man war in Tomi zwar mit solchen und anderen Täuschungen und Trugbildern vertraut und sehnte sich in der Monotonie eines Jahres oft nach dieser betörenden Abwechslung, aber was Cyparis an diesem Abend zeigte, betraf das nachprüfbare, das eigene Leben, die Plagen an der Küste und auf dem Meer …, selbst der blöde Battus konnte sehen, daß an diesen Sturmbildern nichts Glaubhaftes war. Spielzeugmasten waren geborsten, Spielzeugsegel zerrissen, und auch der Orkan rührte wohl nur von einem Windrad her, ähnlich dem Ventilator, mit dem der Liliputaner die gleißenden Lampen seines Apparates kühlte. Im vergangenen Jahr hatten sich Tereus’ Sohn Itys einen Finger verstümmelt, als er in das Sirren dieses Ventilators griff; die Flügelblätter hatten sein Blut in tausend winzigen Tropfen auf die Vorführmaschine des Liliputaners verteilt.
Das Unheil war durchschaut. Als Cyparis begriff, daß sein Drama Gefahr lief, alle Kraft zu verlieren, erhöhte er die Lautstärke der Musik und des Sturmgeheuls und überspielte so den groben Spott aus dem Publikum.
Erst jetzt, inmitten dieses neu entfachten Wütens, entdeckte Alcyone ihren Geliebten. Ceyx trieb an ein Stück Bruchholz geklammert allein in der Gischt. In seinen Haaren glänzte Tang, auf seinen Schultern saßen Seeanemonen und Muscheln; er streckte eine blutige Hand nach Alcyone aus und öffnete den Mund zu einem Schrei, blieb stumm. Und so schrie Alcyone für ihn. Und erwachte. Und sah Ceyx tief und ruhig atmend neben sich auf dem Lager. Aber es war kein Trost, ihn so liegen zu sehen.
Am nächsten Morgen schwankten müde Fahnen auf den Hafen zu. Vor dem Fallreep der Brigantine standen sie still. Ceyx ging an Bord, wandte sich auf diesem kurzen, steilen Weg wieder und wieder um und stand dann doch an die Reling gelehnt, lange, während die Brigantine durch einen dichten, seufzenden Wald aus Masten und Rahen dem offenen Meer entgegen und aus der Sichtweite glitt. Von nun an geschah alles, wie es geträumt war, nur in dunkleren, leuchtenderen Farben.
Am Abend des dritten Tages nach dem Auslaufen erhob sich der Sturm aus dem Traum. Ceyx’ Gefährten arbeiteten wie rasend gegen ihr Ende, verzweifelten, schleuderten Ballast und schließlich Opfergaben in die Flut, und doch war das Schiff schon ein Wrack, als es sank. Ein Segelmacher, der dem Wasser zuvorkam und Hand an sich legte, starb als erster; andere kämpften noch eine Stunde und länger um das Leben und starben auch. Endlich war Ceyx so allein, wie Alcyone ihn längst gesehen hatte, klammerte sich immer noch fest und hustete und keuchte ihren Namen und alle Hoffnung aus sich heraus. Dann glaubte er zu erkennen, daß aller Trost allein in Alcyones Armen und nicht in Delphi und keinem Heiligtum lag. Wie sehr er sich nun nach ihr und dem Land sehnte, auf dem sie ging, nach festem Land. Dann versank auch er. Auf einer Planke blieben Blutflecken zurück, die das Wasser rasch auswusch, und einige Fetzen Haut; Seevögel ließen sich auf dem Holz nieder und schlugen mit ihren Schnäbeln nach diesem Rest. Darüber beruhigte sich das Meer.
Nun war es doch kalt geworden. In den schwarzen Bäumen von Tomi, im Labyrinth der Gassen und im schmiedeeisernen Zierat verfing sich der Nebelflor, der allabendlich von der Küste aufstieg und sich in der Nacht als Rauhreif niederschlagen würde. Auf dem Planwagen des Vorführers schimmerten die ersten Eiskristalle. Die Glutbecken glommen nur noch schwach und wurden nicht mehr gespeist. Die Zuschauer kannten die übliche Länge von Cyparis’ Dramen und ahnten, daß dieses hier auf sein Ende zulief, und begannen sich ihre Vermutungen über den Ausgang zuzurufen. Cyparis gab sich geschlagen und nahm die dröhnende Lautstärke zurück.
Alcyones Traum war erfüllt; aber noch saß die Witwe mit zwei Freundinnen zwischen Lorbeer und Rosenstöcken auf einer Veranda des Palastes und nähte an einem Kleid, das sie zum Fest von Ceyx’ Rückkehr tragen wollte. Mit ihren Gedanken war sie auch dieser Arbeit schon weit voraus, wand Girlanden, sah Ceyx die steile Straße herauf und auf sich zukommen und breitete die Arme aus.
Tot! brüllte nun Battus und lachte, glücklich darüber, daß er es war, er, der so viel Wichtiges vor der Schönen dort oben und vor allen anderen wußte, tot! Er ist tot.