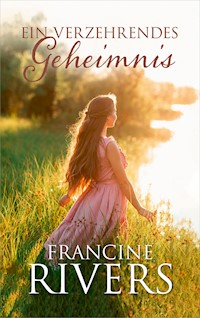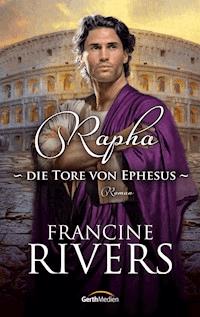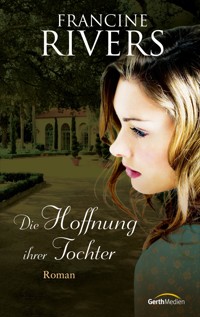Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kalifornien, 1940: Pastor Freeman findet ein verlassenes Neugeborenes unter einer Brücke. Seine Frau und er ziehen die kleine Abra auf wie ein eigenes Kind. Ihr Sohn Joshua wird Abras persönlicher Beschützer und bester Freund. Doch Abra fühlt sich trotz allem nicht wirklich zugehörig. Sie wächst zu einem rebellischen Teenager heran und brennt schließlich mit dem charmanten Dylan nach Hollywood durch, um Karriere beim Film zu machen. Tatsächlich gerät sie bald an einflussreiche Leute und wird zum neuen Stern am Filmhimmel. Endlich ist sie "jemand" - doch der Erfolg hat einen schrecklichen Preis ... Mit diesem lange erwarteten Roman legt Bestsellerautorin Francine Rivers eine wahrhaft filmreife Geschichte um Versuchung, Gnade und bedingungslose Liebe vor, die dem Leser noch lange nachgeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Francine Rivers war bereits eine Bestsellerautorin, als sie sich dem christlichen Glauben ihrer Kindheit wieder zuwandte. Anschließend schrieb sie im Jahr 1986 ihr bekanntestes Buch, „Die Liebe ist stark“, dem noch rund 20 weitere Romane folgten. Sie lebt mit ihrem Mann in Nordkalifornien.
Die amerikanische Originalausgabeerschien im Verlag Tyndale House Publishersunter dem Titel „Bridge to Haven“.Published in association with Browne and Miller Literary Associates, LLC, 410 Michigan Avenue, Suite 460, Chicago, IL 60605© 2014 by Francine RiversAll Rights Reserved.© der deutschen Ausgabe 2015 by Gerth Medien GmbH, Dillerberg 1, 35614 AsslarDie Bibelzitate wurden, sofern nicht anders angegeben, den folgenden Bibelübersetzungen entnommen:- Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (GN)- Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung,© 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (LÜ 84)1. Auflage 2015ISBN 978-3-96122-171-4Umschlaggestaltung: Hanni PlatoUmschlagfoto: Stephen Vosloo, Tyndale House (Frau und Auto),franckreporter/iStockphoto (Palmen)Satz: DTP Verlagsservice Apel, Wietzewww.Gerth.de
Kapitel 1
Seit meiner Geburt hast du mich gehalten,von Anfang an hast du für mich gesorgt.Deshalb lobe ich dich allezeit!
Psalm 71,6
1936
Pastor Ezekiel Freeman füllte seine Lungen mit der kühlen Oktoberluft und begann mit seinem morgendlichen Gebetsspaziergang. Als er damals in die Stadt gekommen war, hatte er die Route auf einer Karte festgelegt. Jedes Gebäude rief ihm seine Bewohner ins Gedächtnis, und er brachte sie vor Gott, dankte für Prüfungen, die sie bestanden hatten, betete für die, die schwierige Situationen durchlebten und bat Gott, ihm zu zeigen, wie er ihnen helfen könnte.
Auf dem Weg zur Thomas Jefferson Highschool kam er an Eddies Diner vorbei, in dem die Schüler gern herumhingen. Der Gastraum war hell erleuchtet.
Eddie kam an die Tür. „Morgen, Zeke. Wie wäre es mit einer Tasse Kaffee?“
Zeke setzte sich an die Theke, während Eddie einen Stapel Hamburger-Frikadellen vorbereitete. Sie unterhielten sich über die Football-Mannschaft der Highschool und wer wohl ein Stipendium bekommen würde. Schließlich dankte Zeke Eddie für den Kaffee und das Gespräch und verschwand wieder nach draußen in die Dunkelheit.
Er überquerte die Hauptstraße und lief an den Eisenbahnschienen entlang. Da hinten war ein Lagerfeuer. Er ging zu den Gleisarbeitern, die sich daran wärmten, und fragte, ob er sich zu ihnen setzen dürfe. Einige der Männer arbeiteten schon einige Zeit in der Stadt und hatten Zeke bereits kennengelernt. Andere waren Fremde, die müde und ausgelaugt wirkten, nachdem sie kreuz und quer durch das ganze Land gezogen waren, unterwegs alle möglichen Jobs angenommen hatten und von der Hand in den Mund lebten. Ein junger Mann sagte, ihm gefiele die Stadt und er würde gern bleiben. Zeke informierte ihn darüber, dass das Holzlager im Norden einen Helfer suchte. Er gab dem jungen Mann seine Karte. „Kommen Sie doch mal vorbei, wann immer Sie mögen. Mich interessiert, wie Sie zurechtkommen.“
Die Grillen im hohen Gras und das Käuzchen auf einer Tanne verstummten, als ein Wagen in den Parkplatz des Riverfront Parks einbog und in der Nähe der Toiletten zum Stehen kam. Eine junge Frau stieg aus. Der volle Mond am Himmel spendete gerade so viel Licht, dass sie sehen konnte, wo sie hintrat.
Stöhnend vor Schmerz beugte sie sich vor und legte die Hand auf ihren Bauch. Die Wehen kamen jetzt schnell hintereinander, es lag nicht einmal eine Minute dazwischen. Sie brauchte eine Zuflucht, ein Versteck, wo sie ihr Kind zur Welt bringen konnte. Durch die Dunkelheit taumelte sie zur Damentoilette, doch die Tür war abgeschlossen. Unterdrückt schluchzend wandte sie sich ab.
Warum nur war sie so weit gefahren? Warum hatte sie sich nicht in einem Motel ein Zimmer genommen? Jetzt war es zu spät.
Der Marktplatz war die nächste Station auf Zekes Wanderung. Er betete für jeden einzelnen Ladenbesitzer, die Mitglieder des Stadtrats, die am Nachmittag zu einer Sitzung im Rathaus zusammenkommen würden, und für die Touristen, die im Haven Hotel abgestiegen waren. Es war noch dunkel, als er Roland Dutchers Lieferwagen entdeckte, der gerade in einer Querstraße wendete. Alle nannten ihn Dutch, auch seine Frau, die mit Krebs im Endstadium im Krankenhaus lag. Zeke hatte sie mehrmals besucht und wusste, dass sie mehr Angst hatte, ihr Mann werde den Glauben an Gott verlieren, als vor dem Sterben. „Ich weiß, wo ich hingehe. Aber ich habe Angst, wie Dutch wohl darauf reagieren wird.“
Der Mann arbeitete sechs Tage die Woche und sah keine Notwendigkeit, den siebten in der Kirche zu verbringen. Die Bremsen des Lieferwagens quietschten kurz, als er anhielt. Dutch drehte seine Scheibe herunter. „Es ist ein bisschen kalt, um durch die Straßen zu ziehen, Pastor. Haben Sie hier irgendwo eine Freundin versteckt?“
Zeke ignorierte den Sarkasmus und steckte seine eiskalten Hände in seine Manteltaschen. „Um diese Zeit kann ich am besten beten.“
„Nun, Höllenfeuer und Halleluja, lassen Sie sich von mir nicht von der Arbeit abhalten.“ Er stieß ein hartes Lachen aus.
Zeke trat näher. „Ich habe gestern Sharon besucht.“
Dutch ließ scharf den Atem entweichen. „Dann wissen Sie ja, dass es ihr nicht gut geht.“
„Ja, es geht ihr nicht gut.“ Wenn nicht ein Wunder geschah, blieb ihr nicht mehr viel Zeit. Das Loslassen würde ihr leichter fallen, wenn sie sich nicht so große Sorgen um ihren Mann machen würde, aber eine solche Äußerung würde Dutchs Streitlust nur noch anstacheln.
„Nur zu, Pastor. Laden Sie mich zum Gottesdienst ein.“
„Sie wissen doch, dass die Kirche Ihnen immer offen steht.“
Dutch sackte ein wenig in sich zusammen. „Im Augenblick würde ich Gott am liebsten ins Gesicht spucken. Sie ist eine großartige Frau, die beste, die ich kenne. Wenn jemand ein Wunder verdient hätte, dann Sharon. Sagen Sie mir, welche Hilfe Gott ihr gibt.“
„Sharons Körper wird sterben, Dutch, aber ihre Seele wird weiterleben.“ Das Aufflackern des Schmerzes in Dutchs Augen zeigte Zeke, dass er nicht bereit war, ihm länger zuzuhören. „Soll ich Ihnen helfen, den Lieferwagen zu entladen?“
„Danke, aber das schaffe ich schon allein.“ Dutch legte den Gang ein, stieß einen Fluch aus und fuhr los.
Das Kind kam mit einem Schwall warmen Blutes aus ihrem Körper und die junge Frau atmete erleichtert auf. Die eiserne Umklammerung war verschwunden und sie hatte Zeit, wieder zu Atem zu kommen. Im Schatten der Brücke kauernd blickte sie keuchend durch die Stahlträger in den mit Sternen übersäten Himmel hinauf.
Das Baby lag blass im Mondlicht auf einer dunklen Decke auf der Erde. Es war zu dunkel, um zu erkennen, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, aber andererseits … wollte sie das überhaupt wissen?
Mit fahrigen Bewegungen wand sich die junge Frau aus ihrem dünnen Pullover und legte ihn über das Neugeborene.
Ein kalter Wind setzte ein. Zeke schlug den Kragen seines Mantels hoch. Er überquerte mehrere Straßen auf dem Weg zum Krankenhaus. Die Brücke kam ihm in den Sinn, doch sie lag in der anderen Richtung. In den Sommermonaten ging er häufig zum Riverfront Park, vor allem, wenn die Touristen auf dem kleinen angrenzenden Campingplatz lagerten. Jetzt im Herbst, wo es schon unangenehm kalt war und die Blätter von den Bäumen fielen, war der Zeltplatz verlassen.
Die Dunkelheit lichtete sich, doch bis die Sonne aufging, würde es noch eine ganze Weile dauern. Er sollte nach Hause gehen. Doch die Brücke ging ihm einfach nicht aus dem Sinn. Zeke drehte um und machte sich auf den Weg dorthin.
Hätte er doch Handschuhe angezogen! Seine Hände waren eiskalt. Er blies in sie hinein. An der Ecke blieb er stehen und überlegte, ob er tatsächlich zur Brücke gehen oder doch lieber nach Hause zurückkehren sollte. Marianne und Joshua würden bald frühstücken und er würde zu spät kommen, wenn er jetzt noch weiterging.
Doch er spürte ein ungewöhnliches Gefühl der Dringlichkeit in sich. Jemand benötigte seine Hilfe. Bis zur Brücke würde er nur zehn Minuten brauchen, etwas weniger, wenn er seinen Schritt beschleunigte. Er musste diesem inneren Drängen nachgeben, sonst würde er keinen Frieden finden.
Am ganzen Körper zitternd kurbelte die junge Frau ihre Fensterscheibe hoch. Von jetzt an würde sie nie mehr ohne Schuldgefühle und Reue leben können, das war ihr bewusst. Ihre Hand zitterte, als sie den Schlüssel umdrehte, den sie im Zündschloss hatte stecken lassen. Sie wollte nichts weiter, als diesen Ort hinter sich zu lassen und alles, was geschehen war, alles, was sie falsch gemacht hatte, zu vergessen.
Sie trat etwas zu fest auf das Gaspedal. Der Wagen schleuderte zur Seite und ein Adrenalinstoß schoss durch ihren Körper. Kleine Steinchen spritzten hoch. Etwas langsamer bog sie rechts ab, zur Hauptstraße. Mit tränenverschleierten Augen starrte sie auf die Straße. Sie würde nach Norden fahren und sich ein billiges Motel suchen. Dann würde sie entscheiden, wie sie ihrem Leben ein Ende setzte.
Der Wind strich über das sandige Ufer. Das verlassene Baby, nicht mehr geschützt durch die Wärme eines Mutterschoßes, spürte die stechende Kälte der Welt. Ein leiser Schrei ertönte, dann ein jammernder Klagelaut. Der Laut wurde über das Wasser getragen, aber in den Häusern oberhalb des Flusses blieben die Lichter dunkel.
Die Stahlträger der Brücke ragten über die Bäume hinaus. Zeke überquerte die alte Flussstraße und nahm den Fußgängerweg über die Brücke. Auf halbem Weg blieb er stehen und beugte sich über das Geländer. Ganz ruhig floss der Fluss unter ihm dahin. Vor ein paar Tagen hatte es geregnet. Der Strand war glatt und feucht. Niemand zu sehen.
Warum bin ich hier, Herr?
Zeke richtete sich auf. Noch immer hatte er keine innere Ruhe gefunden. Nach einem kurzen Moment drehte er sich um. Es war an der Zeit, nach Hause zu gehen.
Ein leises Jammern mischte sich in das Rauschen des Flusses. Was war das? Er klammerte sich am Geländer fest, beugte sich vor und spähte an den Stützpfeilern vorbei in die Dunkelheit. Da! Da war es wieder. So schnell er konnte überquerte er die Brücke und die Grasfläche zum Parkplatz. Vielleicht ein Kätzchen? Ungewollte „Abfälle“ wurden von den Leuten häufig am Straßenrand entsorgt.
Wieder ertönte der Klagelaut und dieses Mal erkannte er es. Joshua hatte als Neugeborener solche Töne von sich gegeben. Ein Baby, hier? Er rannte zum Flussufer und folgte dem Schreien über den Sand zu dem Kies unter der Brücke. Die Kieselsteine knirschten unter seinen Füßen.
Da, schon wieder, schwächer dieses Mal, aber so nah, dass er anhielt und gründlich den Boden zu seinen Füßen musterte. Stirnrunzelnd hockte er sich hin und hob etwas auf, das aussah wie ein weggeworfener Pullover. „Oh Herr …!“ Ein Baby. Es lag so reglos, so klein, so blass auf dem Boden, dass er sich fragte, ob er vielleicht schon zu spät kam. Es war ein Mädchen. Er schob seine Hände unter das Kind. Es war federleicht. Als er sich das Baby in die Armbeuge legte, breitete es die Arme aus wie ein winziger Vogel, der zu fliegen versuchte, und stieß einen markerschütternden Schrei aus.
Zeke riss seinen Mantel auf, seine Hemdknöpfe, und drückte das Baby an seinen Körper. Zusätzlich hauchte er sein Gesicht an, um es zu wärmen. „Schrei nur, meine Kleine. Schrei, so laut du kannst. Und klammere dich ans Leben, verstanden?“
Zeke kannte jede Abkürzung und erreichte das Krankenhaus, noch bevor die Sonne aufging.
Gegen Mittag war Zeke wieder im Krankenhaus, um Sharon zu besuchen. Dutch war bei ihr, grimmig und ausgezehrt. Er hielt die zarte Hand seiner Frau in seiner und sagte kein Wort. Sharon streckte ihre andere Hand nach Zeke aus. Zeke ergriff sie und betete für sie und Dutch.
Es war ihm unmöglich, das Krankenhaus zu verlassen, ohne noch einmal die Neugeborenenstation aufzusuchen. Marianne stand vor der Scheibe, den Arm um den fünfjährigen Joshua gelegt. Das überraschte ihn nicht. Zärtlichkeit und Stolz wallten in ihm auf beim Anblick seiner Frau und ihres gemeinsamen Sohnes mit den dünnen Beinen und den großen Füßen.
Joshua legte seine Hand an das Glas. „Sie ist so klein, Papa. War ich auch so klein?“ Das winzige Baby schlief tief und fest in dem kleinen Stubenwagen.
„Nein, Junge. Du hast neun Pfund gewogen.“ Der Ausdruck auf Mariannes Gesicht machte Zeke unruhig.
Er ergriff ihre Hand. „Wir sollten nach Hause gehen, Liebes.“
„Gott sei Dank, dass du da warst, Zeke. Was wäre aus ihr geworden, wenn du sie nicht gefunden hättest?“ Marianne blickte ihn an. „Wir sollten sie adoptieren.“
„Du weißt, dass das nicht möglich ist. Man wird ein anderes Paar finden, das sie aufnimmt.“ Er wollte sie fortführen.
Marianne rührte sich nicht. „Wer wäre besser geeignet als wir?“
Joshua stimmte mit ein. „Du hast sie gefunden, Papa. Wer etwas findet, darf es behalten.“
„Sie ist doch kein Geldschein, den ich auf dem Gehweg gefunden habe, Junge. Sie braucht eine Familie.“
„Wir sind eine Familie.“
„Du weißt, was ich meine.“ Er legte seine Hand an Mariannes Wange. „Du hast wohl vergessen, wie anstrengend es ist, ein neugeborenes Baby zu versorgen.“
„Ich schaffe das schon, Zeke. Warum sollte sie nicht zu uns kommen?“ Sie zog sich zurück. „Bitte sieh mich nicht so an. Ich bin kräftiger, als du denkst.“ Ihre Augen füllten sich mit Tränen, bevor sie sich abwandte. „Schau sie dir doch nur an. Bricht es dir nicht das Herz?“
Bei ihrem Anblick schmolz er dahin. Aber er durfte nicht nachgeben. „Wir sollten jetzt gehen.“
Marianne drückte seine Hand. „Denk doch nur an all die Bibelstellen, in denen es um die Fürsorge für Witwen und Waisen geht.“
„Verwende nicht Bibelstellen gegen mich. Ich versuche doch nur, dich zu schützen.“
Joshua blickte hoch. „Wovor beschützen, Papa?“
„Vor nichts.“ Marianne warf Zeke einen beschwörenden Blick zu. „Es ist nur ein Gedanke, den dein Papa sich vor langer Zeit in den Kopf gesetzt hat. Er wird darüber hinwegkommen. Gott hat sie dir in die Arme gelegt, Zeke. Sag nicht, dass es nicht so ist.“ Marianne blickte ihn mit ihren großen Augen flehend an. „Wir haben unseren Jungen. Ein kleines Mädchen würde unsere Familie so sehr bereichern. Habe ich das nicht immer gesagt?“
Das stimmte. Marianne hatte sich mehr Kinder gewünscht, aber der Arzt hatte sie davor gewarnt, dass ihr Herz, das durch ein rheumatisches Fieber in ihrer Kindheit geschädigt worden war, eine zweite Schwangerschaft nicht verkraften würde.
Zeke spürte, wie seine Entschlossenheit ins Wanken geriet. „Marianne. Bitte. Hör auf.“ Nach Joshuas Geburt hatte sie Monate gebraucht, um sich zu erholen. Die Versorgung eines Neugeborenen wäre viel zu anstrengend für sie.
„Wir könnten ihre Pflegeeltern sein. Wir sollten sie so bald wie möglich nach Hause holen. Wenn es mir zuviel wird, dann …“ Ihre Augen wurden feucht. „Bitte, Zeke.“
Zehn Tage später unterschrieb Dr. Rubenstein die Entlassungsformulare für das kleine namenlose Mädchen und legte es in Mariannes Arme. „Sie und Ihr Mann werden der Kleinen sehr gute Pflegeeltern sein.“
Nach den ersten drei Nächten begann Zeke sich Sorgen zu machen. Marianne stand alle zwei Stunden auf und fütterte das Baby. Wie lange würde ihr Herz das aushalten? Doch obwohl sie erschöpft wirkte, hätte sie glücklicher nicht sein können. Marianne saß in einem Schaukelstuhl, das Baby in den Armen, und fütterte es mit einer Flasche warmer Milch. „Sie braucht einen Namen, Zeke. Einen Namen voller Verheißung und Hoffnung.“
„Abra bedeutet ‚Mutter der Völker‘.“ Er sprach die Worte aus, bevor er sich zurückhalten konnte.
Marianne lachte. „Du wolltest sie auch, nicht? Und sag jetzt nicht, es wäre nicht so.“
Wie hätte es anders sein können? Trotzdem ließ die Angst ihn nicht aus ihren Fängen. „Wir sind nur ihre Pflegeeltern, Marianne. Vergiss das nicht. Wenn dir alles zu viel wird, geben wir Abra wieder ab.“
„An wen sollen wir sie denn abgeben? Das Jugendamt ist sehr angetan von uns. Und bestimmt gibt es in der ganzen Stadt keinen Menschen, der uns Abra jetzt noch wegnehmen würde.“ Peter Matthews, Lehrer an der Grundschule am Ort, und seine Frau Priscilla hatten anfangs Interesse an der Kleinen bekundet, aber da sie selbst eine kleine Tochter zu versorgen hatten, waren sie einverstanden gewesen, dass Abra bei den Freemans blieb, solange sie in der Lage waren, sie zu versorgen.
Marianne stellte das leere Fläschchen zur Seite und legte das Baby an ihre Schulter. „Wir sollten ein zweites Kinderzimmer anbauen. Abra wird nicht immer ein Baby bleiben. Sie braucht ein Kinderbett, später ein richtiges Bett und natürlich ein eigenes Zimmer.“
Mariannes Mutterinstinkt war geweckt. Man konnte nicht vernünftig mit ihr reden, doch mit jedem Tag wuchs ihre Erschöpfung. Dunkle Ringe lagen unter ihren Augen.
„Morgen schläfst du aus. Ich nehme sie mit auf meinen Spaziergang.“
„Im Dunkeln?“
„Es gibt Straßenlaternen, und ich kenne die Stadt wie meine Westentasche.“
„Bestimmt ist es zu kalt für sie.“
„Ich packe sie warm ein.“ Er faltete eine Decke zu einem Dreieck, nahm Abra aus Mariannes Armen, band sie sich um die Taille und die Arme und richtete sich auf. „Siehst du? So bleibt sie schön warm.“ Und sie war direkt an seinem Herzen, wo sie vom ersten Augenblick an gewesen war, seit sein Blick auf sie gefallen war.
Manchmal wurde Abra unruhig, wenn er sie zu seinen frühmorgendlichen Spaziergängen mitnahm, dann sang er ihr etwas vor. Sie schlief eine Weile und wurde wieder wach, wenn Zeke bei Eddies Diner stehen blieb oder ein paar Worte mit Dutch wechselte.
„Wie schön, dass Sie die Kleine aufgenommen haben. Ist sie nicht niedlich, mit ihren roten Haaren?“ Eddie strich mit der Fingerspitze über Abras Wange.
Sogar der verbitterte Dutch lächelte, als er sich aus dem Fenster seines Wagens lehnte, um einen Blick auf sie zu werfen. „Sie sieht aus wie ein kleiner Engel.“ Pause. „Sharon und ich hätten gern Kinder gehabt.“ Das war ein weiterer Vorwurf an Gott. Sharon war inzwischen verstorben, und Zeke wusste, dass der Mann schrecklich trauerte. Als Abra mit ihrer Hand Dutchs kleinen Finger umklammerte, war er den Tränen nahe. „Wer legt denn ein Baby unter einer Brücke ab, um Himmels willen? Wie gut, dass Sie zufällig vorbeikamen.“
„Es war kein Zufall, dass ich an jenem Morgen dorthin gegangen bin.“
„Wie das?“ Dutchs Motor ratterte im Leerlauf.
„Ich spürte ein inneres Drängen, zur Brücke zu gehen. Manchmal tut Gott so etwas.“
Dutch wirkte bekümmert. „Nun, da werde ich nicht widersprechen. Auf jeden Fall hat das die Kleine gerettet, denn sonst wäre sie mittlerweile tot und begraben.“ Wie Sharon, sagten seine Augen.
„Wenn Sie mal reden möchten, Dutch, sagen Sie nur Bescheid.“
„Sie sollten mich besser aufgeben.“
„Sharon hat das nicht getan. Warum sollte ich?“
Abra wurde größer und schlief länger zwischen den Mahlzeiten, und auch Marianne bekam mehr Schlaf. Trotzdem nahm Zeke Abra Morgen für Morgen auf seine Spaziergänge mit. „Ich werde das beibehalten, bis sie nachts durchschläft.“ Jeden Morgen stand er noch vor dem Weckerläuten auf, zog sich an und ging ins Kinderzimmer. Abra lag dann schon hellwach in ihrem Bettchen und wartete auf ihn.
1941
Ein Kleinkind zu versorgen ist anstrengend, selbst wenn es pflegeleicht ist, und Zeke bemerkte, wie Mariannes Kräfte nachließen.
Als er eines Tages im Juni nach Hause kam, lag Marianne schlafend auf der Couch im Wohnzimmer, während die mittlerweile vierjährige Abra ihre Puppe in der Toilettenschüssel badete. Da wusste er, dass etwas geschehen musste.
„Du bist erschöpft.“
„Abra stellt schneller etwas an, als ich ‚Fischers Fritz fischt frische Fische‘ sagen kann.“
„Das kann nicht so weitergehen, Marianne.“
Auch anderen in der Gemeinde fiel auf, wie erschöpft Marianne war, und sie äußerten ihre Besorgnis. Priscilla Matthews sprach sie eines Sonntags nach dem Gottesdienst an. Ihr Mann hatte Gitter vor die Türen gebaut, damit ihre ebenfalls vierjährige Penny nicht mehr aus dem Wohnzimmer entwischen konnte. „Das ganze Zimmer ist jetzt ein großes Laufställchen, Marianne. Ich habe aufgegeben und alles weggeschlossen, was kaputtgehen kann. Wie wäre es, wenn Zeke Abra an einigen Nachmittagen in der Woche zu uns rüberbringt? Dann könntest du dich ganz unbeschwert und ohne Störungen ein paar Stunden ausruhen.“
Marianne lehnte ab, doch Zeke fand das eine hervorragende Lösung.
Zeke kaufte Material und machte sich daran, hinter dem Haus ein zweites Kinderzimmer anzubauen. Joshua, inzwischen neun, saß auf den Brettern und hielt sie fest, während Zeke sägte. Ein Gemeindemitglied verlegte die Stromkabel. Ein anderes baute ein Bett und half Zeke, auf der dem Garten zugewandten Seite Fenster einzusetzen.
Obwohl Zeke nicht begeistert davon war, dass sein Sohn in eine schmale, umgebaute Veranda als Kinderzimmer zog, liebte Joshua sein „Fort“. Sein bester Freund, Dave Upton, wollte bei ihm übernachten, doch das Zimmer war so schmal, dass Zeke am Ende für die beiden im Garten ein Zelt aufbaute. Als er wieder ins Haus kam, sank er in seinen Sessel. „Das Fort ist zu klein.“
Marianne lächelte. Abra saß neben ihr im Schaukelstuhl und blätterte in der Kinderbibel. „Ich habe keine einzige Klage von Joshua gehört. Die Jungen sind sehr glücklich mit ihrem Zeltabenteuer, Zeke.“
„Im Augenblick noch.“ Falls Joshua nach seinem Vater und seinen Onkeln in Iowa kam, dann würde er dieses Zimmer sprengen, noch bevor er die Highschool besuchte.
Zeke schaltete das Radio ein und wandte sich der Post zu. Im Radio gab es nur schlimme Nachrichten. Hitler wurde immer dreister. Der unersättliche Führer schickte nach wie vor Flugzeuge über den Kanal, um England zu bombardieren, während seine Truppen im Osten Russlands an den Grenzen rüttelten. Charles Lydickson, der Bankier in der Stadt, meinte, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis Amerika in den Krieg hineingezogen würde. Der Atlantische Ozean sei kein Schutz mehr, seit die deutschen U-Boote die Meere unsicher machten und unzählige Schiffe versenkten. Zeke dankte Gott dafür, dass Joshua erst neun Jahre alt war, doch sofort überfielen ihn Schuldgefühle. Er kannte so viele Väter, deren Söhne vielleicht schon bald in den Krieg ziehen müssten.
Marianne hatte die Geschichte von David und Goliat zu Ende gelesen. Sie drückte die halb schlafende Abra an sich, selbst viel zu müde, um aufzustehen.
Zeke sprang auf. „Heute bringe ich sie mal ins Bett.“ Er nahm Abra auf den Arm. Das Kind schmiegte sich an ihn, legte den Kopf an seine Schulter, den Daumen im Mund.
Er zog die Decke hoch und steckte sie um sie herum fest. Dann neigte er den Kopf. Sie faltete die Hände und er nahm sie in seine. „Unser Vater im Himmel …“ Nach dem Gebet beugte er sich vor und gab ihr einen Kuss. „Schlaf schön.“
Bevor er den Kopf wieder heben konnte, legte sie die Arme um seinen Hals. „Ich hab dich lieb, Papa.“ Er habe sie auch lieb, beteuerte er, drückte ihr einen Kuss auf jede Wange und die Stirn und verließ das Zimmer.
Marianne war völlig am Ende. Er runzelte bei ihrem Anblick die Stirn, doch sie schüttelte den Kopf und lächelte schwach. „Mir geht es gut, Zeke. Ich bin nur müde. Es ist nichts, was nicht eine gute Portion Schlaf heilen könnte.“
Zeke wusste, dass das nicht stimmte, als sie beim Aufstehen leicht ins Schwanken geriet. Er fing sie auf, trug sie in ihr Schlafzimmer und setzte sich mit ihr auf dem Schoß auf das Bett. „Ich rufe den Arzt.“
„Du weißt doch, was er sagen wird.“ Sie brach in Tränen aus.
„Wir müssen uns etwas überlegen.“ Er hatte nicht den Mut, es anders auszudrücken, aber sie wusste, was er meinte.
„Ich werde Abra nicht weggeben.“
„Marianne …“
„Sie braucht mich.“
„Ich brauche dich auch.“
„Du liebst sie doch genauso sehr wie ich, Zeke. Wie kannst du nur daran denken, sie wegzugeben?“
„Wir hätten sie nie zu uns nehmen dürfen.“
Zeke wiegte seine Frau in den Armen. Nach einer Weile half er ihr, ihren Morgenrock auszuziehen und sich hinzulegen. Er küsste sie und schaltete das Licht aus, bevor er die Tür hinter sich ins Schloss zog.
Im Flur stolperte er beinahe über Abra, die mit gekreuzten Beinen auf dem Boden hockte, ihren Teddy fest an sich gedrückt, den Daumen im Mund. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn. Wie viel hatte sie mitbekommen?
Er nahm sie auf den Arm. „Du solltest längst im Bett liegen, meine Kleine.“ Nachdem er sie wieder zugedeckt hatte, tippte Zeke an ihre Nasenspitze. „Und dieses Mal bleibst du im Bett, ja?“ Er gab ihr noch einen Kuss. „Schlaf jetzt.“
Niedergeschlagen ließ er sich in seinen Sessel im Wohnzimmer sinken und barg den Kopf in den Händen. Habe ich dich missverstanden, Herr? Habe ich mich von Marianne überreden lassen, obwohl du andere Pläne für Abra hattest? Du weißt besser als ich, wie sehr ich beide liebe. Was soll ich jetzt tun, Herr? Gott, was soll ich nur tun?
Obwohl Papa den Ofen bereits angeheizt hatte, damit es am nächsten Tag beim Gottesdienst schön warm war, hockte Abra zitternd in der ersten Kirchenbank, während Mama Lieder auf dem Klavier übte.
Der Regen trommelte auf das Dach und an die Fenster. Papa saß in seinem kleinen Büro und ging seine Predigtnotizen durch. Joshua war in seiner Pfadfinderuniform losgezogen, um Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz zu verkaufen. In weniger als drei Wochen stand Weihnachten bevor. Mama hatte mit Abra Plätzchen gebacken und die Krippe auf dem Kaminsims aufgebaut. Papa und Joshua hatten außen am Haus die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Nach dem Abendessen stellte sich Abra gern vor das Tor und freute sich am hell erleuchteten Haus.
Mama klappte das Liederbuch zu, legte es zur Seite und erhob sich. „So, meine Kleine. Jetzt bist du dran.“
Abra sprang von der Bank und rannte zu den Stufen zur Klavierbank. Mama wollte sie hochheben, ließ sie jedoch wieder los, trat zur Seite und stützte sich schwer auf das Klavier. Ihre rechte Hand presste sie an ihre Brust und sie schnappte nach Luft, lächelte Abra jedoch beruhigend zu. „Spiel zuerst deine Tonleitern und dann ‚Stille Nacht‘. Kannst du das?“
Normalerweise blieb Mama direkt neben ihr stehen. Außer wenn es ihr nicht so gut ging.
Abra spielte für ihr Leben gern Klavier. Sie übte Tonleitern und Akkorde, obwohl sie Mühe hatte, alle Tasten auf einmal zu greifen. Anschließend versuchte sie sich an Stille Nacht, O Bethlehem, du kleine Stadt und Away in a Manger. Wann immer sie ein Lied zu Ende gespielt hatte, sagte Mama, sie hätte das gut gemacht, und Abra war ganz stolz.
Papa kam in den Gottesdienstraum. „Ich denke, es ist Zeit, nach Hause zu fahren.“ Er legte den Arm um Mama und zog sie hoch. Enttäuscht klappte Abra den Klavierdeckel zu und folgte ihnen nach draußen zum Wagen. Mama entschuldigte sich dafür, dass sie so müde sei, und Papa sagte, wenn sie ein paar Stunden schliefe, würde es ihr wieder besser gehen.
Mama protestierte, als Papa sie ins Haus trug. In ihrem Schlafzimmer setzte er sich ein paar Minuten zu ihr. Dann kam er ins Wohnzimmer zurück. „Sei schön leise, Abra, und lass Mama ein wenig schlafen.“ Als Papa zum Auto zurückging, schlich Abra ins Schlafzimmer und kletterte auf das Bett.
„Da ist ja mein Mädchen“, sagte Mama und zog sie an sich.
„Bist du wieder krank?“
„Schsch. Ich bin nicht krank. Nur ein wenig müde.“
Sie schlief ein, und Abra blieb bei ihr, bis sie draußen das Auto hörte. Sie glitt aus dem Bett und rannte ins Wohnzimmer, wo sie aus dem Fenster sah. Papa hob einen Weihnachtsbaum vom Dach des alten grauen Plymouth.
Vor Freude quietschend riss Abra die Haustür auf und rannte die Stufen hinunter. Aufgeregt klatschte sie in die Hände. „Der ist ja so groß!“
Joshua kam zur Hintertür herein, die Wangen von der Kälte gerötet, doch seine Augen strahlten. Der Weihnachtsbaumverkauf war gut gelaufen. Wenn die Jugendgruppe dieses Jahr genügend Geld verdiente, würden sie davon das Camp im Yosemite-Park bezahlen. Falls das nicht reichte, hatte Joshua bereits mit den Weirs und den McKennas vereinbart, dass er ihren Rasen mähen würde. „Sie zahlen mir fünfzig Cent in der Woche. Mal zwei, das sind vier Dollar im Monat!“ Das schien ein Haufen Geld zu sein. „Dann kann ich das Zeltlager vielleicht sogar selbst bezahlen.“
Nach dem Abendessen bestand Mama darauf, den Abwasch selbst zu übernehmen. Sie bat Papa, schon einmal die Kiste mit dem Weihnachtsbaumschmuck zu holen und den Baum zu schmücken. Papa entwirrte die elektrischen Weihnachtsbaumkerzen und reichte sie nacheinander Joshua und Abra, die sie am Baum aufhängten.
In der Küche fiel etwas krachend zu Boden. Erschrocken ließ Abra eine Glaskugel fallen, während Papa aufsprang und in die Küche stürzte. „Marianne? Alles in Ordnung?“
Zitternd bückte sich Abra, um die Scherben aufzuheben, doch Joshua trat an ihre Seite. „Lass mich das machen. Du könntest dich verletzen.“ Sie brach in Tränen aus, und er zog sie an sich. „Wein doch nicht.“
Abra klammerte sich an ihn, ihr Herz raste. Die Tür ging auf, und Mama erschien. Ihr Lächeln erstarb. „Was ist los?“
„Sie hat eine Glaskugel zerbrochen.“
Papa nahm Abra auf den Arm. „Hast du dich verletzt?“ Sie schüttelte den Kopf. Papa tätschelte ihren Rücken. „Dann ist es doch nicht schlimm.“ Er drückte sie schnell an sich und stellte sie wieder auf den Boden. „Ihr zwei schmückt den Baum fertig, und ich mache Feuer im Kamin.“
Mama schaltete das Radio ein und wählte einen Musiksender aus. Erschöpft ließ sie sich in ihrem Schaukelstuhl nieder und nahm ihr Strickzeug aus dem Korb. Abra kletterte zu ihr in den Sessel. Mama küsste sie auf den Kopf. „Möchtest du keine Kugeln mehr an den Baum hängen?“
„Ich will lieber bei dir sitzen.“
Mit grimmigem Gesichtsausdruck blickte Papa über die Schulter zurück, während er das Holz aufschichtete.
Am Sonntag war es kalt, doch wenigstens hatte es zu regnen aufgehört. Ehepaare mit Kindern drängten sich nach dem Gottesdienst in der Empfangshalle.
Mama half Miss Mitzi, die Sonntagsschulteller abzuwaschen und abzutrocknen. Papa unterhielt sich mit einigen Nachzüglern. Nachdem alle fort waren, gingen Mama, Papa und Abra in den Gottesdienstraum. Mama ordnete die Gesangbücher und sammelte die heruntergefallenen Bekanntmachungsblätter ein. Papa stellte die glänzenden Messingkerzenhalter und Abendmahlsteller fort. Abra saß auf der Klavierbank und spielte Akkorde.
Die Kirchentür flog auf, und ein Mann kam hereingestürmt. Mama richtete sich auf, drückte die Hand an die Brust. „Clyde Eisenhower! Du hast mich zu Tode erschreckt.“
„Die Japaner haben einen unserer Marinestützpunkte auf Hawaii bombardiert!“
Zu Hause schaltete Papa gleich das Radio an. „ …Wie Präsident Roosevelt gerade verlauten ließ, fand ein Luftangriff der Japaner auf Pearl Harbour statt. Betroffen waren alle Marine- und Militärstützpunkte auf der Hauptinsel Hawaiis Oahu …“, erklärte der Radiosprecher erregt.
Mama sank auf einen Küchenstuhl. Papa schloss die Augen und senkte den Kopf. „Ich wusste, dass es so kommen würde.“
Mama hob Abra auf ihren Schoß und lauschte schweigend der Stimme, die von Bombardierungen erzählte. Schiffe waren versenkt worden und viele Männer ums Leben gekommen. Mama begann zu weinen. Abra brach ebenfalls in Tränen aus. Mama drückte sie fest an sich und wiegte sie in ihren Armen. „Es ist alles gut, Schätzchen. Alles ist gut.“
Aber Abra wusste, dass es nicht so war.
Miss Mitzi riss die Tür auf. „Na, wenn das nicht mein liebstes kleines Mädchen ist!“ Sie breitete die Arme aus. Kichernd umarmte Abra sie. „Wie lange darf ich sie dieses Mal behalten?“
„So lange Sie wollen“, erwiderte Mama, als sie ihnen ins Wohnzimmer folgte.
Abra war gern bei Miss Mitzi. Überall im Wohnzimmer verteilt standen Nippessachen und Abra durfte sie in die Hand nehmen und sogar damit spielen. Manchmal kochte sie Kaffee und goss auch Abra eine Teetasse voll, und sie ließ sie Sahne und so viel Zucker nehmen, wie sie wollte.
„Du siehst schrecklich erschöpft aus, Marianne“, meinte Mitzi besorgt.
„Ich fahre nach Hause und halte einen ausgiebigen Mittagsschlaf.“
„Tu das, Liebes.“ Mitzi gab ihr einen Kuss auf die Wange. „Überfordere dich nicht.“
Mama küsste Abra auf die Wange. „Sei ein liebes Mädchen, Schätzchen.“
Mitzi schob das Kinn vor. „Na, dann geh mal auf die Suche“, forderte sie Abra auf. Mitzi begleitete Mama zur Haustür, wo sie sich noch unterhielten, während Abra durch das Wohnzimmer schlenderte und nach ihrem Lieblingsfigürchen suchte – einem glänzenden Porzellanschwan an der Seite einer hässlichen Ente. Sie fand ihn auf einem Tisch in der Ecke unter einer Federboa.
Mitzi kam ins Wohnzimmer zurück. „So schnell hast du ihn gefunden?“ Sie stellte ihn auf den Kaminsims. „Nächstes Mal muss ich mir wohl ein besseres Versteck ausdenken. – Wie wäre es mit einem kleinen Liedchen?“ Sie setzte sich auf den alten Klavierhocker und spielte eine fröhliche Melodie. „Wenn du Bach, Beethoven, Chopin und Mozart spielen kannst, bringe ich dir die Spaßmelodien bei.“ Ihre Hände flogen über die Tasten. Mitten im Spielen stand sie auf, schob den Hocker nach hinten, streckte einen Fuß aus, dann den anderen, in einem unbeholfenen Tanzschritt. Abra lachte und ahmte sie nach.
Mitzi trat vom Klavier zurück. „Genug gealbert. Du bist dran.“ Kichernd nahm Abra ihre Position ein. Mitzi stellte ein Notenblatt auf den Notenständer. „Ein kleiner vereinfachter Beethoven ist genau das Richtige für diesen Tag.“
Abra übte Klavier, bis die Uhr auf dem Kaminsims vier Mal schlug. Mitzi schaute auf ihre Armbanduhr. „Hast du Lust, ein wenig Verkleiden zu spielen? Ich muss mal telefonieren.“
Abra rutschte vom Hocker herunter. „Darf ich mir deinen Schmuck ansehen?“
„Natürlich darfst du das, Liebes.“ Mitzi deutete zum Schlafzimmer. „Sieh im Schrank nach und auch in den Schubladen. Du darfst alles anprobieren, was du möchtest.“
Abra entdeckte eine ganze Schatztruhe voller Kugeln und Perlen. Sie legte Glitzerohrringe an und schlang sich eine Halskette aus roten Glasperlen um den Hals, dazu noch eine weiße Perlenkette und eine mit schwarzen Jettsteinen. Ihr gefiel das Gewicht von Glanz und Gloria an ihrem Hals. Als sie Mitzis Rougedöschen entdeckte, rieb sie ein wenig davon auf ihre Wangen. Aus Mitzis unzähligen kleinen Tuben und Döschen wählte sie den dunkelsten Lippenstift. Sie riss den Mund auf und imitierte die Frauen, die sie in der Toilette in der Kirche beobachtet hatte, wenn sie Lippenstift auftrugen. Schließlich fand sie noch die Puderdose und puderte ihre Wangen. Sie musste husten, als eine Duftwolke sie einhüllte.
„Alles in Ordnung bei dir?“, rief Mitzi aus dem anderen Zimmer.
„Ja!“ Jetzt war Mitzis Schrank an der Reihe. Sie setzte einen Hut mit einer breiten Krempe und einer roten Schleife auf, dazu schlang sie einen schwarzen Schal mit aufgestickten Blumen und langen Fransen um den Hals. Und dann schob sie ihre Füße in ein paar rote Pumps mit hohen Absätzen.
„Ach du meine Güte!“ Mitzi kam herbeigeeilt und packte ihre Hand. „Pastor Zeke ist unterwegs, um dich abzuholen. Schnell ab mit dem Zeug, bevor er hier eintrifft.“ Lachend nahm sie ihr den großen Hut ab und schleuderte ihn in den Schrank. Sie wickelte sie auch aus dem Schal. „Den hat mir vor hundertfünfzig Jahren ein Verehrer geschenkt, als ich im Cabaret in Paris gesungen habe.“
„Was ist ein Cabaret?“
„Ach, vergiss, dass ich es erwähnt habe.“ Mitzi warf den Schal auf die rosa Überdecke. „Und die alten Halsketten! Du meine Güte. Wie viele hast du angelegt? Ich wundere mich, dass du dich bei diesem Gewicht noch auf den Füßen halten kannst. Jetzt komm ins Bad. Wir müssen dein Gesicht noch reinigen“ Lachend trug Mitzi eine Creme auf Abras Gesicht auf und wischte sie wieder ab. „Mit den dunklen Augenbrauen und roten Lippen siehst du aus wie ein kleiner Clown.“ Sie lachte erneut und schrubbte Abras Wangen, bis sie prickelten.
Die Türglocke läutete.
„Nun, besser kriegen wir es nicht hin.“ Sie warf den Waschlappen zur Seite, nahm Abras Hand und ging mit ihr ins Wohnzimmer. „Warte hier, ich mache die Tür auf.“
Papa warf einen Blick auf Abra, und seine Augenbrauen schossen in die Höhe. Sein Mund zuckte, als er Mitzi einen Seitenblick zuwarf. „Hmmmm.“
Mitzi faltete die Hände hinter ihrem Rücken und grinste. „Ich habe ihr gesagt, sie kann sich aus meinem Schrank alles nehmen, was sie möchte, während ich mit Marianne telefoniere. Ich habe vergessen, welche Versuchungen dort lauern. Marianne klang so erschöpft.“
Papa streckte die Hand aus. „Komm, Abra.“
Mama lag auf dem Sofa und schlief. Sie wachte auf, aber Papa sagte, sie solle weiterschlafen. Er würde Abendessen kochen. Abra solle ein wenig allein spielen. Joshua kam durch die Hintertür herein und redete mit Papa. Das Telefon läutete. Zum ersten Mal, seit Abra denken konnte, nahm Papa den Hörer nicht ab.
Mama schien es besser zu gehen, als sie sich zum Abendessen an den Tisch setzten. Papa sprach das Tischgebet. Jeder erzählte, was er an diesem Tag erlebt hatte. Nach dem Essen räumte Joshua den Tisch ab und spülte das Geschirr. Abra wollte ihm helfen, aber er scheuchte sie fort. „Ich bin schneller fertig, wenn ich es allein mache.“
Mama ging früh schlafen. Sobald Papa Abra ins Bett gebracht hatte, folgte er ihr. Abra konnte noch nicht einschlafen und lauschte auf das leise Murmeln ihrer Stimmen. Es dauerte sehr lange, bis der Schlaf sie übermannte.
Es war noch dunkel, als Abra erwachte, weil die Haustür ins Schloss fiel. Papa war zu seiner frühmorgendlichen Gebetszeit aufgebrochen.
Das Haus wirkte kalt und dunkel, nachdem er fort war, obwohl Mama im Nebenraum schlief und Joshua in seinem „Fort“ war. Abra schlich auf Zehenspitzen in Mamas und Papas Schlafzimmer. Mama drehte sich um und hob den Kopf. „Was ist los, Schätzchen?“
„Ich hab Angst.“
Mama hob die Decke. Abra kletterte ins Bett und kuschelte sich darunter. Mama legte einen Arm um sie und drückte sie an sich. Die Wärme tat Abra gut, und sie schlief wieder ein. Sie fuhr aus dem Schlaf hoch, als Mama ein leises Stöhnen von sich gab und leise murmelte: „Nicht jetzt, Herr. Bitte. Nicht jetzt.“ Sie stöhnte erneut, und ihr Körper versteifte sich. Sie rollte sich auf den Rücken.
Abra drehte sich zu ihr um. „Mama?“
„Schlaf weiter, Schatz. Schlaf noch ein bisschen.“ Es klang sehr angestrengt, als rede sie durch die Zähne. Ein Schluchzen ertönte, dann stieß sie einen langen Atemzug aus und entspannte sich.
„Mama?“ Als sie nicht antwortete, schmiegte sich Abra an sie, rollte sich neben ihr zusammen.
Als Abra aus dem Schlaf hochfuhr, hoben kalte, starke Hände sie aus dem Bett. „Geh wieder in dein Bett, Abra“, flüsterte Papa. Im kalten Zimmer fröstelte sie. Sie legte ihre Arme um ihren Körper und blickte über die Schulter zurück, als sie zur Tür ging.
Papa trat um das Bett herum. „Na, schläfst du heute Morgen mal aus?“ Er sprach mit leiser, liebevoller Stimme, beugte sich vor und gab Mama einen Kuss. „Marianne?“ Er fuhr hoch und schaltete das Licht an. Mit heiserer Stimme schrie er ihren Namen, warf die Decke zurück und riss sie in die Arme.
Mama hing in Papas Armen wie eine schlaffe Stoffpuppe. Ihr Mund und ihre Augen waren offen.
Papa sank auf das Bett, wiegte sie in seinen Armen und schluchzte. „Oh Gott, nein … nein … nein.“
Kapitel 2
Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn!
Hiob 1,21
Joshua saß in der Kirche in der ersten Reihe und blickte mit tränenverhangenen Augen zu seinem Vater hoch. Abra hockte neben ihm, ganz erstarrt und Tränen liefen über ihre blassen Wangen. Er ergriff ihre Hand, ihre Finger waren eiskalt. In den Reihen hinter ihnen saßen dicht gedrängt die Trauergäste. Einige von ihnen weinten leise. Papas Stimme brach; er blieb eine Weile mit gesenktem Kopf schweigend stehen. Jemand schluchzte, und Joshua wusste nicht, ob das Geräusch von ihm oder von Abra gekommen war.
Mr und Mrs Matthews traten aus der Reihe unmittelbar hinter ihnen und setzten sich neben Joshua und Abra. Penny zwängte sich zwischen Abra und ihre Mutter und nahm Abras Hand. Mr Matthews legte den Arm um Joshua.
Papa hob langsam den Kopf und blickte sie an. „Es ist sehr schwer, Abschied zu nehmen von einem Menschen, den man liebt, auch wenn wir wissen, dass wir ihn wiedersehen werden. Marianne war eine wundervolle Frau und Mutter.“
Er erzählte davon, dass sie sich seit ihrer Kindheit kannten. Damals hatten sie noch auf der Farm ihrer Eltern in Iowa gelebt. Sie hatten sehr jung geheiratet und waren sehr arm gewesen, aber auch sehr glücklich. Er erzählte von ihren Familien, die Joshua nie kennengelernt hatte, weil sie so weit entfernt lebten. „Wenn jemand da ist, der etwas sagen oder eine Geschichte über Marianne erzählen möchte, so hat er jetzt die Gelegenheit dazu.“
Nacheinander erhoben sich die Leute. Mama hatte viele Freunde und sie alle hatten etwas Nettes über sie zu sagen. Eine Frau sagte, Marianne sei eine Beterin gewesen. Eine andere meinte, sie sei eine Heilige gewesen. Einige ältere Gemeindemitglieder erzählten, wie sie mit einem Auflauf oder einem Kuchen vorbeigekommen war.
Schließlich versiegte der Strom. Niemand rührte sich. Miss Mitzi erhob sich und marschierte nach vorne. Unterwegs putzte sie sich die Nase und steckte ihr Taschentuch dann in den Ärmel ihres Pullovers. Sie stieg die drei Stufen hoch und setzte sich ans Klavier. Papa stand immer noch auf der Kanzel. Sie lächelte ihm zu. „Jetzt bin ich an der Reihe, Zeke.“
Papa nickte.
Mitzi blickte erst Joshua an und dann Abra. „Als Marianne mit Abra zum Klavierunterricht kam, habe ich mich gewundert, warum sie sie nicht einfach selbst unterrichtete. Wir alle wissen, wie gut sie spielen konnte. Doch sie meinte, sie könne nur geistliche Lieder spielen, und sie wollte, dass Abra auch andere Musikrichtungen kennenlernte. Ich fragte, was sie denn am liebsten möge, und sie hat mich überrascht.“ Sie blickte zur Decke hoch. „Das ist für dich, Liebes. Ich hoffe, du tanzt dort oben.“
Mitzi klopfte mit dem Fuß ein paar Mal den Takt und begann den „Maple Leaf Rag“ zu spielen. Einige Trauergäste wirkten schockiert, doch Papa lachte. Joshua lachte ebenfalls und wischte sich die Tränen ab.
Nach diesem Stück blickte Mitzi zu Papa hinüber und begann eines von Mamas Lieblingsliedern zu spielen. Papa schloss die Augen und sang mit. „Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken …“ Nacheinander stimmten die Trauergäste mit ein, bis schließlich die ganze Trauergemeinde mitsang.
Papa stieg die Stufen hinunter und Peter Matthews stand auf, drückte Joshuas Schulter und trat zu den anderen Sargträgern. Die ganze Gemeinde erhob sich und sang weiter. „Er verklärt mich in sein Licht; das ist meine Zuversicht.“ Joshua ergriff Abras Hand und sie folgten Papa und den Männern, die Mama in dem Sarg nach draußen trugen.
Drei Wochen nach Mamas Beerdigung ging mit einem lauten Knall der Wagen kaputt. Papa stieg aus und klappte die Motorhaube auf. Abra saß auf dem Beifahrersitz und wartete. Nach ein paar Minuten knallte Papa die Motorhaube wieder zu. Sein Gesicht war angespannt. „Komm, Abra. Wir werden wohl zur Schule laufen müssen.“
Es war kalt, aber sie musste mit Papas langen Schritten mithalten, daher wurde ihr schnell warm. Sie wollte nicht zur Schule gehen. Nach Mamas Tod war sie eine Woche lang zu Hause geblieben und als sie dann wieder in die Klasse gekommen war, hatte einer der Jungen sie geneckt, sie sei eine Heulsuse, bis Penny ihm gesagt hatte, er solle den Mund halten, und er würde auch weinen, wenn seine Mama sterben würde, wenn er direkt neben ihr lag. Sie wusste das, denn ihre Mama hatte das erzählt. Am nächsten Tag behauptete ein Mädchen auf dem Spielplatz, Abra hätte nie eine Mutter gehabt. Pastor Zeke hätte sie unter einer Brücke gefunden, wo man kleine Kätzchen aussetzen würde, die man nicht haben wollte.
Abra stolperte und wäre beinahe hingefallen, doch Papa fasste ihre Hand. „Kann ich nicht mit dir in die Kirche kommen?“
„Du musst doch zur Schule gehen.“
Ihre Beine taten weh und es war noch ziemlich weit. „Müssen wir auch wieder zu Fuß nach Hause gehen?“
„Vermutlich. Wenn du zu müde bist, um zu laufen, trage ich dich.“
„Kannst du mich nicht jetzt schon tragen?“
Er setzte sie auf seine Hüfte. „Na gut. Aber nur ein Stück.“
Sie legte den Kopf an seine Schulter. „Ich vermisse Mama.“
„Ich auch.“
Papa setzte sie erst kurz vor der Schule wieder ab. „Mrs Matthews wird dich heute Nachmittag abholen und mit nach Hause nehmen. Ich komme dann und hole dich um Viertel nach fünf ab.“
Ihre Unterlippe zitterte. „Ich möchte aber nach Hause.“
„Widersprich mir nicht, Abra.“ Er gab ihr einen Kuss auf die Wange. „Ich muss tun, was das Beste für dich ist, ob es uns nun gefällt oder nicht.“ Sie begann zu weinen, und er drückte sie an sich. „Bitte wein doch nicht.“ Auch er war den Tränen nahe. „Das alles ist schon schwierig genug, auch ohne dass du immerzu weinst.“ Er strich mit dem Finger über ihre Nase und hob ihr Kinn an. „Jetzt geh.“
Nach der Schule wartete Mrs Matthews vor der Klassentür und unterhielt sich mit Robbie Austins Mutter. Sie wirkte traurig und ernst, bis sie sie entdeckte. „Da sind ja meine Mädchen!“ Sie gab zuerst Penny einen Kuss auf die Wange, dann Abra. „Wie war euer Tag?“ Auf dem Weg zum Wagen plapperte Penny munter drauflos. „Und rein mit euch beiden.“ Mrs Matthews ließ beide vorne sitzen, Abra in der Mitte. Penny redete wie ein Wasserfall.
Im Haus roch es nach frisch gebackenen Keksen. Mrs Matthews hatte den Küchentisch für eine Teeparty gedeckt. Sie tranken Apfelsaft und knabberten Kekse. Abra ging es ein klein wenig besser.
Pennys Zimmer war ganz in Weiß und Rosa gehalten. Durch das Fenster konnte man in den Vorgarten blicken. Während Penny ihre Spielzeugkiste durchwühlte, setzte sich Abra in die Fensternische und starrte hinunter in den Vorgarten mit dem weißen Gartenzaun. Sie erinnerte sich, dass die Gartenlaube im Sommer mit roten Rosen bewachsen war. Mama liebte Rosen. Abras Kehle zog sich zusammen.
„Komm, wir malen!“ Penny warf ihre Malbücher auf den geblümten Teppich und klappte eine Schuhschachtel voller Stifte auf. Abra setzte sich zu ihr. Penny redete ununterbrochen, doch Abra wartete die ganze Zeit nur darauf, dass die Großvateruhr unten fünf Mal schlug und die Türglocke ging. Endlich war es so weit. Papa war gekommen, um sie abzuholen, genau wie er es versprochen hatte.
Penny stöhnte laut. „Ich will nicht, dass du gehst! Wir spielen doch gerade so schön!“ Sie folgte Abra durch den Flur. „Ich wünschte, du wärst meine Schwester. Dann könnten wir immer miteinander spielen.“
Papa und Mrs Matthews standen im Eingang und unterhielten sich leise. „Mama?“, jammerte Penny. „Kann Abra nicht über Nacht hierbleiben? Biiiitte?“
„Natürlich kann sie das, aber das muss Pastor Zeke entscheiden.“
Voller Eifer drehte sich Penny zu Abra um. „Wir könnten Halma spielen und Radio hören.“
Papa blickte Abra an. Er wirkte erschöpft. „Sie hat keinen Schlafanzug und keine Sachen für die Schule morgen dabei.“
„Ach, das ist gar kein Problem. Sie und Penny haben dieselbe Größe. Und wir haben noch neue Zahnbürsten.“
„Oh, toll!“ Penny hüpfte vor Begeisterung in die Höhe. „Komm, Abra, wir gehen spielen!“
Abra eilte zu Papa, fasste seine Hand und klammerte sich an ihn. Sie wollte nach Hause. Papa beugte sich zu ihr herunter. „Es ist ein langer Heimweg, Abra, und wir müssten zu Fuß gehen. Ich halte es für eine gute Idee, dass du hier übernachtest.“ Als sie protestieren wollte, legte er den Finger an ihre Lippen. „Du wirst viel Spaß haben.“
Zeke sah nach Joshua, bevor er zu seinem Morgenspaziergang aufbrach. Abra hatte die letzten drei Nächte bei den Matthews verbracht. Er schloss die Haustür ab, legte den Schlüssel unter den Blumentopf und begann seine Runde, die am Friedhof endete. In den vergangenen Wochen war er so häufig an Mariannes Grab gewesen, dass er den Weg auch gefunden hätte, wenn nicht der volle Mond am Himmel gestanden hätte. Der weiße Marmorstein funkelte im Mondlicht.
Er sehnte sich so nach ihr. Ihren Augen, ihrer Stimme, dem Austausch mit ihr. Er stopfte die Hände in seine Taschen. „Mrs Welch ist gestern in die Kirche gekommen.“ Die Jugendamtsmitarbeiterin hatte ihm ihr Beileid ausgesprochen und dann einige Fragen gestellt. Er schluckte und kämpfte gegen die Tränen an. „Es war ein Fehler, Abra zu uns zu nehmen. Ich gab nach, weil ich wusste, wie sehr du dir ein zweites Kind gewünscht hast.“ Er schloss die Augen und schüttelte den Kopf. „Nein, das stimmt nicht. Ich gab nach, weil auch ich mich in sie verliebt hatte.“ Die Stimme versagte ihm.
„Du weißt, wie aufreibend meine Arbeit ist. Überall versage ich. Dich konnte ich nicht beschützen. Ich versage als Vater und als Pastor. Meine Trauer hält mich so gefangen, dass ich unter der Last zusammenbreche.“ Er stieß ein verbittertes Lachen aus. „Ich weiß, hundert Mal habe ich es zu anderen gesagt, die eine Krise erlebten, aber wenn mich noch einmal jemand daran erinnert, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann werde ich …“
Seine Kehle schnürte sich zusammen. „Abra ist erst fünf. Sie braucht eine Mutter. Sie braucht einen Vater. Einen richtigen Vater, der für sie da ist. Ich werde Peter und Priscilla heute fragen, ob sie Abra adoptieren wollen. Du weißt, dass sie sie von Anfang an gern zu sich genommen hätten, und seit deinem Tod haben sie mir ihre Hilfe angeboten, wo immer sie konnten. Ich bin sicher, dass sie sie gern in ihre Familie aufnehmen würden.“
Zeke blinzelte die Tränen fort und starrte in die Ferne. „Mrs Welch ist nicht sicher, ob das gut ist. Sie meint, Abra würde sich in einer ganz neuen Umgebung vermutlich schneller eingewöhnen. Vielleicht ist das schon wieder selbstsüchtig, aber ich möchte sie in meiner Nähe haben, nicht weit fort in einer anderen Stadt, umgeben von ihr gänzlich fremden Menschen.“
Traf er gerade wieder eine Entscheidung, die er später bereuen würde? Nein, es war nicht so, dass er die fünf Jahre bereute, die Abra bei ihnen gewesen war. Marianne war so glücklich gewesen. „Oh Marianne, du weißt, wie sehr ich sie liebe. Es bringt mich um den Verstand, sie abzugeben. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige.“ Schluchzend ließ er sich zu Boden sinken. „Sie wird es nicht verstehen.“ Er ließ seine Tränen fließen. „Vergib mir. Bitte vergib mir.“
Wenn Mrs Welch ihre Meinung noch änderte, würde Abra in einer anderen Stadt untergebracht werden. Er würde gar nicht erfahren, wo sie wäre. Dann könnte er sie nicht aufwachsen sehen.
Zeke machte sich auf den Weg zur Hauptstraße. Ein Lieferwagen hielt neben ihm an und Dutch kurbelte die Scheibe herunter. „Wie geht es Ihnen, Pastor?“
„Es geht.“ So gerade eben.
„Ich verstehe Sie. Steigen Sie ein. Ich fahre Sie in die Stadt zurück.“
Zeke setzte sich auf den Beifahrersitz. „Danke.“
Dutch fuhr los. „Ein paar Wochen lang habe ich an Sharons Grab gesessen und mit ihr geredet – Tag für Tag, dann alle zwei Tage, schließlich einmal die Woche. Jetzt gehe ich nur noch zu ihrem Geburtstag und unserem Hochzeitstag hin. Sie hätte gewollt, dass ich mein Leben weiterlebe.“ Er warf einen Seitenblick zu Zeke hinüber. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass sie nicht dort ist.“ Er fluchte unterdrückt. „Ich versuche, Ihnen Trost zu spenden und versage ganz jämmerlich dabei.“
„Machen Sie sich keine Gedanken.“
Dutch lächelte schwach. „Sie haben mir einmal gesagt, im Himmel gäbe es keine Tränen.“ Er starrte auf die Straße. „Nun, hier unten gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge davon, nicht? Ich weiß, wie weh es im Augenblick tut.“ Er schaltete herunter und bremste ab. „Sie werden durch den Schmerz waten und auf der anderen Seite herausklettern.“ An der Straßenecke hielt er an. „Genau wie ich.“
Zeke streckte ihm die Hand hin. „Danke, Dutch.“
„Wie wäre es, wenn wir mal einen Kaffee zusammen trinken?“
Zeke blickte Dutch an. Sollte die Tür nach all den Jahren endlich aufgehen?
„Ich habe eine Menge Fragen“, meinte Dutch verlegen. „Vermutlich hat Sharon mir die Antworten längst gegeben, aber sobald sie anfing, über den Glauben zu reden, habe ich meine Ohren auf Durchzug gestellt.“
„Wie wäre es in Bessies Café morgen früh, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind? Gegen Viertel nach sieben?“
„Ist gut. Bis dann.“ Dutch hob grüßend die Hand und bog nach rechts ab.
Die Sonne ging auf. Zeke schloss kurz die Augen und versuchte, den Gedanken an die vor ihm liegende Zeit zu verdrängen. Herr, bring mich nur durch diesen Tag. Geh mit mir durch diesen Schmerz und hilf mir, auf der anderen Seite herauszusteigen.
Abra weinte den ganzen Nachmittag. Papa wollte sie nicht mehr. Denn es war ihre Schuld, dass Mama gestorben war. Sie hatte mitbekommen, wie Papa einmal gesagt hatte, sie hätte Mama zu viel Arbeit gemacht.
Mrs Matthews saß neben ihr in Pennys Kinderzimmer, streichelte ihr über den Rücken und versicherte ihr, wie lieb sie sie hätten und wie sehr sie hofften, sie würde sie eines Tages auch lieben.
Ein paar Minuten später ging die Tür auf, und die ganze Familie kam herein. Sie gingen zu Abra, und Penny setzte sich neben sie. „Mama und Papa haben erzählt, dass du jetzt meine Schwester wirst!“
Tränen liefen über Abras Wangen. Penny wurde unsicher. „Willst du denn nicht meine Schwester sein?“
Abras Lippen zitterten. „Ich will deine Freundin sein.“
Mrs Matthews legte beiden Mädchen eine Hand auf den Kopf und streichelte ihnen über die Haare. „Jetzt kannst du beides sein.“
Penny umarmte Abra. „Ich habe Mama gesagt, ich wünschte, du wärst meine Schwester. Sie meinte, ich solle dafür beten, und das habe ich getan. Ich habe gebetet und gebetet, und jetzt habe ich genau das bekommen, was ich mir immer gewünscht habe.“
Abra fragte sich, was geschehen würde, wenn Penny ihre Meinung änderte. Wie Papa.
Nach dem Abendessen und der Vorlesezeit wurde Penny zusammen mit Abra zu Bett gebracht. Mrs Matthews gab beiden einen Kuss, schaltete das Licht aus und schloss die Tür. Penny plapperte munter drauflos, bis sie mitten im Satz einschlief.
Hellwach starrte Abra zu dem Spitzenbaldachin hoch. Mama hatte gesagt, sie würde sie immer lieben, und Mama war gestorben. Mama hatte auch gesagt, Gott würde sie noch nicht in den Himmel holen, aber genau das hatte er getan. Papa hatte behauptet, er würde sie lieben, doch dann sagte er, sie müsste jetzt bei den Matthews leben. Mr und Mrs Matthews wollten jetzt ihr Papa und ihre Mama sein.
Warum interessierte sich keiner dafür, was Abra wollte?
Regen trommelte auf das Dach, zuerst ein paar Tropfen, dann immer mehr. Penny murmelte im Schlaf. Abra schlug die Decke zurück, stand auf und setzte sich ans Fenster. Sie schlang die Arme um ihre Beine und legte ihr Kinn darauf. Das Licht der Straßenlaternen wirkte im Regen verschwommen.
Ein Mann bog um die Ecke und schritt über den Bürgersteig. Papa! Vielleicht hatte er seine Meinung geändert und wollte sie zurückholen! Sie kniete sich auf die Fensterbank und legte die Hände an die Scheibe. Er blickte kurz hoch und verlangsamte seinen Schritt, als er an dem weißen Zaun vorbeiging.
Hatte er sie nicht gesehen? Sie klopfte ans Fenster. Der Wind riss an den Zweigen der Birke im Vorgarten. Er stand unten am Tor. Sie klopfte, lauter dieses Mal, und ihr Herz begann zu rasen.
Er blickte nicht hoch und trat auch nicht durch das Tor. Reglos, mit gesenktem Kopf stand er da, wie immer, wenn er betete. Abra hockte sich auf die Fersen, senkte ebenfalls den Kopf und umklammerte ihre Hände. „Bitte, Gott, bitte, bitte, mach, dass mein Papa mich nach Hause holt. Bitte. Ich will auch immer lieb sein. Ich verspreche es.“ Sie wischte ihre Tränen fort. „Ich will nach Hause.“
Voller Hoffnung richtete sie sich auf und schaute aus dem Fenster.
Papa war fort.
Peter und Priscilla gaben sich alle Mühe, die Mädchen gleichwertig zu behandeln. Doch Pennys brennender Wunsch nach einer Schwester verblasste. Zum Eklat kam es, als Priscilla für Abra eine neue Spielhose nähte.
„Ich dachte, die machst du für mich!“, schluchzte Penny.
„Du hast doch schon einige Spielhosen, aber Abra nicht.“
Penny weinte umso heftiger. „Ich will, dass sie wieder weggeht!“
Peter kam aus der Küche, wo er Zeitung gelesen hatte. „Jetzt reicht es, Penny. Geh auf dein Zimmer!“
Sie verzog sich, streckte aber vorher Abra noch die Zunge heraus. Peter sagte zu Priscilla, sie müssten mit Penny reden, und beide gingen nach oben. Sie zogen die Tür zu Pennys Zimmer hinter sich zu und blieben so lange weg, dass Abra nicht wusste, was sie tun sollte. Schließlich ging sie in den Garten hinaus und setzte sich auf die Schaukel. Sollte sie nach Hause gehen? Wo würde Papa sie dann hinbringen? Zu einer anderen Familie?
Sie drehte sich mit der Schaukel, bis die Ketten sich umeinander verdreht hatten, dann hob sie die Füße und überließ sich der herumwirbelnden Schaukel. Penny ist ihre richtige Tochter, richtige Tochter, richtige Tochter. Ihr war ganz schwindelig, doch sie wiederholte den Vorgang. Ich sollte besser nett zu ihr sein, nett zu ihr sein, nett zu ihr sein.
Abra hatte gehört, was Peter am Morgen zu Priscilla gesagt hatte. „In den vergangenen drei Monaten hat sie nicht einmal gelächelt. Früher war sie so ein fröhliches kleines Mädchen.“
„Marianne hat sie sehr geliebt, vielleicht zu sehr“, antwortete Priscilla leise. „Wenn sie uns Abra von Anfang an überlassen hätte, hätten wir jetzt nicht diese Probleme.“
Peter goss sich eine Tasse Kaffee ein. „Ich hoffe, dass sich die Situation bald entspannt, sonst weiß ich nicht, was werden soll.“
Furcht hatte Abra erfasst. Überlegten sie, sie wegzugeben?
„Abra!“, rief Peter jetzt. Sie sprang von der Schaukel. „Da bist du ja. Komm wieder herein, Liebes. Wir möchten mit dir reden.“
Abras Herz klopfte zum Zerspringen, als sie Peter ins Wohnzimmer folgte. Würden sie sie fortschicken? Müsste sie dann bei Fremden leben? Priscilla und Penny saßen auf der Couch. Peter legte die Hand auf Abras Schulter. „Penny hat dir etwas zu sagen.“
„Es tut mir leid, Abra.“ Pennys Gesicht war vom Weinen gerötet und aufgequollen. „Ich bin froh, dass du meine Schwester bist.“ Doch ihre Augen verrieten, dass sie es nicht so meinte.
„Das war brav!“ Priscilla drückte sie an sich und gab ihr einen Kuss.
Abra traute ihnen nicht. Priscilla zog Abra neben sich auf das Sofa und legte einen Arm um ihre Schultern. Sie drückte Abra und Penny an sich, jede auf eine Seite. „Ihr beide seid jetzt unsere kleinen Mädchen. Wir freuen uns so, zwei Töchter zu haben.“
Papa kam nach wie vor alle paar Tage vorbei. Joshua begleitete ihn nie. Sie sahen sich nur jede Woche in der Kirche, und dann standen sie voreinander, starrten sich an und wussten nicht, was sie sagen sollten. Wann immer Abra Papas Stimme hörte, stürzte sie die Treppe hinunter in der Hoffnung, er sei dieses Mal gekommen, um sie nach Hause zu holen. Priscilla ergriff ihre Hand und beugte sich zu ihr herab. „Du darfst Pastor Zeke nicht mehr Papa nennen, Abra. Peter ist jetzt dein Papa.“
An solchen Abenden weinte sie sich in den Schlaf, und manchmal quälten sie auch Albträume. Sie schrie im Traum nach ihrem Papa, aber er konnte sie nicht hören. Sie versuchte, ihm nachzurennen, aber sie wurde festgehalten. „Papa, Papa!“, rief sie, doch er drehte sich nicht um.
Priscilla weckte sie und nahm sie in den Arm. „Alles ist gut, Abra. Mama ist hier.“ Aber Mama war nicht da. Mama lag in einer Kiste in der Erde.
Egal, wie oft sie es auch sagten, Abra glaubte nicht, dass Peter und Priscilla sie liebten. Sie hatten sie nur adoptiert, weil Penny eine Schwester haben wollte. Wenn Penny keine Lust mehr auf eine Schwester hatte, würden Peter und Priscilla Abra weggeben. Und wo würde sie dann hinkommen? Zu wem?
Als Papa das nächste Mal vorbeikam, führte Peter auf der Veranda ein langes Gespräch mit ihm. Anschließend kam er allein zurück ins Haus. Abra wollte sich an ihm vorbeidrücken, doch Peter hockte sich vor sie und nahm sie an den Schultern. „Du wirst Pastor Zeke eine Zeit lang nicht sehen, Abra.“
Sie dachte, er meinte, sie würde ihn erst am Sonntag in der Kirche wiedersehen, doch am Sonntagmorgen schlug Peter einen anderen Weg ein. Penny fragte, wo sie denn hinführen, und Peter erklärte, sie würden jetzt eine andere Kirche besuchen. Penny heulte und jammerte, weil sie ihre Freunde nicht mehr sehen würde, doch Peter sagte, eine Veränderung würde ihnen allen gut tun. Abra wusste, sie war der Grund, warum sie Papas Kirche nicht mehr besuchten, und ihre letzte Hoffnung erstarb. Jetzt würde sie auch Joshua nicht mehr sehen.
1950
Mitzi öffnete die Haustür und blickte sich um. Sie hatte noch kein Make-up aufgelegt und sich auch noch nicht frisiert. „Ist schon wieder Mittwoch?“ Sie winkte Abra hinein und schloss die Tür hinter ihr. Sie trug einen roten Morgenmantel und ihre Füße steckten in zerschlissenen Satinpantoffeln.
Abra starrte sie an. „Du hast gesagt, ich dürfte hier üben.“