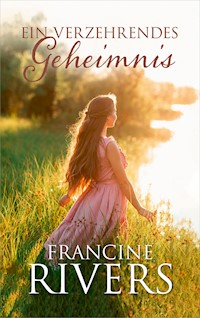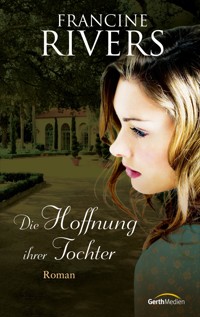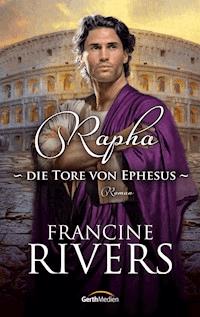
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Im Zeichen des Löwen
- Sprache: Deutsch
Ephesus im ersten Jahrhundert n. Chr.: Ihr Leben schien vorbei zu sein, als die Judenchristin Hadassa in der Arena den Löwen vorgeworfen wurde. Doch wie durch ein Wunder überlebte sie ihre schrecklichen Verletzungen. Als Helferin des jungen Arztes Alexander setzt sie sich mit großem Einsatz für die Kranken und Verzweifelten von Ephesus ein. Rapha nennen sie sie - die Heilerin. Heilung und Hilfe braucht auch Julia, Hadassas ehemalige Herrin, deren Weg immer steiler in den Abgrund führt. Und Marcus, der seine geliebte Hadassa tot glaubt und sich auf eine Pilgerreise in ihre Heimat Jerusalem begibt, um den Gott zu suchen, für den Hadassa zu sterben bereit war. Kann aus den Trümmern ihrer Träume neues Leben wachsen? Die sprachlich überarbeitete und erweiterte Fortsetzung des Bestsellers von Francine Rivers. Band 1: Hadassa - Im Schatten Roms, Nr. 5516890 Band 3 der Trilogie erscheint im Juni 2014.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANCINE
RIVERS
Rapha
DIE TORE VON EPHESUS
Roman
Aus dem Englischen von
Friedemann Lux
Vorwort von Francine Rivers
Als ich 1986 den Glauben an Gott für mich entdeckte, wollte ich am liebsten allen davon erzählen. Andererseits wollte ich aber auch niemanden abschrecken oder riskieren, dass Freunde mich für komisch hielten, die meine Gedanken und Gefühle nicht nachvollziehen konnten. Und so wurde ich immer zögerlicher und sagte schließlich gar nichts mehr über meinen neu gefundenen Glauben.
Doch das wiederum frustrierte mich, weil ich fand, dass ich mich feige verhielt. Auf der Suche nach Inspiration beschäftigte ich mich mit den Geschichten der ersten Christen, die für ihren Glauben Häme, Verfolgung und sogar einen grausamen Tod in Kauf nahmen. Aus dieser Suche ist die Romanreihe um Hadassa, die junge Sklavin in Rom, entstanden.
Während ich Hadassas Geschichte schrieb, wurde mir klar, dass man Mut nicht aus sich selbst heraus entwickeln kann. Doch wenn wir uns von ganzem Herzen Gott anvertrauen, schenkt er uns die Fähigkeit und die Kraft, uns jeder Situation zu stellen, die uns begegnet. Er gibt uns auch die richtigen Worte, wenn es darauf ankommt.
Ich betrachte mich auch nach all den Jahren noch als Suchende, als Christin unterwegs mit vielen Fehlern und Schwächen. Doch Gott hat mir mit meinem schriftstellerischen Talent eine wunderbare Möglichkeit gegeben, mich meinen eigenen Fragen durch Geschichten anzunähern. Jeder meiner Charaktere verkörpert eine andere Sichtweise, und indem ich mich mit ihnen auseinandersetze und ihnen eine Stimme gebe, finde ich meine eigenen Antworten. Auch meine tägliche Bibellektüre hilft mir dabei enorm weiter. Gott hat viel Geduld mit mir und bringt mir jeden Tag wieder neue Dinge bei.
Wenn Leser mir schreiben, dass sie von meinen Geschichten berührt und verändert werden, steht Gott allein dafür alle Ehre zu. Alle guten Dinge kommen von ihm und er kann alles benutzen, um seine Ziele mit den Menschen voranzutreiben – auch erdachte Geschichten wie meine.
Am Anfang schrieb ich meine Romane also vor allem, um selbst Antworten auf meine vielen Fragen zu finden. Heute hoffe ich auf mehr; ich möchte in Ihnen, den Lesern, Hunger und Durst nach Gott erwecken. Und so hoffe ich, dass auch dieses Buch Menschen zurück zu ihrer größten Sehnsucht führt, zu der nach Gemeinschaft mit ihrem liebevollen Schöpfer, der nur darauf wartet, dass wir uns ihm zuwenden und Leben in Fülle von ihm annehmen.
Von Herzen,
Francine Rivers
Prolog
Alexander Democedes Amandinus stand an der Tür des Todes und wartete auf seine Chance, das Leben zu studieren. Er mochte die Spiele nicht und war nur widerwillig gekommen. Doch was er jetzt sah, faszinierte ihn bis ins Mark. Er starrte auf das still daliegende Mädchen und verspürte einen unerklärlichen Triumph.
Er war immer zurückgeschreckt vor der wilden Gier des Mobs. Sein Vater hatte ihm das damit erklärt, dass es manchen Menschen innere Erleichterung brachte, bei Gewaltszenen zuzuschauen, und manchmal hatte Alexander diese Erleichterung, schon fast krankhaft und pervers, tatsächlich in den Gesichtern lesen können, in Rom, in Korinth und hier in Ephesus. Vielleicht waren die Zuschauer den Göttern dankbar, dass nicht sie es waren, die da den Löwen oder einem geschulten Gladiator oder einem noch schlimmeren Todbringer gegenüberstanden. Vielleicht brauchten sie dieses geplante Abschlachten, um die Sinnlosigkeit ihrer vor sich hin faulenden Welt vergessen zu können.
Alexander packte das Eisengitter fester und spähte in die Arena hinaus, wo die junge Frau in ihrem Blut lag. Merkwürdig ruhig, fast freudig war sie in die Arena geschritten. Sie hatte eine besondere Ausstrahlung, etwas Unerklärliches an sich gehabt, das ihn gefesselt hatte. Gesungen hatte sie; einen Augenblick lang hatte ihre Stimme sich wie eine Lerche in die Luft erhoben, dann hatte das Gebrüll des Mobs sie verschluckt. Sie war weiter über den Sand geschritten, auf Alexander zu, und mit jedem ihrer Schritte hatte sein Herz stärker gepocht. Schlicht hatte sie ausgesehen, aber irgendetwas war von ihr ausgegangen – eine Art Leuchten; oder hatte er sich das nur eingebildet? Dann hatte die Löwin sie gepackt, und Alexander hatte den Schmerz fast selbst gespürt.
Jetzt kämpften zwei der Tiere um ihren Körper. Alexander kniff die Augen zusammen, als die eine Löwin ihre Zähne tief in den Schenkel der jungen Frau schlug und sie wegzuschleifen begann. Die andere Löwin wollte ihr die Beute streitig machen und schon rollten sie beide fauchend und kratzend im Sand.
Ein kleines Mädchen in einer verschmutzten und zerlumpten Tunika rannte schreiend an dem vergitterten Tor vorbei, hinter dem Alexander stand. Er biss die Zähne zusammen, versuchte nicht hinzuhören. Die Mutter stellte sich vor ihr Kind. Ein Löwe mit glitzernden Juwelen am Halsband streckte sie nieder, ein zweiter sprang hinter dem Kind her. Renn, Kleine, renn! Alexanders Finger schlangen sich um das Gitter. Er lehnte seine Stirn dagegen. Langsam atmen, nicht durchdrehen.
Er kannte sie alle, die Argumente für die Spiele: Die Menschen, die man den Löwen vorwarf, waren Verbrecher, die den Tod verdient hatten. Die, die jetzt gerade niedergemacht wurden, gehörten zu einer Religion, die Rom zerstören wollte. Nun gut. Aber vielleicht hatte eine Gesellschaft, die derart grausam selbst kleine Kinder umbrachte, nichts anderes verdient?
Die verzweifelten Schreie des Kindes jagten eiskalte Schauer durch seinen Körper. Fast war er dankbar, als das Maul der Löwin sich um die kleine Kehle schloss und sie verstummen ließ. Dann hörte er das rohe Lachen des hinter ihm stehenden Wachsoldaten: „Das füllt dem Löwen mal gerade ’nen hohlen Zahn!“
Alexanders Unterkiefer mahlte. Am liebsten hätte er die Augen geschlossen, aber er spürte, wie der Soldat ihn durch das Visier seines polierten Helms hindurch beobachtete. Er durfte sich jetzt keine Blöße geben! Wenn er ein guter Arzt werden wollte, musste er das überwinden. Wie sein Lehrer Phlegon ihm mehr als einmal gesagt hatte: „Wenn du Erfolg haben willst, darfst du nicht so zart besaitet sein. Sterben und Tod mitzuerleben ist nun einmal das Los eines Arztes.“
Phlegon hatte recht. Und Alexander wusste auch, dass er ohne diese Spiele keine Gelegenheit bekommen würde, seine Kenntnisse der menschlichen Anatomie zu vervollständigen. Die Schriften und Zeichnungen, die es gab, hatte er alle studiert. Noch mehr lernen konnte er nur durch das Sezieren noch lebender Menschen. Phlegon wusste wohl, wie sehr Alexander diese Eingriffe zuwider waren, aber der alte Arzt war unnachgiebig gewesen und seine Logik ebenso: „Du willst ein guter Arzt werden? Dann sage mir, mein lieber Schüler, ob du dich von einem Arzt operieren lassen würdest, der keine Anatomiekenntnisse aus erster Hand hat! Alle Bilder der Welt können das Studium am lebenden Objekt nicht ersetzen. Sei dankbar, dass die Spiele dir eine Gelegenheit dazu geben!“
Dankbar. Alexander schaute zu, wie ein Opfer nach dem anderen fiel und die entsetzlichen Angst- und Schmerzensschreie von den gedämpften Fressgeräuschen der Löwen abgelöst wurden. Dankbar? Er schüttelte den Kopf. Nein, für so etwas würde er niemals dankbar sein können.
Ein neues Geräusch kam auf, unheimlicher als das Reißen und Knurren der Löwen. Es kam von den Zuschauerrängen, und Alexander erkannte es sofort: das Murmeln und Murren der Langeweile. Der dramatische Teil des Schauspiels war vorbei, an den fressenden Tieren war der Mob nicht mehr interessiert. Das Murren schwoll an, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der Veranstalter der Spiele reagierte rasch: Die Tore zu den Löwenkäfigen öffneten sich wieder und bewaffnete Wärter kamen heraus, um die Tiere zurückzutreiben, die ihre Krallen und Zähne instinktiv tiefer in ihrer Menschenbeute vergruben.
Alexander betete zum Mars, dass die Männer schnell arbeiten würden, und zum Äskulap, dass mindestens eines der Opfer noch nicht ganz tot war, damit er das tun konnte, wozu er gekommen war.
Das schwierige Unterfangen, hungrige Raubtiere von ihrer Beute zu trennen, interessierte Alexander nicht. Seine Augen schweiften ruhelos über den Sand, suchten nach Überlebenden. Viel Hoffnung hatte er nicht.
Sein Blick fiel wieder auf die junge Sängerin. Kein Löwe war bei ihr. Merkwürdig, wo sie doch weit entfernt von den Männern lag, die die Tiere zurück in die Käfige trieben. Aber was war das? Er reckte den Kopf und blinzelte gegen die Sonne an. Ihre Finger bewegten sich!
Er drehte sich hastig zu dem Soldaten um. „Da drüben, die in der Mitte!“
„Die haben sie doch als Erste erwischt, die ist tot.“
„Ich möchte sie mir ansehen.“
„Wie du wünschst.“ Der Wächter trat nach vorn und pfiff zweimal kurz. Alexander sah, wie der als Totenfährmann Charon verkleidete Schauspieler, der zwischen den Opfern herumtanzte, sich umdrehte und auf das Mädchen zusprang. Seine gefiederte Schnabelmaske ging nach unten, als er auf ein Lebenszeichen horchte, sein Hammer winkte theatralisch durch die Luft. Der Hammer fiel nicht.
Charon packte einen Arm der jungen Frau und schleifte sie über den Sand zur Tür des Todes. Im gleichen Augenblick sprang eine Löwin den Wärter an, der sie zurück in den Tunnel trieb. Die Menge schrie begeistert auf. Mit knapper Not gelang es dem Mann, sich das wütende Tier mit der Peitsche vom Leib zu halten und endlich von dem Kind wegzutreiben, das es gerade verspeisen wollte.
Der Wachsoldat benutzte die Ablenkung, um das Tor des Todes weit zu öffnen. „Schnell!“, zischte er, und Charon rannte mit der jungen Frau im Schlepptau herein. Der Wächter schnippte mit den Fingern, und zwei Sklaven sprangen herbei, packten sie an Armen und Beinen und trugen sie in den schwach erleuchteten Gang.
„Vorsichtig!“, rief Alexander, als sie das Mädchen auf den blutbesudelten Tisch warfen. Er schob die Sklaven ärgerlich beiseite. Wenn diese Trottel ihr jetzt nur nicht den Rest gegeben hatten!
Die Hand des Soldaten legte sich auf Alexanders Arm. „Sechs Sesterzen, bevor du sie aufschneidest“, sagte er kühl.
„Ist das nicht ein bisschen teuer?“
Der Wächter grinste. „Nicht für einen Schüler von Phlegon. Du musst eine Kiste voll Gold haben, dass du dir so einen Lehrer leisten kannst.“
„Sie wird zusehends leerer“, gab Alexander trocken zurück und öffnete den Beutel an seiner Hüfte. Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm noch blieb, bevor das Mädchen starb, und hatte keine Lust, jetzt um ein paar Münzen zu feilschen. Der Wachsoldat nahm sein Bestechungsgeld, von dem die Hälfte schon für Charon reserviert war, und ging.
Alexander wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Mädchen zu. Ihr Gesicht war eine rohe Masse aus zerrissenem Fleisch und Sand, die Tunika blutgetränkt. Viel Blut. Eigentlich musste sie tot sein. Er beugte sich über sie, legte sein Ohr an ihre Lippen – und spürte einen warmen Hauch. Sie lebte noch! Aber viel Zeit konnte er nicht mehr haben.
Er winkte seine eigenen Sklaven herbei und wischte sich mit einem Tuch die Hände ab. „Legt sie da drüben hin, wo es ruhiger ist. Aber vorsichtig!“
Die beiden Sklaven traten eifrig in Aktion. Phlegons Sklave Troas stand daneben und schaute zu. Alexander kniff die Lippen zusammen. Troas war ein fähiger Mann, aber zu kaltschnäuzig für seinen Geschmack.
„Licht bitte“, sagte Alexander und schnippte mit den Fingern. Der eine Sklave holte eine Fackel.
Alexander beugte sich wieder über die junge Frau, die jetzt auf einem Steintisch in einer Nische des Ganges lag. Der große Augenblick, für den er das schaurige Schauspiel in der Arena auf sich genommen hatte, war da: Gleich würde er die Bauchdecke öffnen, um die darunterliegenden Organe zu studieren. Er schluckte schwer und band dann die Ledertasche auf, in der seine Instrumente lagen. Er wählte ein schmales, scharfes Skalpell aus. Seine Hand schwitzte und zitterte. Jetzt brach ihm auch auf der Stirn der Schweiß aus. Er spürte Troas’ kritischen Blick in seinem Rücken. Geschwindigkeit war jetzt alles. Nur noch ein paar Minuten, und das Mädchen würde tot sein – gestorben an seinen Wunden. Oder an dem, was Alexander vorhatte.
Innerlich verfluchte er das römische Gesetz, das die Sezierung bereits Gestorbener verbot und ihn zu diesem grausamen Experiment zwang. Aber wie sonst konnte er das nötige Wissen über den menschlichen Körper erhalten, wie sonst die Fähigkeiten erwerben, die er brauchte, um Leben zu retten? Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und verwünschte seine elende Schwäche.
„Sie wird nichts spüren“, sagte Troas leise.
Alexander biss die Zähne zusammen, schnitt die Tunika des Mädchens vom Halsausschnitt bis zum Saum auf und zog sie vorsichtig auseinander. Jetzt also … doch dann runzelte er die Stirn. Von der Brust bis zur Leiste hatte sie nur oberflächliche Wunden und langsam dunkler werdende Blutergüsse.
„Haltet die Fackel näher“, befahl er. Er musste sich die Kopfverletzungen noch einmal ansehen. Vom Haaransatz bis herunter zum Kinn verliefen mehrere tiefe Krallenfurchen. Ein zweiter Schnitt ging quer über ihren Hals, knapp an der Schlagader vorbei. Sein Blick glitt langsam tiefer. Böse Wunden am Unterarm; der Knochen war gebrochen. Doch am schlimmsten war die Wunde am Oberschenkel, in den die Löwin ihre Zähne geschlagen hatte, um ihr Opfer wegzuziehen. Alexanders Augen weiteten sich. Eigentlich hätte das Mädchen verbluten müssen, aber der Sand hatte die Wunden erstaunlich wirksam verschlossen.
Was nun? Ein rascher, geschickter Schnitt, und er könnte seine Organschau beginnen. Und hätte das Mädchen getötet. Der Schweiß lief ihm in die Augen, sein Herz hämmerte. Er sah, wie die Brust der Bewusstlosen sich hob und senkte, die Halsschlagader schwach pulsierte. Übelkeit würgte in seiner Kehle.
„Sie wird nichts spüren, Herr“, sagte Troas wieder. „Sie ist nicht bei Bewusstsein.“
„Das sehe ich!“, schnappte Alexander und warf ihm einen finsteren Blick zu. Er trat wieder näher und setzte das Messer an. Erst am Vortag hatte er an einem Gladiator gearbeitet und dabei in fünf Minuten mehr über die menschliche Anatomie gelernt als in stundenlangem Theorieunterricht. Zum Glück hatte der Sterbende seine Augen nicht mehr geöffnet; aber seine Wunden waren um einiges schlimmer gewesen als die dieses Mädchens hier.
Alexander schloss wieder die Augen und sammelte sich. Er hatte Phlegon oft bei der Arbeit zugesehen, fasziniert seine geschickten Hände beobachtet und seiner Stimme zugehört: „Man muss schnell arbeiten. So. Sie sind schon fast tot, wenn du sie kriegst, und jeden Augenblick kann es vorbei sein. Vergeude nicht deine Zeit mit Grübeleien darüber, ob sie etwas spüren oder nicht. Nutze die paar Minuten, die die Götter dir gewähren! Sobald das Herz nicht mehr schlägt, musst du aufhören, damit dich nicht der Zorn der Götter und des römischen Gesetzes trifft.“ Der Mann, den Phlegon aufgeschnitten hatte, lebte nur noch ein paar Minuten, bevor er auf dem Tisch verblutete, aber seine Schreie hallten noch jetzt in Alexanders Ohren wider.
Er sah zu Phlegons Meisterassistenten hin. Dass Phlegon Troas zu diesem Eingriff geschickt hatte, war ein beredtes Zeugnis für die Hoffnungen, die der große Arzt in seinen jungen Studenten setzte. Troas hatte Phlegon oft assistiert und kannte sich besser in der Medizin aus als die meisten praktizierenden Ärzte. Er war ein dunkelhäutiger Ägypter mit schweren Augenlidern. Vielleicht war er in die alten Geheimnisse seines Volkes eingeweiht. Mit Troas zusammenzuarbeiten war eine Ehre. Alexander fand, dass er auf die Ehre verzichten konnte.
„Wie oft bist du schon bei so etwas dabei gewesen, Troas?“, fragte er ihn.
„Hundertmal, vielleicht auch öfter.“ Der Ägypter spitzte zynisch den Mund. „Soll ich es machen?“
„Nein.“
„Dann fang endlich an. Was du heute hier lernst, wird morgen Menschen retten.“
Das Mädchen stöhnte und bewegte sich. Troas schnippte mit den Fingern und Alexanders Diener traten herbei. „Packt sie an den Händen und Knöcheln und haltet sie fest“, befahl Troas, ohne eine Regung zu zeigen.
Sie zogen ihren gebrochenen Arm nach oben. Sie zuckte und ihre Lider flatterten auf. Alexander starrte in die braunen Augen, in denen Schmerz und Verwirrung geschrieben standen. Seine Hand verweigerte ihren Dienst. Hier lag keine halbe Leiche, hier lag ein leidender Mensch.
Troas’ Stimme wurde energischer. „Mein Herr, du musst dich beeilen.“
Sie murmelte etwas Unverständliches und ihr Körper erschlaffte wieder. Das Messer fiel aus Alexanders Hand und klapperte auf den Steinboden.
Troas ging um den Tisch herum, hob es auf und hielt es ihm hin. „Sie ist wieder bewusstlos. Du kannst jetzt unbesorgt arbeiten.“
„Holt mir eine Schüssel mit Wasser.“
„Willst du sie etwa behandeln?“
Alexander sah ihn scharf an. „Was geht das dich an?“ Sein junges intelligentes Gesicht hatte plötzlich einen gebieterischen Ausdruck. Mochte Alexander Demacedes Amandinus auch nur ein Student sein und noch nicht die Fertigkeit und Erfahrung des Meisterassistenten haben – er war ein Freier und Troas nur ein Sklave.
Nun gut. Troas schluckte seinen Zorn und Stolz hinunter und trat zurück. „Verzeih, Herr“, sagte er ausdruckslos. „Ich wollte dich nur daran erinnern, dass sie so oder so dem Tod geweiht ist.“
„Mir scheint, die Götter haben ihr Leben verschont.“
„Ja, Herr. Für dich, damit du das Nötige lernen kannst, um ein Arzt zu werden.“
„Ich will nicht der sein, der ihr den Tod bringt!“
„Überleg doch: Durch den Befehl des Prokonsuls ist sie schon tot. Nicht du hast sie unter die Löwen geschickt.“
Alexander nahm sein Messer entgegen und steckte es zu den anderen Instrumenten in der Ledertasche zurück. „Welcher Gott auch immer ihr Leben verschont hat – ich werde nicht seinen Zorn auf mich ziehen, indem ich es jetzt nehme.“ Er nickte zu ihr hin. „Wie du selbst siehst, haben ihre Wunden keine wichtigen Organe verletzt.“
„Willst du lieber, dass sie langsam am Wundfieber stirbt?“
„Ich will, dass sie überhaupt nicht stirbt.“ Alexanders Gehirn arbeitete fieberhaft. Er sah sie wieder vor sich, wie sie singend und mit ausgebreiteten Armen über den Sand geschritten war, als wolle sie den Himmel umarmen. „Wir müssen sie hier rausschaffen.“
„Bist du von Sinnen?“, zischte Troas. Er drehte sich um. Hoffentlich hatte der Wächter nichts gehört.
„Hier kann ich sie nicht richtig versorgen“, murmelte Alexander.
Troas packte ihn am Arm, seine Stimme war mühsam beherrscht. „Das kannst du nicht machen!“ Er nickte vielsagend in Richtung der Soldaten. „Du kannst uns alle in Schwierigkeiten bringen, wenn du versuchst, eine verurteilte Gefangene zu retten.“
„Dann bitten wir wohl besser alle unsere Götter, dass sie uns helfen und beschützen. Und jetzt halt den Mund und bring sie hier weg, sofort! Den Wächter übernehme ich, da du ja solche Angst vor ihm hast. Ich komme nach, sobald ich kann.“
Der Ägypter starrte ihn ungläubig an.
„Los!“
Troas winkte den anderen zu und zischte Anweisungen, während Alexander seine Tasche zusammenpackte. Der Wächter beobachtete sie neugierig. Alexander wischte sich das Blut von den Händen und ging ruhig auf ihn zu.
„Du kannst sie nicht mitnehmen“, sagte der Soldat.
„Sie ist tot. Sie bringen nur noch die Leiche weg.“ Alexander lehnte sich an das Tor und blickte auf den heißen Sand hinaus. „Die sechs Sesterzen waren verschwendet, es war schon zu spät.“
Der Wächter grinste kalt. „Du wolltest sie ja unbedingt haben.“
Alexander lachte kurz auf und schaute mit gut gespieltem Interesse zu den beiden Gladiatoren hinüber, die gerade ihren Kampf begannen. „Wie lange wird dieser Kampf dauern?“
Der Wächter maß die Männer mit kritischem Blick. „Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch länger. Aber diesmal gibt’s keine Überlebenden.“
Alexander warf das blutverschmierte Tuch fort. „Dann hole ich mir erst einmal einen Wein.“
Als er an dem Steintisch vorbeiging, nahm er beiläufig seine Tasche auf. Er zwang sich, nicht zu schnell durch die fackelerleuchteten Gänge zu gehen. Mit jedem Schritt schlug sein Herz schneller. Endlich trat er ins Sonnenlicht und ein leichter Luftzug strich ihm über das Gesicht.
„Schnell! Schnell!“ Alexander fuhr herum. Er hatte die Worte ganz deutlich gehört, als habe jemand sie ihm direkt ins Ohr geflüstert. Aber es war niemand zu sehen.
1
Ein Jahr später
Marcus Lucianus Valerian wanderte durch das Straßenlabyrinth der Ewigen Stadt. Er suchte Frieden und fand ihn nicht. Rom deprimierte ihn nur. Er hatte den Gestank des verdreckten Tiber und das erstickende Menschengewühl beinahe vergessen gehabt. Vielleicht hatte er es auch früher einfach nie bemerkt. In den Wochen, seit er in seine Geburtsstadt zurückgekehrt war, war er stundenlang durch die Straßen gelaufen und hatte alte Freunde besucht, aber das Gelächter klang hohl und das Feiern und Trinken war anstrengend und leer gewesen.
Er brauchte eine Abwechslung. Daher hatte er sich breitschlagen lassen, zusammen mit Antigonus die Spiele zu besuchen. Sein Freund war jetzt ein mächtiger Senator, der einen festen Platz auf der Ehrentribüne hatte. Marcus versuchte, ruhig zu bleiben, als er seinen Platz einnahm. Aber das Trompetengeschmetter und die Eröffnungsparade der Gladiatoren machten ihm die Brust eng.
Seit Ephesus war er nicht mehr zu den Spielen gegangen. Ob er sie heute ertragen könnte? Es war schmerzlich deutlich, dass Antigonus jetzt noch versessener darauf war als früher; er hatte eine hohe Summe auf einen Gladiator aus Gallien gesetzt.
Mehrere Frauen setzten sich zu ihnen unter die Markise. Schöne, sinnliche Frauen. Sie waren sichtlich mindestens so sehr an Marcus interessiert wie an den Spielen. Er sah sie an. Ein kurzer Strom der Erregung durchfloss ihn, dann war das Gefühl vorbei. Wenn Hadassa Wein gewesen war, dann waren diese Weiber Pfützenwasser. Ihr flaches Geschwätz ging ihm auf die Nerven. Selbst Antigonus’ anzügliche Witze, die ihm früher so gefallen hatten, störten ihn nur. Wie hatte er diese Obszönitäten nur je lustig finden können? Oder Antigonus’ Finanzsorgenlitanei bemitleidenswert?
„Erzähl noch einen“, lachte eine der Frauen.
„Du wirst rote Ohren kriegen“, warnte Antigonus. Seine Augen tanzten.
„Noch einen, noch einen!“, echoten die anderen.
Marcus nicht. Still und angewidert saß er da. Aufgeputzt wiePfauen und misstönend wie Krähen, dachte er.
Eine der Frauen ließ sich neben ihm nieder, ihre Hüfte berührte seine. „Die Spiele regen mich immer so an“, schnurrte sie.
Sie begann über ihren letzten Liebhaber zu sprechen und berichtete, was sie alles mit ihm gemacht hatte. Ihre grell geschminkten Augen suchten Marcus’ Gesicht nach Zustimmung ab. Er sah sie voller Abscheu an, doch sie schien es nicht zu merken und setzte ihre plumpen Annäherungsversuche fort.
Unten gingen die Spiele ihren blutigen Gang. Antigonus und die Frauen lachten, spotteten und fluchten über die Opfer in der Arena. Sie genossen das Töten. Marcus’ Nerven wurden immer dünner. Er versuchte es mit Wein. Einen Becher nach dem anderen leerte er, um die Schreie da unten zu betäuben. Aber das Bild, das sich ihm eingebrannt hatte, ging nicht weg, ja wurde noch schärfer. Die andere Arena, das andere Opfer …
Die Erregung um ihn herum stieg. Antigonus umarmte eine der Frauen, sie begannen sich ungeniert zu küssen. Ein neues Bild trat vor Marcus’ inneres Auge: seine Schwester Julia. Damals, als er sie das erste Mal zu den Spielen mitgenommen und über die plötzliche Leidenschaft in ihren dunklen Augen gelacht hatte.
Er hielt es nicht mehr aus und stand auf. Grob drängte er sich durch die aufgeputschte Menge nach oben, dann rannte er die Stufen nach draußen hinunter, wie damals in Ephesus. Weg, nur weg von dem Lärm, von dem Blutgeruch. Er lehnte sich an eine Mauer und erbrach sich.
Noch Stunden nach den Spielen hallte das Geschrei des Mobs in seinem Kopf wider und quälte ihn. Aber was hatte er seit Hadassas Tod schon anderes verspürt als das? Innere Qualen und eine schwarze, furchtbare Leere.
„Willst du nichts mehr von uns wissen?“, fragte Antigonus, als er ein paar Tage später Marcus besuchte. „Gestern Abend warst du nicht auf Crassus’ Fest. Wir hatten alle mit dir gerechnet.“
„Ich hatte zu tun.“ Marcus hatte vorgehabt, für immer nach Rom zurückzukehren in der verzweifelten Hoffnung, hier Frieden zu finden. Die Hoffnung war vergeblich gewesen. Er sah Antigonus an und schüttelte den Kopf. „Ich werde nicht mehr lange in Rom sein.“
„Ich dachte, du wolltest bleiben?“
„Ich hab es mir anders überlegt.“
„Aber warum?“
„Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.“
Antigonus’ Augen funkelten sarkastisch. „Na, ich hoffe, du kannst wenigstens etwas von deiner kostbaren Zeit für das Fest erübrigen, das ich für dich geben werde. Und warum siehst du so griesgrämig aus? Bei den Göttern, Marcus, du hast dich verändert, seit du in Ephesus warst. Was haben sie mit dir gemacht?“
„Ich habe viel zu tun, Antigonus.“
„Du brauchst mal Abwechslung von deinem Trübsalblasen.“ Seine Stimme wurde jovial. Marcus spürte, dass er ihn gleich um Geld bitten würde. „Die Unterhaltung, die ich bestellt habe, wird deinen Kopf im Nu wieder frei machen.“
„Schon gut, ich komme zu deinem Fest.“ Wann ging der Kerl endlich? Warum begriffen die Leute nicht, dass Marcus in Ruhe gelassen werden wollte? „Aber für Klatsch und Tratsch habe ich heute einfach keine Zeit.“
Endlich stand Antigonus. An der Tür drehte er sich noch einmal um und sah seinen Freund verärgert an. „Ich hoffe nur, dass du morgen Abend besserer Laune bist.“
Aber Marcus war nicht besserer Laune. Mit die erste Person, die er sah, als er Antigonus’ Villa betrat, war Arria. Antigonus hatte sie mit keinem Wort erwähnt. Marcus warf ihm einen verärgerten Blick zu.
Der Senator antwortete mit einem verschmitzten Lachen. „Sie war fast zwei Jahre lang deine Geliebte, Marcus, so lange hat es keiner mehr geschafft. – Was guckst du mich so an? Du hattest mir doch gesagt, dass ihr euch freundschaftlich getrennt habt.“
Arria schien noch ganz die Alte: schön, frivol und stets auf Zerstreuung aus. Und doch war sie anders geworden: nicht mehr jugendlich-lieblich, sondern härter, abgebrühter. Ihr Lachen klang nicht mehr fröhlich, sondern schrill. Mehrere Männer umschwärmten sie. Sie witzelte mit ihnen, flüsterte anzügliche Bemerkungen nach links und rechts. Jetzt blickte sie zu Marcus hin und sah ihn fragend an. Natürlich, sie fragte sich, wann er wohl zu ihr kommen würde. Sie konnte ja nicht wissen, dass der Fisch, den sie angeln wollte, keinen Hunger mehr hatte.
Antigonus beugte sich zu ihm. „Schau, wie sie dich ansieht, Marcus. Du brauchst bloß mit dem kleinen Finger zu winken, und du hast sie wieder. Der, den sie da gerade wie einen Schoßhund tätschelt, ist ihr neuester Liebhaber, Metrodomus Crataeus Merula. Nichts im Kopf, aber ein dicker Geldbeutel. Fast so reich wie du, aber inzwischen hat unsere kleine Arria selbst ein paar Goldstücke. Ihr Buch hat ziemlich Furore gemacht.“
„Buch?“ Marcus lachte zynisch. „Ich wusste nicht mal, dass Arria ihren Namen schreiben kann, geschweige denn ganze Sätze.“
„Ich sehe, du hast es nicht gelesen, sonst würdest du nicht darüber lachen. Unsere kleine Arria hat ungeahnte Talente. Bei den Göttern, das hat Ärger gegeben in den hohen Kreisen. Ein Senator hat wegen der Enthüllungen in diesem Buch seine Frau verloren … es heißt, dass er womöglich Selbstmord begehen muss. Diskretion ist ja noch nie Arrias Stärke gewesen, aber jetzt ist sie geradezu skandalsüchtig. Mehrere Schreiber sind Tag und Nacht damit beschäftigt, ihr kleines Werk zu kopieren. Der Preis für ein Exemplar ist unverschämt.“
„Aber du hast ihn ohne Murren gezahlt, wie?“
„Aber sicher doch. Ich musste doch sehen, ob sie mich auch erwähnt hat. Sie hat, in Kapitel elf. Leider nur in einem Nebensatz.“ Er sah Marcus amüsiert an. „Über dich dagegen hat sie sich ausgiebig ausgelassen. Kein Wunder, dass Sarapais so verrückt auf dich war bei den Spielen kürzlich. Sie wollte wohl testen, ob es stimmt, was Arria über dich schreibt. Am besten, du kaufst dir mal ein Exemplar und liest es. Liebe alte Erinnerungen und so.“
„Arria ist schön, aber rücksichtslos. Am besten, man vergisst sie.“
„Ist das nicht ein grausames Urteil über eine einstige Geliebte?“
„Ich habe Arria nie geliebt.“ Marcus wandte seine Aufmerksamkeit den vor ihm tanzenden Mädchen zu. Die Schellen an ihren Fuß- und Handgelenken, ihre sinnlichen Bewegungen und halb durchsichtigen Schleier – es ekelte ihn an. Hoffentlich hörten sie bald auf.
Plötzlich packte Antigonus eine der Tänzerinnen, zog sie auf seinen Schoß und küsste sie heftig. Das Mädchen zappelte und wehrte sich. Antigonus lachte Marcus zu: „Komm, schnapp dir auch eine.“ Er riss dem Mädchen die Schleier herunter und drückte sie auf seine Liege.
Die Schreie des Sklavenmädchens zogen Marcus die Eingeweide zusammen. Hatte er diesen verzweifelten Blick nicht schon einmal gesehen? Richtig, in Hadassas Augen, damals, als er sich nicht mehr hatte beherrschen können. „Lass sie los, Antigonus.“
Mehrere Gäste begannen Antigonus lachend anzuspornen. Der betrunkene Senator packte die schreiende Sklavin fester.
Marcus stand heftig auf. „Lass sie los, sagte ich!“
Es wurde abrupt still. Mit offenem Mund starrten alle den zornigen jungen Valerianer an. Antigonus hob lachend den Kopf und sah zu ihm hoch. Sein Lachen erstarb. Er rollte zur Seite und ließ die Sklavin los, die hysterisch weinend davonrannte. „Entschuldige, Marcus, du hättest doch sagen können, dass du sie selbst willst.“
Marcus spürte, wie Arria ihn aus brennenden Augen ansah. „Ich wollte das Mädchen nicht“, sagte er knapp. „Und auch sonst niemanden hier.“
Flüstern und Tuscheln. Mehrere Frauen sahen grinsend zu Arria hinüber.
Antigonus’ Brauen zogen sich zusammen. „Warum hast du mich dann in meinem Vergnügen gestört?“
„Du warst drauf und dran, das Mädchen zu vergewaltigen.“
Antigonus lachte trocken. „Vergewaltigen? Noch eine Minute, und es hätte ihr Spaß gemacht.“
„Das bezweifle ich.“
Antigonus’ Erheiterung verflog, seine Augen blitzten. „Seit wann scherst du dich um die Gefühle von Sklavinnen? Ich könnte dir ein oder zwei Gelegenheiten nennen, wo du dich ähnlich verlustiert hast.“
„Danke, ich habe selbst ein Gedächtnis.“ Marcus trank hastig seinen Becher leer. „Und jetzt brauche ich dringend frische Luft.“
Er ging in den Garten, aber Arria folgte ihm, Merula im Schlepptau. Marcus biss die Zähne zusammen und versuchte, sie gar nicht zu beachten. Sie sprach über ihre Affäre mit ihm, als habe sie erst gestern geendet und nicht schon vor vier Jahren. Merula starrte Marcus finster an. Marcus bedauerte ihn. Das war Arrias Spezialität: ihre Liebhaber quälen.
„Hast du schon mein Buch gelesen, Marcus?“, fragte sie jetzt honigsüß.
„Nein.“
„Du würdest es bestimmt gut finden.“
Sein Blick flackerte über ihr Gesicht. „Ich mag keinen Unrat mehr.“
Ihr Gesicht verzog sich missbilligend. „Ich habe gelogen in dem Kapitel über dich. Du warst der schlechteste Liebhaber, den ich je hatte!“
Er grinste sie kalt an. „Stimmt. Ich war der Einzige, der noch sein Gehirn im Kopf hatte, als er mit dir Schluss machte.“ Er drehte sich um, blendete die obszönen Flüche aus, die sie ihm hinterherschrie, und verließ den Garten. Zurück im Saal versuchte er, sich im Gespräch mit alten Bekannten und Freunden zu zerstreuen. Aber ihr Gelächter tat ihm weh, es ging immer auf Kosten anderer Menschen. Er spürte die kleinliche Schadenfreude hinter den gekicherten Skandalen.
Schließlich zog er sich auf ein Polster zurück, trank Wein und beobachtete die Szene. Wie sie miteinander Theater spielten, das Gift unter ihren höflichen Masken hervorspuckten. Warum waren sie heute so grausam? Aber halt, es war doch immer so gewesen! Früher hatte er es mitgemacht und genossen … Und jetzt fragte er sich, warum er hier war … wozu er überhaupt nach Rom zurückgekehrt war.
Antigonus kam zu ihm, einen Arm lässig um die Hüften eines reich gekleideten, bleichen Mädchens gelegt. Sie hatte die Kurven der Aphrodite, und einen Augenblick lang antwortete Marcus ihren dunklen, sinnlichen Augen. Seit einer halben Ewigkeit war er keiner Frau mehr nahe gewesen.
Antigonus bemerkte seinen Blick und lächelte selbstgefällig. „Ich wusste doch, dass sie dir gefallen würde. Sie ist reif wie ein Pfirsich.“ Er löste seinen Arm von dem Mädchen und gab ihr einen kleinen Schubs. Sie sank an Marcus’ Brust und sah ihn mit halb geöffnetem Mund an. „Genieße sie den ganzen Abend oder auch länger, wenn du willst. Sie heißt Didyma.“
Marcus nahm sie an den Schultern und schob sie sanft zurück, während er Antigonus trocken zulächelte. Die Frau sah ihren Herrn fragend an.
Antigonus zuckte die Schultern. „Er scheint dich nicht zu wollen, Diddy.“ Er bedeutete ihr zu gehen.
Marcus setzte seinen Becher ab: „Ich schätze die Geste, Antigonus …“
„Aber …?“ Antigonus schüttelte den Kopf. „Du bist mir ein Rätsel, Marcus. Keine Frauen mehr, keine Spiele … Was ist mit dir passiert in Ephesus?“
„Nichts, was du verstehen würdest.“
„Komm, versuch es!“
Marcus lächelte sarkastisch. „Ich würde mein Privatleben niemals einem Mann der Öffentlichkeit anvertrauen.“
Antigonus’ Augen zogen sich zusammen. „Wie bissig du in den letzten Tagen bist … Habe ich dir etwas getan?“
Marcus schüttelte den Kopf. „Es geht nicht um dich, Antigonus. Es ist … alles.“
„Was alles?“
„Das ganze verdammte Leben!“ Die Vergnügungen von früher schmeckten ihm nicht mehr. Als Hadassa starb, war auch in ihm etwas gestorben. Seine innerste Seele war wie verdreht. Aber wie sollte er das einem Mann wie Antigonus erklären, wie ihm klarmachen, dass alles sinnlos geworden war, seit eine Sklavin in der Arena in Ephesus gestorben war? Er erhob sich, um zu gehen. „Bitte entschuldige“, sagte er tonlos. „Ich bin kein guter Gesellschafter zur Zeit.“
Im Laufe des nächsten Monats bekam er weitere Einladungen. Er schlug sie alle aus und vertiefte sich stattdessen in seine Geschäfte. Aber auch die Arbeit brachte ihm keinen Frieden. Schließlich begriff er: Er musste reinen Tisch machen – mit seiner Vergangenheit, mit Rom, mit allem.
Er verkaufte den Steinbruch und die restlichen Bauaufträge. Der satte Profit ließ ihn kalt. Er ging mit den Verwaltern der valerianischen Lagerhäuser die Bücher durch. Sextus, einem langjährigen Partner seines Vaters, der dem Haus Valerian treu gedient hatte, bot er den Posten des Chefverwalters ihres Besitzes in Rom an, inklusive eines großzügigen Anteils an den Bruttoprofiten.
Sextus war wie vom Donner gerührt. „So großzügig warst du früher nie.“ Unausgesprochener Argwohn schwang in seiner Stimme mit.
„Du kannst die Gelder verteilen, wie du willst, ohne mich zu fragen.“
„Ich meinte nicht das Geld“, sagte Sextus. „Ich spreche von der Vollmacht. Wenn ich dich recht verstehe, übergibst du mir die Zügel deiner Geschäfte in Rom.“
„Richtig.“
„Hast du vergessen, dass ich einmal ein Sklave deines Vaters war?“
„Nein.“
Sextus sah ihn misstrauisch an. Er wusste, wie viele Sorgen Marcus seinem Vater gemacht hatte. Der Ehrgeiz des jungen Mannes war wie ein rasendes Fieber gewesen, das sein Gewissen verzehrt hatte. Was für ein Spiel spielte er jetzt? „Wolltest du nicht die Geschäfte deines Vaters ebenso kontrollieren wie deine?“
Marcus lächelte kühl. „Du sprichst sehr offen.“
„Möchtest du lieber, dass ich dir schmeichele?“
Marcus’ Mund zog sich zusammen, aber er beherrschte sich. Er durfte nicht vergessen, dass dieser Mann ein treuer Freund seines Vaters gewesen war. „Ich habe mich in Ephesus mit meinem Vater versöhnt.“
Sextus schwieg ungläubig. Marcus blickte ihn fest an. „Das Blut meines Vaters fließt in meinen Adern, Sextus. Ich mache dir dieses Angebot nicht leichtfertig, ich habe auch keine Hintergedanken dabei. Ich habe es mir in den letzten Wochen reiflich überlegt. Siebzehn Jahre lang sind die Waren in diesen Lagerhäusern durch deine Hände gegangen. Du kennst die Männer, die die Schiffe ausladen und die Waren einlagern, alle mit Namen. Du weißt, welchen Händlern man trauen kann und welchen nicht. Du hast über jede Transaktion sorgfältig Rechenschaft abgelegt. Wem könnte ich mehr trauen als dir?“ Er hielt ihm die Schriftrolle entgegen.
Sextus nahm sie nicht. „Du kannst es annehmen oder nicht“, sagte Marcus, „aber du solltest wissen: Meinen sonstigen Besitz in Rom habe ich veräußert. Der einzige Grund, warum ich die Schiffe und Lagerhäuser nicht auch verkauft habe, ist, dass sie so eng mit dem Leben meines Vaters verquickt sind. Sein Schweiß und Blut, nicht meines, haben dieses Handelsimperium aufgebaut. Ich biete dir diese Stellung an, weil du fähig dazu bist, aber mehr noch, weil du der Freund meines Vaters warst. Wenn du ablehnst, verkaufe ich alles; sei dir darüber klar, Sextus.“
Sextus lachte hart. „Selbst wenn du es ernst meintest mit dem Verkaufen – ich kenne niemanden, der das Geld hätte, ein Unternehmen dieser Größe zu kaufen.“
„Das weiß ich auch.“ Marcus’ Augen waren kalt. „Ich habe kein Problem damit, die Schiffe und Häuser einzeln zu verkaufen, Schiff für Schiff, Gebäude für Gebäude.“
Sextus sah, dass er es ernst meinte. Was für ein opportunistisches Denken! Und dieser Mann war der Sohn des Decimus?
„Über fünfhundert Menschen arbeiten für dich! Die meisten sind Freie. Ist dir ihr Wohlergehen und das ihrer Familien egal?“
„Du kennst sie besser als ich.“
„Wenn du jetzt verkaufst, bekommst du nur einen Bruchteil des Wertes heraus. Ich glaube nicht, dass du das tun würdest.“
„Warte nur ab.“ Marcus warf die Rolle auf den Tisch.
Sextus sah ihn einen langen Augenblick an. Die entschlossene Härte im Gesicht des jungen Mannes erschreckte ihn. „Aber warum?“
„Weil ich diesen Mühlstein um den Hals loswerden will, der mich an Rom fesselt!“
„Und dafür willst du so weit gehen? Wenn du wirklich deinen Frieden mit deinem Vater gemacht hast, wie kannst du dann zerstören, was er ein Leben lang aufgebaut hat?“
„Es geht nicht darum, was ich will, Sextus. Hör zu: Als der Tod kam, sah mein Vater, dass das alles sinnlos und leer war. Und heute gebe ich ihm recht.“ Er wies auf die Schriftrolle. „Was ist deine Antwort?“
„Ich brauche Bedenkzeit.“
„Du hast so lange Zeit, bis ich durch diese Tür gegangen bin.“
Was für eine Arroganz! Doch dann besann Sextus sich und schüttelte mit leisem Lachen den Kopf. „Du bist wirklich wie dein Vater. Selbst nachdem er mich freigegeben hatte, wusste er sich immer durchzusetzen.“
„Nicht in allem.“
Sextus spürte Marcus’ inneren Schmerz. Doch, vielleicht hatte er wirklich Frieden mit seinem Vater gemacht und bereute jetzt die verlorenen Jahre der Rebellion. Er nahm die Schriftrolle und klopfte mit ihr auf seine Handfläche. Er dachte an den Vater und sah den Sohn lange an. „Gut, ich nehme an“, sagte er schließlich. „Unter einer Bedingung.“
„Heraus damit.“
„Ich werde dir genauso dienen wie deinem Vater.“ Er warf das Schriftstück in das glühende Kohlenbecken und streckte seine Hand aus. Marcus nahm sie mit einem Kloß im Hals.
Bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen segelte Marcus nach Ephesus. Stundenlang stand er während der langen Reise am Bug des Schiffes, den salzigen Wind im Gesicht. Zum ersten Mal ließ er seinen innersten Gedanken wieder freien Lauf. Hadassa … auf solch einem Schiff, an solch einem Bug hatte sie neben ihm gestanden. Der Wind hatte ihre Haarsträhnen um ihr Gesicht geblasen. Mit ernsten Augen hatte sie über ihren unsichtbaren Gott gesprochen. „Gott ist die Liebe“, hatte sie gesagt. Und später, in Ephesus: „Gott spricht in einer leisen Stimme im Wind.“
Genauso schien jetzt ihre Stimme zu ihm zu sprechen, ihn leise zu rufen, wie ein Windhauch. Aber wohin rufen? In die Verzweiflung? In den Tod?
Halb wollte er sie vergessen, halb fürchtete er sich genau davor. Er kam sich vor wie jemand, der eine Tür geöffnet hatte und sie nicht mehr zubekam. Ihre Stimme schien ihn überallhin zu begleiten, wie ein Echo in seiner Dunkelheit.
2
Als Marcus in Ephesus an Land ging, wogte kein Gefühl von Heimkehr durch seine Seele. Er ließ seine Sachen bei den Dienern und ging direkt zur Villa seiner Mutter, die an einem Berghang nicht weit von der Stadtmitte lag.
Ein überraschter Sklave begrüßte ihn. Seine Mutter war nicht da, würde aber in einer Stunde wieder zurück sein. Müde und niedergeschlagen ging er in den Innenhof und setzte sich. Helles Sonnenlicht ergoss sich in das nach oben offene Atrium und ließ das Wasser in dem Zierbecken funkeln und blitzen. Das beruhigende Plätschern des Brunnens verlor sich in den Gängen. Es war schön in der schattigen Nische, in der Marcus saß. Aber er merkte nichts davon.
Er lehnte seinen Kopf zurück an die Wand und versuchte, seinen Schmerz in dem Murmeln des Wassers zu verlieren. Doch stattdessen kamen die Erinnerungsbilder mit doppelter Wucht zurück, bis der Schmerz ihn ersticken wollte.
Vierzehn Monate war es jetzt her, dass Hadassa gestorben war, aber in seiner zerrissenen Seele schien es erst gestern gewesen zu sein. Wie oft hatte sie hier gesessen, genau auf dieser Bank, zu ihrem unsichtbaren Gott gebetet und einen Frieden gefunden, den Marcus nicht kannte. Fast konnte er ihre Stimme wieder hören – so leise und melodisch wie das Wasser. Für seinen Vater und seine Mutter hatte sie gebetet. Und für ihn. Und für Julia!
Er schloss die Augen. Alles ungeschehen machen können, Hadassa wieder lebendig machen, die Qual der letzten Monate auswischen … Wenn sie jetzt hier neben ihm sitzen würde … Er wollte ihren Namen aussprechen wie in einer Beschwörung und sie so durch die Macht seiner Liebe von den Toten zurückholen. Und so flüsterte er: „Hadassa … Hadassa.“
Aber sie kam nicht. Dafür kamen die blutigen Bilder ihres Todes zurück und der Aufruhr in seiner Seele danach, das namenlose Entsetzen, die Trauer, die Schuld, die sich zu dem hilflosen, bohrenden Zorn vereint hatten, der ihn nicht mehr loslassen wollte. Was hat all ihr Beten ihr genützt?, dachte er bitter. Wie ruhig sie vor den Löwen in der Arena gestanden hatte. Wenn sie geschrien hatte, hatte er es jedenfalls nicht gehört in dem Gebrüll des ephesischen Mobs. Und eine in dem Mob war seine eigene Schwester gewesen …
Als er nach Rom fuhr, hatte seine Mutter gesagt, dass die Zeit alle Wunden heile. Aber die Last, die seit Hadassas Tod auf seiner Seele lag, war nicht leichter geworden, sondern schwerer, immer schwerer. Wie ein Mühlstein hing der Schmerz um seinen Hals, unter dem er zusammenzubrechen drohte.
Er seufzte und stand auf. Er durfte nicht so viel über die Vergangenheit grübeln. Jedenfalls nicht heute, wo er so todmüde war von der endlosen Reise. Rom hatte ihn nicht von seiner inneren Lähmung befreien können; es war alles nur noch schlimmer geworden. Und jetzt war er wieder in Ephesus und keinen Deut glücklicher als an dem Tag, wo er das Schiff nach Rom bestiegen hatte.
Er stand im Peristylum der Villa und kämpfte gegen die dunkle Wolke an. Das Haus war still wie ein Grab, selbst die Sklaven hörte man nicht. Er spürte ihre Nähe, aber sie hielten klugerweise Abstand. Jetzt ging die Haustür. Er hörte leise Stimmen, dann eilige Schritte.
„Marcus!“ Seine Mutter lief auf ihn zu und umarmte ihn.
„Mutter“, sagte er lächelnd und schob sie ein Stückchen zurück, um ihr Gesicht zu studieren. „Du siehst gut aus.“ Er küsste sie auf die Wangen.
„Warum bist du schon wieder zurück?“, fragte sie. „Ich dachte, ich würde dich erst nach Jahren wiedersehen.“
„Meine Geschäfte sind erledigt. Es gab keinen Grund, länger zu bleiben.“
„Ist alles so, wie du es erhofftest?“
„Ich bin noch reicher als vor einem Jahr, wenn du das meinst.“
Sein Lächeln war hohl. Phoebe sah ihm in die Augen und ihr Blick wurde weich. Sie legte sacht eine Hand an seine Wange, als sei er ein Kind, das sich wehgetan hatte. „Du hast es nicht vergessen können.“
Er trat einen Schritt zurück. Ob alle Mütter so die Seelen ihrer Kinder lesen konnten? „Ich habe die Führung der Lagerhäuser Sextus übertragen“, sagte er bemüht lebhaft. „Er ist fähig und vertrauenswürdig.“
„Du bist genauso ein Menschenkenner wie dein Vater“, sagte Phoebe leise.
„Nicht immer.“ Er seufzte auf. Nur nicht an seine Schwester denken … „Julius sagte mir, dass du mehrere Wochen Fieber hattest.“
„Ja. Aber jetzt bin ich wieder gesund.“
Marcus blickte sie forschend an. „Er sagte, du ermüdest noch rasch. Du bist dünner als früher.“
Sie lachte. „Mach dir keine Sorgen! Jetzt, wo du wieder da bist, wird auch mein Appetit wiederkommen.“ Sie nahm seine Hand. „Wenn dein Vater auf einer seiner langen Reisen war, habe ich mir immer Sorgen um ihn gemacht, und jetzt mache ich mir wohl Sorgen, wenn du fort bist. Die See ist unberechenbar.“
Sie setzte sich auf die Bank; er blieb stehen. Sie sah, wie ruhelos er war. Auch er war schmaler geworden, sein Gesicht älter und härter. „Wie war Rom?“
„So ziemlich wie früher. Ich habe Antigonus und seine Stiefellecker gesehen. Er jammerte über seine Finanzen, wie immer.“
„Und hast du ihm gegeben, was er wollte?“
„Nein.“
„Warum nicht?“
„Weil er dreihunderttausend Sesterzen wollte, und jede Sesterze wäre in die Ausrichtung von Spielen gegangen.“ Er wandte sich ab. Früher hätte er ohne Umstände Ja gesagt und wäre gern als Ehrengast zu den Spielen gekommen. Und der dankbare Antigonus hätte ihm natürlich Bauaufträge der Regierung verschafft und die Türen reicher Aristokraten geöffnet, die noch größere und schönere Villen wollten.
Ein Politiker wie Antigonus musste sich mit dem Volk gutstellen, und dazu gab es nichts Besseres, als Spiele zu veranstalten. Den Leuten war es egal, welche politische Meinung ein Senator hatte, solange er sie nur gut unterhielt und von den Problemen des Alltags ablenkte: dem Handelsdefizit, den Unruhen, Hunger, Krankheiten, den billigen Arbeitssklaven, die aus den Provinzen herbeiströmten und den Freien Arbeitsplätze wegnahmen.
Schluss damit! Marcus schämte sich, wenn er daran dachte, wie viele Hunderttausend Sesterzen er Antigonus früher für seine politischen Bestechungskünste gegeben hatte. Er hatte an seinen eigenen Vorteil gedacht; Freunde in den hohen Kreisen waren gut für das Geschäft. Keine Minute lang hatte er an die Menschenopfer gedacht, die die Arena verlangte; sie waren ihm egal gewesen. Die Finanzspritzen für Antigonus waren Investitionen gewesen; sie hatte Marcus schneller die begehrten Bauaufträge in den vom Feuer verwüsteten reicheren Vierteln Roms verschafft. Durch kluge Bestechung hatte er seine Chance bekommen, und die Chance hatte ihm Reichtum gebracht. Seine Göttin hieß Fortuna.
Und jetzt hielt ihm sein Gedächtnis den Spiegel vor: Da hast du gesessen, dich gelangweilt und mit Freunden Wein getrunken, während unten im Sand ein Mann an ein Kreuz genagelt wurde; hast dich von einem Sklaven mit Delikatessen verwöhnen lassen, während unten Männer aufeinander einstechen mussten, bis einer von ihnen tot war. Und wofür? Um einen gelangweilten, blutlüsternen Mob zu unterhalten. Und einer von dem Mob warst du selbst. Und einer der Geldgeber auch. Und jetzt zahlst du einen noch höheren Preis: Jetzt weißt du, dass du auch Hadassas Tod mitfinanziert hast …
Marcus hatte gelacht, als ein Mann in panischer Angst über den Sand rannte, in sinnloser Flucht vor einem Rudel ausgehungerter Hunde. Er hörte wieder das Anfeuerungsgebrüll aus Tausenden von Kehlen, als die Löwin Hadassa packte. Was hatte Hadassa denn getan? Sie hatte etwas Unschuldiges an sich gehabt, das das Gewissen und die Eifersucht einer schmutzigen Hure gereizt hatte. Und die Hure war Marcus’ Schwester gewesen.
Phoebe saß still auf ihrer Bank und betrachtete das verbitterte Gesicht ihres Sohnes. „Julia hat gefragt, wann du wiederkommst.“ Sie sah, wie seine Kiefermuskeln mahlten. „Sie will dich sehen, Marcus.“
Er sagte nichts.
„Sie braucht dich.“
„Was sie braucht, ist mir egal.“
„Und wenn sie es wiedergutmachen will?“
„Wiedergutmachen? Kann sie Hadassa wieder lebendig machen? Kann sie ihre Tat ungeschehen machen? Nein, Mutter, da ist nichts wiedergutzumachen.“
„Sie ist immer noch deine Schwester“, sagte Phoebe sanft.
„Du magst eine Tochter haben, Mutter, aber ich schwöre dir, ich habe keine Schwester.“
Sie sah die Heftigkeit, die Kompromisslosigkeit in seinem Gesicht. „Kannst du nicht vergessen, was vergangen ist?“
„Nein.“
„Oder vergeben?“
„Niemals! Ich bete und wünsche, dass alle Flüche der Welt sie treffen.“
Die Augen seiner Mutter füllten sich mit Tränen. „Vielleicht erinnerst du dich besser daran, wie Hadassa lebte, und nicht, wie sie starb.“
Die Worte trafen. Er drehte sich leicht zur Seite, ärgerlich, dass sie so zu ihm sprach. „Ich erinnere mich nur zu gut“, sagte er rau.
„Vielleicht erinnern wir uns nicht in dem gleichen Licht“, sagte Phoebe leise. Sie hob ihre Hand, um den unter ihrem Palus versteckten Anhänger zu betasten, auf dem das Emblem ihres neuen Glaubens eingraviert war: ein Hirte, der ein verirrtes Schaf auf seinen Schultern trug. Marcus wusste nichts davon. Ob sie es ihm jetzt sagen sollte?
Sie konnte immer noch nicht begreifen, wie Hadassa ihr zum Wegweiser geworden war. Sie war eine Christin geworden, getauft mit Wasser und mit dem Heiligen Geist des lebendigen Gottes. Es war ihr nicht schwergefallen – nicht so wie bei Decimus, der buchstäblich bis an sein Lebensende gewartet hatte, bis er Christus angenommen hatte. Und jetzt kämpfte Marcus, der seinem Vater so ähnlich war, gegen Gottes Geist an. Marcus, der keinen Herrn über sein Leben duldete außer sich selbst.
Phoebe sah, wie seine Finger sich zu Fäusten ballten und wieder lösten. Nein, jetzt noch nicht. Er würde nur zornig werden, sie nicht verstehen und Angst haben, dass er sie verlieren würde, genauso wie damals Hadassa. Wenn er nur sehen könnte, dass Hadassa gar nicht verloren war. Er war verloren.
„Was hätte Hadassa gewollt, das du jetzt tust?“
Marcus schloss die Augen. „Wenn sie anders gehandelt hätte, wäre sie jetzt noch am Leben.“
„Wenn sie anders gewesen wäre, Marcus, hättest du sie nicht so lieben können, von ganzem Herzen und ganzer Seele.“ So wie er Gott lieben würde, wenn er nur begreifen würde, dass es Gottes Geist in Hadassa gewesen war, der ihn so zu ihr hinzog.
Sie sah seinen Schmerz und litt mit ihm. „Soll dein Grabmal für Hadassa dein unversöhnlicher Hass auf deine Schwester sein?“
„Lass, Mutter“, sagte er knapp.
„Wie kann ich das? Du bist mein Sohn, und was Julia auch getan haben mag, sie ist meine Tochter. Ich liebe euch beide. Und ich liebe Hadassa.“
„Hadassa ist tot, Mutter!“ Er starrte sie an. „Und warum? Weil sie eine Verbrecherin war? Nein! Eine eifersüchtige Hure hat sie ermordet!“
Phoebe legte ihre Hand auf seinen Arm. „Für mich ist Hadassa nicht tot. Und auch für dich nicht.“
„Nicht tot? Wie kannst du so etwas sagen? Ist sie etwa jetzt hier bei uns?“ Er trat zurück zu der Bank, auf der Hadassa so oft in den ruhigen Abendstunden und der frühen Morgenstille gesessen hatte, und lehnte sich erschöpft gegen die Wand.
Seine Mutter setzte sich neben ihn und nahm wieder seine Hand. „Weißt du noch, was sie deinem Vater kurz vor seinem Tod sagte?“
„Er nahm meine Hand und legte sie auf Hadassas. Sie gehörte mir.“ Er sah ihn wieder vor sich, den Blick in Hadassas dunklen Augen, als er seine Hand fest um die ihre geschlossen hatte. Ob sein Vater gewusst hatte, dass sie in Gefahr war? Hatte er ihm ein Zeichen geben wollen, den Auftrag, sie zu beschützen? Am gleichen Tag noch hätte er sie von Julia zurückholen sollen, statt zu warten, bis Julia sie freigab. Julia war wieder schwanger gewesen damals, ihr Liebhaber verschwunden. Er hatte Mitleid mit ihr gehabt und die Augen verschlossen vor der Gefahr. Wäre er damals nur klüger gewesen, Hadassa würde noch leben. Und seine Frau sein.
„Marcus, Hadassa hat gesagt: ‚Wenn du nur glaubst und Gottes Gnade annimmst, wirst du bei Gott im Paradies sein.‘ Sie hat uns gesagt, dass jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt.“
Er drückte ihre Hand. „Trostworte für einen Sterbenden, Mutter. Es gibt kein Leben nach dem Tod, nur Staub und Dunkelheit. Alles, was wir haben, ist hier. Jetzt. Das einzige ewige Leben, das es geben kann, ist in den Gedanken eines anderen. Hadassa lebt weiter, solange ich lebe. Sie lebt in mir.“ Seine Augen wurden hart. „Und weil ich sie liebe, werde ich nie vergessen, wie sie starb und wer ihren Tod verschuldet hat.“
„Wirst du denn nie verstehen, warum sie starb?“ Tränen glitzerten in Phoebes Augen.
„Doch, ich weiß, warum sie starb. Sie wurde aus purer Eifersucht und Gehässigkeit ermordet.“ Er zog seine Hand zurück, kämpfte gegen die in ihm tobenden Gefühle an. „Manchmal wünsche ich, ich könnte vergessen“, sagte er. Er legte seinen Kopf in seine Hände und knetete seine Stirn, als wolle er die Erinnerungen wegmassieren. „Einmal sagte sie mir, dass ihr Gott im Wind zu ihr spricht, aber ich kann nichts hören außer dem leisen Echo ihrer Stimme.“
„Dann hör besser hin.“
„Ich kann nicht! Ich halte es nicht aus.“
„Vielleicht musst du ihren Gott suchen, um den Frieden zu bekommen, von dem sie sprach.“
Marcus’ Kopf ruckte hoch. Er lachte auf. „Ihren Gott?“
„Ihr Glaube an ihn war ihr innerstes Wesen, Marcus. Das weißt du doch.“
Er stand auf und trat zur Seite. „Und wo war dieser allmächtige Gott, als sie vor den Löwen stand? Wenn es ihn gibt, ist er ein Schuft, er hat sie im Stich gelassen!“
„Wenn du das wirklich glaubst, musst du der Sache nachgehen.“
„Wie soll ich das denn machen, Mutter? Zu den Priestern eines Tempels gehen, den es gar nicht mehr gibt? Titus hat Jerusalem zerstört. Ganz Judäa ist ein Trümmerhaufen.“
„Du musst zu ihrem Gott gehen und ihn selbst fragen.“
Er sah sie stirnrunzelnd an. „Du fängst doch hoffentlich nicht auch an, an diesen verdammten Jesus zu glauben? Ich habe dir doch erzählt, wie das mit ihm war. Er war ein einfacher Zimmermann, der es sich mit den Juden verdorben hatte. Sie ließen ihn kreuzigen.“
„Du hast Hadassa geliebt.“
„Ich liebe sie immer noch.“
„Ist sie es dann nicht wert, dass du genauer nachfragst? Was war das eine, das ihr wichtiger war als selbst das Leben? Du musst ihren Gott suchen und ihn fragen, warum sie starb. Nur er kann dir die Antworten geben, die du brauchst.“
Marcus’ Mund zog sich zynisch zusammen. „Wie sucht man einen unsichtbaren Gott?“
„Wie Hadassa es machte. Bete.“
Trauer überspülte ihn, dann Bitterkeit und Wut. „Bei den Göttern, Mutter, was hat sie denn jemals vom Beten gehabt?“ Er sah in ihr überraschtes, bestürztes Gesicht und begriff, dass er sie gerade tief getroffen hatte. Unter Aufbietung aller Kraft zwang er sich, ruhiger zu werden. „Mutter, ich weiß, du willst mich trösten, aber es gibt keinen Trost. Verstehst du nicht? Vielleicht wird die Zeit die Dinge ändern, ich weiß es nicht. Aber kein Gott wird mir helfen.“ Er schüttelte den Kopf, seine Stimme wurde wieder zornig. „Seit ich ein Kind war, hast du in unserem Lararium deine Opfergaben vor die Hausgötter gelegt. Hat das deinen anderen Sohn und deine zweite Tochter vor dem Fieber gerettet? Hat es Vater am Leben erhalten? Hast du jemals eine Stimme im Wind gehört?“ Sein Zorn verflog, er fühlte nur noch diese schreckliche Leere. „Es gibt keine Götter.“
„Dann hat Hadassa gelogen.“
Er zuckte zusammen. „Nein. Sie glaubte jedes Wort, das sie sagte.“
„Dann hat sie also an eine Lüge geglaubt, Marcus? Dann ist sie für nichts gestorben?“ Sie sah, wie seine Hand sich schmerzlich zusammenzog; ihre Fragen taten ihm weh. Aber besser jetzt Schmerzen als später den ewigen Tod erleiden.
Sie stand auf und trat zu ihm und legte ihre Hand an seine Wange. „Marcus, wenn du wirklich glaubst, dass Hadassas Gott sie verlassen hat, dann frag ihn doch einfach, wie er so etwas tun konnte.“
„Und was soll das bringen?“
„Alles. Mehr als du denkst. Wie willst du sonst jemals Frieden finden?“
„Frieden? Das ist eine Illusion. Es gibt keinen wahren Frieden. Wenn ich jemals Hadassas Gott suche, Mutter, dann nicht, um ihn zu preisen, wie sie es tat, sondern um ihn zu verfluchen.“
Phoebe sagte nichts mehr, aber ihr Herz schrie auf. Herr, vergib ihm. Er weiß nicht, was er sagt …
3
„Der da“, sagte Julia Valerian und zeigte auf einen kleinen braunen Ziegenbock. „Der dunkelbraune. Ist er makellos?“
„Alle meine Ziegen sind makellos“, sagte der Händler, drängte sich durch die Herde im Pferch, packte das Tier und schlang einen Strick um seinen Hals. „Diese Tiere haben keine Fehler.“ Er hob den zappelnden Bock hoch, trug ihn zu Julia und nannte seinen Preis.
Julias Augen wurden schmal. Sie blickte das dürre Tier an, dann wieder den Händler. „So viel Geld für ein so kleines Tier? Nein!“
Der Händler ließ seinen Blick demonstrativ über ihren feinen wollenen Palus, die Perlen in ihrem Haar und den Karbunkel an ihrer Halskette streifen. „Ihr scheint es Euch leisten zu können. Wenn Ihr ein Sonderangebot sucht, falle es auf Euer Haupt zurück.“ Er setzte den Bock ab und richtete sich auf. „Ich verschwende meine Zeit nicht mit Feilschen, Frau. Seht Ihr dieses Zeichen an seinem Ohr? Dieses Tier ist von den Priestern als Opfer geweiht, zu Eurem eigenen Besten. Das Geld, das Ihr zahlt, geht an den Tempel. Versteht Ihr? Wenn Ihr woanders einen billigeren Bock kaufen und versuchen wollt, ihn vor die Götter und ihre geweihten Diener zu bringen, ist das Euer Risiko.“ Seine dunklen Augen sprühten Funken.
Julia zitterte vor Wut. Sie wusste genau, dass der Händler sie betrog. Aber sie hatte keine Wahl. Der Mann hatte ja recht. Nur ein Narr wagte es, die Götter zum Besten zu halten oder die Priester, die in ihrem Auftrag die heiligen Zeichen in den Eingeweiden der geschlachteten Opfertiere lasen. Schließlich war sie hierhergekommen, um herauszufinden, was ihr fehlte, und wenn sie dazu diesen unverschämten Preis für ein Opfertier zahlen musste, musste es wohl sein.
„Also gut“, sagte sie. „Ich nehme ihn.“ Sie nahm ihr Armband ab und öffnete die Kapsel; dann zählte sie dem Händler die drei Sesterzen in die Hand.
Er rieb die Münzen zufrieden zwischen seinen Fingern und ließ sie in seinen Beutel gleiten. „Er gehört Euch“, sagte er und gab ihr den Strick. „Möge er Euch Gesundheit bringen.“
„Nimm ihn“, befahl Julia Eudemas und trat zur Seite, damit ihre Sklavin das meckernde, sich sträubende Tier fortziehen konnte. Der Händler schaute lachend zu.
Sie gingen in den Tempel. Der mit stickigem Weihrauchgeruch vermengte Blutgestank wollte Julia den Magen umdrehen. Sie stellte sich in die Schlange und schluckte die Übelkeit hinunter. Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn. Immer wieder musste sie an den Wortwechsel denken, den sie am vergangenen Abend mit Primus gehabt hatte.
„Du bist zu keiner Einladung mehr zu gebrauchen, Julia“, hatte Primus gesagt. „Wo du gehst und stehst, brütest du vor dich hin.“
„Wie rasend lieb von dir, bester Ehegatte, dass du an meine Gesundheit denkst.“ Julia blickte hilfesuchend Calaba an, aber die winkte Eudemas, das Tablett mit der Gänseleber näher zu bringen, wählte ein Stück und lächelte so, dass das Sklavenmädchen erst errötete und dann blass wurde; dann wedelte sie sie fort und sah ihr nach, wie sie das Tablett zu Primus trug.
Erst jetzt bemerkte sie, dass Julia sie ansah. Sie hob ihre Augenbrauen und fragte mit gleichgültigem Blick: „Was ist, Liebe?“
„Ist es dir egal, dass ich krank bin?“
„Natürlich nicht.“ In Calabas ruhige Stimme mischte sich eine Spur Ungeduld. „Aber dir scheint es wohl egal zu sein, liebste Julia. Wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, dass es langweilig wird. Konzentriere dich darauf, gesund zu werden. Lass dich von deinem Willen heilen. Alles, worauf du deinen Willen konzentrierst, wird geschehen.“
„Als ob ich das nicht versucht hätte, Calaba!“
„Aber wohl nicht genug, sonst wärst du geheilt. Du musst jeden Morgen deine Gedanken auf dich selbst konzentrieren und meditieren, wie ich es dir gezeigt habe. Entleere deinen Geist von allem, bis nur das Wissen übrig bleibt, dass du deine eigene Göttin bist und dein Körper dein Tempel. Du hast die Macht über deinen Tempel, dein Wille geschieht, Julia. Du glaubst einfach nicht genug. Du musst glauben, dann wird alles geschehen, was du willst.“
Julia wich den dunklen, kalten Augen aus. Morgen um Morgen hatte sie genau das getan, was Calaba gesagt hatte. Manchmal überfiel das Fieber sie mitten in ihren Meditationen, sodass sie vor Schwäche und Übelkeit zitterte. Wie hoffnungslos das alles war! „Vielleicht gibt es Dinge, die man nicht durch Willenskraft beherrschen kann“, sagte sie leise.
Calaba sah sie verächtlich an. „Wenn du keinen Glauben an dich selbst und deine innere Kraft hast, solltest du vielleicht Primus’ Rat befolgen und im Tempel ein Opfer darbringen. Was mich betrifft, glaube ich nicht an die Götter. Was ich erreicht habe, habe ich allein durch meine eigenen Anstrengungen und meinen Verstand erreicht und nicht durch irgendwelche übernatürlichen, unsichtbaren Mächte. Aber wenn du wirklich glaubst, dass du keine eigene Kraft hast, Julia, bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als dir aus anderen Quellen Kraft zu holen.“
Dass Calaba nach all den zärtlichen Monaten ihrem Leiden so gleichgültig zusehen konnte! Julia beobachtete, wie sie noch ein Stück Gänseleber aß und dann Eudemas bat, ihr das parfümierte Wasser zum Händewaschen zu bringen. Mit niedergeschlagenen Augen hielt die Sklavin Calaba das Becken hin; sie errötete tief, als die langen, juwelenbesetzten Finger kurz ihren Arm streichelten, bevor sie sie entließen. Ein erwartungsvolles Katzenlächeln spielte um Calabas Lippen.
Julia wurde schlecht. Sie wusste, dass sie vor ihren eigenen Augen betrogen wurde – und dass sie nichts daran ändern konnte.
Auch Primus bemerkte, was vor sich ging. Seine mokante Stimme unterbrach die brütende Stille. „Der Prokonsul lässt oft die Götter befragen. Die Priester wissen, ob eine Seuche ausgebrochen ist. Geh hin, Julia, du weißt dann wenigstens, ob deine Krankheit von den Göttern verordnet ist.“
„Und was habe ich davon?“
Calaba seufzte laut und erhob sich. „Ich bin dieser Worte müde.“
„Wo gehst du hin?“, fragte Julia betroffen.
Calaba seufzte wieder. „In die Bäder. Ich habe Sapphira versprochen, sie heute Abend zu besuchen.“
Sapphira – der Name zog Julias Magen noch mehr zusammen. Sapphira war jung und schön und kam aus einer hoch angesehenen römischen Familie. Als sie sie das erste Mal sah, hatte Calaba sie „vielversprechend“ gefunden.
„Mir ist heute nicht nach Ausgehen, Calaba.“
„Ich habe dich auch nicht eingeladen.“
Julia starrte sie an. „Sind dir meine Gefühle so egal?“
„O nein. Aber ich wusste, dass du Nein sagen würdest, und da habe ich dich gar nicht erst eingeplant. Du magst doch Sapphira sowieso nicht, oder?“
„Du dafür umso mehr.“
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: