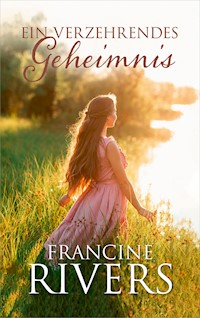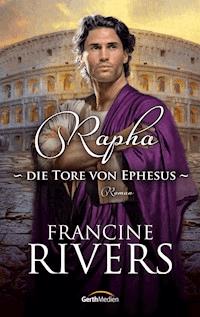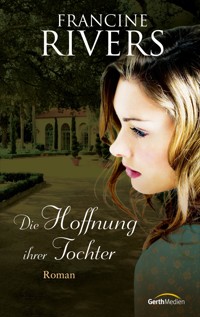Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nordamerika im Goldrausch der 1850er-Jahre: Die erst achtjährige Sarah wird in die Prostitution verkauft. "Angel" ist Sarahs Name im Milieu, doch was sie erlebt, ist die Hölle auf Erden. Angel wird innerlich kalt wie Stein und lässt nichts und niemanden mehr an sich heran. Bis Michael Hosea, ein einfacher, rechtschaffener Farmer, auf den Plan trittund sie aus dem Gefängnis der Abhängigkeit und Gewalt herausholt. Mit großer Geduld lebt er ihr vor, was bedingungslose Liebe heißt. Ganz langsam beginnt Angels Herz aufzutauen ... Francine Rivers zählt seit vielen Jahren zu den renommiertesten Roman-Autoren. Mit dieser Geschichte hat sie einen Klassiker des Genres geschaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Francine Rivers war bereits eine bekannte Bestsellerautorin, als sie sich dem christlichen Glauben ihrer Kindheit wieder zuwandte. Danach schrieb sie 1986 ihr bekanntestes Buch, Die Liebe ist stark, dem noch rund 20 weitere großartige Romane folgten. Heute lebt Francine mit ihrem Mann in Nordkalifornien und genießt es, Zeit mit ihren drei mittlerweile erwachsenen Kindern zu verbringen und ihre Enkel zu verwöhnen.
Kind der DunkelheitWer unter euch ohne Sünde ist,der werfe den ersten Stein auf sie.Jesus in Johannes 8,7
Prolog
Der Herr der Finsternis ist ein edler Herr.
(Shakespeare)
Neuengland, 1835
Alex Stafford war genau so, wie Mama gesagt hatte. Er war groß und dunkelhaarig, und noch nie hatte Sarah einen attraktiveren Mann gesehen. Selbst in seinen staubigen Reitkleidern und mit dem schweißnassen Haar kam er ihr vor wie die Prinzen in den Geschichten, die Mama immer vorlas. Sarahs Herz galoppierte vor Freude und Stolz. Keiner der anderen Väter, die sie in der Messe sah, konnte es mit diesem aufnehmen!
Er sah sie aus seinen dunklen Augen an, und ihr Herz sang. Sie trug ihr bestes blaues Kleid und eine weiße Schürze, und Mama hatte ihr Zöpfe geflochten, mit blauen und rosa Bändern. Sicher gefiel sie ihrem Vater. Mama hatte gesagt, dass Blau seine Lieblingsfarbe war. Aber warum lächelte er nicht? Stand sie nicht still genug? „Hampel nicht herum und benimm dich wie eine Dame, das hat Papa gern“, hatte Mama gesagt.
„Ist sie nicht hübsch, Alex?“, fragte Mama. Ihre Stimme klang komisch – so gepresst und erstickt. „Ist sie nicht das süßeste kleine Mädchen, das du je gesehen hast?“
Sarah sah, wie Papas Stirn sich runzelte. Er sah nicht fröhlich aus, sondern ärgerlich. So wie Mama manchmal, wenn Sarah zu viel redete oder zu viel fragte.
„Nur ein paar Minuten“, sagte Mama. Sie sagte es ganz schnell. Hatte sie Angst? Aber wovor? „Es würde ihr so viel bedeuten, Alex. Bitte …“
Alex Stafford starrte auf Sarah herunter, den Mund zusammengepresst, und musterte sie schweigend. Sarah stand so still, wie sie konnte. Sie hatte sich an diesem Morgen lange im Spiegel betrachtet und wusste, was Papa jetzt sah. Sie hatte sein Kinn und seine Nase und Mamas blondes Haar und ihre helle Haut. Auch ihre Augen waren die ihrer Mutter, nur etwas dunkler. Papa musste sie einfach hübsch finden, er musste! Sie schaute hoffnungsvoll zu ihm hoch. Aber der Blick in seinen Augen war gar nicht nett.
„Hast du absichtlich Blau gewählt, Mae?“ Wie kalt und vorwurfsvoll die Worte klangen. „Weil es ihre Augenfarbe hervorhebt?“
Sarah schaute unwillkürlich zu ihrer Mutter hin, und ihr Herz machte einen Hopser. Mama sah ängstlich aus.
Alex schaute zum Flur hin. „Cleo!“
„Sie ist nicht da“, sagte Mama leise, den Kopf hoch erhoben. „Ich habe ihr heute freigegeben.“
Papas Augen schienen noch dunkler zu werden. „So? Dann hast du ja jetzt ein Problem, Liebling.“
Mama wurde noch steifer. Dann biss sie sich auf die Lippe und sah auf Sarah hinunter. Was hatten sie nur? Warum freute Papa sich denn nicht? Sie war so aufgeregt gewesen, dass sie ihn jetzt endlich sehen würde, und wenn es nur für ein Weilchen war …
„Was soll ich denn machen?“ Mama richtete die Worte an Papa, und so sagte Sarah nichts, hoffte nur still weiter.
„Schick sie fort. Sie kennt doch sicher den Weg zu Cleo, oder?“
Kleine rote Flecken erschienen auf Mamas Wangen. „Wie meinst du das, Alex? Dass ich andere Gäste empfange, wenn du nicht da bist?“
Sarahs Lächeln erstarb verwirrt. Warum guckten sie sie nicht an? Hatten sie vergessen, dass sie da war? Was war bloß los? Mama schien richtig verzweifelt. Warum war Papa so böse darüber, dass Cleo nicht da war?
Sie kaute auf ihrer Unterlippe, sah vom einen zum anderen. Sie machte einen Schritt nach vorne und zog vorsichtig am Reitmantel ihres Vaters. „Papa …“
„Nenn mich nicht so!“
Sie blinzelte, erschreckt und verwirrt. Er war doch aber ihr Papa, das hatte Mama gesagt! Jedes Mal, wenn er kam, brachte er sogar Geschenke für sie mit, die Mama ihr dann gab. War er vielleicht böse, dass sie sich nicht bedankt hatte? „Ich möchte dir Danke sagen für die Geschenke, die du …“
„Still, Sarah“, sagte ihre Mutter rasch. „Nicht jetzt, Spatz.“
Papa warf Mama einen finsteren Blick zu. „Warum sagst du ihr auf einmal, dass sie ruhig sein soll, Mae?“
Mama trat einen Schritt näher und legte ihre Hand auf Sarahs Schulter. Sarah spürte, dass sie zitterte, aber jetzt beugte sich Papa zu ihr herunter und er lächelte. „Was für Geschenke?“, fragte er.
Er war so stattlich, genau wie Mama gesagt hatte. Auf so einen Vater konnte man stolz sein!
„Komm, Kleine, sag’s mir.“
„Ich mag die Zuckersachen, die du mir mitbringst“, sagte Sarah. Sie sonnte sich in seiner Aufmerksamkeit. „Sie sind sehr schön. Aber am allerbesten gefiel mir der Kristallschwan.“
Ihr Gesicht war ganz rot vor Freude, weil Papa ihr zuhörte. Er lächelte sogar, obwohl das Lächeln nicht so schön war. Sein Mund war so dünn wie ein Strich dabei.
„So, so.“ Er richtete sich wieder auf und sah Mama an. „Schön zu wissen, wie viel meine Geschenke dir bedeuten.“
Sarah sah entzückt zu ihm hoch. „Ich stelle den Schwan immer auf meine Fensterbank, da scheint die Sonne durch ihn durch, und auf der Wand tanzen bunte Flecken. Willst du es mal sehen?“ Sie nahm seine Hand. Er riss sie weg, und Sarah blinzelte überrascht.
Mama biss sich auf die Unterlippe und hielt Papa ihre Hand hin, dann ließ sie sie wieder sinken. Sie sah ängstlich aus. Sarah schaute von ihr zu Papa und wieder zurück, versuchte das alles zu begreifen. Was hatte sie falsch gemacht? Freute Papa sich nicht, dass ihr seine Geschenke gefielen?
„Du gibst also meine Geschenke an das Kind weiter“, sagte er. „Dann scheinen sie dir ja sehr wichtig zu sein.“
Wie eisig er klang. Sarah biss sich auf die Lippe, aber bevor sie etwas sagen konnte, berührte Mama sanft ihre Schulter. „Spatz, sei lieb und geh nach draußen spielen.“
Sarah schaute sie traurig an. „Kann ich nicht hierbleiben? Ich bin auch ganz leise.“ Mamas Augen wurden feucht, sie sah Papa an.
Alex beugte sich zu Sarah hinunter. „Ich möchte, dass du jetzt nach draußen gehst und spielst“, sagte er ruhig. „Ich muss allein mit deiner Mutter reden.“ Er strich ihr lächelnd über die Wange.
Sarah lächelte zurück, ganz bezaubert. Papa hatte sie berührt, er war doch nicht böse, er hatte sie lieb, so, wie Mama es gesagt hatte! „Darf ich zurückkommen, wenn ihr fertig seid?“, fragte sie.
Papa richtete sich steif wieder auf. „Deine Mutter wird dich holen, wenn es so weit ist. Und jetzt gehorche und geh nach draußen!“
„Ja, Papa.“ Sarah wäre lieber geblieben, aber sie wollte, dass Papa mit ihr zufrieden war. Sie ging aus dem Wohnzimmer hinaus und hüpfte durch die Küche und zur Hintertür. Draußen pflückte sie ein paar Gänseblümchen, die in dem Beet neben der Tür wuchsen, dann lief sie zum Rosenspalier und begann, Blütenblätter zu zupfen. „Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht …“ Als sie um die Ecke bog, verstummte sie. Sie wollte Mama und Papa nicht stören; sie wollte nur in ihrer Nähe sein.
Vielleicht würde Papa sie auf seine Schultern nehmen. Oder sogar auf einen Ausritt auf seinem großen schwarzen Pferd mitnehmen. Dazu müsste sie sich natürlich umziehen; er würde nicht wollen, dass sie ihr schönes Kleid schmutzig machte. Wenn er Sarah doch auf seinem Schoß sitzen lassen hätte, während er mit Mama sprach! Sie wäre auch ganz still gewesen.
Durch das geöffnete Wohnzimmerfenster drangen Stimmen. Das Fenster war oft offen; Mama mochte den Duft der Rosen. Am besten setzte Sarah sich einfach unten vor das Fenster und hörte ihren Eltern zu. Wenn sie ganz leise war, würde sie sie nicht stören und Mama bräuchte sich nur hinauszulehnen und sie zu rufen, wenn sie fertig waren.
„Was sollte ich denn machen, Alex? Du hast dich nie auch nur eine Minute mit ihr abgegeben. Was sollte ich ihr sagen? Dass sie ihrem Vater egal ist? Dass er sich wünscht, sie wäre nie geboren worden?“
Sarahs Mund klappte auf. Sag, dass das nicht stimmt, Papa! Sag es!
„Ich habe diesen Schwan aus Europa mitgebracht, extra für dich, und du schenkst ihn an ein Kind weg! Hast du ihr vielleicht auch die Perlen gegeben? Und die Spieluhr – die hat sie wohl auch, wie?“
Die Gänseblümchen fielen Sarah aus der Hand und sie sank auf den Boden, Kleid hin, Kleid her. Ihr Herz verlangsamte seinen wilden, glücklichen Takt. Mit jedem Wort schien ihr Magen tiefer zu sinken.
„Alex, bitte! Ich hab mir nichts dabei gedacht. Es hat es einfacher gemacht. Erst heute Morgen hat sie mich gefragt, ob sie jetzt alt genug ist, um dich zu sehen. Jedes Mal, wenn du kommst, fragt sie mich das. Ich konnte nicht schon wieder Nein sagen, ich hab’s nicht übers Herz gebracht! Sie versteht nicht, warum du nichts von ihr wissen willst, und ich auch nicht.“
„Du weißt, wie ich über sie denke.“
„Wie kannst du so etwas sagen? Du kennst sie doch gar nicht. Sie ist so ein süßes Kind, Alex, klug und aufgeweckt und hat vor nichts Angst. Sie ist dir so ähnlich. Sie ist eine Persönlichkeit, Alex, und du kannst nicht ewig leugnen, dass sie da ist. Sie ist deine Tochter …“
„Ich habe genügend Kinder mit meiner Frau. Eheliche Kinder. Du wusstest genau, dass ich nicht noch eins will.“
„Wie kannst du das sagen? Wie kannst du dein eigenes Fleisch und Blut nicht lieben?“
„Ich hatte es dir von Anfang an gesagt, aber du wolltest ja nicht hören. Sie hätte nie geboren werden sollen, Mae, aber du musstest unbedingt deinen Kopf durchsetzen.“
„Meinst du etwa, ich wollte schwanger werden? Meinst du, ich hätte das geplant?“
„Ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Besonders, als ich dir einen Ausweg anbot und du nicht wolltest. Der Arzt, zu dem ich dich schickte, hätte das erledigt. Er hätte dir …“
„Das konnte ich nicht. Wie konntest du von mir verlangen, dass ich mein ungeborenes Kind töte? Verstehst du denn nicht? Das ist eine Todsünde!“
„Du bist zu oft in der Kirche gewesen“, sagte er spöttisch. „Hast du noch nie daran gedacht, dass du deine jetzigen Probleme nicht hättest, wenn du das Balg losgeworden wärst? Es wäre so einfach gewesen. Aber du bist fortgerannt.“
„Ja, ich wollte sie!“ Mamas Stimme brach. „Sie war ein Stück von dir, Alex, und auch von mir. Ich wollte sie, auch wenn du sie nicht …“
„Ist das der einzige Grund?“
„Du tust mir weh, Alex!“
Irgendetwas klirrte. Sarah zuckte zusammen. „Ist das der einzige Grund, Mae? Hast du sie nicht vielleicht gekriegt, um mich besser unter Druck setzen zu können?“
„Das glaubst du doch selbst nicht!“ Jetzt weinte Mama. „Du bist so … so selbstsüchtig! Alles hab ich für dich aufgegeben – meine Familie, meine Freunde, meine Selbstachtung, alles, woran ich geglaubt habe, jede Hoffnung, die ich je hatte …“
„Ich habe dir dieses Haus gekauft und auch sonst alles, was du brauchst.“
Mamas Stimme wurde merkwürdig schrill. „Weißt du überhaupt, wie das ist, wenn ich durch die Straßen gehe? Du kommst und gehst, wann du willst, und die Leute wissen, wer du bist, und sie wissen, was ich bin. Keiner schaut mich an, keiner spricht mit mir. Sarah merkt es auch. Einmal hat sie mich danach gefragt, und ich habe ihr gesagt: Wir sind anders als die anderen Leute. Ich wusste nicht, was ich ihr sonst sagen sollte.“ Sie schluchzte auf. „Ich kann das nicht mehr!“
„Ich habe genug von deinem schlechten Gewissen und von diesem Balg! Es ruiniert alles, was wir hatten. Erinnerst du dich nicht mehr, wie glücklich wir waren? Wir haben uns nie gestritten, und ich konnte es gar nicht erwarten, bei dir zu sein. Und jetzt ist das alles dahin wegen dem Gör!“
Mama schrie ein schlimmes Wort. Dann kam ein Krachen. Voller Angst sprang Sarah auf und rannte los. Sie rannte durch Mamas Blumen und über das Gras und auf den Weg zum Wasserhaus. Sie rannte, bis sie nicht mehr konnte. Keuchend und mit Seitenstichen sank sie in das hohe Gras und schluchzte so sehr, dass es sie schüttelte.
Sie hörte, wie ein Pferd herangaloppierte, und als sie aufblickte, sah sie, wie ihr Vater auf seinem großen Rappen vorbeipreschte. Sie duckte sich wieder ins Gras und wartete, dass Mama kam und sie holte.
Aber Mama kam nicht, und sie rief auch nicht. Nach einer Weile ging Sarah zu dem Wasserhaus zurück, setzte sich unter die blühenden Ranken und wartete weiter. Als Mama endlich kam, hatte Sarah ihre Tränen getrocknet, aber sie zitterte immer noch von dem, was sie gehört hatte.
Mama war ganz blass, ihre Augen rot gerändert. Auf der einen Wange war ein großer blauer Fleck, den sie mit Puder zu überdecken versucht hatte. Sie lächelte, aber es war nicht ihr richtiges Lächeln. „Wo bist du denn gewesen, Spatz? Ich habe dich überall gesucht!“
Sarah wusste, dass das nicht stimmte; sie hatte ja nach ihr Ausschau gehalten. Mama befeuchtete ihr Spitzentaschentuch mit der Zunge und wischte einen Schmutzfleck von Sarahs Wange. „Dein Vater musste ganz plötzlich wieder weg.“
Sarah wollte diesen Mann nie mehr sehen. Er hatte Mama wehgetan und sie zum Weinen gebracht.
„Es ist alles gut, Schätzchen. Weißt du, was wir beide jetzt machen? Wir gehen zurück und ziehen uns um, und dann packen wir ein Picknick ein und gehen zum Bach. Möchtest du das?“
Sarah nickte und legte die Arme um Mamas Hals. Mama hielt sie ganz fest, ihr Gesicht in ihrem Haar vergraben. „Wir schaffen das, Schätzchen, wirst schon sehen. Wir beide schaffen das, bestimmt!“
Alex kam nicht wieder, und Mama wurde dünn und blass. Sie blieb morgens lange im Bett, und wenn sie dann aufstand, machte sie nicht mehr ihre üblichen Spaziergänge. Wenn sie lächelte, leuchteten ihre Augen nicht auf. Cleo sagte, sie müsse mehr essen. Cleo sagte vieles, oft unbedacht, wenn Sarah es hören konnte.
„Er schickt Ihnen nach wie vor Geld, Miss Mae. Das ist doch etwas.“
„Das Geld ist mir egal.“ Mamas Augen füllten sich mit Tränen. „Es war mir immer egal.“
„Wenn Sie keines mehr hätten, wäre es Ihnen nicht egal.“
Sarah versuchte, Mama aufzumuntern, indem sie ihr große Blumensträuße pflückte. Mama lächelte dann immer und dankte ihr, aber es war kein Funkeln in ihren Augen. Sarah sang auch die Lieder, die sie von Mama gelernt hatte – traurige irische Balladen und ein paar lateinische Gesänge aus der Messe.
„Mama, warum singst du gar nicht mehr?“ Sarah kletterte auf das Bett ihrer Mutter.
Mama kämmte langsam ihr langes blondes Haar. „Mir ist jetzt nicht nach Singen, Spatz. Mama muss gerade viel nachdenken.“
Sarahs Herz wurde schwerer. Das war alles ihre Schuld. Wenn sie nicht geboren worden wäre, ginge es Mama jetzt gut. „Kommt Alex wieder, Mama?“
Mama sah sie überrascht an. Vielleicht dachte sie, dass Sarah ihn gern wiedersehen wollte. Aber das stimmte nicht. Überhaupt nicht! Seit er da gewesen war, war Mama so traurig und langweilig geworden. Sarah hatte sogar gehört, wie sie zu Cleo sagte, dass Liebe kein Segen war, sondern ein Fluch.
Sie warf einen Blick auf Mamas Gesicht. Sie schien mit ihren Gedanken wieder weit weg zu sein. Natürlich: Sie dachte wieder an ihn. Sie wollte, dass er wiederkam, und nachts weinte sie, weil er es nicht tat. Sie presste ihr Gesicht dabei in das Kissen, aber Sarah hörte ihr Schluchzen trotzdem.
Sarah senkte den Kopf. „Was wäre, wenn ich krank werden und sterben würde, Mama?“
„Du wirst nicht krank“, sagte Mama und schaute kurz zu ihr hin. „Du bist viel zu jung und gesund, um zu sterben.“
Sarah schaute ihr zu, wie sie ihr Haar kämmte. Wie goldener Sonnenschein floss es um ihre blassen Schultern. Mama war so schön; wie konnte Alex sie nicht lieben? „Aber wenn ich tot wäre, Mama, würde Alex dann zurückkommen und bei dir bleiben?“
Mama drehte sich zu Sarah hin. Ihre weit aufgerissenen Augen erschreckten das Mädchen. „So etwas darfst du nicht denken, Sarah!“
Noch nie hatte Mama so heftig zu ihr gesprochen. Sarah spürte, wie ihr Kinn zu zittern begann. „Ja, Mama.“
„Sag das nie wieder“, fuhr ihre Mutter fort, jetzt leiser. „Versprich mir das. Das hat doch alles nichts mit dir zu tun.“ Sie zog Sarah in ihre Arme und streichelte sie sanft. „Ich liebe dich, Sarah, ich liebe dich mehr als alles andere auf der ganzen Welt.“
Außer ihm, dachte Sarah. Außer Alex Stafford. Was, wenn er wiederkam? Was, wenn er Mama vor die Wahl stellte? Was würde Mama dann tun?
Voller Angst kuschelte Sarah sich an ihre Mutter und betete, dass er nie mehr kommen würde.
Ein junger Mann kam Mama besuchen. Sarah saß mit ihrer Puppe neben dem Kamin und schaute zu, wie ihre Mutter mit ihm sprach. Die einzigen Menschen, die sonst ins Haus kamen, waren Mr Pennyrod, der Feuerholz brachte, und Bob. Bob mochte Cleo. Er war Metzger und neckte Cleo immer mit „Hinterschinken“ und „saftigen Keulen“. Cleo lachte dann, aber Sarah fand es nicht lustig. Er trug immer eine weiße Schürze mit Blutflecken drauf.
Der junge Mann gab Mama einen Brief, aber sie öffnete ihn nicht. Sie servierte ihm Tee, und er sagte „Danke schön“. Danach sagte er nicht mehr viel, außer dass es nach Regen aussehe und dass Mamas Garten schön sei. Er sagte auch, dass der Weg von der Stadt weit war. Mama stellte ihm Plätzchen hin; sie schien Sarah ganz vergessen zu haben.
Sarah spürte, dass etwas nicht stimmte. Mama saß zu aufrecht da und sprach sehr leise. „Ein hübsches Kind, die Kleine“, sagte der Mann und lächelte Sarah zu. Sie schaute verlegen nach unten. Würde Mama sie jetzt wieder nach draußen schicken?
„Ja, das stimmt, danke.“
„Sie sieht Ihnen sehr ähnlich. Schön wie ein Sonnenaufgang.“
Mama lächelte ihr zu. „Sarah, warum gehst du nicht nach draußen und holst ein paar Blumen für den Tisch?“
Sarah nahm ihre Puppe und ging gehorsam nach draußen. Sie wollte ein gutes Mädchen sein. Am liebsten mochte Mama Rosen. Sarah pflückte auch Rittersporn, Levkojen, Hahnenfuß, Margeriten und Gänseblümchen, bis der Korb an ihrem Arm voll war.
Als sie wieder ins Haus kam, war der junge Mann nicht mehr da, und der Brief lag offen auf Mamas Schoß. Ihre Augen glänzten, ihre Wangen waren gerötet. Sie faltete den Brief lächelnd zusammen und schob ihn in ihren Ärmel. Dann stand sie auf, hob Sarah hoch und ließ sie fröhlich hin- und herschaukeln. „Danke für die schönen Blumen, Spatz.“ Sie küsste sie und stellte sie wieder auf ihre Füße.
„Wie ich Blumen liebe“, sagte Mama. „Sie sind so schön, nicht wahr? Stell sie doch bitte ins Wasser; ich muss etwas holen. Was für ein herrlicher Tag heute, Sarah!“
Sarah schaute ihr hinterher. Nein, der Tag war nicht schön, er war mies und Sarah war schlecht vor Angst. Sie holte die große Vase und füllte sie mit frischem Wasser. Die Blumen schnitt sie nicht an und entfernte auch keine Blätter; Mama würde es sowieso nicht merken, nicht heute.
Alex Stafford würde wiederkommen.
Mama kam mit Cleo zurück ins Wohnzimmer. „Spatz, ich hab eine tolle Überraschung für dich. Cleo fährt diese Woche an die See und möchte dich mitnehmen. Ist das nicht schön?“
Sarahs Herz begann zu rasen.
„Ist das nicht lieb von ihr?“, fuhr Mama fort. „Sie hat dort einen Freund, dem ein Gasthaus gehört, der mag kleine Mädchen.“
Cleos Lächeln war merkwürdig steif. Sarah sah ihre Mutter an. „Aber ich will nicht mitfahren, Mama. Ich will bei dir bleiben.“ Sie wusste, was hier geschah: Mama schickte sie weg, weil ihr Vater sie nicht wollte! Vielleicht wollte Mama sie jetzt auch nicht mehr?
„Unsinn“, lachte Mama. „Du musst mal was von der weiten Welt sehen. Das Meer wird dir gefallen, Sarah, es ist so schön dort. Da kannst du im Sand spielen und den Wellen zuhören. Und Burgen bauen und Muscheln sammeln. Warte nur, wie lustig das ist, wenn der Schaum deine Zehen kitzelt.“
Mama sah wieder richtig lebendig aus. Wie ihr Gesicht leuchtete! Sarah sank das Herz.
„Komm, Spatz, wir packen deine Sachen.“
Sarah schaute zu, wie sie ihre Sachen in einer Tasche verstaute. Mama schien es gar nicht abwarten zu können, sie loszuwerden.
Cleo hob Sarah in die Kutsche, dann stieg sie selbst hinein. Sie setzte sich dem Mädchen gegenüber und lächelte breit, die braunen Augen hell. „Das wird ein richtiges Abenteuer, Sarah.“
Sarah wäre am liebsten von der Kutsche gesprungen und zurück zu Mama gelaufen, aber die hätte sie nur wieder weggeschickt. Der Kutscher sagte „Hopp!“ und fuhr los. Sarahs Gesicht klebte am Fenster, hinter dem die vertrauten Häuser viel zu schnell vorbeiglitten. Bald sah alles unbekannt aus, und Sarah ließ sich zurück auf die harte Bank sinken. Je weiter sie kamen, desto verlorener fühlte sie sich.
„Wir übernachten in den Vier Winden“, sagte Cleo, die sichtlich erleichtert war, dass Sarah brav war. Immerhin war sie noch nie länger als ein paar Stunden von ihrer Mutter fort gewesen. Sie saß starr und feierlich da.
„Es gibt da leckeres Essen und schöne Zimmer“, fuhr Cleo fort. „Und ganz nah am Meer werden wir auch sein. Wenn du einen schmalen Grasweg entlanggehst, kommst du zu den Klippen, wo die Brandung gegen die Felsen donnert. Das klingt toll. Und dann der salzige Geruch in der Luft – es gibt nichts Schöneres.“
Nichts Schöneres? Und das Häuschen und der Blumengarten dahinter? Sarah kämpfte ihre Tränen nieder und schaute wieder zum Fenster hinaus. Der aufgewirbelte Staub der Straße kratzte ihr in Augen und Hals.
Langsam gingen die Stunden dahin; Sarahs Kopf begann zu schmerzen. Sie war so müde, dass sie kaum die Augen offen halten konnte, aber jedes Mal, wenn sie sie schloss, schwankte und schlingerte die Kutsche, sodass sie wieder wach wurde.
Einmal hielt der Kutscher an, um die Pferde zu wechseln und etwas an der Kutsche zu reparieren. Cleo und sie gingen zur Toilette. Die Frau des Stationsvorstehers stand in der Tür und trocknete sich die Hände ab. Sie lächelte Sarah an. „Na, so ein hübsches Mädchen! Du bist doch sicher hungrig? Du hast genug Zeit für einen Teller Eintopf.“
Sarah senkte scheu ihren Blick. „Nein, danke, Madam.“
Cleo setzte sich vor einen Bierkrug. „Du musst was essen, bevor wir weiterfahren. Der Kutscher hat gesagt, es kann noch eine halbe Stunde dauern. Bis zur Küste sind es noch drei oder vier Stunden, und ich will nicht, dass du dann plärrst, weil du Hunger hast. Dies ist deine letzte Chance vor den Vier Winden, was zwischen die Rippen zu kriegen.“
Sarah starrte sie an. Jetzt nur nicht weinen. Cleo holte tief Luft, dann strich sie ihr unbeholfen über das Haar. „Iss einfach was, Sarah.“ Sarah nahm gehorsam ihren Löffel und fing an.
Als sie weiterfuhren, war Sarah sehr still. Sie saß am Fenster und schaute hinaus, die Hände im Schoß gefaltet, den Rücken gerade. Cleo schien dankbar für die Ruhe zu sein, sie nickte ein.
Als sie wieder aufwachte, lächelte sie Sarah an. „Riechst du das Meer?“, fragte sie, doch Sarah zuckte nur die Achseln.
Sie erreichten die Vier Winde kurz nach Sonnenuntergang. Sarah klammerte sich an Cleos Hand, während der Kutscher ihre Taschen losband. Sie zuckte erschrocken zusammen. Was war das für ein fernes Brüllen, wie von einem Ungeheuer? „Was ist das, Cleo?“
„Das ist das Meer, das gegen die Felsen donnert. Toll, nicht?“
Sarah fand, dass es das schrecklichste, bedrohlichste Geräusch war, das sie je gehört hatte. Der Wind heulte in den Bäumen wie ein hungriger Wolf, und als die Tür zu den Vier Winden aufging, schallten lautes Lachen und raue Männerstimmen heraus. Sarah schrak zurück. Da wollte sie nicht hinein!
„Nun geh doch.“ Cleo schob sie nach vorn. „Nimm deine Tasche, ich muss mich um meine kümmern.“
Sarah schleifte ihre Tasche zur Tür, Cleo stieß sie mit der Schulter auf und ging hinein, dicht gefolgt von dem Mädchen. Cleos Augen wanderten durch den Raum, dann begann sie zu lächeln. Sarah folgte ihrem Blick und sah, dass sich an der Theke ein bärtiger Mann und ein kräftiger Matrose im Armdrücken maßen. Der Bärtige drehte seinen Kopf etwas, und der Matrose, der die Sekunde Ablenkung sofort nutzte, drückte mit einem Triumphschrei seinen Arm auf die Theke. Verschreckt sah Sarah, wie der Verlierer auf die Füße sprang und dem Matrosen einen Boxhieb verpasste, sodass der krachend zu Boden ging.
Cleo lachte auf. Sarah, die sich hinter ihren Rock geflüchtet hatte, sah zu, wie der Mann von der Theke sich einen Weg zu Cleo bahnte und ihr zu den Anfeuerungsrufen der anderen Männer einen Kuss auf die Wange drückte. Dann fiel sein Blick auf Sarah, die vor Angst am liebsten gestorben wäre. Seine Augenbrauen hoben sich. „’ne Errungenschaft von dir? Muss ja ein hübscher Kerl gewesen sein!“
Es dauerte einen Augenblick, bis Cleo begriff, wovon er redete. „Nein, Merrick, Quatsch! Die gehört nicht zu mir. Das ist die Tochter der Dame, für die ich arbeite.“
„Und was macht sie hier?“
„Das ist eine lange, traurige Geschichte, lassen wir das jetzt mal.“
Merrick nickte und gab ihr einen Klaps auf die Wange. „Na, wie schmeckt dir das Landleben?“ Er lächelte, aber es war kein schönes Lächeln. Eher eine Grimasse.
Noch nie hatte Sarah jemanden wie Merrick gesehen. Er war unheimlich groß und hatte schwarzes Haar und einen gestutzten schwarzen Bart. Sie musste an die Seeräubergeschichten denken, die Mama ihr manchmal erzählte. Merricks Stimme war laut und tief, und er sah Cleo an, als wollte er sie aufessen. Cleo schien das nicht zu stören. Ohne weiter auf Sarah zu achten ging sie durch die Gaststube. Sarah beeilte sich, ihr zu folgen. Wie die sie alle ansahen!
„He, Stump, ein Bier für unsere Cleo!“, rief Merrick dem grauhaarigen Wirt zu, der Cleo augenzwinkernd begrüßte. Dann hob er Sarah hoch und setzte sie auf die Theke. „Einen Wein mit Wasser für das verschreckte Hühnchen hier!“ Er betastete ihre Samtjacke. „Deine Mama ist reich, wie?“
„Ihr Papa ist reich“, sagte Cleo. „Und verheiratet. Aber nicht mit ihrer Mama.“
„Oh!“ Merrick grinste mokant. „So ist das.“ Er hob Sarahs Kinn an und strich über ihre Wange. „Augen wie Veilchen und Haar wie ein Engel. Deine Mama muss eine Schönheit sein. Würd’ sie gern mal kennenlernen.“
Cleo wurde ganz steif und sah wütend aus. Sarah wünschte sich, dass Merrick sie in Ruhe lassen würde, aber er streichelte weiter ihre Wange.
„Lass sie, Merrick, sie hat schon so Angst genug! Das ist das erste Mal, dass sie weg von ihrer Mama ist.“
Er lachte. „Ja, sie sieht ein bisschen weiß um die Kiemen aus. Komm, Kleine, ich tu’ dir nichts. Hier, trink.“ Er schob Sarah den Becher mit dem Wasserwein hin. „Ein tüchtiger Schluck, und du hast vor nichts mehr Angst.“
Sarah kostete und verzog das Gesicht. Er lachte wieder. „Ist was Besseres gewöhnt, wie?“
„Sie ist gar nichts gewöhnt“, sagte Cleo. Jetzt klang sie wirklich ärgerlich. „Jetzt komm, Kind, du musst keine Angst haben, er will nur spielen.“
Der alte Stump und die anderen an der Theke lachten, auch Merrick. Jedes Mal, wenn die Becher leer waren, bestellte er neue. Er riss Witze, und Cleo lachte viel. Ihre Stimme klang komisch, so als ob die Worte alle zusammenliefen.
Draußen regnete es inzwischen, Zweige kratzten an den Fensterscheiben. Sarah war so müde, dass ihr die Augen zufallen wollten.
Merrick hob wieder seinen Becher. „Zieht die Ruder ein, die Kleine. Lass uns raufgehen, da können wir uns besser darüber unterhalten, warum du zurückgekommen bist.“
„Und was soll ich mit dem Kind machen?“
Tränen stachen in Sarahs Augen, ein dicker Kloß stieg in ihre Kehle. Wollte sie denn keiner mehr?
„Das hübsche kleine Ding könnte man doch bestimmt jemandem vererben, oder?“
„Das hab ich Mae auch schon gesagt, aber sie will das nicht. Das Einzige, was sie hat, wenn ihr Kavalier nicht da ist, ist dieses Kind. Hübsch aussehen und die Blumen gießen – das ist so ziemlich alles, was Mae kann.“ Sie berührte sachte Sarahs Schulter. „Komm, wir gehen jetzt ins Bett. Sag Mr Merrick gute Nacht.“
Merrick grinste. „Ich bring die Damen nach oben.“
Als Cleo die Tür ihres früheren Zimmers öffnete, hielt Merrick sie offen und kam ebenfalls hinein. Sarah sah Cleo ängstlich an.
„Was soll das?“, zischte Cleo. „Du kannst hier nicht rein. Sie erzählt das ihrer Mutter, und dann bin ich meine Stelle los.“
„Da weiß ich was gegen.“ Merrick beugte sich hinunter und kniff Sarah ins Kinn. „Wenn du einer Menschenseele sagst, dass ich mit Cleo hier im Zimmer war, dann schneid’ ich dir deine kleine rosa Zunge ab, klar?“ Sarah nickte, stumm vor Angst. Er grinste und ließ sie los. Sie rannte in die Ecke und duckte sich zitternd an die Wand. Ihr war schlecht. „Siehst du?“, kicherte Merrick. „Problem gelöst. Die hält dicht.“
Cleo starrte ihn an. Würde sie ihm jetzt endlich sagen, er solle gehen? „Das war gerade echt grausam“, sagte sie. Dann zu Sarah: „Er hat’s nicht so gemeint, Spatz, das war nur ein Spaß. Glaub ihm kein Wort.“
„Glaub’s lieber doch, Mädchen!“ Er zog Cleo an sich. Sie schob ihn weg, aber ihr Widerstand schien nur halbherzig.
„Ich kenn’ dich, Cleo.“ Merricks Augen glänzten. „Warum hast du dich wohl in die Kutsche gesetzt und bist hergekommen? Nur, um das Meer wiederzusehen?“ Jetzt hatte Merrick sie gepackt und küsste sie.
Cleo versuchte sich loszureißen, aber er hielt sie fest. „Merrick, nicht! Sie guckt doch zu.“
„Na und?“ Er lachte. „Wusste gar nicht, dass du so viel Pflichtgefühl hast.“ Er ließ sie los, aber Sarah fand, dass Cleo gar nicht froh aussah, sondern eher, als ob sie gleich losweinen würde. Merrick grinste und drehte sich zu Sarah um. „Komm, Kleine.“
Sarah wich zurück. „Was hast du vor, Merrick?“, fragte Cleo.
„Ich tu sie raus. Es schadet ihr nicht, wenn sie ein bisschen im Flur sitzt. Und sag jetzt nicht Nein. Ich schick sie ja nur vor die Tür, da tut ihr keiner was.“ Er zog eine Decke und ein Kissen vom Bett und bedeutete Sarah, ihm zu folgen. „Oder muss ich dich holen?“
Sarah folgte ihm zitternd in den Flur, wo er die Decke und das Kissen in eine Ecke warf. Ein Schatten huschte vor ihnen weg.
„Du hockst dich hierhin und machst keinen Mucks, klar? Wenn du nicht hierbleibst oder herumschreist, hol ich dich und werf dich ins Meer, wo dich die Krabben fressen. Hast du verstanden?“
Sarahs Mund war zu trocken, um zu antworten. Sie nickte stumm.
Cleo kam zur Tür. „Merrick, da draußen können wir sie nicht lassen, ich hab gerade eine Ratte gesehen.“
„Die tun ihr nichts, keine Bange.“ Er tätschelte Sarahs Wange. „Du bleibst hier, bis Cleo dich holt. Rühr dich nicht vom Fleck.“
„J-ja, Sir“, stotterte sie.
Er richtete sich auf, drehte Cleo um und schob sie in das Zimmer zurück. Die Tür schloss sich hinter ihnen. Sarah hörte, wie Merrick redete und Cleo kicherte. Dann hörte sie andere, ganz komische Geräusche. Am liebsten wäre sie fortgerannt, aber sie erinnerte sich an Merricks Worte. Voller Angst zog sie sich die schmutzige Decke über die Ohren und presste die Hände dagegen.
Es wurde still in dem Zimmer. Sarah schaute angestrengt in das Dunkel des Gangs. Sie spürte, dass irgendwo Augen waren, die sie beobachteten. Was, wenn die Ratte zurückkam? Sie starrte weiter in die Dunkelheit, voller Angst vor dem, was da lauerte.
Die Tür klickte auf, und sie fuhr zusammen. Merrick kam heraus. Sie machte sich noch kleiner; hoffentlich sah er sie nicht! Aber er schien vergessen zu haben, dass es sie gab. Ohne auch nur einen Blick in ihre Richtung zu werfen ging er den Flur entlang und die Treppe hinab. Sicher würde Cleo sie gleich holen …
Minuten vergingen, eine Stunde, noch eine. Cleo kam nicht. Sarah rollte sich in die Decke, drückte sich gegen die Wand und wartete – wie sie auf Mama gewartet hatte, an dem Tag, an dem Alex gekommen war.
Cleos Schädel brummte, als die Sonne auf ihrem Gesicht sie weckte. Ihre Zunge war belegt von dem vielen Bier, das sie am Abend getrunken hatte. Ihre Hand tastete zur Seite, aber Merrick war nicht mehr da. Typisch. Sie weigerte sich, sich darüber zu ärgern. Oh, sie brauchte einen Kaffee. Sie erhob sich, wusch sich das Gesicht und zog sich an. Als sie die Tür öffnete, sah sie das Kind in dem kalten Flur kauern, dunkle Schatten um die blauen Augen.
„Oh!“, sagte Cleo schwach. Die Kleine hatte sie ja ganz vergessen! Das schlechte Gewissen kam wie eine wütende Welle. Was, wenn Mae herausbekam, dass sie ihre Tochter eine ganze Nacht in einem kalten, dunklen Gang alleingelassen hatte? Sie hob das Mädchen hoch und trug es in das Zimmer. Sarahs Hände fühlten sich an wie Eis, und sie war totenblass.
„Sag deiner Mama bloß nichts davon.“ Cleo schluchzte es fast. „Sonst schickt sie mich fort, und dann war es deine Schuld.“
Sarah weinte. „Sei nicht böse, Cleo, sei doch nicht böse, bitte.“ Ihre Augen waren rot gerändert. „Und sag Merrick nichts, bitte! Sonst wirft er mich ins Meer und die Krabben fressen mich!“
„Psst! Hör auf zu weinen“, sagte Cleo, jetzt wieder ruhiger. „Weinen nützt nichts. Hat es deiner Mama je was genützt?“ Sie zog Sarah reumütig in ihre Arme und hielt sie fest. „Wir erzählen das niemandem, das bleibt unter uns, ja?“
Merrick kam nicht zurück in die Vier Winde, und am nächsten Abend betrank Cleo sich. Sie brachte Sarah zeitig ins Bett und ging zurück an die Theke. Sicher würde er noch kommen? Aber er kam nicht. Sie blieb noch etwas, lachte mit anderen Männern, tat so, als sei alles in Ordnung. Dann ging sie zurück nach oben, eine Flasche Rum in der Hand. Sarah saß im Bett, hellwach, die Augen riesengroß.
Cleo brauchte jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. „Ich werde dir jetzt die heilige Wahrheit sagen, kleines Mädchen. Hör mir gut zu.“ Sie nahm einen langen Schluck, spülte die Tränen und das Elend hinunter, ließ die Wut und die Bitterkeit frei fließen. „Die Männer wollen uns alle nur ausnutzen. Wenn du ihnen dein Herz schenkst, reißen sie es in Fetzen.“ Sie trank wieder. Ihre Stimme wurde undeutlicher. „Denen sind wir doch alle egal. Nimm nur deinen feinen Papa. Hat er ein Herz für deine Mama? Nein.“
Sarah vergrub sich tiefer in die Bettdecken und stopfte sich die Finger in die Ohren. Cleo riss ihr die Decken weg, ihre Augen funkelten. „Guck mich an!“
Sarah gehorchte. In ihren Augen stand die nackte Angst geschrieben und sie zitterte wie Espenlaub. „Deine Mama hat mir befohlen, gut auf dich aufzupassen, und das werde ich machen. Ich werde dir die Wahrheit sagen, die heilige Wahrheit. Hör zu, damit du was fürs Leben lernst!“ Sie ließ sie los und Sarah saß stocksteif da.
Cleo ließ sich in den Sessel fallen und nahm den nächsten Schluck Rum. „Dein feiner Herr Papa kümmert sich um niemanden, schon gar nicht um dich. Er kommt, wenn er Lust hat, bedient sich bei ihr und reitet zurück zu seinem schönen Haus in der Stadt mit der vornehmen Frau und den wohlerzogenen Kindern. Und deine Mutter? Sie lebt nur für seinen nächsten Besuch.“
Cleo lachte traurig auf und schüttelte den Kopf. „Sie ist so dumm, deine Mutter. Wartet auf ihn und küsst ihm schier die Füße, wenn er wiederkommt. Aber früher oder später wird er ihrer überdrüssig werden und sie wegwerfen. Und dich dazu. Worauf du dich verlassen kannst.“
Sarah weinte jetzt.
„Den Menschen ist doch alles egal“, sagte Cleo. Sie fühlte sich mit jeder Sekunde elender. „Einer nutzt den anderen aus, das machen wir doch alle so. Damit wir uns wohlfühlen. Oder schlecht. Oder gar nichts fühlen. Diejenigen, die das draufhaben, das sind die Glückspilze. Wie Merrick oder wie dein reicher Papa. Wir anderen müssen zusehen, wo wir bleiben.“
Cleo wollte weiterreden, aber ihre Augenlider waren so schwer, dass sie sie nicht offen halten konnte. Sarah schaute zu, wie Cleo vor sich hinmurmelnd immer tiefer in den Sessel sank.
Sarah zitterte wie Espenlaub. Hatte Cleo etwa recht? Sie durfte nicht recht haben! Aber tief, tief drinnen sagte ihr eine Stimme, dass es stimmte. Wie konnte Sarahs Vater sie liebhaben, wenn er ihr den Tod gewünscht hatte? Oder ihre Mutter, wenn sie sie wegschickte?
Die heilige Wahrheit. Was war die heilige Wahrheit?
Am nächsten Morgen fuhren sie zurück. Das Meer hatte Sarah kein einziges Mal gesehen.
Als sie zu Hause ankamen, tat Mama so, als ob alles in bester Ordnung sei. Aber Sarah spürte, dass das nicht stimmte. In der Diele standen Kisten und Mama war dabei zu packen.
„Wir fahren zu deinen Großeltern.“ Mamas Stimme sollte fröhlich klingen, aber ihre Augen waren wie tot. „Sie haben dich ja noch nie gesehen.“ Zu Cleo sagte sie, dass es ihr leidtäte, sie entlassen zu müssen, aber Cleo meinte, das sei schon in Ordnung. Sie hatte beschlossen, Bob, den Metzger, zu heiraten. Mama sagte, sie hoffe, dass Cleo mit ihm glücklich werden würde, und Cleo ging.
Mitten in der Nacht wachte Sarah auf. Mama war nicht im Bett, aber sie konnte sie hören. Dem Klang ihrer Stimme folgend, ging sie ins Wohnzimmer. Das Fenster stand offen. Was machte Mama da draußen, so spät in der Nacht?
Da sah sie sie im milchigen Mondlicht. Sie kniete in ihrem dünnen Nachthemd auf der Erde und riss die Blumen heraus, eine nach der anderen, schleuderte sie in alle Richtungen und weinte und redete die ganze Zeit vor sich hin. Jetzt nahm sie ein Messer in die Hand, ging zu ihren geliebten Rosensträuchern und schnitt die Pflanzen an der Wurzel ab, eine nach der anderen.
Danach beugte sie sich nach vorne und schluchzte und schluchzte, hin- und herschaukelnd wie ein mutterloses Kind, das Messer noch in der Hand.
Sarah sank auf den Fußboden des dunklen Zimmers und umklammerte sich mit ihren eigenen Armen.
Den ganzen nächsten Tag fuhren sie in einer Kutsche. Die Nacht verbrachten sie in einer Herberge. Mama sagte kaum etwas, und Sarah drückte ihre Puppe fest an ihre Brust. In dem Zimmer war nur ein Bett, und Sarah schlief zufrieden neben ihrer Mutter. Als sie am Morgen aufwachte, saß Mama am Fenster und betete. Die Perlen des Rosenkranzes glitten durch ihre Finger. Sarah lauschte. Was sagte ihre Mutter da immer und immer wieder?
„Vergib mir, Jesus, ich habe mir das selbst angetan. Mea culpa, mea culpa …“
Nach einem weiteren Tag in der Kutsche kamen sie in eine Stadt. Mama war bleich und angespannt. Sie klopfte den Staub von Sarahs Kleid und rückte ihren Hut gerade. Dann nahm sie Sarahs Hand, und sie gingen los. Nach einer ganzen Weile kamen sie zu einer von Bäumen gesäumten Straße.
Vor einem weißen Zaun hielt Mama an. „Gott, bitte gib, dass sie mir vergeben“, flüsterte sie. „Oh, bitte, Gott, bitte!“
Das Haus hinter dem Zaun war nicht viel größer als ihr Häuschen daheim, aber es hatte eine schöne Veranda vor der Eingangstür, und auf den Fensterbänken standen Blumentöpfe. An allen Fenstern hingen Spitzengardinen. Sarah fand, dass es ein sehr schönes Haus war.
Sie gingen zur Haustür. Mama holte tief Luft und klopfte an. Eine Frau öffnete; sie war klein und grauhaarig und trug ein geblümtes Baumwollkleid und eine weiße Schürze. Sie starrte Mama an, und ihre blauen Augen füllten sich mit Tränen. „Oh“, sagte sie. „Oh, oh …“
„Ich bin nach Hause gekommen, Mutter“, sagte Mama. „Bitte lass mich nach Hause kommen.“
„So einfach ist das nicht ...“
„Ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll.“
Die Frau sah Sarah an. „Das ist dein Mädchen, ja?“ Sie lächelte traurig. „Sie ist sehr hübsch.“
„Bitte, Mama.“
Die Frau öffnete die Tür weiter und ließ sie ein. Sie führte sie in ein kleines Zimmer mit hohen Bücherregalen. „Warte hier, ich rede mit deinem Vater.“
Mama ging durch das Zimmer und rang dabei die Hände. Dann kam die Frau zurück, das Gesicht weiß und zerfurcht, die Wangen nass.
„Nein“, sagte sie.
Nur das eine Wort.
Nein.
Mama machte einen Schritt zur Tür hin. Die Frau hielt sie auf. „Er wird dir nur Dinge sagen, die dir noch mehr wehtun.“
„Wehtun? Wie kann mir etwas noch mehr wehtun, Mama?“
„Mae, bitte, tu es nicht …“
„Ich werde ihn anflehen, auf die Knie gehen werde ich. Ich werde ihm sagen, dass er recht hatte. Oh, er hatte ja so recht!“
„Es wird nichts nützen. Er hat gesagt, für ihn ist seine Tochter tot.“
Mae schob sich an ihr vorbei. „Ich bin nicht tot!“ Die Frau bedeutete Sarah mit einer Geste zu bleiben, dann lief sie hinter Mama her und schloss die Tür hinter sich. Sarah hörte gedämpfte Stimmen.
Nach einer Weile kam Mama zurück. Ihr Gesicht war kreideweiß, aber sie weinte nicht mehr. „Komm, Spatz“, sagte sie tonlos. „Wir gehen.“
„Mae“, sagte die Frau. „Oh, Mae.“ Sie schob ihr etwas in die Hand. „Mehr habe ich nicht.“
Mama antwortete nicht. Aus einem anderen Zimmer kam eine ärgerliche Männerstimme. „Ich muss gehen“, sagte die Frau.
Mama nickte und drehte sich um.
Als sie das Ende der kleinen Allee erreicht hatten, öffnete Mae ihre Hand und betrachtete das Geld, das ihre Mutter hineingelegt hatte. Sie lachte leise und gebrochen auf. Dann nahm sie Sarahs Hand und ging weiter, während ihr die Tränen über die Wangen strömten.
Mama verkaufte ihren Rubinring und ihre Perlen. Sie wohnten in einem Gasthaus, bis das Geld zur Neige ging. Dann verkaufte Mama ihre Spieluhr, und eine Weile wohnten sie ganz gut in einer billigeren Pension. Schließlich bat Mama Sarah, ihr den Kristallschwan zu geben, und mit dem Geld, das sie für ihn bekamen, wohnten sie lange in einem heruntergekommenen Hotel, bis Mama eine Bretterbude am Hafen von New York fand.
Jetzt sah Sarah endlich das Meer. Auf dem Wasser trieb Unrat, aber sie mochte es trotzdem. Manchmal ging sie zum Kai hinunter und sah den Schiffen zu, die mit ihrer Fracht aus fernen Ländern kamen. Sie mochte den salzigen Geschmack in der Luft, sie lauschte dem Schwappen des Wassers gegen die Holzpfosten des Kais und dem Kreischen der Möwen.
Im Hafen gab es raue Männer und Seeleute aus aller Herren Länder. Einige von ihnen besuchten Mama, und dann bat sie Sarah immer, draußen zu warten, bis sie wieder gingen. Sie blieben nie sehr lange. Manchmal kniffen sie Sarah in die Wange und versprachen ihr, wiederzukommen, wenn sie größer wäre. Einige sagten, dass sie noch hübscher sei als Mama, aber Sarah wusste natürlich, dass das nicht stimmte.
Die Männer gefielen ihr nicht. Wenn sie kamen, lachte Mama und tat so, als freue sie sich über ihren Besuch, aber wenn sie dann wieder weg waren, weinte sie und trank Whisky, bis sie auf dem zerknitterten Bett beim Fenster einschlief.
Sarah war jetzt sieben Jahre alt und fragte sich manchmal, ob Cleo nicht vielleicht doch recht gehabt hatte mit ihrer heiligen Wahrheit.
Dann zog Onkel Rab zu ihnen, und das Leben wurde besser. Es kamen nicht mehr so viele Besucher; eigentlich nur noch, wenn keine Münzen mehr in Onkel Rabs Hosentasche klimperten. Er war groß und schwerfällig, und Mama schien ihn zu mögen. Sie schliefen zusammen in dem Bett am Fenster und Sarah in dem kleinen Bett auf dem Fußboden.
„Er ist nicht sehr klug“, sagte Mama ihr. „Aber er hat das Herz auf dem rechten Fleck, und er will für uns sorgen. Aber manchmal kann er das nicht, und dann braucht er Mamas Hilfe. Es sind schwere Zeiten, Spatz.“
Manchmal war Rab einfach danach, draußen vor der Tür zu sitzen, sich zu betrinken und Lieder über die Frauen zu singen. Wenn es regnete, ging er in die Kneipe am Ende der Straße, um mit seinen Freunden zusammen zu sein. Mama trank dann oder schlief, und Sarah vertrieb sich die Zeit damit, alte Dosen aufzusammeln und sie zu säubern, bis sie wie Silber glänzten. Sie stellte sie unter die Löcher im Dach der Hütte, setzte sich hin und lauschte der einförmigen Musik der Regentropfen, die in die Dosen platschten.
Auch das mit dem Weinen hatte Cleo ganz richtig durchschaut: Mit Weinen änderte man gar nichts. Mama weinte und weinte, bis Sarah sich am liebsten die Ohren zugestopft hätte, aber wurde etwas anders dadurch? Nein.
Wenn die anderen Kinder Sarah hänselten und ihr hässliche Namen hinterherriefen, sagte sie nichts. Es stimmte ja, was sie da sagten, man konnte es nicht leugnen. Wenn dann die Tränen in ihr hochstiegen, wie eine unsichtbare, brennend heiße Faust, schluckte sie sie hinunter – immer tiefer, bis sie ein kleiner harter Stein in ihrer Brust wurden. Sie lernte, ihren Peinigern mit einem kalten Verachtungslächeln zu begegnen, als ob sie ihr nichts anhaben könnten. Manchmal bildete sie sich ein, dass es wirklich so war.
In dem Winter, in dem Sarah acht Jahre alt wurde, wurde Mama krank. Sie wollte nicht zum Arzt gehen. „Ich muss mich nur ausruhen.“ Aber ihr Atem ging immer schwerer.
„Pass gut auf mein kleines Mädchen auf, Rab“, sagte sie, und dabei lächelte sie wie in den alten Zeiten.
Sie starb eines Morgens, mit dem ersten Sonnenlicht des Frühlings auf ihrem Gesicht und dem Rosenkranz in ihren Händen. Rab weinte furchtbar. Sarah nicht. Das Gewicht auf ihrer Seele wollte sie fast erdrücken. Als Rab nach draußen ging, legte sie sich neben Mama und schlang ihre Arme um sie.
Wie steif und kalt Mama war. Sarah hätte sie so gerne gewärmt. Ihre Augen fühlten sich heiß und irgendwie krümelig an. Sie schloss sie und flüsterte, immer wieder: „Wach auf, Mama, wach auf, bitte wach auf …“ Aber sie wachte nicht auf, und endlich kamen die Tränen. „Ich will mit dir gehen, nimm mich mit! Lieber Gott, bitte, ich will mit meiner Mama gehen!“
Sie weinte, bis sie vor Erschöpfung einschlief. Sie wurde erst wach, als Rab sie hochhob. Neben ihm standen mehrere Männer.
Die wollten etwas mit Mama machen! Sarah schrie sie an: „Lasst meine Mama in Ruhe!“ Rab hielt sie so fest, dass sie fast keine Luft mehr bekam an seinem übel riechenden Hemd, während die anderen daran gingen, Mama in ein Tuch zu wickeln. Sarah hörte auf zu schreien. Rab ließ sie los, und sie ließ sich auf den Boden plumpsen und saß steif und starr da.
Die Männer unterhielten sich, als sei sie gar nicht da. Vielleicht war sie das auch nicht. „Sie muss mal echt schön gewesen sein“, sagte einer, als er begann, das Leichentuch über Mamas Gesicht zuzunähen.
„Es ist besser für sie, dass sie tot ist“, sagte Rab und begann wieder zu weinen. „Jetzt ist sie wenigstens nicht mehr unglücklich, jetzt ist sie frei.“
Frei, dachte Sarah. Frei von mir! Wenn ich nicht geboren wäre, würde Mama jetzt in einem schönen Häuschen auf dem Land leben, mit vielen bunten Blumen. Sie wäre glücklich. Und lebendig.
„Wartet“, sagte der Mann. Er nahm den Rosenkranz aus Mamas Fingern und ließ ihn in Sarahs Schoß fallen. „Sie hätte bestimmt gewollt, dass du das kriegst, Kleine.“ Er nähte das Tuch fertig zu. Sarah ließ die Perlen durch ihre kalten Finger gleiten und starrte vor sich hin.
Dann gingen sie und trugen Mama fort. Sarah saß lange allein da. Würde Rab wirklich für sie sorgen? Als die Nacht kam und er immer noch nicht zurück war, ging sie hinunter zum Hafen und warf den Rosenkranz ins Wasser. „Zu was bist du denn gut?“, schrie sie zum Himmel hinauf.
Es kam keine Antwort.
Sie erinnerte sich, wie Mama in die große Kirche gegangen war und mit dem schwarz gekleideten Mann gesprochen hatte. Er hatte lange geredet, und Mama hatte mit gesenktem Kopf zugehört; die Tränen waren ihr über die Wangen gelaufen. Sie war nie mehr in die Kirche gegangen, aber manchmal, wenn der Regen gegen das Fenster trommelte, hatte sie die Rosenkranzperlen durch ihre schlanken Finger gleiten lassen.
„Was bringst du mir denn? Sag’s mir!“, schrie Sarah wieder. Ein Matrose, der gerade vorbeiging, sah sie von der Seite her ganz merkwürdig an.
Als Rab zwei Tage später zurückkam, war er so betrunken, dass er nicht mehr wusste, wer Sarah war.
Sie legte eine Decke über ihn und setzte sich neben ihn. „Ist schon gut, Rab, du hast ja noch mich.“ Sie würde nicht so für ihn sorgen können, wie Mama das getan hatte, aber irgendwie würden sie es schon schaffen.
Auf dem Fenster trommelte der Regen. Sarah stellte ihre Dosen auf und zwang sich, nur noch auf die monotone Musik der herabfallenden Tropfen zu hören.
Am Morgen hatte Rab ein schlechtes Gewissen. Er weinte wieder. „Ich muss doch mein Versprechen an Mae halten, sonst findet sie keinen Frieden.“ Er hielt seinen Kopf in den Händen und schaute Sarah aus blutunterlaufenen traurigen Augen an. „Was mach ich bloß mit dir, Kind?“
Er schaute in den Schrank und fand nur eine Dose Bohnen. Er öffnete sie, aß die Hälfte und ließ den Rest für Sarah übrig. „Ich geh ein bisschen nach draußen, ich muss nachdenken. Mit ein paar Freunden reden, vielleicht wissen die was.“
Sarah setzte sich auf das Bett, presste Mamas Kissen an ihr Gesicht und atmete den fernen, tröstenden Duft ihrer Mutter ein. Es war kalt; draußen schneite es. Sie machte Feuer und aß die Bohnen. Bibbernd zog sie eine Decke vom Bett und wickelte sie um sich. Dann setzte sie sich so nah an den Kamin, wie sie konnte.
Draußen ging die Sonne unter. Die Stille klang wie der Tod. Alles in Sarah schien langsamer zu werden. Wenn sie jetzt die Augen schloss und sich fallen ließ, dann konnte sie einfach aufhören zu atmen und sterben, da war sie sicher. Sie versuchte sich darauf zu konzentrieren, aber da hörte sie eine Männerstimme. Es war Rab; er klang ganz aufgeregt.
„Sie gefällt Ihnen bestimmt, ich schwör’s. Ein gutes Mädchen, und hübsch, echt hübsch. Und nicht dumm.“
Sie atmete erleichtert aus, als er die Tür öffnete. Er war nicht betrunken, nur ein wenig angeheitert, die Augen hell und lustig. Zum ersten Mal seit Wochen lächelte er. „Jetzt wird alles gut, Kind“, sagte er.
Hinter ihm trat ein zweiter Mann in den Schuppen. Der Mann war so breit gebaut wie die Schauermänner auf dem Kai, und seine Augen waren hart. Er schaute Sarah an, und sie rutschte instinktiv etwas zurück. „Steh auf“, sagte Rab. „Dieser Herr möchte dich kennenlernen. Er arbeitet für jemanden, der ein kleines Mädchen adoptieren will.“
Sarah wusste nicht, wovon Rab redete, aber sie wusste, dass ihr der Mann, den er da mitgebracht hatte, nicht gefiel. Er kam auf sie zu, und sie versuchte, sich hinter Rab zu verstecken, aber der hielt sie fest. Der Fremde hob ihr Kinn an, drehte ihren Kopf nach rechts und nach links und musterte sie. Als er ihr Kinn wieder losließ, nahm er eine Strähne von ihrem blonden Haar zwischen seine Finger und rieb sie.
„Schön.“ Er lächelte. „Wirklich sehr hübsch. Wird ihm gefallen.“
Ihr Herz hämmerte. Sie sah zu Rab hoch, aber der schien nichts Böses an dem Mann zu finden. „Sie sieht aus wie ihre Mutter“, sagte Rab. Seine Stimme brach.
„Sie ist dürr und dreckig.“
„Wir sind arm“, jammerte Rab.
Der Mann holte ein Bündel Geldscheine aus seiner Hosentasche, zog zwei heraus und hielt sie Rab hin. „Mach sie sauber und besorg ihr was Anständiges anzuziehen, und dann bring sie hierhin.“ Er reichte ihm einen Zettel mit einer Adresse und ging.
Rab stieß einen Freudenschrei aus. „Mädchen, du hast’s geschafft!“ Jetzt grinste er bis über beide Ohren. „Hab’ ich nicht deiner Mama versprochen, dass ich gut für dich sorge?“
Er nahm sie an der Hand und führte sie hinaus. Ein paar Häuserblocks entfernt hielt er vor einem anderen Schuppen an. Eine Frau in einem dünnen Kittel öffnete auf sein Klopfen. Braunes Lockenhaar fiel ihr auf die Schultern. Um ihre haselnussbraunen Augen lagen dunkle Ringe.
„Ich brauch’ deine Hilfe, Stella.“ Rab erklärte ihr alles, und sie runzelte die Stirn und kaute auf ihrer Unterlippe herum.
„Bist du ganz sicher, Rab? Warst du auch bestimmt nicht bloß betrunken? Irgendwie klingt das komisch. Hat er nicht einen Namen genannt oder so?“
„Ich hab ihn nicht gefragt. Aber ich weiß, für wen er arbeitet. Der Mann, der sie adoptieren will, ist reich und ein hohes Tier in der Regierung.“
„Und so jemand sucht sich im Hafenviertel eine Tochter?“
„Das ist nicht meine Sache! Es ist die große Chance für die Kleine, und ich hab’s doch Mae versprochen.“ Neue Tränen zitterten in seiner Stimme.
Stella sah ihn traurig an. „Jetzt wein’ doch nicht, Rab. Ich kümmer’ mich um das Mädchen. Geh einen trinken und komm dann wieder, sie abholen.“
Er ging, und Stella suchte in ihrem Kleiderschrank herum, bis sie etwas Weiches, Rosafarbenes fand. „Bin gleich wieder da“, sagte sie und nahm einen Eimer, um Wasser zu holen. Als sie wiederkam, erwärmte sie das Wasser in einem Topf. „Und jetzt wasch dich gründlich. Ein schmutziges Mädchen will keiner.“
Sarah gehorchte. In ihrem Magen machte sich ein Angstkloß breit.
Stella wusch ihr mit dem Rest des Wassers die Haare. „Du hast das schönste Haar, das ich je gesehen hab’ – golden wie der Sonnenschein. Und so hübsche blaue Augen.“
Die Frau änderte das rosa Hemdblusenkleid für sie ab und band Sarahs Haar mit blauen Bändern zu Zöpfen zusammen. Sarah erinnerte sich daran, dass Mama es auch so gemacht hatte, als sie noch in ihrem Häuschen wohnten. Oder hatte sie das alles nur geträumt?
Stella trug rosa Farbe auf Sarahs kalte Wangen und Lippen auf und massierte sie vorsichtig ein. „Du bist ja so blass. Hab keine Angst. Wer würde schon so einem süßen Mädchen wie dir was Böses tun?“
Als Rab zurückkam, fiel Sarah ihm um den Hals und hielt ihn fest. „Bitte schick mich nicht fort, Rab, bleib bei mir! Du kannst doch mein Vater sein. Du brauchst auch gar nichts zu machen. Ich kann selbst für mich sorgen, und für dich.“
„Wie willst du das anstellen? Du bist viel zu klein, um Geld zu verdienen. Oder willst du etwa stehlen, wie ich? Nein, ich bring dich zu den Reichen, da hast du’s gut. Und jetzt komm.“
Sie gingen lange, es wurde schon dunkel. Sarah hielt Rabs Hand ganz fest. Sie kamen an Kneipen vorbei, aus denen laute Musik und Rufen und Singen kam. Dann kamen Straßen mit großen, schönen Häusern, wie Sarah sie noch nie gesehen hatte. Die erleuchteten Fenster sahen aus wie große Glühaugen, die sie misstrauisch beobachteten. Sie gehörte nicht hierher, und die Fenster wussten das und wollten, dass sie wegging. Sarah hielt zitternd Rabs Hand fest. Der blieb hin und wieder stehen, um Passanten den zerknüllten Zettel mit der Adresse zu zeigen und sie nach dem Weg zu fragen.
Sarahs Beine begannen zu schmerzen, ihr Magen knurrte. Endlich hielt Rab an und sah zu einem großen Haus hoch, das zwischen ebenso prächtigen Nachbarn stand. „Mensch, das ist ja das reinste Schloss!“
Es gab keine Blumen. Nur Stein, kalt und dunkel. Sarah war zu müde, um es zu bemerken; sie setzte sich einfach auf die unterste Treppenstufe und wünschte sich, wieder in dem Schuppen am Hafen zu sein, wo man das Meer roch, wenn die Flut hereinkam.
„Komm, Mädchen, nur noch ein paar Schritte, und du bist zu Hause.“ Rab zog sie hoch. Sie starrte ängstlich den großen Messinglöwenkopf auf der Tür an. Rab packte den Ring in den Zähnen des Löwen und ließ ihn gegen die Tür fallen. „Vornehm“, sagte er.
Ein Mann in einem dunklen Anzug öffnete und musterte Rab abschätzig. Bevor er ihm die Tür vor der Nase zuschlagen konnte, hielt Rab ihm den Zettel hin. Der Mann las ihn, dann öffnete er die Tür so weit, dass sie eintreten konnten. „Hier entlang“, sagte er kühl.
Drinnen war es warm und es roch angenehm. Vor Sarah öffnete sich ein hoher Raum. Auf dem blank polierten Parkettfußboden lag wie ein schöner Traum ein Teppich mit Blumenmuster. Von der Decke glitzerten Lichter wie Diamanten. So etwas Schönes hatte Sarah noch nie in ihrem Leben gesehen. Ob es im Himmel so ähnlich war?
Eine rothaarige Frau mit dunklen Augen und einem roten Mund kam herbei, um sie zu begrüßen. Sie trug ein schönes schwarzes Kleid, über ihren Schultern und dem vollen Busen glitzerten schwarze Perlen. Sie schaute Sarah an, und ihre Stirn legte sich in Falten. Ihre Augen blitzten zu Rab hin, dann sanfter zurück zu Sarah. Sie bückte sich und hielt ihr ihre Hand hin. „Ich bin Sally. Und wie heißt du, Kleine?“
Sarah sah sie stumm an und machte einen Schritt zurück, hinter Rab.
„Sie ist ein bisschen schüchtern“, sagte Rab entschuldigend. „Machen Sie sich nichts draus.“
Die Frau, die Sally hieß, richtete sich wieder auf und sah ihn aus harten Augen an. „Wissen Sie genau, was Sie da tun, Mister?“
„Ja, sicher. Sie wohnen hier in ’nem richtigen Palast, Madam, nicht in so ’nem Loch wie wir.“
„Rechts die Treppe hoch“, sagte die Frau tonlos. „Dann die erste Tür links. Warten Sie da.“ Bevor Rab zwei Schritte gegangen war, hielt sie ihn mit ihrer Hand auf. „Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Hauen Sie ab, jetzt sofort, und nehmen Sie die Kleine wieder mit.“
„Warum denn das?“
„Weil Sie sie sonst nie mehr sehen werden.“
Er zuckte die Achseln. „Mein Kind ist’s sowieso nicht. Ist er hier? Ich meine, der große Mann.“
„Er kommt gleich, und wenn Sie etwas Hirn im Schädel haben, dann halten Sie den Mund.“
Rab steuerte auf die Treppe zu. Sarah wollte zur Tür rennen, aber er hielt ihre Hand fest. Sie drehte sich um und sah, wie die Frau in Schwarz ihnen mit einem schmerzlichen Gesichtsausdruck hinterherschaute.
In dem Zimmer im Obergeschoss war alles groß: die hohe Mahagonikommode, der rote Ziegelkamin, der Schreibtisch aus Teakholz, das Messingbett. In der Ecke stand ein Waschtisch aus weißem Marmor; der Handtuchhalter war aus Messing, das wie echtes Gold aussah, so blank war es poliert. Die Lampenschirme hatten juwelenbesetzte Quasten, die Fenstervorhänge waren blutrot. Sie waren fest zugezogen, sodass niemand hineinschauen konnte. Oder hinaus.
„Setz dich, Kleine.“ Rab strich ihr über den Rücken und wies auf einen Ohrensessel, der genauso aussah wie der, in dem Mama so gerne gesessen hatte, als sie noch das Häuschen hatten. Sarahs Herz begann zu rasen. War das vielleicht derselbe Sessel?
Konnte es sein? Hatte ihr Vater es sich vielleicht anders überlegt? Hatte er die ganze Zeit Mama und sie gesucht und endlich herausgefunden, wo sie war und was geschehen war? Tat ihm all das Böse leid, das er gesagt hatte, und wollte er sie jetzt doch? Eine verzweifelte Hoffnung stieg in ihr hoch, ihr Herz schlug noch schneller.
Rab trat an einen Tisch neben dem Fenster, auf dem mehrere Kristallflaschen standen. „Mensch, das gibt’s ja nicht!“ Seine Finger fuhren begutachtend über die Flaschen. Er zog den Stöpsel aus einer heraus und beroch die bernsteinfarbene Flüssigkeit. „Meine Güte …“ Mit einem Seufzer setzte er die Flasche an seine Lippen. Er kippte die Hälfte des Inhalts hinunter und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. „Nur der Himmel ist schöner.“ Er öffnete eine andere Flasche und goss etwas in die Flasche hinein, aus der er getrunken hatte. Er hielt beide Flaschen hoch, um zu sehen, ob sie wieder gleich voll aussahen, dann stellte er sie vorsichtig wieder hin und verschloss sie.
Dann öffnete er den Schrank und steckte den Kopf hinein. Seine eine Hand schob etwas in die Hosentasche. Er ging zu dem Schreibtisch und inspizierte ihn ebenfalls; weitere Gegenstände landeten in seinen Taschen.
Irgendwo im Haus lachte jemand. Sarahs Augen wurden schwer, sie ließ sich tiefer in den Sessel sinken. Wann kam denn ihr Vater endlich? Rab bediente sich wieder aus einer der Glasflaschen.
„Schmeckt Ihnen mein Brandy?“, erklang eine tiefe, leise Stimme.
Sarah schaute überrascht hoch. Ihr Herz sank. Nein, das war nicht ihr Vater! Es war ein groß gewachsener, dunkler Fremder. Seine Augen glänzten. Noch nie hatte sie ein Gesicht gesehen, das so ebenmäßig war. Und so kalt. Er war ganz in Schwarz gekleidet, auch sein Hut war schwarz. Hinter ihm war der Mann in den Raum gekommen, der sie bei Rab begutachtet hatte.
Rab steckte den Stöpsel in die Kristallkaraffe und stellte sie zurück auf das silberne Tablett. „Hab lang nicht mehr so was Gutes gekriegt“, sagte er. Sarah sah, wie sein Gesicht blasser wurde, als der Fremde ihn durchdringend ansah. Er räusperte sich verlegen und scharrte mit den Füßen.