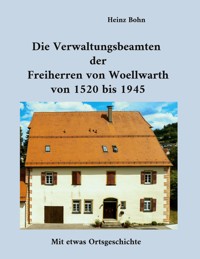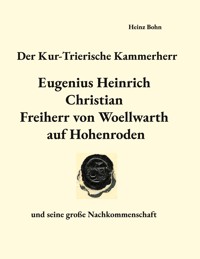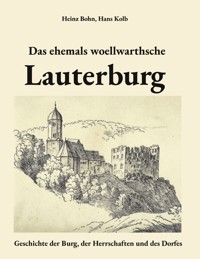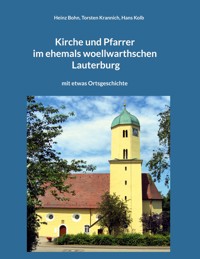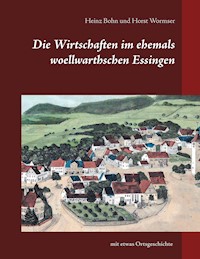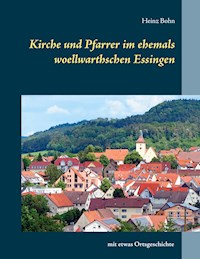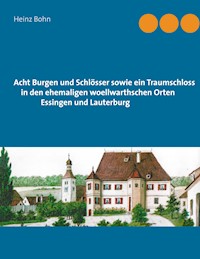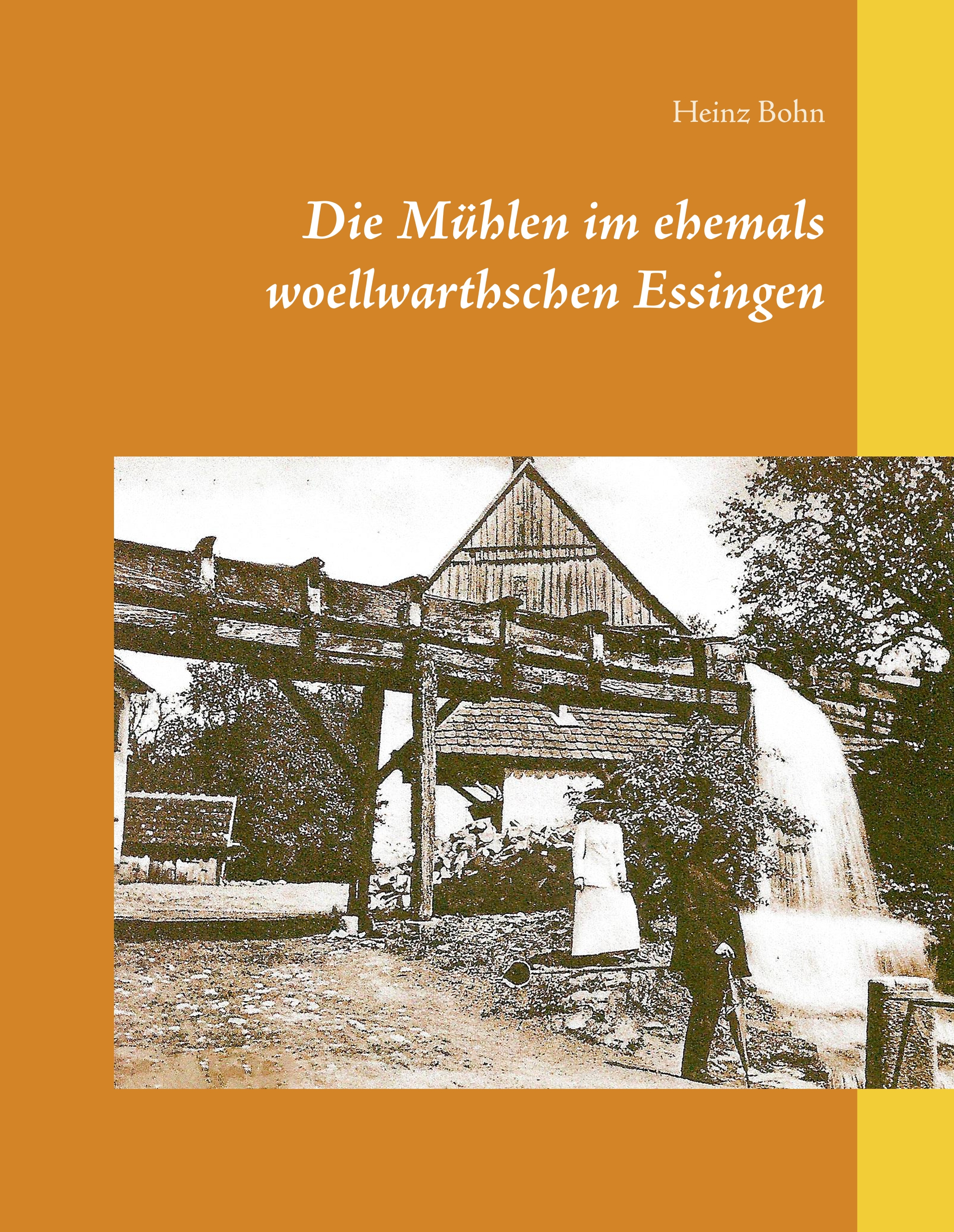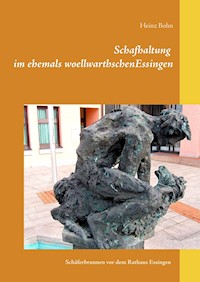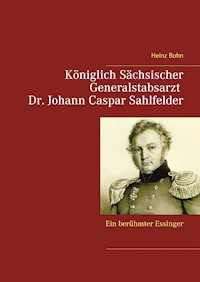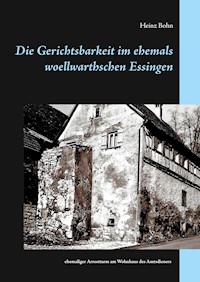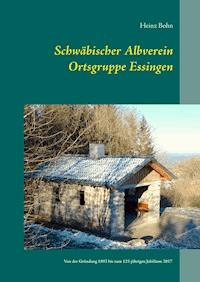Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der ehemaligen Filialkirche "Zu Unserer Lieben Frau" auf dem Friedhof in Essingen ist nur noch der Chor vorhanden; das Kirchenschiff wurde um das Jahr 1830 abgebrochen. Die einfache, einschiffige Saalkirche ohne Turm wurde vor über 600 Jahren auf den Resten einer romanischen Vorgängerkirche erbaut. 1286 stifteten die Herren von Schnaitberg, sie waren dillingsche Ministeriale, eine Kaplanei für diese Kirche. Die beiden Essinger Kirchensätze wurden 1313 von Graf Ludwig V. von Oettingen im Tauschhandel an Abt Rudolf von Ellwangen abgegeben. 1361 übertrug Kaiser Karl V. die Patronats- und Präsentationsrechte der Essinger Hauptkirche im Ort und ihrer Filiale auf dem Berg an das Zisterzienserkloster Kirchheim am Ries. 1479 gingen die Kaplaneipfründe der Filialkirche samt Stiftungsurkunde von Jörg von Schnaitberg zu Löwenstein an Rennwart von Woellwarth; zu diesem Zeitpunkt ist Kaplan Lazarus in der Filialkirche nachzuweisen. 1538 erwarb Georg Heinrich von Woellwarth das Patronat vom Kloster Kirchheim. Dem 1988 gegründeten Essinger Heimat- und Geschichtsverein gelang es, den verbliebenen Chor der früheren Kirche mit Unterstützung und finanzieller Hilfe der Gemeinde Essingen, des Denkmalamtes Baden-Württemberg, der Denkmalstiftung, des Landratsamtes Ostalbkreis sowie der Vereinsmitglieder zu sanieren und vor dem weiteren Verfall zu bewahren. Nachdem sie fast fünf Jahrhunderte unter einer dicken Tüncheschicht verborgen waren, konnten auch die um 1400 entstandenen gotischen Wandmalereien mit erheblichem finanziellem Aufwand wieder freigelegt werden. Sie sind heute von hohem kulturellem und kunsthistorischem Wert. Mit diesem Beitrag wurde neben der Beschreibung des Chors der Versuch unternommen, anhand der aufgefundenen Dokumente das abgebrochene Langhaus zu rekonstruieren. Am 25. April 2009 konnte die Wiedereinweihung des renovierten Chors der früheren Kirche "Zu Unserer Lieben Frau" gefeiert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Marienkirche auf dem Friedhof Essingen
Beschreibung des heute noch vorhandenen Chores.
Abriss des Kirchenschiffes um das Jahr 1830
Kostenvoranschlag über die Reparatur der Kirche
Rekonstruktion des Kirchenschiffes
Rekonstruktion des Innbereiches.
Bestätigung des Rekonstruktionsversuchs
Grundriss der ehemaligen Marienkirche
Höhe des ehemaligen Kirchengebäudes
Bemerkungen zu einer möglichen Sondierung
Steinbruch auf dem Friedhof
Stichwortartige Zusammenfassung der Geschichte der Marienkirche:
Im 12. Jahrhundert
Um 1286
1313
1349
1361
1410 - 1432
1420
1470
1479
1538 - 1553
1567 - 1569
1629
1809
1822/23
1827
1831
1854
1865
1865 - 1867
1867
Ab 1988
2000 - 2001
Grabanlage von Eugenius von Woellwarth
Grabplatte von Johanne Eberhardine Gayling von Altheim
Gedenktafel für Friedrich Karl von Woellwarth
Grabtafel von Wilhelm von Woellwarth
2004 Schaden am Putz der Nordwestfassade
2005 neue Eingangstüre
2006 Bodenkacheln
2006 Renovierung der Nordwestfassade
2006 Marienkirche erstrahlt in neuem Glanz
2008 Planierung der Fläche vor dem Chor, Stelen an den Eckpunkten des ehemaligen Kirchenschiffs
2009 Wiedereinweihung der Marienkirche
Die über 600 Jahre alten gotischen Fresco- und Secco-Wandmalereien
Vergleich mit den Wandmalereien in der katholischen Johanneskapelle Zimmern
Einige Bilder aus der Marienkirche Essingen nach der Restaurierung
Übersicht der freigelegten gotischen Wandmalereien
Schlussbemerkungen zu noch offenen Fragen
Der Name Marienkapelle oder Marienkirche
Alter und Baustil der Marienkirche
Essingen als Geburtsort von Bischof Otto I. dem Hl. zu Bamberg?
Holzfiguren aus der Marienkirche
Warum zwei Kirchen und zwei Friedhöfe in Essingen?
Fundamente alter Gebäude östlich des Chores
Dank
Quellenhinweis
Die Marienkirche auf dem Friedhof Essingen
Lage der ehemaligen Kirche „St. Lbfrouwn“ – Ausschnitt aus: Gmünder Pirschkarte 1571/72, Museum für Natur- und Stadtkultur Schwäbisch Gmünd
Bisher ist über die ehemalige Kirche auf dem Berg kaum etwas bekannt. Lediglich über den vom Abriss verschont gebliebenen und in den letzten Jahren sanierten Chor, heute allgemein als Marienkirche bezeichnet, liegen einige neuere Erkenntnisse vor. Es ist hier insbesondere auf den ersten Bericht über die durchgeführte archäologische Befundbeobachtung durch die Arbeitsgemeinschaft SBW Weihs und Schaetz vom Oktober/November 2000 zu verweisen1, der aber zum ehemaligen Kirchenschiff (Langhaus) selbst keine Ergebnisse erbrachte. Auch eine Ermittlung des Alters der Dachkonstruktion des Chores war nicht Gegenstand der Befunderhebung. Nach Angaben in der Vorbemerkung wurden zum Bericht neben dem Grundriss des Chores, erstellt von Architekt Lang in Schwäbisch Gmünd, an archivalischem Material offensichtlich nur die Beschreibung des Oberamtes Aalen von 1854 sowie die wenigen vorhandenen Publikationen und mündlichen Überlieferungen herangezogen, die aber einer wissenschaftlichen Prüfung sicherlich nicht standhalten.
Es ist meines Erachtens eine sorgfältige Auswertung aller verfügbaren Dokumente und Daten in den Archiven unabdingbar, um eine ganzheitliche Beurteilung des Ensembles vornehmen und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen zu können. Offensichtlich hat aber das heute übliche Schubladendenken auch in der Wissenschaft Einzug gehalten; Fehler sind da geradezu vorprogrammiert. So wird beispielsweise unter den allgemeinen Anmerkungen des archäologischen Berichtes vermerkt, dass in der ersten Nennung im Jahre 1361 die Kapelle als „Totenhof-Kirche“ bezeichnet wird. In der Urkunde vom 28. November 1361 findet sich der Eintrag „die Kirche zu Essingen und ihres Filials daselbst“, von einer „Totenhof-Kirche“ ist nicht die Rede. Der Begriff der Totenhofkirche taucht erstmals rund 500 Jahre später in der Oberamtsbeschreibung 1854 auf.2 Die erste Nennung erfolgte zudem nicht 1361, sondern bereits 1313! Falsche Wiedergabe von Originaldokumenten oder Schlussfolgerungen auf rudimentären Informationen sind der Sache nicht gerade dienlich!
Hervorragend bearbeitet und beschrieben wurden die Wandmalereien durch Frau Janine Butenuth in ihrer Magisterarbeit „Die spätgotischen Wandmalereien der Marienkapelle in Essingen“ 2003/2004 unter der Betreuung von Prof. Dr. Heidrun Stein-Kecks an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.3 Ausführliche Hinweise zur Wandmalerei erübrigen sich deshalb von meiner Seite.
Der Chor der Marienkirche steht westlich der Rems auf einer Anhöhe etwas abgesetzt vom östlich der Rems stehenden Ortskern von Essingen. Bei diesem Chor handelt es sich um den Rest der ehemaligen Filialkirche „Zu Unserer Lieben Frauen“, einer einfachen, einschiffigen Saalkirche ohne Turm.
In den Urkunden von 1313 und 1361, auf die später noch eingegangen wird, ist leider nicht erwähnt, wo sich der „Altar zur lieben Frau“ tatsächlich befand. Ich schließe ich mich aber trotz einiger Bedenken der sich mittlerweile durchgesetzten Auffassung an, dass sich dieser Altar in der ehemaligen Kirche auf dem Berg befand, obwohl auch die Essinger Hauptkirche (Quirinuskirche4) oder eine der spätmittelalterlichen Kapellen im oder um den Ort dafür in Frage kommen könnte.
Bei der ehemaligen Marienkirche handelte es sich um eine einfache, einschiffige Saalkirche mit einem eingezogenen rechteckigen, fast quadratischen Chorraum, deren wesentliche Teile aus dem späten Hochmittelalter (11. bis Mitte 13. Jh.) und dem Spätmittelalter (13. bis Ende 15. Jahrhundert) stammen. Man kann sie deshalb trotz ihrer isolierten Lage ohne weiteres auch als so genannte „mittelalterliche Dorfkirche“ bezeichnen. Darunter versteht man meist einfache und wenig strukturierte Feldsteinkirchen, sehr untergeordnet auch Werk-, Bruch- und Backsteinbauten ohne großen Bauschmuck. Die meisten dieser Kirchen wurden in späteren Zeiten mehr oder weniger stark verändert, umgebaut oder nach Zerstörungen wieder aufgebaut.
Chor der Marienkirche vor der Renovierung 1988 Foto: Archiv Horst Wormser, Essingen
Beschreibung des heute noch vorhandenen Chores, Marienkapelle oder Marienkirche genannt.
Der heute noch vorhandene spätgotische Chor, Reste eines romanischen Vorgängerbaues aus dem 12. Jahrhundert in Form einer gemauerten Apsis (Altarnische) können nachgewiesen werden, erhebt sich in Richtung Nordosten auf einem fast quadratischen Grundriss, wobei die Außenmaße in der Länge rund 7,30 und in der Breite 7,20 Meter betragen bei einer Traufhöhe von 5,00 und einer Firsthöhe von rund 10,50 Meter. Die Innenmaße betragen in der Länge rund 5,30 Meter, in der Breite rund 5,10 Meter und in der Höhe rund 5,30 Meter.
Marienkirche von der Parkschule aus gesehen (Südostseite) Foto: 5. Februar 2005
Südwestseite
Südostseite
Westseite
Nordwestseite
Fotos: Mai 2003
Die Mauerdicke beträgt knapp einen Meter.
Die Mauerwerksausführung lässt sich vor allem an der Südostecke gut beobachten: unregelmäßig große Kalk- und Sandbruchsteine, letztere intensiv ockerfarben, sind mit einem hellbeigen Mörtel groblagig aufeinander gesetzt.
Der Chor hat drei Fensteröffnungen. Ein spitzbogiges Fenster in der Ostwand ist nahezu drei Meter hoch und knapp einen Meter breit.
Darüber befindet sich im Giebelbereich noch eine rechteckige Öffnung etwa 1,10 x 0,80 m, die mit einem hölzernen Laden verschlossen ist.
Das rechteckige Fenster in der Südwand ist etwa 2,10 Meter hoch und 0,70 Meter breit. Von oben her gesehen findet sich ein Glasschaden im 2. und 3. Glasteil.
Das Fußbodenniveau scheint bis heute nicht wesentlich verändert zu sein, wie eine Probegrabung durch Herrn Horst Wormser, Essingen, zeigte. Reste des Fußbodens aus gotischen Tonziegelfliesen wurden sichergestellt. Die Grabanlagen im Fußbodenbereich werden in diesem Beitrag separat ausführlich dargestellt.
Der vermutlich nach dem Abriss des Langhauses zugemauerte Chorbogen lässt sich nur noch von innen erkennen: 4 Meter breit und etwa 3,40 Meter hoch. An dieser Stelle befindet sich der heutige Eingang.
Foto: 14.09.2003
Die einstigen Anschluss-Stellen (Verzahnungen) zum Langhaus an den nord- und südwestlichen Ecken des Chores lassen sich im Fundamentbereich noch nachweisen.
Foto: 14.09.2003
Der gesamte Chorbau wird von einem spitzen, steil zulaufenden Satteldach bedeckt, das in der Höhe knapp die Hälfte der Gesamthöhe der Kirche einnimmt. Das Dach ist mit Biberschwanzziegeln gedeckt.
Eine ornamentale Fassadengestaltung fehlt ganz, wenn man einmal von den kleinen „Verzierungen“ im nordöstlichen Giebelbereich der Ostwand rechts und links neben dem mit einem Holzladen verschlossenen Giebelfenster absieht. Welche Bedeutung diese haben, ist unklar. Es könnte sich dabei auch um Bauklammern handeln, die das Mauerwerk zusammenhalten.
Fotos: 14.09.2003
Gestützt wird der Chorbau zur östlichen Talseite hin von zwei mächtigen Strebepfeilern an den nordöstlichen und südöstlichen Ecken; die Pfeiler sind teilweise in die anschließende Kirchhofsmauer integriert.
Die massigen Pfeiler haben wohl eine statische Aufgabe zu erfüllen und stützen die Außenwände, insbesondere die Ostwand am steil abfallenden Hang zum Dorf hin.
Abriss des Kirchenschiffes um das Jahr 1830
Eine Pfarrbeschreibung von 1807 soll bekunden, dass in der Kirche keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. Ein derartiger Vermerk findet sich jedoch in der Pfarrbeschreibung 1807 von Pfarrer Johann Jakob Mann5 nicht, der von 1790 bis 1826 in Essingen amtierte.6
Im Januar 1809 wurde ein Überschlag über die Reparatur des Kirchleins auf dem Freythof dahier erstellt, der nachfolgend ausführlich behandelt wird. Die entsprechenden Reparaturmaßnahmen kamen jedoch wohl aus Gründen der Unrentabilität nicht zur Ausführung, wie der Pfarrbeschreibung von Pfarrer Leonhard Gustav Böckheler aus dem Jahre 1827 zu entnehmen ist: „Weil Reparaturen sich nicht mehr lohnen, soll die ihrem Einsturz nahen Kirche von der Herrschaft abgetragen werden.“7
In diesem Pfarrbericht von 1827 erfolgte ein Nachtrag, dass das Langhaus der baufälligen Kirche abgebrochen wurde, um dadurch mehr Platz auf dem Friedhof zu schaffen.8 Aus welchem Jahr dieser Nachtrag stammt, lässt sich aber leider nicht nachvollziehen.
Pfarrer Heinrich Hartmann aus Steinenberg (heute zur Gemeinde Rudersberg gehörend) schrieb 1847, „dass die Kirche wegen angeblicher Baufälligkeit vor nicht einmal 15 Jahren bis auf den Chor niedergerissen wurde mit einem Kostenaufwand, mit dem man das Nötige hätte zweimal wiederherstellen können.“9
Auch in der Beschreibung des Oberamts Aalen von 1854 wird berichtet, dass der alte massive Bau 1831 bis auf den Chor abgerissen wurde, welcher als „jetzige Todtenhof-Kirche“ zur woellwarthschen Familiengruft bestimmt ist.10 Eine Quellenangabe erfolgte dabei nicht.
In seiner Beschreibung des Marktfleckens und Pfarrdorfes Essingen11 von 1859 erwähnt Carl Friedrich Wagner12einen „abgebrochenen Teil der kleinen Kirche auf dem Berg“, ein konkretes Abrissdatum gibt er dabei auch nicht an.
Sollte es zutreffend sein, dass „davon ausgegangen werden kann, dass er (Wagner) die Marienkapelle noch mit eigenen Augen gesehen hat“, wie Frau Janine Butenuth vermutet13, dann hätte Wagner mit Sicherheit in seiner Beschreibung das genaue Datum der Abbrucharbeiten notiert, denn Wagner junior war ein sehr genauer Beobachter, der stets sehr korrekt dokumentierte, wie den zahlreichen Unterlagen des Archivs Woellwarth zu entnehmen ist.
Pfarrer Albert Pregizer, von 1883 bis 1893 in Essingen amtierend, fertigte 1889/90 eine „Darstellung an das Dekanat am Oberamt Aalen zum seither vom Stiftungsrat verwalteten Stiftungsvermögen“ 14, in der er unter Ziffer 5 folgendes bemerkte: