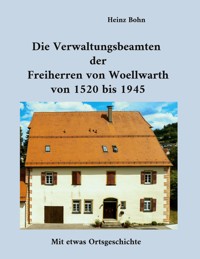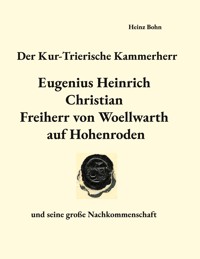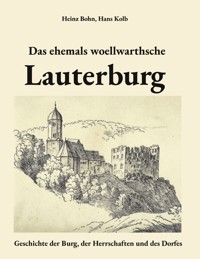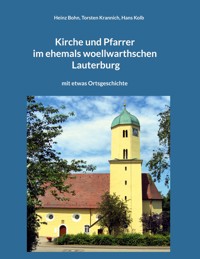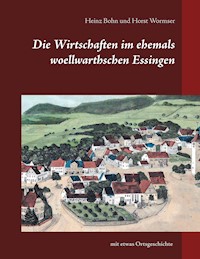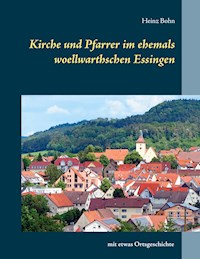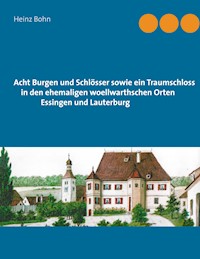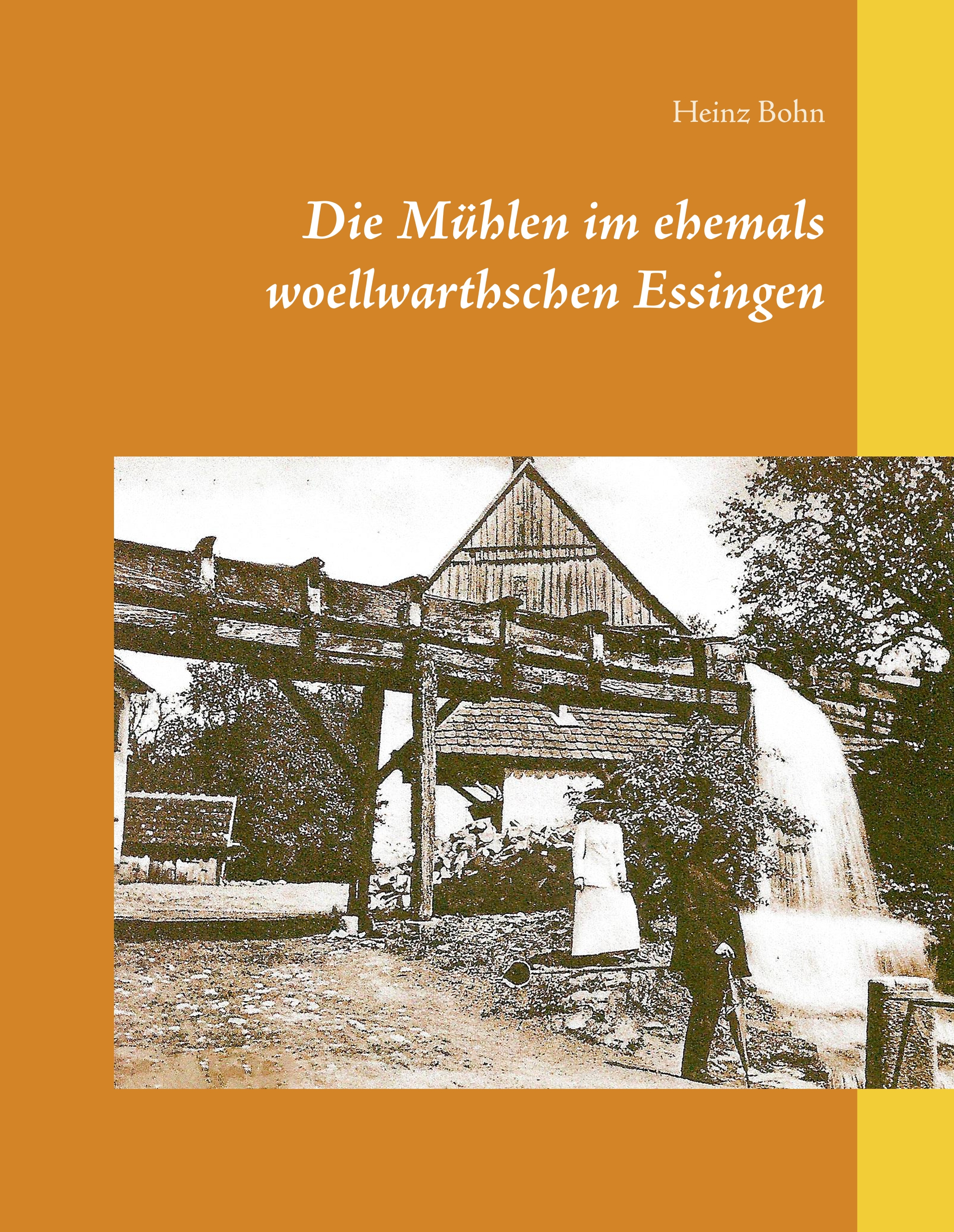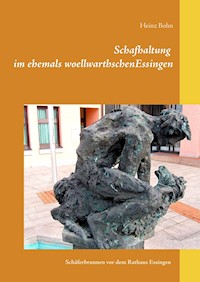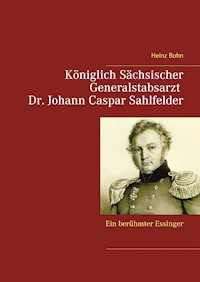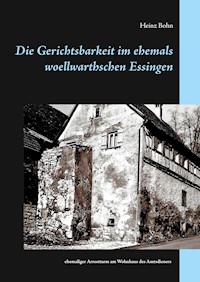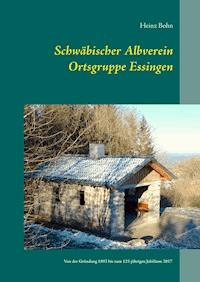6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem Schutzbrief vom 11. November 1684 wurden sechs Juden und ihre Familien durch die Ortsherrschaft von Woellwarth in Essingen aufgenommen. Es handelte sich um den Vorsteher der kleinen jüdischen Gemeinde Zägg, er wird auch Süßlin der Ältere genannt, seinen Sohn Süßlin, Mair Moses, Moses Polagg, Lazarus und Ezechiel. In den Jahren 1684 bis 1687 bezahlten die sechs genannten Familienväter das vereinbarte Schutzgeld. In der Abrechnung von 1688 wird Mair Moses nicht mehr aufgeführt; vermutlich war er in Essingen nicht mehr wohnhaft. Ab 1689 finden sich keine Abrechnungen mehr, so dass davon auszugehen ist, dass alle jüdischen Familien Essingen wieder verlassen hatten. Die jüdischen Familien in Essingen wohnten in einem >Judenhaus< und lebten vor allem vom Vieh- und Warenhandel. Spuren des jüdischen Friedhofes im Gewann Kemmle können nicht mehr festgestellt werden, zumal auf dem Grundstück keine Bestattungen vorgenommen wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 39
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christliche und jüdische Scholasten beim Disput (Holzschnitt 1483)1
Inhaltsverzeichnis
Wie kam es zum Begriff des „Schutzjuden“?
Juden in Württemberg
Judensteuer
Aufenthaltsverbot für Juden in Württemberg
Die Grundherrschaft der Freiherren von Woellwarth
Juden im woellwarthschen Herrschaftsbereich
Die Dorfordnungen für Essingen und Lauterburg von 1554 und 1663 verbieten den Handel mit Juden
Judenschutzbrief von 1684 als erster Nachweis von Juden in Essingen
Wortlaut des Vertrages von 1684
Ausfertigung für die Juden
Ausfertigung für die Gemeinde Essingen
Ausfertigung für die Herrschaft von Woellwarth
Einige Abrechnungen mit den Juden
Anfrage beim Rat der Stadt Aalen 1685
Vertreibung der Juden aus Essingen
Der Judenfriedhof
Gebäude Nr. 161, ab 1822 „Beim Bären“ Haus Nr. 172, 173 und 173a, später Bahnhofstraße 8
Gebäude Nr. 160, ab 1822 „Beim Bären“ Haus Nr. 171 und 171a,später Bahnhofstraße 6
Judengasse
Beschreibung der Häuser in der Judengasse nach dem Kataster 1822/23
Weitere Beziehungen von Juden mit Essingen
Juden kaufen und verkaufen 1884 das Anwesen des Zieglers Wilhelm Koch in Lauterburg
Dank
Quellennachweis
Schutzjuden im ehemals woellwarthschen Essingen
Ende des 17. Jahrhunderts lebten eine Zeit lang Juden unter dem besonderen Schutz der Herrschaft von Woellwarth in Essingen. Juden waren über Jahrhunderte hinweg vor allem beim gebietsübergreifenden Viehhandel auf dem woellwarthschen Herrschaftsgebiet tätig. Mit einem kleinen Rückblick soll an diese „Schutzjuden“ in Essingen erinnert werden.
Wie kam es zum Begriff des „Schutzjuden“?
Ein Dokument, das Karl dem Großen zugeschrieben wird und vor 814 erstellt worden sein soll2, beschreibt die rechtliche Stellung der Juden im Römischen Reich sehr deutlich:
„Kein Jude darf von einer Kirche etwas für Bürgschaft oder Schuld nehmen bei Verlust des Vermögens und der rechten Hand.
Keine Christen in Schuldknechtschaft bringen bei Verlust der Schuld,
Weder Münze in seinem Haus haben noch Wein oder Getreide verkaufen bei Verlust des Vermögens und Gefängnis.“
Zwischen 814 und 825 nimmt der Karolinger Kaiser Ludwig der Fromme die Juden in seinen Schutz, gewährt ihnen Zollfreiheit, das Recht innerhalb des Reichs zu tauschen und zu verkaufen und nach ihren Gesetzen zu leben.3
Am 6. April 1157 bestätigt der Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa den Juden die ihnen von Kaiser Heinrich IV. verbrieften Rechte wie beispielsweise die alleinige Unterstellung unter die königliche Gerichtsbarkeit als Kammerknechte, den Schutz des erblichen Besitzes, das Recht des Geldwechsels in den Städten oder den freien Handel innerhalb des Reiches.4 Dieser Schutz musste bei der Neuwahl eines jeden deutschen Königs oder Kaisers neu erworben werden, was auf Dauer zu einer enormen Steuerlast für die Juden führte. Die Juden standen also gegen Bezahlung von Gebühren unter besonderem Schutz der Obrigkeit.
Juden in Württemberg
Vom 11. Jahrhundert an leben Juden als kaiserliche Schutzbefohlene auch auf dem Gebiet des heutigen Württemberg.
So werden im Reichsteuerverzeichnis von 1241 unter anderem jüdische Gemeinden in Ulm und Esslingen erwähnt. Da die Juden schon seit dem fünften Jahrhundert vor Christus verfolgt und drangsaliert werden, geht ihre Ansiedlung auch in Württemberg nicht ohne Probleme vonstatten.
Im vierten Laterankonzil von 1215 unter Papst Innozenz III. werden diskriminierende Gesetze gegen die Juden erlassen und unter anderem das Tragen von Sondertrachten, Judenhut und Judenabzeichen vorgeschrieben. Weitere und zunehmende Verachtung, Kriminalisierung und Verfolgung der Juden ist die Folge.
Papst Gregor IX. beauftragt am 4. März 1233 die Erzbischöfe, Bischöfe und Kirchenprälaten in Deutschland „…den Übermut der dortigen Juden, welche christliche Leibeigene haben und zum Judenthum zwingen, welche schlechte Christen in dasselbe aufnehmen, welche gegen das toledanische Konzil5 verstoßen würden und öffentliche Ämter übernehmen und zur Misshandlung der Christen benutzen, welche auch an den Kleidern die vorgeschriebenen Abzeichen nicht tragen, zu unterdrücken und es durchaus nicht zu dulden, dass solche über ihren Glauben mit den Christen diskutieren und sie bei dieser Gelegenheit in die Irre führen.“6
1298 fallen Tausende von Juden in Württemberg der Kreuzzugshysterie zum Opfer: Verfolgung, Vertreibung und Wiederansiedlung folgen im steten Wechsel, Willkür und Gewalt gegenüber Juden werden zum Bestandteil des Alltags.
Am 16. Oktober 1320 versprechen Graf Eberhard I. von Württemberg, sein Sohn Graf Ulrich und sein Enkel Ulrich König Friedrich (der Schöne) von Österreich, „…bei dessen Lebzeiten von den Juden und deren Gütern, wo immer sie gelegen seien, keinen Zoll zu erheben, außer wenn diese in Städten und Festen der Grafen und in den Dörfern, wo sie das Dorfgericht besitzen, Wein kaufen oder auf Wein leihen und ihn fortschaffen. Ebenso soll ihnen der zollpflichtig sein, welcher sich von König Friedrich abwendet.“7