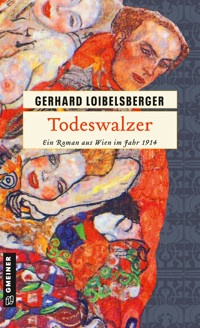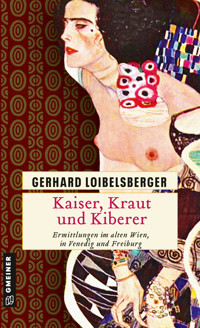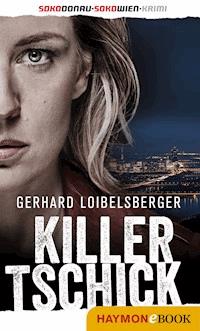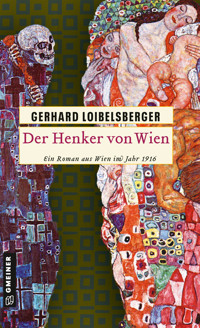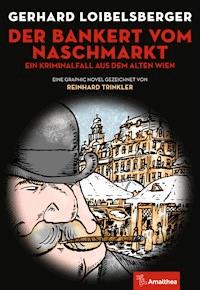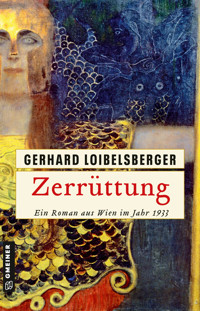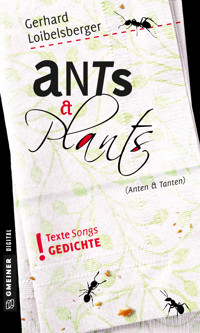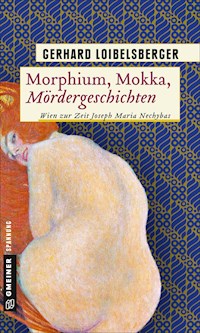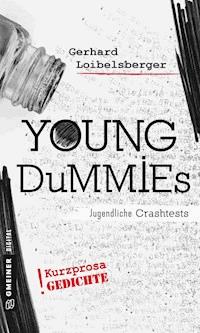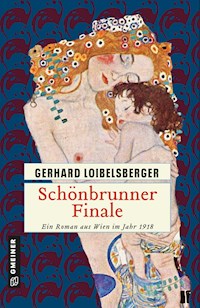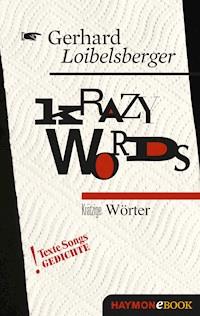Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MONO VERLAG OG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Nechyba
- Sprache: Deutsch
Wien 1903. Auf dem nächtlichen Naschmarkt, dem größten Viktualien-Markt der Stadt, wird die junge Gräfin Hermine von Hainisch-Hinterberg brutal ermordet. Die Presse macht viel Lärm um den »Naschmarkt-Mord«, vor allem der Journalist Leo Goldblatt übt Druck auf die Polizei aus. Und während sich Joseph Maria Nechyba, Inspector des kaiserlich-königlichen Polizeiagenteninstituts und ausgewiesener Gourmet, lieber seinem leiblichen Wohlbefinden als den Ermittlungen widmet, geschieht ein weiterer Mord am Naschmarkt …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Loibelsberger
Die Naschmarkt-Morde
Ein Roman aus dem alten Wien
Impressum
Die Zitate im Kapirel XII/3. wurden entnommen:
Otto Weininger, ›Geschlecht und Charakter‹, Matthes & Seitz Verlag, München 1997, S. 296
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
8. Auflage 2014
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Katja Ernst, Susanne Tachlinski
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Danae« von Gustav Klimt, www.zeno.org, © Hans Dichand, Wien
ISBN 978-3-8392-3380-1
Widmung
Für meine Lebensgefährtin Lisa, meinen verstorbenen Freund Utz und meinen Buchhändler Walter.
Ohne ihre Hilfe wäre dieses Buch nicht entstanden.
Verzeichnis der historischen Personen
Peter Altenberg (1859 – 1919): Schriftsteller, Exzentriker, Poet.
Ferdinand Gorup von Besanez (1855 – 1928): Zentralinspector der Wiener Sicherheitswache. Im Roman ein Vorgesetzter Nechybas.
Gustav Klimt (1862 – 1918): Hauptvertreter des Wiener Jugendstils. Zu seiner Zeit sehr umstritten. Heute wahrscheinlich der bekannteste Maler Österreichs.
Adolf Kratochwilla (1860 – 1938): Besitzer des Café Sperl seit 1884. Im Roman Tarockpartner von Nechyba und Goldblatt.
Josef Lang (1855 – 1931): Scharfrichter (Henker). Im Roman Tarockpartner von Nechyba und Goldblatt.
Leopold Lipschütz (1870 – 1939): Bekannter Wiener Journalist. Im Roman ein Vorgesetzter Goldblatts.
Alfred Fürst Montenuovo (1854 – 1926): Obersthofmeister. Im Roman ein Verwandter der Schönthal-Schrattenbachs und Hainisch-Hinterbergs.
Adalbert Graf Sternberg (1868 – 1930): Politiker, Spieler, Lebemann. Gefürchteter Duellgegner.
Otto Weininger (1880 – 1903): Philosoph und Schriftsteller. Verfasser von ›Geschlecht und Charakter‹.
1. Teil
Amtsblatt der k. k. Polizei-Direction in Wien:
Polizei-Directions-Erlass vom 4. Juni 1903, Z. 52.045/A. B.
Im Einklang mit den Bestimmungen der Kundmachung des Wiener Magistrates vom 15. Februar 1901, Z. 78.666, werden von nun an, an Branntweinschänker im Wiener Policei-Rayon Licenzen zum Öffnen ihrer Lokale vor der gesetzlich zulässigen Eröffnungsstunde nicht mehr ertheilt, und sind demzufolge auch derartige, seinerzeit von hier aus ertheilte Bewilligungen von den betreffenden k. k. Policei-Bezirks-Commissariaten ab 1. Juli d. J. unter keinen Umständen mehr zu erneuern.
Bei der Erledigung derartiger mündlicher oder schriftlicher Ansuchen ist übrigens auf die Bestimmungen des h. o. Decrets vom 9. Februar 1897, Z. 14.681/A. B., entsprechend Bedacht zu nehmen.
Selbstredend sind auch Bewilligungen zum Offenhalten von Branntweinschänken über die gesetzliche Sperrstunde (10 Uhr abends) nicht zu ertheilen.
Prolog
Kühl schmiegte sich das Springmesser an die Außenseite seines Schenkels. Bei jedem Schritt rutschte es in der Hosentasche ein Stückchen hin und her und vermittelte ihm ein Gefühl der Macht.
Durch die schmalen Gässchen der Innenstadt verfolgte er sein Opfer. Als es die Weite des Karlsplatzes überquerte, blieb er bewusst zurück, um keinen Argwohn zu erregen. Gleichzeitig begann sein Puls höher zu schlagen, mit feuchten Fingern tastete er nach dem kühlen Metallgriff des Messers. Jenseits des Karlsplatzes begann die dunkle Zone des Naschmarktes, dort würde er sein Opfer stellen. Zwischen einer Erfrischungsbude und einem gemauerten Stand mit der Aufschrift ›Seefische‹ tauchte seine Beute in eine Schattenwelt ein. Der Weg führte sie durch locker gruppierte Bäume, Büsche und allerlei Marktgerümpel. Linker Hand ragte die düstere Silhouette des Freihauses – ein heruntergekommener Miethauskomplex aus dem 18. Jahrhundert – in den sternenlosen Himmel. Vor dieser Kulisse schwebte wie ein mechanischer Mond die riesige ›Nachtleuchtende Uhr‹. Sie zeigte drei Minuten vor 9 Uhr. Die hallenden Schritte der jungen Frau wurden vom Rauschen der Bäume sowie vom leisen Rumoren der Großstadt untermalt. Sie trug ein bodenlanges Kostüm sowie einen keck auf dem Kopf sitzenden Hut samt Schleier. Außer ihr, einigen Ratten und herumstreunenden Katzen schienen keine Lebewesen das nächtliche Marktareal zu bevölkern. Flinken Schrittes lief der Verfolger über den Platz, kam ihr immer näher, zog das Springmesser und ließ die Klinge mit einem scharfen Klick Abendluft schnuppern. Als er zum Angriff ansetzte, rutschte er auf verfaultem Gemüse aus und stürzte zu Boden. Das Springmesser flog in hohem Bogen weg, eine herumstreunende Katze flüchtete kreischend. Die junge Frau erschrak, hielt kurz inne, blickte sich um und setzte dann, rascher ausschreitend, ihren Weg fort. Ihre anfängliche Sicherheit war einer nervösen Angespanntheit gewichen. Den Blick immer starr vorwärts auf das hohe Gebäude des Theaters an der Wien gerichtet, marschierte sie nun schnell durch die dunkle Gasse, die sich zwischen den Marktständen auftat. Die Lichter der nahen Magdalenenstraße* erschienen ihr wie Leuchtbojen eines rettenden Ufers. Ihre Schritte waren nicht mehr locker und unbekümmert, Muskeln und Sehnen waren angespannt, sie trat ziemlich fest auf, das Stakkato ihrer Schritte hallte. Ein einziger Gedanke hatte von ihr Besitz ergriffen: Weg von hier! So schnell wie möglich die unheimliche Szenerie von Schatten, Schirmen, Kisten, Körben und Fässern verlassen. Außerdem war da noch etwas. Sie vermeinte, Schritte zu hören. Dann wieder nicht. Alles nur Einbildung – ein Phantom ihrer Fantasie?
»Ich bin eine hysterische Blödistin …«, sagte sie halblaut und zwang sich, langsamer zu gehen und tief durchzuatmen. Wer sollte ihr schon folgen? Vielleicht war es auch nur ein Obdachloser, der betrunken zwischen dem Marktgerümpel hin und her torkelte. Das Durchatmen half. Ihre Schritte wurden entspannter. Die dunklen Gespenster verflogen, der Sommerabend umfing sie mit samtiger Geborgenheit. Voll Vorfreude dachte sie an das bevorstehende Rendezvous. Sie bog in das gähnend schwarze Loch eines Durchgangs ein. Plötzlich war es wieder da: das Gefühl, verfolgt zu werden. Gänsehaut. Sie hörte ganz deutlich Schritte hinter sich. Nahe. Ganz nahe. Sie rannte. Ihre Füße bewegten sich mechanisch. Blut pochte in ihren Schläfen. Stoßweiser Atem. Luft, Luft! Der vermaledeite Schleier! Laufen, stolpern, laufen, kollidieren mit einem massiven Körper.
»Aufpassen, Mädl! Wo rennst denn hin? Welcher Zerberus ist denn dir auf den Fersen?«, scherzte der weißhaarige Herr, in dessen kugelförmige Gestalt sie hineingerannt war. Ihre Finger krallten sich in den Stoff seines Sakkos. Sie presste, um Atem ringend, hervor: »Ich werd verfolgt …!«
Der Mann sah sich um, konnte aber außer ein paar Papierfetzen, die von einem plötzlichen Windstoß aufgewirbelt wurden, nichts Ungewöhnliches entdecken.
»Da is’ nix«, stellte er beruhigend fest. »Aber ich geh eh hinüber ins Café Dobner. Bis dorthin begleit ich dich. Dort sind dann wieder mehr Leut’ auf der Straße. Da brauchst nachher keine Angst mehr zu haben …«
Im Schatten eines Marktstandes kauerte ein Mann. Das Messer war weg, seine Finger umklammerten einen Seidenschal. Heute hatte er Pech gehabt, aber früher oder später würde er es schaffen – allerdings nicht mit dem Springmesser. Die Vorstellung, sie zu erdrosseln, hatte von ihm Besitz ergriffen; eine unblutige, lautlose Lösung, um seine Lebensumstände wieder in den Griff zu bekommen.
*Heute: Linke Wienzeile
I. Kapitel
Es klang wie das Donnergrollen eines fernen Gewitters. Ganz tief unten in den Kavernen begann es, schwoll mächtig an, durchbrach einen geheimnisvollen Damm, hinter dessen dicken Mauern gewaltig drängende Massen an komprimierter Luft aufgestaut waren. Sie rauschten wie eine gigantische Woge empor, überrollten dabei ein zartes, vorauseilendes Prickeln und explodierten schließlich als röhrender Rülpser. Das darauf folgende Aaahhhh der Erleichterung war für den vor der Tür wartenden Pospischil das Zeichen, dass Joseph Maria Nechyba sein Gabelfrühstück beendet hatte. Dienstbeflissen betrat er das Zimmer.
»Er kann abservieren«, nuschelte der Inspector, lehnte sich zurück und angelte sich eine Zigarre aus der länglichen Kartonschachtel. Es war eine Virginier, die einen Strohhalm als Mundstück hatte. In diesem Mundstück steckte ein weiterer Halm, den Nechyba vor dem Anrauchen herauszog. Seine dicken Finger entwickelten dabei eine Grazie, die man ihnen nicht zugetraut hätte. Eilfertig kramte Pospischil in seiner Jacke, brachte Schwefelhölzer zum Vorschein und entzündete eines. Nechyba benutzte den herausgezogenen Halm als Fidibus, zündete ihn an der dargebotenen Flamme an und entfachte paffend eine Glut. Während der Inspector kunstvolle Rauchkringel formte, räumte Pospischil den Schreibtisch auf, knüllte das Papier, das als Essensunterlage gedient hatte, zusammen und warf es treffsicher in den Papierkorb. Daraufhin wischte er mit der Handkante die Brösel auf dem Schreibtisch zu einem Häufchen und kehrte es auf die offene Handfläche seiner linken Hand. Dann nahm er das leere Bierglas und verließ den Raum, um draußen die zusammengekehrten Brösel von seiner Handfläche zu schlecken.
Nechyba, der diese Schrulle seines Assistenten kannte, fand das ekelhaft. Trotzdem ließ er es weiter geschehen. Das war typisch für den Charakter sowie für die Menschenkenntnis des Inspectors. Im Gegensatz zu manchem anderen Beamten bei der Sicherheitswache glaubte er nicht an die Änderungsfähigkeit des Menschen. ›Einmal ein Strizzi – immer ein Strizzi‹ war eine seiner stehenden Redewendungen, die auf der Gewissheit beruhte, dass ein Gauner immer ein Gauner bleibt. Und dass einer, der sich wie ein Hund benahm, immer hündisch reagieren wird. Deshalb hatte er auch keinerlei Skrupel, seinen Assistenten wie einen Hund zu behandeln: mit einer gewissen Härte und mit dem Anspruch auf unbedingten Gehorsam und Unterordnung.
»Pospischil!«, dröhnte es aus dem Inspectorenzimmer. »Pospischil! Hierher!«
»Jawohl, schon zur Stelle, Herr Inspector!«, rief dieser und lief von dem Spülbecken, wo er das Bierglas gewaschen hatte, mit nassen Händen vor dessen Schreibtisch. Er nahm Haltung an.
»Er wird jetzt die Akte mit der Wirtshausrauferei zwischen den Deutschradikalen und den Sozialdemokraten bearbeiten. Er weiß eh, was zu tun ist. Protokoll anfertigen, Zeugenaussagen einfügen, alles kurz und klar zusammenschreiben, keine Rechtschreibfehler, keine Eselsohren, keine Tintenflecken. Er hat bis Nachmittag Zeit. Und – Pospischil – bevor er die Akte zur Hand nimmt, trockne er sich die Finger ab. Das ist alles. Er kann gehen.«
»Jawohl, Herr Inspector.«
Der k. k. Polizeiagent trat ab und eilte zurück zum Spülbecken, wo unter fließendem Wasser ein mittlerweile blitzsauberes Bierglas stand.
Joseph Maria setzte seine Melone auf und verließ das Büro. Draußen empfing ihn die Schwüle eines Wiener Frühsommertages. Ein bisserl Sonnenschein, ein bisserl Wolken, vermischt mit hoher Luftfeuchtigkeit und ein paar vorwitzigen Regenspritzern. Kurzum: ein Wetter zum Aus-der-Haut-Fahren. Er nahm das Wetter mit einem grimmigen Schnaufer zur Kenntnis und ging mit der Würde eines kaiserlich-königlichen Beamten zur nächsten Tramwayhaltestelle, wo er sich in einen Zug Richtung Oper setzte. Bei der Babenbergerstraße stieg er aus und machte sich auf den Weg zu seinem Lieblingsfleischhauer**. Aus einer Toreinfahrt schoss ein kleiner, zotteliger Spitz und verbellte den Inspector. Eine Frauenstimme keifte: »Seppi! Hierher! Sapperlot! Seppi, du Rabenvieh, wirst herkommen? Seppi, hier! Wenn du jetzt nicht sofort parierst, kommst ins Gulasch!« Diese Drohung machte Eindruck, denn knurrend und fletschend trollte sich der Seppi zurück in den Hof, aus dem er wie ein Deus ex Machina hervorgeschossen war. Nechyba versuchte, sich den Geschmack eines Hundegulaschs vorzustellen. Dabei kam ihm der pelzig-ranzige Geruch, der den meisten Hunden im Sommer eigen ist, in den Sinn. Ob sich diese Ausdünstungen mit dem würzig-süßen Paprika-Zwiebel-Aroma eines ordentlichen Gulaschs vertragen würden? Ein Gedanke, bei dem der Inspector erschauerte. Dies geschah, als er bei seinem Lieblingsfleischhauer eintrat. Der Schauer wurde von Anastasius Schöberl, der in Vertretung des oft abwesenden Meisters das Geschäft führte, sofort bemerkt und kommentiert: »Gott zum Gruß. Der Herr Oberpolizeirat gibt uns die Ehre. Was ist ihm denn? Betritt er den Tempel der fleischlichen Genüsse nur mehr mit Schauder und Grausen? So dreckig ist es bei uns doch gar nicht … Zumindest ist’s nicht dreckiger als bei anderen Fleischhauern in der Stadt. Oder ist er gar krank, der Herr Oberpolizeikommissär? Dagegen hätten wir was: ein exzellentes Beinfleisch, das eine Suppe gibt, die alle Stückerln spielt und die Tote auferstehen lässt. Dazu ein paar Markknochen mitgekocht und das Ganze heiß hinuntergelöffelt. Das stärkt Körper und Seele – so ein Kraftsupperl. Also, Herr Polizeipräsident, was darf es denn heute sein?« Diese witzig unverschämte Anrede war typisch für einen echten Wiener Fleischhauergesellen. Sie entlockte Joseph Maria Nechyba ein Schmunzeln. Er erklärte Schöberl, dass er heute Abend Spanische Vögel***kochen wolle und dafür ein butterweiches Rumpsteak benötige. Das Fleisch solle ihm der Lehrbub ›so gegen halb sechs am Abend‹ nach Hause bringen. Joseph Maria Nechyba tippte an die Krempe seiner Melone und begab sich auf ein Mittagessen ins Gasthaus Zur goldenen Glocke.
**Metzger
***Eine Zubereitungsart des Rumpsteaks: Man schneidet es in zwei Teile, spickt, salzt und pfeffert es, gibt etwas Sardellenbutter dazu, rollt und bindet es zusammen, lässt Schmalz heiß werden, gibt fein gehackte Zwiebel, etwas Mehl dazu, lässt alles gelb anrösten und legt das Rumpsteak hinein, begießt alles mit Suppe und lässt es zwei Stunden dünsten.
II. Kapitel
Als Stanislaus Gotthelf die Greislerei**** der Lotte Landerl betrat, war es schon mittlerer Vormittag.
»Guten Morgen, Stani«, wurde er freundlich begrüßt. »Na, bist auch schon munter?«
Damit spielte die Landerl auf die Tatsache an, dass Gotthelf seinen Tagesablauf nach Lust und Laune gestalten konnte: viel schlafen, spät aufstehen, spazieren gehen, ein bisschen Geld verdienen, Mädeln treffen, im Kaffeehaus sitzen, sich betrinken oder einfach nichts tun. All das war möglich, da sich Stanislaus Gotthelf seit seiner Jugend konsequent dem sogenannten normalen Leben entzogen hatte und sich um Konventionen herzlich wenig scherte.
»Gurrrten Morrrrgen!«, schnarrte es durch die Greislerei, und Lotte Landerl musste – wie immer – wegen dieser Verballhornung schmunzeln. Das Liebenswerteste an Gotthelf war zweifellos sein weißer Papagei Toni, den er immer mit sich herumtrug und der eigentlich der Geld verdienende Teil des ungleichen Gespanns war. Wie ein Papagei Geld verdienen konnte? Ganz einfach, indem Gotthelf ihm beigebracht hatte, aus einer silbernen Blechschatulle, in der sich, dicht gesteckt, Hunderte verschiedene Horoskop-Zettel befanden, auf Kommando einen herauszupicken. Damit spielte der Papagei Schicksal. So wurde der astrologische Blödsinn, der auf den Horoskop-Zetteln gedruckt stand, mystisch überhöht. Das Unglaubliche an Gotthelfs Gewerbe war die Tatsache, dass Menschen dafür Geld ausgaben. Und das waren gar nicht so wenig! Wo immer der Planetenverkäufer*****mit seinem weißen Papagei und der Silberschatulle aufkreuzte, kauften ihm vor allem Personen weiblichen Geschlechts seinen astrologischen Klimbim ab. Da dieses Geschäft wie von selbst lief, brauchte sich der Stani auch nicht wirklich am Riemen zu reißen. Die Zettel kaufte er bei einem alten Drucker in der Leopoldstadt, der die astrologischen Texte selbst verfasste und mittels einer Handpresse vervielfältigte. Sein Kundenkreis bestand aus fahrenden Gesellen, Zigeunerinnen, Marktbudenbesitzern und anderem Volk, das wie Gotthelf vom Magistrat einen Erlaubnisschein fürs Hausieren erwirkt hatte.
Hausieren, handeln, feilschen und Leute betrügen hatte Gotthelf mit der Muttermilch mitbekommen; schließlich war seine Mutter eine berühmt-berüchtigte Fratschlerin******am Naschmarkt gewesen. Sie hatte ihn als Kind nur in abgetragenen Fetzen herumlaufen lassen. Deshalb legte er als Erwachsener besonderen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Seine herausgeputzte Erscheinung stand in bizarrem Kontrast zu seinem Aussehen: Gotthelf war ein mageres Mannsbild mit blassem Antlitz, das unzählige Aknenarben verunstalteten. Außerdem hatte er ein Pferdegebiss. Doch sein gepflegtes Äußeres und seine höfliche Art zu sprechen machten beim weiblichen Geschlecht mächtig Eindruck. Und so erwarb er sich trotz seiner Hässlichkeit bei Dienstmädchen, Köchinnen und den unzähligen anderen weiblichen Wesen der niedrigen Stände den Ruf, ein charmanter Kerl und ein Vorstadtcasanova zu sein.
»Grüß dich, Lotte«, murmelte er verschlafen, ging auf die Landerl zu und zwickte sie in die Seite.
»Hör auf, du Narr!«, zischte sie und machte einen schnellen Schritt zurück.
»Mein Mann kann jeden Augenblick zurückkommen.«
»Geh, Lotterl … Dein Gatte sitzt doch beim Brandineser*******und ist sicher schon beim dritten oder vierten Stamperl Schnaps. Der kommt so schnell nicht zurück.«
»Beim Brandineser sitzt der schon wieder? So ein Saufkopf!«, schimpfte die Landerl, während sie dem Stani eine Scheibe Brot abschnitt und darauf dick Butter strich. Sie gab ihm das Brot, verschwand im Hinterzimmer und wärmte dort Kaffee auf, von dem sie morgens in weiser Voraussicht mehr gekocht hatte.
Den heißen Kaffee goss sie in ein benütztes sowie in ein frisches Häferl********. Vorne im Verkaufsraum schlürften die beiden dann schweigend Kaffee. Nachdenklich betrachtete sie ihn aus den Augenwinkeln und sagte schließlich schmunzelnd: »Weißt, Stani, eigentlich ist es unglaublich, dass so ein Vieh von einer Mutter so einen lieben Buben wie dich zur Welt gebracht hat …«
****Tante-Emma-Laden
*****Horoskopverkäufer
******Marktweib
*******Branntweinkneipe
********Tasse
III. Kapitel
Zuerst war ein metallisches Knacken zu hören. Es wurde durch das Einrasten von Zahnrädern verursacht. Diese setzten den Sperrmechanismus einer Feder außer Kraft, die–weil aufgezogen–in abwartender Position verharrt hatte. Nun setzte sie den Klöppel in Gang, der unbarmherzig auf die Glocke des Weckers einhämmerte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!