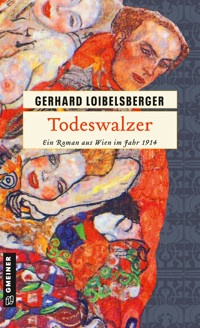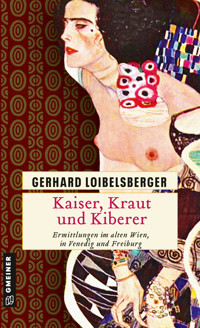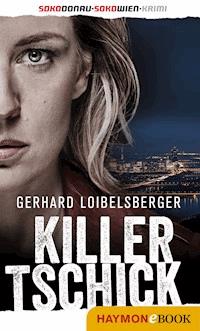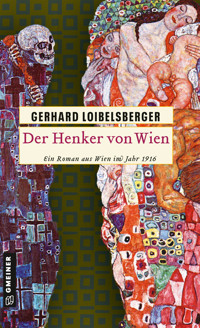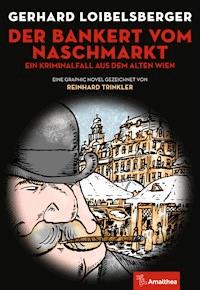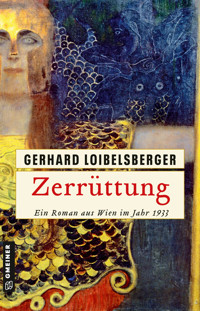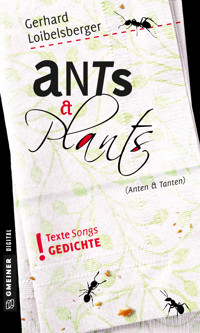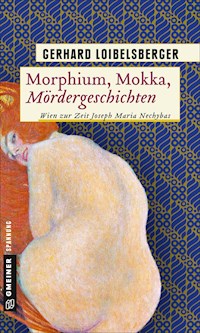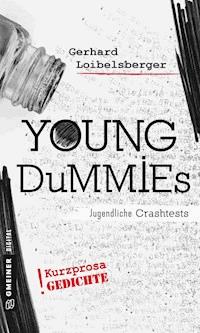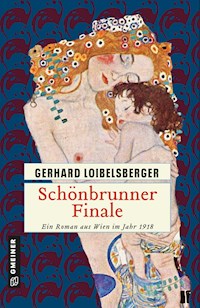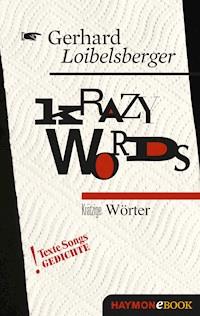Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kennen Sie Josef Fischer? Den Raubmörder, der zwei junge Frauen umgebracht, diese danach mit Flusssäure verunstaltet und mit einem Beil zerhackt hat? Zu dieser Geschichte aus dem alten Wien gesellen sich True-Crime-Stories aus dem neuen Wien, wie »Der Schrebergarten Sigi«. »Wiener Zuckerl« enthält natürlich auch Neues von den beiden Kultermittler Inspector Nechyba und Lupino Severino. Außerdem erzählt Gerhard Loibelsberger Geschichten aus seiner Jugend. Ein weiteres Zuckerl ist »Der tränende Eisberg«, eine Geschichte, die er nach einer Idee von Isabel Karajan verfasst hat. Leseprobe aus »Die Bier-Fini«, einer Erzählung basierend auf einem Totschlag im Juli des Jahres 1918: »Voll Zorn betrat Joseph Maria Nechyba das Marktamt am Naschmarkt. Wie ein Panzerkreuzer schob er sich durch das Menschenmeer, vor zu dem breiten Tisch, hinter dem die Marktamtbeamten Auskünfte erteilten und Beschwerden entgegennahmen. In Zeiten des allgemeinen Lebensmittelmangels überwogen letztere. Der Oberinspector steuerte auf einen sanguinisch aussehenden Marktamtmitarbeiter zu und brummte, als er vor ihm stand: ›Stankowitz‹ ...«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf dem Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?
Folgen Sie
auch auf Social Media
& abonnieren Sie unseren Newsletter
Jede Story ein besonderes Zuckerl
Krachmandeln, Seidenzuckerl, süßsäuerliche Fruchtbonbons: Gerhard Loibelsberger erzählt Geschichten für jeden Geschmack – vielfältig, spannend, atmosphärisch dicht. Kriminelles mit Biss aus dem alten und dem neuen Wien, auch mit den beiden Kultermittlern Inspector Nechyba und Lupino Severino. Erfundenes und „True Crime“ von anno dazumal.
Ein weiteres Zuckerl ist „Der tränende Eisberg“, nach einer Idee von Isabel Karajan.
Klappentext
Voll Zorn betrat Joseph Maria Nechyba das Marktamt am Naschmarkt. Wie ein Panzerkreuzer schob er sich durch das Menschenmeer vor zu dem breiten Tisch, hinter dem die Marktamtbeamten Auskünfte erteilten und Beschwerden entgegennahmen. In Zeiten des allgemeinen Lebensmittelmangels überwogen letztere. Der Oberinspector steuerte auf einen sanguinisch aussehenden Marktamtmitarbeiter zu und brummte, als er vor ihm stand: „Stankowitz …“ Der wurde beim Anblick des Oberinspectors blass, fertigte die Frau, die gerade eine Beschwerde bei ihm vorbrachte, mit einigen unfreundlichen Worten ab und wandte sich Nechyba zu:
„Was gibt’s? Was hab ich verbrochen?“
Gerhard Loibelsberger
Wiener Zuckerl
Wiener Krimis und andere Geschichten
Vorwort
Wiener Zuckerl? Was soll das?
Warum ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, Zuckerl anbiete?
Nun, der Name und die Verpackung des Buches sind Erinnerungen an meine Kindheit. Damals liebte ich die Wiener Zuckerl in all ihren vielfältigen Geschmacksrichtungen.
Vielfalt ist das Thema dieses Buches. Es bietet die unterschiedlichsten Erzählungen, die ich im Laufe der letzten zwanzig Jahre geschrieben habe. Einige wurden veröffentlicht, andere nicht. Und einige habe ich für dieses Buch neu geschrieben. Sie finden hier Kriminalgeschichten aus dem alten Wien mit Joseph Maria Nechyba, Kriminalgeschichten aus dem neuen Wien, Geschichten aus meiner Jugend und Geschichten aus Niederösterreich, der Steiermark, Kärnten, Salzburg und Venedig. Ja, auch mein alter Freund Lupino Severino, den Sie vielleicht aus „Quadriga“ oder „Im Namen des Paten“ kennen, spielt in zwei Geschichten die Hauptrolle.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und gebe Ihnen einen Tipp: Wiener Zuckerl lutscht man, ohne sie zu zerbeißen.
In diesem Sinne: Lesen Sie meine Geschichten langsam und mit Genuss.
Gerhard Loibelsberger
Inhalt
Vorwort
Geschichten aus dem alten Wien
Historische Personen
Die rote Rosie
Die Bier-Fini
Wiener Raubmord-Trilogie
Geschichten aus dem neuen Wien
Herr Nechyba wünscht einen guten Morgen
Lecker!
Der Hundstrümmerl-Zertrümmerer
Der Schrebergarten-Sigi
Der Besuch
Groschenroman
Lehrstunde
Die Erwes
Geschichten aus Österreich
Liesi, Lämmer, Ochsennasen
Der tränende Eisberg
Der Kreutzberger
Lupino in Röschitz
I’m on fire
Glossar
Geschichten aus dem alten Wien
Alle kursiv gesetzten Passagen sind Originalzitate aus den damaligen Zeitungen.
Historische Personen
Marie Drda (1898–1918)
Stubenmädchen, Mordopfer
Anna Fischer (?)
Gattin von Josef Fischer
Josef Fischer (1857–1918)
Vergolder-Lehrling, Maulkorbhersteller, Raubmörder
Heinrich Edler von Francesconi (1850–1876)
Raubmörder
Franz Juhl (1894–?)
Hilfsarbeiter, Deserteur, Totschläger
Josefine Juhl (1892–1918)
Standbesitzerin am Naschmarkt
Richard Juhl (1906–?)
Sohn von Josefine Juhl
Anton Lencig (?)
Goldschmied, Vergolder
Viktoria Moldaschl (1844–1874)
Dienstmagd, Mordopfer
Dr. Johann Schober (1874–1932)
Leiter und später Präsident der Wiener Polizei
Veronika Wessely (1838–1918)
Rentnerin, Mordopfer
Robert Wurm (?)
Ziehvater von Marie Drda
Die rote Rosie
„Des is a richtige Kanaille!“, mahnte Joseph Maria Nechyba, als er die rote Rosie einem Sicherheitswachebeamten zum Abführen übergab.
„Bringen S’ die Weibsperson aufs Kommissariat. Die Anklage lautet: illegale Prostitution. Ich schreib morgen einen Bericht. Passen S’ gut auf die auf! Die ist mit allen Wassern gewaschen.“
Der Uniformierte nickte, brummte »I waß eh« und führte die rote Rosie ab. Nechyba sah den beiden nach und bemerkte, wie sie sich an den Polizeibeamten ranschmiss. Er musste grinsen. Ja, die Rosie mit ihrer leuchtend roten Haarpracht, ihren üppigen Formen und einer Haut weiß wie Milch war ein bildhübsches, aber grundverdorbenes Geschöpf. Sie hatte ein Gesicht wie ein Pupperl, leider fehlten ihr im Mund ein paar Zähne. Und wenn man sie genau betrachtete, bemerkte man einen vulgären Zug um ihre Lippen. Ihre grünen Augen funkelten kalt wie Smaragde. Immer noch an Rosies wogenden Busen denkend, stapfte er heim.
Ein Jahr später.
Seit den Morgenstunden herrschte an diesem Oktobertag des Jahres 1902 strahlend schönes Wetter. Trotz der Kälte in der Früh war Joseph Maria Nechyba ohne Überzieher – nur in seinem schwarzen, dreiteiligen Anzug und mit Melone – aus dem Haus gegangen. Der Vormittag im k. k. Polizeiagenteninstitut war ruhig verlaufen, und so hatte er sich um halb ein Uhr mittags in die Restauration „Zum Rebhuhn“ begeben. Danach war er ins Büro zurückgekehrt und hatte seinem Adjutanten, dem zniachtigen1 Pospischil, noch einige Anordnungen für die Bearbeitung diverser Akten gegeben. Anschließend ging er. Offiziell zu einem Termin außer Haus, in Wahrheit aber auf den Naschmarkt. Denn Joseph Maria Nechyba hatte einen Gusto. Am frühen Nachmittag waren am Naschmarkt schon einige Stände abgebaut, doch es gab noch genug Fratschlerinnen2 und Bauern, die ausharrten und auf späte Kundschaft hofften. Am Markt sah Nechyba viele bekannte Gesichter; unter anderem auch den Planetenverkäufer Stanislaus Gotthelf, der an einem gemauerten Stand lehnte und einer Kundin einen Horoskopzettel verkaufte. Sie gab ihm eine 10-Heller-Münze, die er mit der rechten Hand einsteckte, während er mit der linken Hand seinen weißen Papagei von der Schulter hob. Mit der rechten Hand klappte er nun das Kästchen, das um seinen Hals hing, auf, hob es etwas an, und der auf der linken Hand sitzende Papagei spielte Fortuna und pickte einen Horoskopzettel aus dem Kästchen heraus. Mit roten Wangen nahm die Kundin den Zettel, faltete ihn auf, wurde noch röter, rief „Oh!“ und eilte aufgeregt davon. Gotthelf klappte mit der Rechten das Kästchen zu und setzte mit der Linken den Papagei, der übrigens Toni hieß, vorsichtig auf die linke Schulter zurück. Nechyba hörte die Freihaus-Mizzi, eine Fratschlerin, die für ihre Goschn3 und ihre grobe Art bekannt war, mit einer Kundin streiten, und er sah die rote Rosie, die beim Knödelmann ihre prall gefüllte Geldbörse hervorzog, einen dampfend heißen Semmelknödel kaufte und diesen gierig verschlang. Er sah die Hausmeisterin Oprschalek mit einer Kollegin aus dem Freihaus tratschen, und es rannte ihm sein Fleischhauer über den Weg.
„Grüssie, Herr Mostbichler!“, dröhnte Nechyba, „Hörn S’, können S’ mir bitte heut Abend Ihren Lehrbuam mit einem halben Kilo Bauchfleisch vorbeischicken?“
Mostbichler, der es eilig hatte, rief zurück:
„Selbstverständlich, Herr Inspector! Um halb sechs, wenn’s recht ist? Zahlen können S’ dann das nächste Mal, wenn S’ bei mir im G’schäft sind. Habe die Ehre!“
Und schon war er im Gewurl4 der Menschen verschwunden. Bei einer Bäuerin erstand Nechyba pikant riechendes Sauerkraut, das diese aus einem riesigen Holzbottich auf ein Blatt Papier schaufelte. Danach machte sie ein Packerl und hüllte es in mehrere Schichten Zeitungspapier. Nechyba freute sich. Heute Abend würde er ein deftiges Szegediner Krautfleisch machen. Mit ordentlich viel Zwiebel, Paprika und Bauchfleisch. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen. Entspannt schlenderte er über den sonnigen Markt, auf dem es nach Schweiß, allerlei Obst und Gemüse, Gewürzen, und gelegentlich auch nach Verfaultem und Verdorbenem roch.
„Geh Scheissssss’n!“
Ein schriller Schrei aus einer krächzenden Kehle. Nechyba war mit einem Schlag aus seinen Tagträumen gerissen. Wie ein Schlachtross pflügte er durch die Menge, rücksichtslos seine Körpergröße und sein Gewicht einsetzend. Dann sah er den Bahöö5: Der wilde Turl, Freund und Beschützer der roten Rosie, prügelte auf den Planetenverkäufer ein, der ihm den Buckel zudrehte, um sich so gut wie möglich vor den Schlägen zu schützen. Über den beiden flatterte der Toni. Er kreischte wie verrückt und gab einen Schwall Schimpfwörter von sich. Nechyba riss den wilden Turl an der Schulter zurück und schlug ihm mit der Linken, in der er das Sauerkrautpackerl hielt, ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass es den wilden Turl auf den Hosenboden setzte und das Sauerkrautpackerl zerplatzte. Ein Umstand, der dem Turl gar nicht schmeckte. Der Sauerkraut-Gatsch bedeckte sein Gesicht, der Saft brannte ihm in den Augen und er bekam kaum Luft. Er hustete und spuckte.
„Lassen S’ den Turl in Ruah! Sie bamstiger Kiberer, Sie! Der Gotthelf hat mei Geldbörsl g’fladert6 …“
„Rosie, kusch!“, knurrte Nechyba. Dann nahm er den Turl beim Krawattl und drängte ihn an die Wand eines Standes.
„Bist wahnsinnig g’worden, Turl? Willst das Arbeitshaus wieder von innen sehen?“
Der Strizzi7 stotterte:
„Aber Herr Inspector, der Gotthelf hat mei Madl bestohlen …“
„So, so …“, brummte Nechyba.
„Also Rosie, wie war des?“
„Ich hab mir einen Horoskopzettel beim Gotthelf kauft. Und dann hab i, wie verabredet, den Turl troffen, weil i dem a bisserl an Schotter geben wollt. Und wie i mei Geldtaschl g’sucht hab, war’s nimma da. Zuerst hab i mi g’wundert, aber dann is mir a Licht aufgegangen und i hab dem Turl g’sagt, dass mir der Gotthelf mein Börsl g’stessn8 hat. Wahrscheinlich war’s der Papagei. Der hat zuerst das Zetterl rausgepickt und dann hat sich das Rabenviech mit seinem Schnabel mei Geldbörsl g’schnappt.“
„Was redest für einen Stuss9? Der Papagei kann mit’m Schnabel nicht ein prall gefülltes Geldbörsl fladern. Das ist viel zu schwer. Das packt er net.“
Nun befahl er dem Gotthelf, alle Taschen auszuleeren. Es kamen etliche Münzen, ein Tabaksbeutel, Schwefelhölzer sowie ein schmutziges Taschentuch zum Vorschein. Aber nicht Rosies Geldbörse. Das erstaunte Nechyba nicht. Der schöne Stani, wie ihn Personen weiblichen Geschlechts hier am Naschmarkt zu nennen pflegten, war kein Dieb und auch kein Räuber. Er raubte jungen Mädeln höchsten ihre Unschuld. Aber die würde ihnen früher oder später sowieso abhandenkommen. Er sah die rote Rosie forschend an. Sie erwiderte mit frechen, funkelnden Augen seinen Blick. Die Menge, die sich rundum angesammelt hatte, wartete gespannt darauf, was nun passieren würde. Nechyba sah sich um und rief zwei Fratschlerinnen sowie die Freihaus-Mizzi zu sich. Mit grobem Griff nahm er die Rosie beim Genick und führte sie hinter die Kisten und Planen eines Marktstandes. Er schubste sie in ein dunkles Eck und sagte zu den Marktweibern:
„Ihr zwei passt auf, dass die Rosie net abpascht10. Eine vorn und eine hinten. Und du Mizzi, du perlustrierst die Rosie.“
„Berlus… was …? Herr Inspector, ist des eh nix Unanständiges?“
„Du filzt sie! Du schaust, wo’s das Geldtaschl versteckt hat. Und schau auch unterm Kittel nach! Ob sie’s vielleicht ins Strumpfband g’steckt hat.“
Neugierig wie sie waren, folgten die drei umgehend seinen Anweisungen und stürzten sich auf die lauthals zeternde Rosie.
„Lassts mich in Ruh, ihr schiachn11 Krampn12! Greifts mi net an! Gebts eure dreckigen Klebeln13 weg. Es verbrunzte Schastrommeln14, es Hundstuttln15!“
Aber weder Rosies Schimpftirade noch ihre Gegenwehr fruchteten etwas. Schließlich wollten die Marktweiber wissen, ob der Herr Inspector recht hatte. Nechyba stand wie eine Marmorstatue vor dem Marktstand und wartete. Aber nicht lange, denn plötzlich war ein wütender Aufschrei zu hören. Und dann kam die Freihof-Mizzi aus dem dunklen Eck hinterm Marktstand hervor, die prall gefüllte Geldbörse mit triumphierenden Gesten über ihrem Haupt schwenkend. Die Gaffer applaudierten, und die Freihaus-Mizzi verkündete:
„Versteckt hat sie’s g’habt. Zwischen ihren Tuttln. Weils dem Turl nix abgeben wollt …“
1schmächtig
2Marktstandlerin
3Mundwerk
4Gedränge
5Wirbel
6gestohlen
7Zuhälter
8ebenfalls: gestohlen
9Unsinn
10weglaufen
11hässlich
12abwertend für: Frauen
13Finger
14von Darmwinden geplagte Frauen
15Hundebrüste
Die Bier-Fini
Die Erzählung basiert auf dem Fall eines Totschlags im Juli des Jahres 1918.
Voll Zorn betrat Joseph Maria Nechyba das Marktamt am Naschmarkt. Wie ein Panzerkreuzer schob er sich durch das Menschenmeer vor zu dem breiten Tisch, hinter dem die Marktamtbeamten Auskünfte erteilten und Beschwerden entgegennahmen. In Zeiten des allgemeinen Lebensmittelmangels überwogen letztere. Der Oberinspector steuerte auf einen sanguinisch aussehenden Marktamtmitarbeiter zu und brummte, als er vor ihm stand: „Stankowitz …“
Der wurde beim Anblick des Oberinspectors blass, fertigte die Frau, die gerade eine Beschwerde bei ihm vorbrachte, mit einigen unfreundlichen Worten ab und wandte sich Nechyba zu:
„Was gibt’s? Was hab ich verbrochen?“
„Reden S’ net so deppert daher, Stankowitz. Was Sie verbrochen haben, interessiert mich nicht. Was Sie nicht g’macht haben, das interessiert mich.“
„Und das wäre?“
„Sie haben Ihre Aufsichtspflicht aufs Sträflichste vernachlässigt. Die Fratschlerinnen und die Schieber am Markt machen, was sie wollen. Die tanzen euch Marktamtlern auf der Nasn umadum.“
Stankowitz machte eine müde Handbewegung.
„Ich bitt Sie! Sehen S’ net, was da los ist? Da gehts zu wie in einem Irrenhaus.“
Nechyba knallte einen fetten grünen Buschen, aus dem vier gelbe Rüben herauslugten, auf den Tisch und fauchte: „Da! Da schaun S’! Das hat mir eine Fratschlerin gerade als ein Kilo Rüben verkauft. Haben S’ a Messer und a Waage da?“
Stankowitz gab Nechyba ein Zeichen, ihm in die hinteren Räume des Marktamtes zu folgen. Dort stand eine Waage, auf die der Oberinspektor das Büschel warf.
„Da schaun S’! Das is net einmal ein Kilo. Da fehlen sechs Deka. Und jetzt geben S’ mir ein Messer! Jetzt schneid ma das Grünzeug ab.“
Stankowitz schnitt den Blätterbuschen ab und legte die vier Rüben noch einmal auf die Waage. Sie wogen 42 Deka.
„Und das haben S’ als einen Kilo Rüben gekauft?“
„Sie sagen es.“
„Bei wem?“
„Bei einer Fratschlerin, die ich von früher net kenn …“
„Stand 452 bis 454?“
„A junge, fesche Person.“
„Das is die Bier-Fini. Kommen S’, statt ma ihr einen Besuch ab.“
„Fini, was machst denn für Sachen?“, grantelte Stankowitz die Fratschlerin an. Er schnappte sich einige Büschel gelbe Rüben, zückte sein Taschenmesser und begann das Grün abzuschneiden.
„Bist narrisch Theo? Was tuast denn da?“
„Ich schneid das Grün von deinen Rüben ab. Dann wirst sie neu wiegen und ohne dem Viehfutter drauf verkaufen.“
„Aber da verdien i ja nix mehr!“
„Du verkaufst die Rüben sowieso zum amtlich zugelassen Höchstpreis.“ „Wennst net sofort aufhörst, meine Ware zu beschädigen, ruf i die He16.“ Nechyba, der mit stoischer Ruhe der Auseinandersetzung zugeschaut und zugehört hatte, räusperte sich und zückte seine k. k. Polizeiagenten Kokarde.
„Die is eh schon da.“
„Na hallo! Was san Sie für einer?“
„Der Hallo is schon g’storben. Der liegt neben dem Heast am Zentralfriedhof. Und um Ihre Frage zu beantworten: Ich bin der, der große Lust hat, Sie wegen Preistreiberei und gewerbsmäßigen Betrugs anzuzeigen.“
Die Gesichtszüge der Bier-Fini, der Josefine Buhl, die gerade noch wutverzerrt waren, wurden weich. Mit einem picksüßen Lächeln näherte sie sich Nechyba und schnurrte:
„Aber das würden Sie doch nie tun, Herr Inspector …“
„Oberinspector …“
„Oh, là, là! Oberinspector …“, raunte die Fini und drückte ihren Busen an Nechybas Bauch. Der machte einen Schritt zurück und brummte:
„Bleiben S’ mir vom Leib.“
„Bitte um Entschuldigung, Herr Oberinspector. Ich wollt’ ja nur lieb sein.“
„Lieb können S’ zu Ihrem Gatten sein.“
Finis Miene verdüsterte sich und sie begann zu jammern:
„Mein Gatte? Mein Gatte … der is in Kriegsgefangenschaft … in russischer … und i steh allanich mit dem G’schrappn da …“
Dabei machte sie mit dem Kopf einen Schlenker hin zu einem etwa zwölfjährigen Buben, der blass in einer Ecke stand und regungslos die Szene beobachtete.
„Scheißkrieg!“, erklang eine Frauenstimme aus der Menschenmenge, die sich mittlerweile um den Marktstand gebildet hatte. Und eine andere keifte: „Geh! Die Fini braucht gar net auf oam tuan. Die hat eh einen G’schamsterer, der ihr das Bett wärmt.“
Just in diesem Moment beobachtete Nechyba einen Schatten, der sich hinten im Marktstand befand und nun eiligst das Weite suchte.
Am nächsten Tag nach Dienstschluss machte der Oberinspector, so wie fast an jedem Abend, einen Spaziergang über den Naschmarkt. Langsam schob er sich durch die Menschenmassen, die so wie er auf der Suche nach leistbarem Gemüse oder Obst waren. Dazwischen wurden immer wieder Kisten von Pferdefuhrwerken abgeladen. Die Kutscher fluchten, die hungrigen Menschen drängten und die Pferde ließen dicke Pferdeäpfel auf das Pflaster fallen. Faktum war, dass es nie genug Ware gab und es deshalb immer wieder zu hässlichen, tumultartigen Szenen kam, bei denen die uniformierte Polizei und die Ordnungskräfte des Marktamts einschreiten mussten. Als Nechyba am Stand der Bier-Fini vorbeiging, bekam er Lust auf ein kühles Bier. Also steuerte er auf die Fratschlerin zu. Sie sah ihn und setzte augenblicklich ihr picksüßes Lächeln auf.
„Ah, der Herr Oberinspector! Was darf ’s denn sein?“
Leicht vorgebeugt flüsterte sie ihm zu:
„I hätt heut frische Marillen für Sie …“
Nechyba bekam einen Riesenappetit auf Marillenknödel. Also nickte er und folgte der Fratschlerin in den Stand hinein.
„Die Marillen biet i net draußen bei den anderen Sachen an. Die hab i da herinnen. Nur für spezielle Kundschaft. Wie viel darf’s denn sein?“
„Naja … so zwei Kilo …“
Die Standlerin nahm ein großes Stanitzel und füllte es mit Marillen. Nechyba zahlte einen geschmalzenen Preis und fragte, da er noch immer Durst hatte:
„Sie ham doch den Spitznamen Bier-Fini, net wahr? I hätt so a Lust auf a Bier …“
„Na dann gehen S’ da gleich zum Nachbarstand durch. Dort ist mei Bua, und der gibt Ihnen ausm Eisschrank a Bier.“
Nechyba begab sich Josefine Juhls Anweisungen folgend in den Nachbarstand, ließ sich von Finis Sohn eine Flasche Bier aus dem Eisschrank geben und öffnete sie mit einem „Plopp“.
Plötzlich sah er ihn wieder – den Schatten, der sich eiligst päulisierte17.
„Theo? Warum sekkierst du mich?“
„Ich sekkier dich net. Ich möcht nur, dass du dich an die behördlich festgelegten Höchstpreise hältst.“
„Geh Theo! An die halt sich doch keiner.“
„Red keinen Stuss. Alle halten sich dran.“
„Aber nur bei der Ware, die’s öffentlich vorm Standl anbieten. Nicht bei den Sachen, die sie hinten im Standl lagern und unter der Hand verschachern. Glaubst, dass wenn i frische Marillen krieg – eh nur ein paar Kilo – dass i die vorn zu den von euch Marktamtlern festgelegten Preisen verkauf? I bin do net deppert! Die verkauf’ i an ausgewählte Kundschaft im Hinterstüberl. Zu Preisen, die i festleg.“
„Hör auf! Das will i gar net wissen. I red jetzt nur von den gelben Rüben, wo du das ganze Blattlwerk mitgewogen und zum von uns festgesetzten Preis für Rüben mitverkauft hast. Das ist Betrug. Das geht so nicht.“
Josefine Juhl ging um Stankowitz’ Schreibtisch herum, setzte sich auf die Schreibtischkante und lehnte sich zu dem auf einem Sessel sitzenden Beamten hinunter. Da es Juli und ganz schön heiß war, trug sie ihre Bluse weit aufgeknöpft. Sich zu Stankowitz vorbeugend gurrte sie: „Was geht so nicht?“
Als die Bier-Fini eine Viertelstunde später das Marktamt durch die Hintertür verließ, richtete sie mit einigen Handgriffen ihr zerrauftes Haar und ihre Bluse. Danach hob sie den Rock und zog sich ungeniert Strümpfe und Strumpfbänder, die arg verrutscht waren, hinauf. Dies geschah zum Gaudium einiger Rotzbuben, die sie beobachteten und anerkennend zu pfeifen begannen. Auch ein Kerl, der im Schatten des Marktamtes lehnte, sah ihr mit undurchdringlicher Miene zu.
„Beidl18 … g’schissener“, zischte es in sein Ohr. Der scharfe Stahl einer Messerklinge berührte Stankowitz’ Haut. Der Kerl hinter seinem Rücken setzte ihm das Messer brutal an den Hals und drängte ihn gegen die kühlen Kacheln der Wand.
„I stech di ab, du Sau.“
Der Atem des Kerls roch übel. „Bitte bitte … Nehmen S’ mein Portemonnaie, aber tun S’ ma nix.“
„Des nehm i ma sowieso.“
Mit Gewalt drückte er Stankowitz’ Gesicht zu Boden, der nach Urin und Putzmittel stank. Warm sickerte Blut den Hals hinunter. Vermengt mit Angstschweiß. Stankowitz begann zu wimmern und zu würgen.
„Ja! Speib di an … kumm … speib di an, du Oaschwarzn.“
„Bitte … bitte …“
„Nix bitte. Nix danke. Abdanken wirst.“
„Wa… wa… warum?“
„Weilst die Fini budert19 hast … du Beidl … du …“