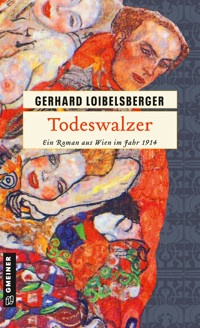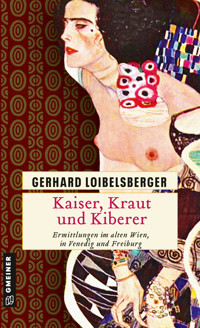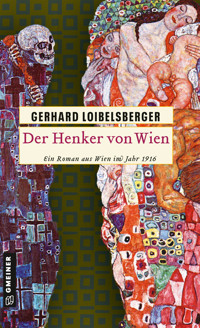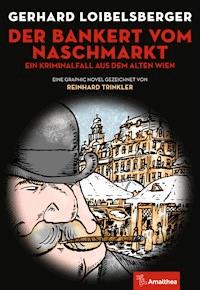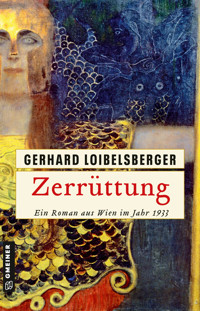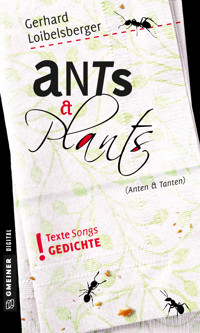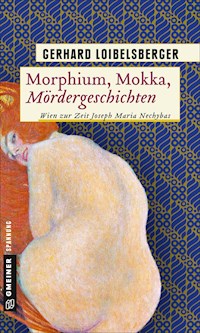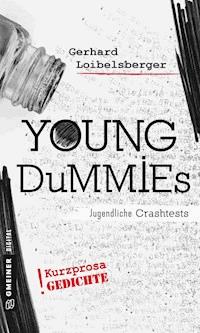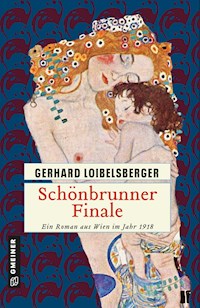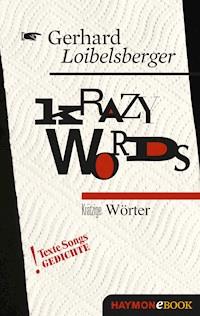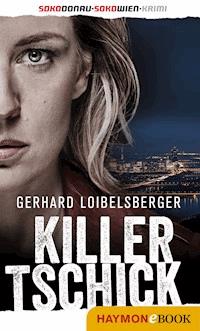
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
EIN ABSOLUTES MUSS FÜR KRIMI-SERIEN-FANS! Anna Hawlicek macht einen Buckel unter ihrem verschlissenen Wintermantel. Sie ist auf dem Weg zu ihrem Stammlokal, in dem sie immer Zigaretten kauft. Unter der Hand, versteht sich. Dieses Mal sind sie besonders billig. Und sie ist wenig später tot. Zur gleichen Zeit liegt ein junger Chinese in den Wiener Praterauen. Ebenfalls tot. Auf seinem Oberkörper hat jemand haufenweise Zigaretten ausgedämpft. Ein Zufall der Sorte zynisch? Oder ein ungeschriebenes Gesetz, das jene eliminiert, die zu viel wissen? Aber warum musste ausgerechnet die alte Hawlicek das Zeitliche segnen? PENNY LANZ MUSS UNTERTAUCHEN - EISKALTER SHOWDOWN FÜR SERIENLIEBLING Penny Lanz und ihre Kollegen Helmuth Nowak & Carl Ribarski von der SOKO Donau in Wien riechen Lunte. Denn was zunächst als harmloses Herzversagen einer Kettenraucherin aussieht, entpuppt sich schnell als undurchsichtiges Geflecht aus mafiösen Strukturen, Schmuggel und hochprofessioneller Geldwäsche. Der tote Chinese ist nämlich niemand Geringerer als der Ziehsohn von Mr. Dong, dem Statthalter der chinesischen Triaden in Wien - der verdächtigt wird, gefälschte Ware in großem Stil nach Österreich zu importieren. Und die Alte ist an hochgiften Schwarzmarktzigaretten gestorben. Immer fester verfangen sich Penny Lanz und ihre Kollegen in einem klebrigen Spinnennetz, aus dem sie sich kaum mehr befreien können … "Ich liebe die Serie SOKO Donau und warte immer sehnsüchtig auf die neuen Folgen. Die Wartezeit wurde mir mit 'Killer-Tschick' unglaublich versüßt. So viel wie hier erfährt man über Penny Lanz und ihre Kollegen im Fernsehen nicht. Und der Fall ist noch dazu so fesselnd, dass ich das Buch an zwei Abenden verschlungen habe." "Ein pfeilschneller Krimi, der mehrere Handlungsstränge gekonnt zu einem spannenden Ganzen verwebt. Undurchsichtig bis zum Schluss. Hoffentlich geht das Buch auch in Serie!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Loibelsberger
Killer-Tschick
SOKO-Donau-Krimi · SOKO-Wien-Krimi
Dieses Buch widme ich meiner Frau Lisa.
Bei Clementine Skorpil, Günter Kelz, Gerhard Körmer und Martin Mucha bedanke ich mich für sachdienliche Hinweise.
Pro Jahr werden 13 Milliarden Zigaretten verkauft, dazu kommen noch rund drei Milliarden Stück, die illegal verkauft und nicht versteuert werden.1
Salzburger Nachrichten
Dezember 2014
Prolog
Schwarzgraue Wellen klatschten an das mit massiven Felsblöcken gesicherte Donauufer. Angetrieben von einem polaren Nordwind, der auch Schnee mit sich führte. Keine zarten weißen Flocken, sondern Graupelschauer, der auf der Gesichtshaut kratzte wie eine rostige Rasierklinge. An diesem eisigen Februarabend ging niemand außer Haus, der nicht unbedingt musste. Oder sich einbildete, hinaus zu müssen. Der nicht ein unstillbares Verlangen nach Gemeinschaft, Menschen und Wärme hatte.
Die Alte machte einen Buckel unter ihrem verschlissenen Wintermantel und dem nicht minder alten Wolltuch, das sie sich um Kopf und Hals geschlungen hatte. Auf ihren krummen Beinen trippelte sie zittrig die Hauswände entlang. Von ihrer winzigen, unbeheizten Gemeindebauwohnung hin zu ihrem Stammlokal. Der böige Sturm machte ihr zu schaffen, fast hätte sie ein besonders heftiger Windstoß umgerissen, wenn sie sich nicht im letzten Moment an der Stange des Autobushaltezeichens festhalten hätte können. Keuchend stand sie da. Der Autobus kam und gab ihr Deckung vor dem Wind. Mit kleinen, unsicheren Schritten ging sie hinter ihm über die Straße. Der gegenüberliegende Gehsteig nahte. Keine Windböe. Und weiter, weiter! Plötzlich aufgeblendete Scheinwerfer, bösartiges Hupen, kreischende Bremsen, ein Reifen streifte ihre rechte Ferse. Der Fahrer schrie beim halb geöffneten Fenster hinaus: „Bist deppat, Oide?“
Hinauf auf den Gehsteig – geschafft! Ein Halteverbotsschild gab ihr Halt. Gerade rechtzeitig, denn eine besonders heftige Windböe riss ihr zur Hälfte das Wolltuch vom Kopf. Mit einer Hand klammerte sie sich an die Stange des Schildes, mit der anderen zog sie das Wolltuch wieder über. Nachdem sie verschnauft hatte, ging sie zielstrebig auf den beleuchteten Eingang ihres Stammbeisls2 zu, hinter dessen Tür sie verschwand.
In dem winzigen Beisl hingen dichte Rauchschwaden. Es war sehr warm und roch nach Bier, feuchten Mänteln, Achselschweiß und Gulaschsuppe. Sie drängte sich zwischen zwei fetten Männern bis zur Theke durch. Der Wirt begrüßte sie mit einem: „Na, wie hammas?3“
Sie ging auf die Frage nach ihrem Befinden nicht ein. Stattdessen stellte sie eine Gegenfrage: „Hast an Spe4?“
„Für di immer, Antschi-Tant.“
Er griff unter die Theke, zog ein Packerl Marlboro hervor und schüttelte eine Zigarette heraus, wobei das silberne Kettenarmband, das er am Handgelenk trug, rhythmisch hin und her hüpfte. ‚Antschi-Tant‘ Hawlicek griff gierig danach und beugte sich vor, damit ihr der Wirt Feuer geben konnte. Sie sog ihre faltigen Wangen ein, als sie einen tiefen Lungenzug nahm, hüstelte und seufzte dann zufrieden. Der massige Kerl rechts neben ihr rutschte vom Barhocker und sagte: „Komm Antschi, bitte setzen …“
Sie blickte ihn kurz an, blies ihm Rauch ins Gesicht und keifte: „Schiwkow! Saufkopf! Dafür zahl ich dir aber ka Trankl5 …“
„Geh Antschi! Ich heute flüssig. Da schau, Kohle!“
Bojko Schiwkows klassisch geschnittenes Gesicht strahlte, als er einen dicken Packen Euro-Scheine aus der Hosentasche zog und ihr unter die Nase hielt. Der Wirt, der der Alten inzwischen einen doppelten Rum hingestellt hatte, nickte brummend: „Mach dir kane Sorgen, der Schiwkow hat heut a Marie6.“
Die Alte nippte an ihrem Glas, starrte Schiwkow an und schnarrte: „Schickst deine Alte am Strich?“
Rundum Gelächter. Schiwkow lachte ebenfalls und nickte: „Idee ist gut. Aber ich habe keine Alte. Das ist ehrlich verdientes Geld.“
Ein dürrer Kerl mit faltigem Gesicht, der neben Schiwkow stand, höhnte: „Das is aber a Scherz jetzt.“
Wieder lachte die ganze Runde. Schiwkow war beleidigt. Er hielt dem Dürren das Geldpäckchen unter die Nase und insistierte: „Das ist ehrlich verdientes Geld. Habe ich mit Zigaretten verdient. Billige Zigaretten aus Ungarn. Hab ich gekauft und weiterverkauft. Auch dem Rudi.“
Er zeigte auf den Wirt, der nickte: „Ja, mir hat er auch an Schwung verkauft. Marlboro. Guter Stoff, die Piefkes würden sagen: allererste Sahne.“
Gelächter.
„Und Antschi-Tant? Wie schmecken s’ dir?“
„Eh guat. Gib ma zwa Packerln. Wie viel willst dafür.“
„Zwei Euro das Packl.“
„Des kann i mir gerade noch leisten …“
Nach Mitternacht, der Sturm hatte sich gelegt, wankte die Alte zurück über die Engerthstraße in ihre kalte Wohnung. Schiwkow hatte zwei weitere Lokalrunden spendiert und so hatte sie nicht nur ein ganzes Packerl von den eben erst erstandenen Marlboros geraucht, sondern auch einige Promille im Blut. Sie schloss die Wohnungstür, von der überall der Lack abblätterte, hinter sich ab und verriegelte sie. Dann drehte sie das Licht auf und schlurfte durch die Küche ins Zimmer. Sie setzte sich auf das ungemachte Bett, kramte in ihrer schäbigen Handtasche und machte mit zitternden Fingern das zweite Packerl Marlboro auf. Sie zündete sich eine an und inhalierte tief. Mehrmals. Plötzlich fühlte sie sich eigenartig. Krämpfe schüttelten ihren Oberkörper, sie fiel zu Boden, wo sie noch einige Zeit lang von Spasmen gebeutelt hin und her rollte und merkwürdige Geräusche von sich gab. Dann war Ruhe.
Zwei Wochen später
Penny Lanz hörte das nervtötende Piepsen des Weckers und stöhnte. Ihre Hand suchte den Störenfried, fand ihn und schaltete ihn aus. Dann versank sie wieder in Tiefschlaf.
Eineinhalb Stunden später kitzelten Sonnenstrahlen ihr Gesicht. Langsam wachte sie auf. O Gott! Ihr Schädel dröhnte. Nicht schon wieder Föhn! Mühsam richtete sie sich auf, ihre Füße schlüpften in die Hauspantoffeln. Sie stolperte ins Badezimmer. Das aufflackernde Neonlicht schmerzte in den Augen. Im Spiegelschrank suchte sie die Tabletten. Eine Tube und eine Medikamentenschachtel fielen zu Boden, bevor sie endlich die Glasverpackung mit den Kopfschmerztabletten fand. Unfokussiert wie sie war, schüttete sie viel zu viele Pillen auf ihre Handfläche. Egal! Die rechte Hand tastete nach dem Zahnputzbecher. Zum Glück war noch etwas Wasser von gestern Abend drinnen. Damit spülte sie drei Tabletten runter. Die restlichen deponierte sie am Waschbeckenrand, bevor sie zurück ins Schlafzimmer taumelte und sich ins Bett fallen ließ. Ich muss in der Dienststelle anrufen … ich muss in der Dienststelle anrufen … hämmerte es in ihrem Kopf. Eine Viertelstunde döste sie vor sich hin, dann begannen die Tabletten zu wirken. Wankend stand Penelope Lanz auf, tapste ins Vorzimmer zur ihrer Handtasche, kramte, fand endlich das Handy und wählte die Dienststelle.
„Dirnberger.“
„Chef, ich bin’s. Penny. Mir geht’s net gut.“
„Um Gottes willen, was is denn?“
„Föhn …“
„Ah ja! Ich versteh …“
„Ich hab Tabletten eing’worfen und komm jetzt dann. Tut mir leid …“
„Passen S’ aber beim Autofahren auf. Ich möchte nicht, dass Ihnen was g’schieht.“
„Ich pass schon auf. Danke …“
Eineinhalb Stunden später parkte Penny Lanz ihren Mini vor der Dienststelle der Sonderkommission am Wiener Donaukanal. Die Kopfschmerzen hatten sich zurückgezogen, sie drückten jetzt nur noch ein bisschen im Hinterkopf. Als sie ausstieg, fegte eine so heftige Böe des Föhnsturms über den Donaukanal, dass sie fast umgerissen worden wäre. Mit wehender blonder Mähne und flatternder Lederjacke flüchtete sie sich in die Wache.
„Morgen …“
Keine Menschenseele antwortete. Sie stellte ihre Handtasche auf den Schreibtisch und begab sich in Dirnbergers Büro. Als der Oberst sie sah, fragte er besorgt: „Sie sind schon da? Ich hab erst zu Mittag mit Ihnen gerechnet.“
„Es geht schon …“
„Sind Sie wirklich okay?“
„Ja …“
„Gut. Dann schau’n Sie bitte in die Engerthstraße 99 – 109. Das ist ein riesiger Gemeindebau. Dort hat man auf der Dreier Stiege a weibliche Leiche gefunden. Noch is unklar, ob’s a natürliche Todesursache gibt oder net. Ich hab den Wohlfahrt und die Frau Dr. Beck hingeschickt. Es wär mir sehr recht, wenn S’ die beiden Kollegen vor Ort unterstützen könnten.“
„Wo sind der Helmuth und der Carl?“
„Unten im Prater beim Wiener Hafen. Da is eine verstümmelte Leich g’funden worden. Wahrscheinlich a Chinese. Ich hab die beiden plus Wohlfahrt und Beck in der Früh dort owe7 g’schickt. Jetzt müssten aber Wohlfahrt und Beck schon in der Engerthstraße sein …“
„Ist gut! Bin schon unterwegs …“
*
„Des war a Kettenraucher …“
„Der Chinese?“
„Nein. Der, der ihn hamdraht hat.“
„Hamdraht?“
„Gekillt hat. Hearst, Carl! Das hast doch schon hundert Mal g’hört!“
„Daheim ist für mich kuschelig, angenehm, friedlich. Sich heimdrehen und dann tot sein – nee. Da sperrt sich mein Unterbewusstsein.“
„Wir Wiener sind halt dem Himmel sehr nah …“
Die Gerichtsmedizinerin Dr. Beck warf trocken ein: „Am Oberkörper von dem Asiaten sind etliche Zigaretten ausgedämpft worden.“
„Sag ich ja! Der, der das g’macht hat, war a Kettenraucher …“, insistierte Helmuth Nowak.
„Gefoltert. Armes Schwein. Hab so was zuletzt am Balkan gesehen.“
„Der Balkan beginnt am Rennweg. Das hat schon der Metternich8 g’sagt“, brummte Nowak. Carl Ribarski stand auf, schüttelte unwillig den Kopf und versuchte, die unangenehmen Erinnerungen an seinen Balkaneinsatz zu verjagen. Dr. Beck, die Gerichtsmedizinerin, stand ebenfalls auf und schnaufte: „Wahrscheinlich hat er noch andere Folterspuren … Ich schau mir das heute am Nachmittag genau an. Aber jetzt muss ich gehen. Der Oberst hat mich angerufen. Es gibt noch eine Leiche. In der Engerthstraße.“
„Franziska, du kannst mit mir mitfahren! Ich muss ja auch in die Engerthstraße.“ Franz Wohlfahrt, der Kriminaltechniker, packte hektisch seine Sachen zusammen. „Hier hab i eh alles erledigt. Die Reifenspuren vorne am Zufahrtsweg und dann die Schleifspuren der Leiche hierher. Sonst hab i nix g’funden. Leider hat der Täter kein Taschentüchl und auch keinen Ausweis verloren.“
Damit eilte er zu seinem Wagen, einem alten Volvo Kombi. Nowak starrte die Leiche an und brummte: „Wenn net zufällig ein Jogger hier Pipi g’macht hätte, wär die Leich in dem Buschwerk da vielleicht erst in ein paar Wochen entdeckt worden …“
„Und dann hätten wir auch keine Reifenspuren oder sonst etwas gehabt. Ich liebe Jogger. Was täten wir ohne sie?“
„Das kann ich dir schon sagen: Wir würden in der Dienststelle sitzen und gemütlich Kaffee trinken.“
„Glaub ich nicht. Da wären wir jetzt schon bei der anderen Leiche in der Engerlingstraße.“
„Engerthstraße, Carl. Engerthstraße!“
„Das ist doch dasselbe, Mensch. Komm, lass uns nachsehen, ob der China Boy im benachbarten Hafen jemandem abgeht.“
*
Es stank. In der Stiege 3, des Janecek Hofs, in der Engerthstraße 99–109, stank es. In jedem Stockwerk anders. Im Erdgeschoss nach Lammeintopf und mächtig viel Kreuzkümmel, im ersten Stock nach Kohl und im zweiten dann nach Verwesung. Augenblicklich begannen sich Pennys Kopfschmerzen mit eindrücklichem Hämmern zurückzumelden. Die Gruppeninspektorin musste kurz innehalten, sie schloss die Augen, strauchelte und wurde von kräftigen Armen aufgefangen.
„Hoppala! Aufpassen, gnä’ Frau!“ Und nach einer kurzen Pause: „Sie sollten da net weitergehen. Da fäult’s9 fürchterlich. Da liegt a verweste Leich drinnen. Kommen S’ in zwei Stunden wieder, dann is das alles weggeräumt.“
Penny schlug die Augen auf und schaute in das breite Gesicht einer Polizistin, deren weißblond gefärbtes Haar kurz geschnitten war und keck unter der Uniformmütze hervorblitzte. Penny bemühte sich, alleine auf ihren wackligen Beinen zu stehen und registrierte, dass die kräftigen Arme der Weißblonden gehörten.
„Geht’s wieder?“
Penny nickte, kramte ihren Dienstausweis aus der Lederjacke und stammelte: „Gruppeninspektorin Lanz, Sonderkommission. Mein Chef hat g’meint, ich soll mir das da anschauen.“
Die weißblonde Polizistin ließ Penny vorsichtig los und reichte ihr ein frisches Stofftaschentuch.
„Da! Nehmen S’ das. Die Alte da drinnen fäult, das is ka Bemmerl10.“
Dankbar nahm Penny das Taschentuch der Kollegin, presste es vor Nase und Mund und betrat die Wohnung. Ihre erste Erkenntnis: Die Bewohnerin war ein Messi. Mannshohe Stapel Zeitungen sowie Unmengen von leeren Zigarettenpackungen ließen keinen anderen Schluss zu. Letztere befanden sich in unzähligen Plastiksackerln11, Obst- und Gemüsekartons. Penny kämpfte sich durch die vollkommen zugemüllte Küche in das einzige Zimmer vor und erschrak. Auf dem Boden lagen zusammengekrümmt die Reste einer alten Frau. Das Gesicht ziemlich verwest, der Bauch aufgebläht von Fäulnisgasen, daher der Gestank. Penny hörte Schritte hinter sich, Franz Wohlfahrts Stimme erklang.
„Ja, was hamma denn da Schönes?“
Penny zuckte zusammen. Der Kriminaltechniker legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter und fuhr fort: „Hast du’s g’sehn? Ja? Na, dann kannst ja gehen. Das hier ist mein Job. Du kriegst die Fotos und alles, was wir am Tatort finden, sauber zusammengestellt und aufgelistet.“
„Hallo Penny! Franz hat Recht. Quäl dich nicht. Das hier ist unser Job.“
Lanz drehte sich um und grinste die Gerichtsmedizinerin gequält an: „Danke, Franziska. Das ist lieb. Von euch beiden … Danke Franz.“
„Is schon gut! Und jetzt geh bitte. Draußen is heute ein wirklich schöner Tag!“
*
„Ein schöner Tag …“, Penny schüttelte den brummenden Kopf. Nein, ein schöner Tag war, wenn man keine Leiche aus Gammelfleisch zu inspizieren hatte. Penny blieb vor dem riesigen Gemeindebau stehen und sah unschlüssig die Engerthstraße hinauf und hinunter. Die Vögel zwitscherten, die Alleebäume zeigten die ersten Knospen, und Penny Lanz spürte plötzlich ein nagendes Hungergefühl. Normalerweise wurde so ein Hungeranfall während der Dienstzeit mit einer Leberkäs-Semmel12 ruhiggestellt. Doch heute grauste ihr davor. Alleine, sich den Geruch von Leberkäse vorstellen zu müssen, verursachte ihr schon Gänsehaut. An diesen Föhntagen war eben nichts wie sonst. Und weil nichts wie sonst war, beschloss Penny die Engerthstraße zu überqueren und in das Beisl vis-à-vis zu gehen. Jetzt ein herzhaftes Gulasch und ein kleines Bier! Das würde helfen. Da es zwanzig Minuten vor zwölf war, bekam sie in der kleinen Gaststube gerade noch einen Sitzplatz an einem Tisch, an dem bereits ein bulliger Kerl hockte. Die resolute Kellnerin setzte die Gruppeninspektorin kurzerhand dorthin. Diese grüßte leise: „Mahlzeit!“
Über das nicht unhübsche Gesicht des Mannes huschte ein kurzes Lächeln, dann quatschte er konzentriert weiter in sein Handy. Irgendeine slawische Sprache, Penny konnte sie nicht identifizieren. Das Telefonat dauerte so lange, bis ihrem Tischnachbarn ein über die Tellerränder hängendes Schnitzel serviert wurde. Der Mann beendete abrupt das Gespräch, murmelte „Mahlzeit!“ in Richtung Penny und begann wie ein Wilder das Schnitzel zu zerteilen und zu verschlingen. Penny bewunderte seinen animalischen Appetit, denn sie selbst musste heute die Sache langsamer angehen. Obwohl sie hungrig war, durfte sie das Gulasch, das übrigens schön durchzogene Fleischstücke enthielt und einen sämigen dunklen Saft hatte, auf dem ein ganz zarter Fettspiegel glänzte, nicht zu hastig essen. Sie kannte ihren Magen. Der war im Moment noch von dem föhnbedingten Brechanfall sowie von den Medikamenten, die sie seit heute Morgen eingeworfen hatte, beleidigt. Mit Bedacht kaute sie das Fleisch und tunkte dazu immer wieder ein Stück des recht knusprigen Semmerls in den Gulaschsaft. Dazwischen trank sie kleine Schlucke Bier. Als sie fertig gegessen hatte, sagte ihr Vis-à-vis plötzlich: „Beste Gulasch von ganze Bezirk.“
Penny nickte und sah sich suchend um.
„Du brauchen Zahnstocher, ned wahr? Bojko dir welche bringen …“
Der muskulöse Mann sprang auf, ging zur Schank und schnappte sich dort ein schmales Glasgefäß, in dem die Zahnstocher einzeln verpackt steckten.
„Bin Stammgast hier, ich darf des.“
Beim Ausputzen der Fleischfasern aus ihren Zähnen kam Penny eine Idee.
„Wenn S’ Stammgast da in dem Beisl sind, kennen Sie vielleicht die Anna Hawlicek?“
„Die Antschi-Tant? Na freilich! Hab sie schon Zeit nicht gesehen.“
„War sie früher öfters da?“
„Na, jeden Tag. Is da g’sessen und hat gepofelt.13“
Der Mann zündete sich genussvoll eine Zigarette an.
„Wollen S’ a ane?“
„Ich rauch nicht. Außerdem ist rauchen doch in Gaststätten verboten.“
„Net da. Da is nur verboten, was stört den Wirt. Und Wirt raucht selber.“
„Aha …“
„Bist du Militante? Wirst du machen Anzeige?“
Diese Frage, die ihr Gegenüber ziemlich laut gestellt hatte, ließ die Gespräche an den Nebentischen verstummen. Penny registrierte, wie sie von allen Seiten feindselig angestarrt wurde.
„Nein, ganz sicher net. Wer rauchen will, soll rauchen. Das ist mir wurscht.“
Rundum wurde genickt und die unterbrochenen Gespräche lebten wieder auf.
„Hab dich noch nie g’sehn hier …“
„Bin auch das erste Mal da. Hab was zum Essen braucht. Hab in der Früh Schädelweh g’habt und nichts gefrühstückt.“
„Dir nix gut heute? Dann du brauchen Schnaps. Geh, Frau Hella, bringen S’ zwei Fernet.“
Danke, aber ich trinke im Dienst nichts. Diese Standardfloskel konnte sich die Gruppeninspektorin gerade noch verkneifen. Und dann wurde auch schon der Fernet serviert. Der Mann hob sein Glas und prostete ihr zu: „Servus! Ich bin Bojko und du?“
„Penny, Penny Lanz …“
„Na dann owe damit!“
Penny schloss die Augen und kippte mit Todesverachtung den Kräuterschnaps hinunter. Er brannte höllisch. Sie schüttelte sich, Schiwkow lachte.
„Musst du trinken öfter. Dann geht besser. Willst noch einen? Lad dich ein.“
Penny winkte ab.
„Penny, wieso bist hier in Beisl?“
„Na, wegen der Hawlicek.“
„Wegen der Antschi-Tant? Bist verwandt mit ihr?“
Penny nickte.
„Na, die hab ich gut schon zwei Wochen nix gesehen. Frau Hella, wann war die Antschi-Tant letztes Mal da?“
Die Kellnerin trat nachdenklich einige Schritte näher an den Tisch, wo die beiden saßen. Sie kratzte sich in ihren graumelierten Locken mit dem gelben Kugelschreiber, auf dem die Nummer eines Taxifunks stand, und murmelte: „Na ja, da wirst schon Recht haben, Bojko. An dem einen Abend, an dem so a grauslicher Sturm gangen is, war sie das letzte Mal da.“
„Können Sie mir genau sagen, wann das war?“
„Warten S’, ich schau einmal auf meinem Kalender nach. Weil an dem Tag war i beim Friseur und hab mi nachher fürchterlich geärgert. Weil bei dem Sturm war mei Frisur sofort wieder im Oasch.“
*
„Herrschaften, wir haben zwei Mordfälle.“
Mit dieser Feststellung eröffnete Oberst Otto Dirnberger die Dienstbesprechung am nächsten Morgen.
„Zwei? Wieso zwei? Zählt der Chineser doppelt?“
„Helmuth, hör bitte auf mit den blöden Scherzen. Die Lage ist durchaus ernst. Wir haben den … den Chineser … und wir haben die Alte.“
„Was für ’ne Alte?“, grunzte Ribarski und kratzte sich die unrasierte Visage.
Nun schaltete sich der Kriminaltechniker Franz Wohlfahrt ein: „Na die, die Penny und ich gestern schon leicht kompostiert in der Engerthstraße g’funden haben.“
„Was? Ist die nicht einfach so g’storben?“
„Kollegin Lanz, das wäre schön. Das ist aber nicht so“, replizierte Dirnberger. „Nach dem Telefonat, das ich vor zehn Minuten mit Frau Dr. Beck geführt hab, müssen wir davon ausgehen, dass sie vergiftet worden ist.“
„Vergiftet?“
„Arsen und Rattengift.“
Nowak grinste: „Na Mahlzeit!“
„Das ist net lustig, Helmuth.“
„Find i schon. Diesen Giftcocktail musst erst einmal zusammenmixen.“
Franz Wohlfahrt widersprach lakonisch: „Da brauchst net viel mixen. So ein Giftcocktail ist mehr oder weniger stark konzentriert in fast allen Schmuggelzigaretten drinnen. Vor allem, wenn der Tabak aus China kommt. China ist ja das größte Tabakanbauland der Welt. Und die Umweltstandards dort sind zum Vergessen. Was ich gestern in der Wohnung von der Alten g’sehn hab, hat die die Tschick14 ja förmlich g’fressen. Die war a totaler Nikotin Junkie.“
„Genau das hat mir Frau Dr. Beck am Telefon auch gesagt. Nur: dass die letzten Tschick, die die Alte geraucht hat, eine besonders hohe, sprich tödliche Konzentration von dem Zeug hatten. Das waren echte Killer-Tschick.“
„Da sollten wir mal nachhaken. Wenn das Zeug auf dem Markt ist, müsste es ja ’ne Handvoll Tote geben.“
„Carl hat Recht“, schaltete sich Penny ein. „Ich werde das gleich einmal checken.“
„Konzentrieren Sie sich auf plötzliche Todesfälle. Zeitraum? Na, sagen wir die letzten zwei Wochen. Vor allem alte, von Krankheiten geschwächte Menschen. Die haben laut Dr. Beck kaum eine Chance, wenn’s diese Killer-Tschick rauchen.“
„Killer-Tschick!“, Helmuth Nowak lachte laut auf. „Das klingt für mich wie Killer-Tomaten. Das war so ein Trash-Film vor etlichen Jahren. Apropos Film: Da fallt mir unser toter Jacky Chan das verblichene Schlitzaug, ein …“
„Alter Rassist …“, grinste Ribarski und gab Helmuth Nowak einen freundschaftlichen Rempler.
„Aber vielleicht sollten wir mal der Chinesen-Szene auf den Zahn fühlen. Wegen dem Toten und wegen der Killer-Tschick.“
„Von denen bekommt ihr doch nix raus. Da stoßt ihr auf eine Mauer des Schweigens.“
„Vielleicht sollten Carl und ich noch einmal hinunter in den Prater und zum Hafen schauen. Außerdem könnten wir das Gespräch mit Mr. Dong suchen.“
„Mit dem Paten der Chinesen-Szene?“
„Warum nicht? Der hat doch tausend Fäden in der Hand. Vielleicht kann der uns auch bei den Killer-Tschick weiterhelfen.“
„Ist in Ordnung, Herrschaften. Die Kollegin Lanz klemmt sich hinter den Computer und recherchiert, ob’s weitere plötzliche Todesfälle unter alten, starken Rauchern gibt. Der Kollege Wohlfahrt nimmt sich noch einmal die Zigaretten vor. Vielleicht kann er irgendwas über die Herkunft der Killer-Tschick herausfinden. Hellmuth, du und der Kollege Ribarski, ihr schaut euch noch einmal unten im Prater um und redet mit Mr. Dong. Das war’s, gemmas an!“
Ribarski nickte und Nowak murmelte beim Hinausgehen amüsiert: „Killer-Tschick … i pack’s net.“
*
Mr. Dong hatte Sorgen. Missmutig verließ er das schmucke Zweifamilienhaus in Wien Mauer, in dem er vor einigen Jahren mitsamt seiner Familie eingezogen war. Tja, ein Zweifamilienhaus für Europäer reichte gerade einmal aus für eine chinesische Großfamilie, wie die Dongs eine war. Dong Lu selbst hatte vier Kinder, eine Ehefrau, einen Bruder, zwei Schwestern sowie drei Cousins und eine Cousine. Weiters wohnte in seinem Haus eine Großmutter, die so alt war, dass keiner genau wusste – am wenigsten sie selbst –, wann sie geboren worden war. Das zweistöckige Gebäude war also bis unters Dach angefüllt mit quirligem chinesischem Leben, doch das bereitete ihm keine Sorgen. Das war normal. Nicht gewohnt war er, dass er bereits nach dem Frühstück die Hitze im Magen spürte. Sein Milz-Yang war beleidigt. Verursacht durch eine äußerst unerquickliche Affäre, bei der er höllisch aufpassen musste, dass sie ihm nicht aus den Händen glitt und er die Kontrolle verlor. Kontrolle. Das war ein zentrales Wort in Mr. Dongs Denken. In der Dong’schen Großfamilie kontrollierte jeder jeden und er, Mr. Dong, alle zusammen. Seine Schwestern kontrollierten die Kinder. Die Kinder kontrollierten die Cousine, die Cousine die Cousins, die Cousins seinen Bruder. Sein Bruder kontrollierte das Haus im Allgemeinen und die Großmutter im Besonderen. Diese wiederum kontrollierte alle zusammen und steckte ihr unappetitliches Riechorgan, aus dem büschelweise schwarze Haare sprossen, dauernd in Dinge, die sie nichts angingen. Auch bei Mr. Dong. Doch das bereitete ihm keine Sorgen. Das war Familie. Sorgen bereitete ihm dieser verdammte Halbstarke. Jimmy Lee, sein Adoptivsohn. Verfluchter Hochstapler. Kam sich wie der kleine Bruder von Bruce Lee vor. Nur weil er hin und wieder einmal Kung Fu trainierte. Damit konnte er die verdammten Langnasen beeindrucken. Ihn, Mr. Dong, keinesfalls. Denn er hatte in seiner Jugend ernsthaft Kung Fu trainiert und seit damals jeden Morgen seine Qi Gong-Übungen gemacht. Mit säuerlicher Miene erinnerte er sich, wie er einst Jimmy Lee in die Schranken weisen musste, als dieser die Grundregeln der kindlichen Pietät verletzt hatte. Der Junge hatte versucht, ihn als Tiger anzuspringen. Lu Dong aber machte den Kranich und wehrte ihn mit kühlem Kopf ab. Ein blitzschneller Beinstoß in den Unterleib brachte Jimmy Lee schließlich zu Fall. Dann war Lu Dong ihm auf die Kehle gestiegen, bis er blau im Gesicht geworden war. Seit damals hatte sich der Bengel gefügt. Und jetzt war er tot. Ein Umstand, der Mr. Dong Sorgen machte, als er im Fonds seines schwarzen 600er Mercedes saß und von seinem Chauffeur durch den dichten Wiener Morgenverkehr ins Büro gefahren wurde.
*
Nacht. Es regnete Schusterbuben. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn sich nicht unter die Regentropfen auch jede Menge Eisgraupeln gemischt hätten. Im peitschenden Wind stachen sie wie Nadeln. Genauer gesagt wie die Nadeln unzähliger Nähmaschinen, die die wenigen Menschen, die bei diesem Wetter durch die Straßen eilten, mit unzähligen Stichen perforieren oder vielleicht sogar ein Muster in deren Haut stechen wollten.
Schiwkow schüttelte sich wie ein nass gewordener Hund, als er sich im Schutz des Hausflurs befand. Endlich daheim! Müde und vom genossenen Alkohol leicht tapsig stapfte er die Stiegen zu seiner Wohnung hinauf. Er steckte den Schlüssel in das altmodische Türschloss und stutzte. Hatte er heute die Wohnungstür beim Weggehen nur ins Schloss fallen lassen? Er bemühte sich, sich zu erinnern. Sich am Kopf kratzend blieb er im Türspalt stehen. Plötzlich roch er kalten Zigarettenrauch vermischt mit Schweiß. Adrenalin schoss ein. Schiwkow war hellwach. Ein Tritt gegen die Tür. Rolle vorwärts hinein in die Wohnung. Ein Schatten schlägt auf ihn. Er rollt zur Seite, der Baseballschläger kracht auf den Küchenboden. Schiwkow packt den Schläger. Reißt an. Der andere lässt los. Ein zweiter Schatten springt Schiwkow in den Magen. Der stöhnt auf, rollt zur Seite, trifft mit dem Schläger ein Schienbein. Schmerzensgebrüll. Schiwkow packt einen Sessel und schleudert ihn einem Angreifer entgegen. Dann ist er wieder auf den Beinen. Den Baseballschläger in der Hand dreht er sich wie ein wildgewordener Derwisch im Kreis. Krachen, Schreien, Splittern. Ein am Boden kriechender Schatten. Der Baseballschläger donnert auf dessen Rücken. Dumpfer Aufprall. Schmerzgeheul. Wie von Sinnen schlägt Schiwkow zu. Glas und Porzellan splittern, Menschenknochen brechen, ein Holzstuhl wird gefällt und zerbricht. Ein Schatten schleppt den zweiten aus der Wohnung hinaus. Schiwkow hinterher. Tritte gegen die beiden. Die Treppe hinunter. Und immer wieder: Bam! Bam! Bam! Der Baseballschläger.
„Wos is denn da los? Seid’s ihr alle deppert g’worden?“
Der dicke Unterrainer, der im zweiten Stock des Hauses wohnte, stand in weißer Feinrippunterhose und weißem Feinrippleiberl in der aufgerissenen Wohnungstür, durch die sich ein Lichtstrom in das dunkle Stiegenhaus ergoss. Schiwkow erstarrte. Die beiden Schatten verflüchtigten sich.
„Wenn’s net sofort a Ruah gebt’s, ruf i die He15!“
Schiwkow stand keuchend vor Unterrainer. Ungeordnete Kleidung, wirres Haar, Baseballschläger in der Hand.
„Nix Polizei. Alles gut. Alles okay.“
„Wos is okay? Nix is okay.“
Unterrainers Schädel wurde knallrot und er schrie sich in Rage: „Du Tschusch16, du bulgarischer! Du glaubst wohl, du kannst dir hier alles erlauben, was? Aber net bei mir! Und da kannst zehn Baseballschläger ham, scheiß i ma nix. Weil wir sind da in Österreich, verstehst. In Österreich! Und da ham sich so dahergelaufene Gfraster17 wie du zu benehmen. Benehmen!!!“
Schiwkow machte einen Katzenbuckel und murmelte: „Schon gut, Chef. Alles gut. Wirklich. Kein Problem.“
Mittlerweile waren mehrere Haustüren geöffnet worden, und eine junge Nachbarin kommentierte die Schreierei spöttisch: „Schau Karli, schnell. Der Unterrainer in der Unterwäsch!“
Und die alte Nemeth keifte: „Halbnackert is er. Der soll sich genieren. Halbnackert umadumzuschreien.“
Unterrainers Kopf nahm eine normale Farbe an, seine Hände flatterten plötzlich schamhaft vor seinem Gemächt, dessen Konturen sich durch die weiße Unterhose abzeichneten, er stammelte: „Dass jetzt a Ruah is … A Ruah!“ Und schon war er in seiner Wohnung verschwunden, nicht ohne die Wohnungstür mit einem mächtigen Kracher hinter sich ins Schloss zu werfen. Die junge Nachbarin und ihr Freund Karli sahen ihm belustigt nach. Karli kommentierte zynisch: „Hast den braunen Streifen in seiner Untergatte18 g’sehn? Der hat sich beim Brüllen voll ang’schissen.“
*
Wie ein begossener Pudel schlich Schiwkow zurück in seine Wohnung. Oder genauer gesagt in das, was einmal seine Wohnung gewesen war. Zugegeben: Sie war nie ein Schmuckkästchen gewesen, sondern eher das Gegenteil. Aber der Anblick, der sich ihm jetzt bot, war einfach schrecklich. Der Küchenboden voller Splitter, einer der beiden Stühle zertrümmert, das schmutzige Geschirr, das überall herumgestanden war, in tausend Scherben. Dazu Blutspritzer am Boden und an den Wänden. Pfui Teufel! Nicht viel netter sah der nachfolgende Raum aus. Hier, wo sich einst sein kombiniertes Wohn- und Schlafzimmer befunden hatte, regierte das Chaos. Das Bett komplett aufgerissen, die Pölster und Matratzen aufgeschnitten, deren trauriges Innenleben aus Federn, Schaumgummi und Sprungfedern quer über den Boden verteilt. Der einzige Kasten in dem Raum stand sperrangelweit offen, alle Fächer waren herausgerissen, die Kleidungsstücke, die er sorgsam auf Kleiderhaken gehängt hatte, lagen nun überall verstreut am Boden. Was ihn besonders schmerzte, war die Tatsache, dass sein einziger dunkler Anzug, dessen Jackett innen ein Armani-Logo schmückte, ebenfalls am Boden lag. Zerknüllt und mit unappetitlichen braunen Flecken übersät. Mit ihm hatte sich einer der beiden Einbrecher, der offensichtlich in einen Hundehaufen gestiegen war, die Schuhe abgewischt. Ja, es stank im Zimmer. Nach Hundescheiße. Schiwkow riss das Fenster auf. Gierig pumpte er die frische Nachtluft in seine Lunge. Vor ihm lag der schmale Innenhof, steile, unverputzte Ziegelmauern, ein trister Baum, jahreszeitlich bedingt völlig kahl. Es gab noch zahlreiche weitere Fenster, die in den Innenhof hinausgingen, doch die meisten waren dunkel. Nur hinter einigen wenigen sah er Licht, das von Jalousien oder dicken Vorhängen stark gedämpft nach außen drang. Schiwkow fühlte sich plötzlich sehr allein. Verraten. Verfolgt. Ein Fremder in einem ihm nach wie vor fremden Land. Sollte er heimgehen? Nach Bulgarien? Bis heute Nacht hatte er sich eingebildet, dass er hier daheim war. Hier in dem alten Zinshaus, das noch Gemeinschafts-WCs am Gang hatte und in dem ein kunterbuntes Völkchen wohnte. Wie zum Beispiel der dicke Herr Unterrainer, gesundheitsbedingt in Frühpension, dem er immer im Frühjahr die Reifen seines Fahrrads aufgepumpt hatte. Ein Fahrrad, mit dem Unterrainer tagtäglich auf die Donauinsel zu seinem Badeplatz fuhr. Oder die alte Nemeth, der er, wenn sie krank war und nicht außer Haus gehen konnte, regelmäßig die Einkäufe erledigte. Oder die beiden Studenten. Karli und Carola. Dem schmalbrüstigen Studenten Karli hatte er beim Einziehen einen Kasten sowie den Rahmen des Doppelbetts in den zweiten Stock hinaufgeschleppt. Das hätte der Karli, der Schwachmatiker, alleine nie geschafft. Und jetzt? Keiner hatte ihm geholfen. Im Gegenteil. Schiwkow steckte sich eine Zigarette an. Er inhalierte tief. Mehrmals. Bis ihm ein ganz klein wenig schwindelig wurde. Dann kam ihm eine böse Idee. Gleich morgen Früh würde er Unterrainer einen Denkzettel verpassen. Denn Rache ist Blutwurst. Eine Wiener Redewendung, die er von Unterrainer aufgeschnappt hatte. Früher, als sie noch miteinander geredet hatten.
*
Die Nacht war lang gewesen. Mädelsabend, wie Franziska Beck zu sagen pflegte. Und den die beiden alleinstehenden Frauen immer mit ziemlich viel Alkohol feierten. Die Gerichtsmedizinerin war Penny vom ersten Augenblick an sympathisch gewesen und so sind sie sehr schnell per Du geworden. Gestern Abend war Franziska Beck mit zwei fetten Rindersteaks plötzlich vor Pennys Tür gestanden.
„’nen Rotwein haste ja immer daheim …“, waren ihre Begrüßungsworte und Penny lachte. Ja, so war sie, die Frau Doktor Beck. Unberechenbar, spontan und voller Ideen. Penny, die auf der Couch gelegen und gelesen hatte, war dort eingeschlafen. Verschlafen ließ sie Franziska Beck in die Wohnung. Die zog brav ihre Schuhe aus und watschelte dann in die Küche. Dort machte sie sich zu schaffen – so als ob es ihre wäre. Penny grinste noch immer über Franziskas Gehweise. Sobald die mollige Gerichtsmedizinerin ihre Schuhe ausgezogen hatte und bloßfüßig unterwegs war, erinnerte ihr Gang an den einer Ente. Indem sie Franziskas Watschelgang nachahmte, tänzelte sie zur Stereoanlage, wo sie eine Guns N’ Roses-CD einlegte. Die Liveversion von ‚Knockin’ on Heaven’s Door‘.
„Franziska! Speziell für dich! Ein Song über deine Kundschaft …“
Beck kam mit zwei Rotweingläsern aus der Küche, reichte eines Penny, lauschte kurz und grummelte dann: „Na, da hab ich doch so meine Zweifel. Meine Kundschaft klopft nicht an die Himmelstür. Die, die ich untersuche, läuten meist an der Höllenpforte. ‚Hells Bells‘ von AC/DC wäre eher angebracht.“
„Kannst du haben. Soll ich’s auflegen?“
„Nee. Nicht jetzt. Vielleicht nach dem Essen, damit man unsere Verdauungsgeräusche nicht so hört …“
Penny musste schmunzeln. Zum Lachen fehlte ihr im Moment die Luft. Ja, sie war nach der Völlerei gestern Abend heute Morgen im Prater unterwegs. Joggend. Vom Praterstern vor zum Lusthaus. Sie war schon ziemlich weit: bei der Ostbahnbrücke, die über den grünen Prater und die Hauptallee führte. Plötzlich riss sie das wilde Gebimmel eines Fahrrades aus ihren Gedanken.
*
Schiwkow schlief schlecht. Kein Wunder, in dem Müllhaufen! Außerdem sickerte der leicht süßliche Gestank von Hundescheiße permanent in seinen Schlaf ein, so dass ihn Alpträume von riesigen kackenden Hunden und an seinen Schuhen klebenden Hundeexkrementen quälten. Nach etwas mehr als vier Stunden Schlaf wachte er auf, torkelte zur Wasserleitung, fand ein Glas, das nicht zerbrochen war, und trank gierig. Dadurch einigermaßen Klarheit im Kopf gewinnend schauerte ihn. Bloßfüßig war er in seinem Dusel in die Küche getaumelt. Nur mit allergrößtem Glück war er nicht in eine der zahlreichen Scherben getreten. Vorsichtig tänzelte er nun zurück ins Schlafzimmer, zog sich Socken und Schuhe an, schnappte sich einen Besen und begann die Scherben, mit denen der Küchenboden übersät war, zusammenzukehren. Als dies geschehen war, kam er auf der Gangtoilette seinem Harndrang nach und betrat dann relativ wach und einigermaßen bei Sinnen seine Wohnung. Beim Anblick des Haufens Scherben in der Mitte der Küche kam ihm eine Idee. Die großen Glasscherben und Keramiktrümmer warf er in den Abfalleimer. Die kleinteiligen Scherben kehrte er feinsäuberlich auf eine Schaufel und ging auf leisen Sohlen ein Stockwerk tiefer. Vorsichtig hob er das Haushaltsschauferl hinauf zum Briefschlitz des Postkastens, auf dem in geschwungener Schreibschrift R. Unterrainer stand, und leerte langsam und behutsam, sodass auch nicht der kleinste Splitter verlorenging, die Scherben in den Postkasten. Als er zurück ins dritte Stockwerk stieg, stellte er sich vor, wie Unterrainer durch den Schlitz hineingriff und sich die Finger verletzte. Oder: wie sich beim Aufsperren des Postkastens eine Flut von Splittern über Unterrainer ergießen würde. In seiner Wohnung wusch sich Bojko Gesicht, Schädel und Oberkörper mit kaltem Wasser, zog sich ein frisches T-Shirt und einen frisch gewaschenen Pullover darüber an, prüfte, ob seine Lederjacke noch nass war, und schlüpfte hinein. Sie fühlte sich etwas feucht und steif an, aber das würde sich geben. Dann schnappte er sich seinen hydraulischen Bolzenschneider, den er in eine eigens angefertigte seitliche Haltevorrichtung steckte. Die hatte ihm ein türkischer Schuster im Alliiertenviertel aus Leder genäht, so dass er das Gerät ähnlich wie einen schweren Revolver seitlich unter dem Arm tragen konnte. Leise, um ja kein unnötiges Geräusch in der sonntäglichen Morgenruhe zu verursachen, stieg Schiwkow die vier Stockwerke in den Keller des Hauses hinab. Dort knipste er den Lichtschalter an und ging vor zum Kellerabteil Unterrainers, das mit einem Vorhängeschloss abgesperrt war. Mit bösem Grinsen griff Bojko zu seinem hydraulischen Bolzenschneider und startete ihn. Es gab ein kurzes, knackendes Geräusch und der Metallbügel des Vorhängeschlosses war zweigeteilt. Bojko steckte das geknackte Schloss in die Jackentasche, öffnete die Kellertür, und vor ihm an der Wand hing das picobello geputzte Unterrainer’sche Waffenrad. Ein Modell aus den 1940er Jahren, von Steyr angefertigt und unter Sammlern sehr begehrt. Er hob das Rad herunter und führte es zum Ausgang. Unterrainers Kellertür ließ er sperrangelweit offen stehen. Vielleicht fladerten19 ihm andere Hausbewohner noch ein paar Sachen. Strafe muss sein.