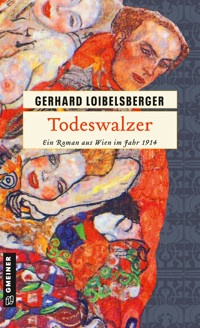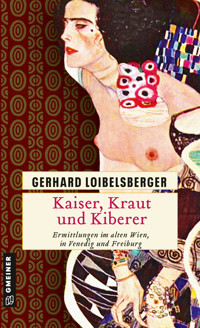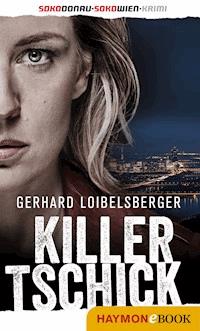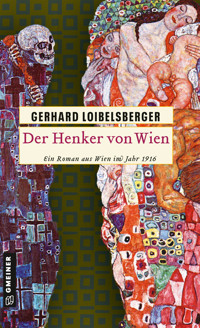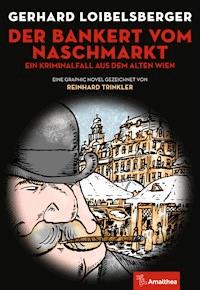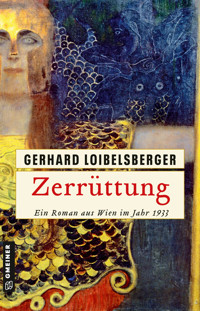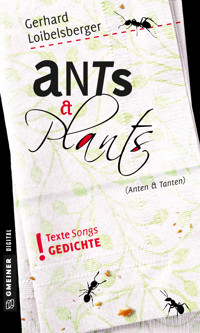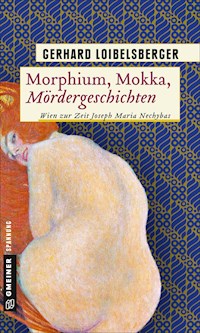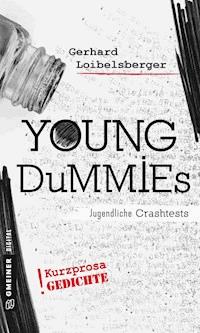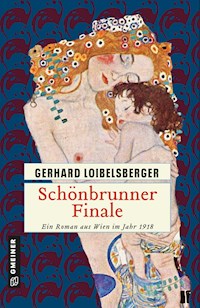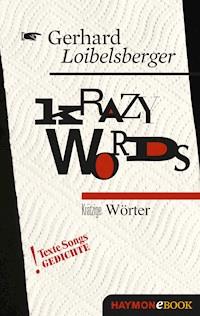11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Die Hölle ist in uns. Und der Teufel, in Gestalt eines Profikillers, sucht das Touristenparadies Venedig heim. Nackte Knabenleichen treiben in den Kanälen und die Medien sprechen bereits vom »Venedig-Ripper«. Eltern reagieren panisch, wollen ihre Kinder einsperren. Wurden Pornos gedreht? Oder steckt ein perverser Einzeltäter hinter den Morden? Privatdetektiv Lupino Severino und Commissario Ludovico Ranieri stochern im Nebel, doch sie müssen den Täter fassen, bevor es weitere Opfer gibt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gerhard Loibelsberger
Quadriga
Venedig-Thriller
Zum Buch
Tod in den KanälenIm Canal Grande treibt eine nackte Knabenleiche. Es bleibt aber nicht bei dieser einen Leiche. Zwei weitere Kinder werden entführt und schwimmen wenig später tot in den Kanälen Venedigs. Eine Journalistin prägt den Begriff ›Venedig-Ripper‹. Der ermittelnde Kommissar gerät deshalb mit ihr in Streit, es kommt zu einem Eklat und er wird vom Dienst suspendiert. Vom Vater des ersten Opfers wird der ehemalige Polizist und nunmehrige Fremdenführer und Privatdetektiv Lupino Severino engagiert. Schließlich verschwindet ein vierter Knabe und plötzlich mischt sich auch die lokale Mafia in die Ermittlungen ein.
Ein mörderischer, ironischer und auch sehr kulinarischer Venedig-Krimi, der von menschlichen Abgründen, Begierden und Schwächen sowie von der Macht des Geldes erzählt. Und die ›Quadriga‹, vier Pferde wahrscheinlich aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert, die auf der Loggia des Doms von San Marco steht, spielt dabei eine mysteriöse Rolle.
Gerhard Loibelsberger, geboren 1957 in Wien, startete 2009 mit den »Naschmarkt-Morden« eine Serie historischer Kriminalromane rund um den schwergewichtigen Inspector Joseph Maria Nechyba. 2010 wurden »Die Naschmarkt-Morde« für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Darüber hinaus wurden die Werke des Autors bereits mit dem silbernen sowie goldenen HOMER Literaturpreis ausgezeichnet. Im Jahr 2017 erschienen der Italien-Thriller »Im Namen des Paten« – als Fortsetzung des Venedig-Thrillers »Quadriga« – sowie der erste Nechyba-Comic »Der Bankert vom Naschmarkt«. Zu Loibelsbergers 60. Geburtstag erschien der Lyrik-Band »Ants & Plants« als E-Book. Infos unter: www.loibelsberger.at
www.loibelsberger.at
Bisherige Veröffentlichungen:
Schönbrunner Finale (2018)
Ants and Plants (E-Book only, 2017)
Der Henker von Wien (2015)
Wiener Seele (2014)
Kaiser, Kraut und Kiberer (2014)
Todeswalzer (2013)
Quadriga (2012)
Nechybas Wien (2012)
Mord und Brand (2011)
Reigen des Todes (2010)
Die Naschmarkt-Morde (2009)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
© Originalausgabe 2012, Gmeiner-Verlag
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © euregiocontent/fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5726-5
Widmung
Dieses Buch widme ich meiner geliebten Lisa, ohne die es nie entstanden wäre.
Mein besonderer Dank gilt meiner Italienischlehrerin Veronica, die viele wertvolle Beiträge geliefert hat.
Ein Dankeschön auch an meine Lektorin Claudia, die an dieses Buch von Anfang an geglaubt hat.
Prolog
Signor Cecchetti war müde. Trotzdem wieselte der alte Mann von Nachbar zu Nachbar, kreuz und quer durch den Dorsoduro. Ein von Angst Getriebener? Nein. Es war Panik. Sie ließ ihn nachts nicht schlafen, und untertags trieb sie ihn vor sich her. Von einem Caffè zur benachbarten Bar, von der Bar zur nächsten Osteria, von der Osteria zu Bekannten, von Bekannten zu einer Trattoria. Weiter, immer weiter und weiter. Seine Füße schmerzten. Doch was war das schon gegen den Schmerz der Seele? Sein ganzes Leben lang war er stolz und zurückhaltend gewesen. Ein Mensch, der am liebsten mit sich selbst allein war. Doch jetzt, auf seine alten Tage, musste er hinaus. Zu den Menschen, zu den Nachbarn, zu den Bekannten und auch zu Unbekannten. Wie ein Hamster im Rad lief er, gekleidet in seinen grauen Arbeitsmantel, der wie immer frisch gewaschen und tadellos gebügelt war, durch das Viertel Dorsoduro. Er besuchte selbst solche Leute, mit denen er vor Jahren das letzte Mal Kontakt gehabt hatte. Getrieben von unermesslicher Angst. Immer das Bild von Giulietta vor Augen. Wie sie in einem kahlen Raum unter einem kalten, unbarmherzig flackernden Licht saß und ihn anflehte. Mit vor Entsetzen irrem Blick und zerschlagenem Gesicht. Wie sie dasaß und stammelnd einen ihr vorgehaltenen Text las. Dieses Bild hatte sich unauslöschlich in ihm eingebrannt. Als sie mit dem Text fertig gewesen war, hatte sie in die Kamera geblickt und geflüstert: »Aiuto! Papà … aiutami!1«
Dieses Video, das man ihm auf einer DVD zugespielt hatte, war die Ursache seiner Panik. Genau so, wie es die Entführer seiner Tochter gefordert hatten, rannte er im ganzen Viertel herum und erzählte es allen. Dass er nämlich so bald wie möglich verreisen und seine Tochter, sein einziges Kind, dringend in den USA besuchen müsse. Seine einzige Tochter, die vor ein paar Jahren ausgewandert war. Circa ein Vierteljahr würde er fort sein. Deshalb hatte er einen Vertreter gesucht und auch gefunden. Dieser würde seine Rahmenmacher- und Vergolderwerkstatt während seiner Abwesenheit führen.
Drei Tage war er nun schon unterwegs gewesen. Als er am Abend des dritten Tages mit vor Erschöpfung zitternden Händen das Tor seines Hauses aufsperrte und die steile Treppe, die neben seiner Werkstatt zur Wohnung emporführt, hinaufstieg, war er völlig fertig. Oben angekommen machte er Licht und ließ sich erschöpft auf einen Küchenstuhl fallen. Nachdem er minutenlang so verharrt hatte, stand er auf, schlurfte zum Vorratsschrank, nahm eine Flasche Grappa heraus, setzte an und machte einen langen Schluck. Dann ging er zu dem Stuhl zurück, stellte die Flasche auf den Küchentisch und begann hemmungslos zu weinen. Der Schwall seiner Tränen überflutete die Gläser der Brille. Er nahm sie ab und als er sie auf den Küchentisch legte, hörte er plötzlich ein Knirschen hinter sich. Gänsehaut. Eiskaltes Prickeln. Schauder. Aufstehen. Bleischwere Glieder. Atem im Genick. Kräftige Hände links und rechts am Hals. Stahlharter Griff. Luft!
»Aiuto!«
Wild rudernde Arme. Klirrend zerschellte die Grappaflasche. Würgen. Röcheln. Alles dunkel. Dunkel. Dunkel. Und aus weiter Ferne eine Stimme:
»Cecchetti, il tuo sostituto è qui …2«
1Hilfe! Papa hilf mir!
2Cecchetti, dein Vertreter ist da …
Ti amo
Eins
Der Asiate riss den Mund auf. Er stieß heisere Schreie aus und gestikulierte wild. Eine Gruppe weiterer Asiaten drängte sich lärmend an das Geländer des Ponte dell’Accademia und deutete ins trübe Wasser des Canal Grande. Andere Touristen blieben stehen, ein fleischiger Amerikaner in Hawaiihemd, Shorts und Sandalen rief: »O my god!« Ein Gondoliere stand mit einem Kollegen am Ankerplatz neben der Brücke und hielt ein Vormittagsschwätzchen. Neugierig geworden ging er mit federnden Schritten die Steinstiegen hinunter zum Kanal. Als er entdeckte, was all die Gaffer anstarrten, fischte er aus seiner weiten, weißen Hose ein Handy, wählte hektisch und gab einen Schwall Sätze in venezianischem Dialekt von sich. Dabei zuckte sein freier Arm hektisch durch die Luft. Sein Kollege hörte, was er sagte, und sprintete nun ebenfalls über die ausgetretenen Steinstufen hinunter. Die beiden Gondolieri sprangen in eine der Gondeln. Während der eine heftig rudernd das Boot unter dem Ponte dell’Accademia durchführte, saß der andere im vorderen Gondelteil und starrte angestrengt auf das Wasser. Mittlerweile hatte sich eine dichte Menschenmenge auf der Brücke versammelt. Passanten, die keine Zeit oder Lust zum Gaffen hatten, mussten sich mühsam durch die Schaulustigen drängen. Dabei kam es zu allerlei Rempeleien, ein dicker deutscher Tourist und ein bunt tätowierter Brite wurden handgreiflich. Der Brite hieb dem Dicken die Faust ins Gesicht. Dieser wankte kurz und schlug dann wie ein wildes Tier um sich. Er traf den Briten, seine eigene Frau sowie andere Unbeteiligte. Glücklicherweise wurde er von seinem Sohn und einigen Umstehenden gepackt und an weiteren Rundumschlägen gehindert. Der kurz geschorene Brite nutzte diese Schwäche des Gegners, spuckte ihm ins Gesicht und verschwand blitzartig in der Menschenmenge.
Inzwischen näherte sich vom Rialto ein Polizeiboot dem Ponte dell’Accademia. Die Gondel mit den beiden Gondolieri kam unter der Brücke ebenfalls wieder zum Vorschein. In ihr lag ein Bündel nacktes Fleisch. Sie fuhr zum Anlegesteg zurück, wo sich bereits die Kellner der angrenzenden Bar sowie unzählige Schaulustige drängten. Die Gondolieri halfen, das Stück Fleisch, das nun als Knabenkörper erkennbar war, auf den Steinboden des Kais zu legen. Das Polizeiboot legte an, drei Polizisten sprangen auf den Bootssteg. Einer gab seinen Kollegen leise Weisungen, worauf diese entschlossen die Menge zurückdrängten. Er selbst trat auf den Knabenkörper zu, den die Gondolieri seitlich auf den Boden gelegt hatten. Er streifte sich Plastikhandschuhe über und drehte die Leiche vorsichtig in Rückenlage. Ein Raunen ging durch die Menge. Aus dem Munde des Knaben baumelte schwarzgrüner Seetang, der schleimig glänzte. Algen verklebten sein Haar und Teile des Gesichts. Das Raunen der Gaffer veranlasste den Polizisten, eine unwillige Kopfbewegung zu machen. Er gab seinen Kollegen mit einem Handzeichen zu verstehen: Verscheucht sie endlich! Ein weiterer Polizist, der Fahrer, der das Motorboot an der Mole angebunden hatte, half nun seinen beiden Kollegen, die sensationslüsterne Menge zurückzudrängen. Der bei dem Knaben stehende Beamte sprach in sein Handy, dann begann er die beiden Gondolieri, die den Knabenkörper aus dem Wasser geholt hatten, zu befragen.
Zwei Vaporetti hatten kurz zuvor bei der Landestelle Accademia angelegt, und der übliche Touristenschwall ergoss sich auf die schmale Piazza vor der Brücke. Wobei es einen recht beachtlichen Teil davon ein Stück weiter zu der Menschentraube hinzog, die sich gebildet hatte. Die Neuankömmlinge wollten natürlich sehen, was hier los sei. Sie drängten von hinten in die Menge. Diese wiederum schob nach vorn, ungeachtet der Bemühungen der drei Polizisten, sie aufzuhalten. Als der Kreis um den Knabenkörper immer enger wurde, nahm der Polizist, der die Amtshandlung leitete, das schmale Bündel Mensch in seine Arme und trug es über den Steg zum Polizeiboot hinaus. Er hatte das Boot noch nicht erreicht, als ein klagender Aufschrei die mittägliche Schwüle zerriss. Schlagend, tretend und wie irre brüllend stürzte ein groß gewachsener Mann in langen, grauen Stoffhosen und weißem Polohemd dem Polizisten nach. Er versuchte, ihm den Knaben zu entreißen. Der Polizist taumelte, ließ aber nicht los und gab dem Angreifer schließlich einen Tritt. Dieser rutschte aus und fiel rücklings mit einem lauten Platscher ins schmutzige Wasser. Die anderen Polizisten eilten herbei, zwei halfen ihrem Vorgesetzten, die Leiche auf dem Polizeiboot zu verstauen. Der dritte bückte sich und reichte dem im Wasser wild um sich Schlagenden die Hand. Mühsam zog er ihn auf den Steg, ein Polizist kam vom Boot zurück, trat hinter den Mann und verpasste ihm mit routinierten Griffen Handschellen. Der völlig durchnässte Angreifer hatte aufgehört zu schreien. Er rang nach Luft, hustete, spuckte und würgte Wasser. Die Polizisten zogen ihn aufs Boot und zwangen ihn, sich zu setzen. Mit aufheulendem Motor legte das Polizeiboot ab. Plötzlich schrie der Gefesselte, den Lärm des Motors übertönend:
»Mein Sohn! Was habt ihr mit meinem Sohn getan?«
Zwei
»No, no, no, Signori! Nicht diese enormi Spotlights. Enormi Spotlights nicht gut. Niente Spotlights. Im Palazzo genug luce. Luce naturale, capito? Mit luce naturale Film drehen. Enormi Spotlights machen Fresken kaputt. Damage Fresken, das sehr teuer. Wenn Fresken kaputt, ich kaputt, du kaputt, tutto kaputto. Niente Spotlights! Solo luce naturale! Capite?« Es folgte eine heftige waagerechte Bewegung mit der flachen Hand, und dann zog er den zentralen Stecker heraus. Die riesigen Scheinwerfer verloschen mit einem ›Woff‹. Staub flimmerte im Lichteinfall der Fenster, dazwischen lauerten dunkle Schatten.
Adi Bender stieg die Magensäure den Schlund empor, und am liebsten hätte er diesem verdammten Italiener auf die eleganten Schuhe gekotzt. Was bildete sich der Typ eigentlich ein? Wer war das überhaupt? Hatte nicht der Aufnahmeleiter mit ihm alles vertraglich geregelt? Wie sollte er, Adi Bender, einen Film ohne Licht drehen? Luce naturale – so ein Scheiß! Der barocke Saal, wo sie drehen wollten, war so riesig, dass er keine Decken haben dürfte, um mit Tageslicht drehen zu können. Hehe, wenn er keine Decke hätte, wären die Scheißfresken schon längst vom Regen heruntergewaschen worden. Und der Italiener wäre kaputt – ein Zustand, den sich Adi Bender sehnlichst herbeiwünschte.
Während der Regisseur in sich versunken dasaß und vor sich hin stierte, verhandelten der Produktionsleiter, dessen Assistentin sowie der Kameramann in einem Kauderwelsch von Deutsch, Italienisch und Englisch mit dem Kerl. Bender unterdrückte halbwegs einen röhrenden Rülpser, bei dem ihm ein gewaltiger Luftstrom vom Magen Halbverdautes hinauf in die Mundhöhle drückte. Mit verkniffenem Gesicht schluckte er das säuerliche Zeug wieder hinunter und griff sich an den Magen; ein höllischer Brand drohte dort seine Magenwände zu zersetzen. Ein Schnaps! Ein Königreich für einen Schnaps, dachte er, stand auf und taumelte hinaus. Draußen, in dem riesigen barocken Stiegenhaus, watschelte er einfach vor sich hin, er öffnete hohe Türen und kam in immer neue mehr oder weniger große Salons und Säle. Nur die Toilette fand er nicht. Als sich sein Magen neuerlich zusammenkrampfte und das üppige Mittagessen nun mit aller Gewalt nach oben drängte, befand er sich gerade in einem chinesischen Zimmer. Kurz entschlossen griff er zu einer hohen Vase, war verwundert, wie fein sich das Porzellan anfühlte, und schoss dann zuerst einen und nach einigem Würgen einen zweiten grün-bräunlichen Strahl in das antike Gefäß. Danach ging es Adi Bender besser. Mit einem Papiertaschentuch wischte er sich den Mund ab, stellte die Vase wieder aufrecht an ihren ursprünglichen Platz und spazierte unendlich erleichtert durch die lange Flucht der Räume zurück. Dabei schwor er sich, nie wieder so üppig Mittag zu essen. Diese verdammten Italiener mit ihren Antipasti, Primi Piatti, Secondi Piatti und danach Dolce und Frutta gingen ihm auf die Nerven. Wie sehnte er sich zurück in das heimatliche Wien, wo man zu Mittag gemütlich ein Gulasch verzehrte und davor vielleicht ein Süppchen löffelte.
Als er zurückkam, wurde noch immer mit dem Italiener gestritten. Mit einem Ruck nahm er die Regieassistentin zur Seite und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie sah ihn ungläubig an und wollte sich zuerst weigern. Sein Griff wurde fester und er drohte ihr mit dem Rausschmiss, wenn sie nicht sofort tat, was er ihr sagte. Sie seufzte und verschwand. Eine Minute später hörte man sie schrill um Hilfe schreien. Die Streitenden hielten inne und eilten hinaus. Bender zog den Kameramann zurück und schubste ihn Richtung Kamera. Den Kameraassistenten und der Licht-Crew befahl er, Kisten, Batterie-Gürtel und Möbel vor die geschlossenen Türen des Saals zu schieben, sodass niemand herein konnte. Dann rief Bender mit seiner Napoleon-Stimme: »Licht an! Schauspieler auf ihre Positionen. Wir drehen in einer Minute!«
Und so war es dann auch. Der Hauptdarsteller, ein weißhaariger österreichischer Publikumsliebling, absolvierte die Szene mit Charme und Routine. Gekonnt riss er seine jüngeren Kollegen und Kolleginnen mit, die Szene war nach fünf Takes im Kasten. Einzig der Tonmensch beschwerte sich, dass er beim O-Ton im Hintergrund Störgeräusche gehabt habe – der Italiener hatte nämlich während des Drehs eine Zeit lang von außen an die Tür getrommelt. »Das ist wurscht«, murmelte Bender und befahl abzubauen und die Türen wieder frei zu machen. Sein Magendruck war weg, die Szene im Kasten, und von draußen drang goldenes Nachmittagslicht in den Salon. Bender öffnete eine der alten Türen und trat hinaus auf einen kleinen Balkon. Er blickte auf einen Kanal und eine Brücke. Zufrieden zündete er sich einen Zigarillo an und genoss die Wärme der Sonne. Schmunzelnd verfolgte er, wie der Produktionsleiter und der Italiener neuerlich zu streiten begannen. Eigentlich war das ja die Verantwortung des Aufnahmeleiters … Doch da fiel es Bender wieder ein: Der hatte heute frei. Denn gestern hatten sie seinen Jungen, den er während der Schulferien zum Dreh mitgenommen hatte, als Leiche aus dem Canal Grande gefischt.
Drei
»Ich hätte ihn nicht mitnehmen sollen … Nicht nach Italien … Eine völlige Scheißidee! Eine Scheißscheißscheißidee!«, wütend krachte seine Faust auf den gepolsterten Rücksitz des Taxis. Die Polsterung ließ ein gedämpftes »Wampf!« vernehmen, sonst nichts. Außer dass die Knöchel seiner schmalen Intellektuellenhände ganz weiß hervortraten, hinterließen die Faustschläge keinerlei Eindruck. Als bleiche Witzfigur saß er im Fond des Taxis und ließ sich kreuz und quer durch Marghera, das Hafenviertel von Venedig, fahren. Schließlich hatte er ja einen Job. Locationsuche. Für den Dreh übermorgen musste er noch dringend eine Location finden. Nachdem der Regisseur ihm schon ganze sieben Location-Vorschläge abgeschossen hatte, war er nun unter Zeitdruck. Trauerarbeit? Scheiß drauf! Wut? Scheiß drauf! Schmerz? Ein Brennen. Ein mörderisches Brennen. Sein Inneres brodelte, und seine Ausbrüche kamen vulkanartig. Eruptionen der Hilflosigkeit. Oh, wie er alles hasste. Dieses Land, die Leute, den Dreh, seine Arbeit, seine Familie. Warum hatte seine Mutter an diesem Nachmittag unbedingt shoppen gehen müssen? Warum hatte sein Vater wieder nur im Produktionsbüro gehockt und gerechnet? Warum hatte seine Frau sich nicht von ihrem Job karenzieren lassen? Warum hatte sie ihn mit Johannes alleine nach Italien fahren lassen? Warum musste ausgerechnet sein Sohn ermordet werden? Warum wurden nicht alle Kindermörder verhaftet? Warum gab es eigentlich Kinderschänder? Warum erlaubte Gott diese Schweinerei? Warum gab es überhaupt das Böse in der Welt? Warum hatte Gott, der angeblich allmächtige, Luzifer nicht vernichtet? Warum ließ er es zu, dass schwache Menschen der Versuchung erlagen? Warum wurden nicht alle Sexualtäter kastriert? Warum nicht grundsätzlich liquidiert? Warum machte denn niemand etwas zum Schutz der Kinder? Warum gab es nur zahnlose Gesetze? Warum wurden nicht alle Perversen dieser Welt einfach ausgerottet? Warum, Herrgott, warum strafst du diese Kreaturen nicht? Warum, oh Herr, lässt du endloses Leid zu? Warum hast du deinen eigenen Sohn geopfert? Warum bist du ein Schlächter, Gott? Warum?
»Wampf!«, machte seine schmale Intellektuellenfaust auf der Sitzpolsterung.
»Wampf! Wampf! Wampf! Wampf!«
Nachdem er sich ausgewampft hatte, sank er erschöpft zurück. Er bemerkte, wie ihn der Taxifahrer im Rückspiegel beobachtete. Plötzlich rannen ihm die Tränen herunter. Sturzbäche über die unrasierten, dunkelblau schimmernden Wangen. Philipp Mühleis versteckte seine Augen hinter der rechten Hand. Heulen wie ein Schlosshund, das kann ich. Dachte er. Sonst kann ich eh nix. Nichts, gar nichts! Ein Versager. Mit 37 Jahren immer noch Anhängsel. Angestellt in der Filmproduktionsfirma seines Vaters, abhängig vom Gehalt seiner gut verdienenden Frau. Die ihn aufgrund ihres ererbten Reichtums nach Strich und Faden verwöhnte. Langsam rollte das Taxi durch die leeren, holprigen Straßen. Links und rechts Fabrik- und Lagerhallen. Hin und wieder das düstere Stahlskelett eines Schiffskrans. Verkrümmte, armselige Bäume. Struppige, nicht minder erbärmliche Büsche. Endlose Mauern mit Graffiti. Zwischen den Mauern rostige Zäune. Manchmal Stacheldraht. Überall Unkraut, teilweise über einen Meter hoch. Rumms! Wieder ein Monsterschlagloch. Fast wäre er sich mit den Fingern ins Auge gefahren. Industrielandschaft. Verschwommen hinter Tränen. Die Nase voll Rotz. Seine rechte Hand suchte ein Taschentuch. Die linke fand es schließlich auf ihrer Seite. Teurer Stoff, sorgsam gebügelt und liebevoll zusammengelegt. Zuerst schnäuzen, da keine Luft mehr. Dann mit einer fast trotzigen Bewegung zuerst links und dann rechts die Sintflut wegwischen. Mehrmals, da nicht auf einmal möglich. Dann klarer Blick. Rechts vor ihm befand sich eine Lagerhalle. Darauf ein Riesengraffito:
Ti amo, baby3
3Ich liebe dich, Baby
Vier
»Ciao, Lupino!«
Er hasste ihn. Diesen Spitznamen. Ihn sowie einiges anderes Hassenswertes in seinem Leben verdankte er seiner Mutter. Wie zum Beispiel die strahlend blauen Augen, die zu seinem dichten, schwarzen Haar einen merkwürdigen Kontrast bildeten. Seine Mutter hatte seinerzeit darauf bestanden, ihn Wolfgang zu taufen. In späterer Folge nannte sie ihn dann Wölfchen und schließlich Lupino. Lupino Severino. Die wohlklingende Phonetik dieses Namens ließ ihn erschaudern. Nur: Wolfgang Severino, seinen amtlichen Namen, hasste er noch mehr. Diese beschissene Mischung aus Deutsch und Italienisch, dieses Zusammenstoppeln von Nord und Süd, von dem was nie zusammengepasst hatte und nie zusammenpassen würde, brandmarkte ihn. Als ob der Herrgott nicht bewusst den Alpenhauptkamm erschaffen hätte.
»Un vino bianco4«, knurrte er und starrte Marcello feindselig an. Doch an dem gut gelaunten Wirt prallte Lupinos üble Laune ab. Die schlecht sitzenden, falschen Zähne des Wirtes leuchteten freundlich im Neonlicht, und er fragte Lupino, welche Laus ihm denn über die Leber gelaufen sei. Statt einer Antwort nahm er das Glas, murmelte auf Deutsch: »Das geht dich einen Scheißdreck an …« und verzog sich an einen Tisch, der direkt neben dem Plastikperlenvorhang, der den Kücheneingang verdeckte, stand. Als er das Glas Wein ausgetrunken hatte, stand er auf und ging mit dem leeren Glas in die Küche. Dort griff er zu der Flasche Sauvignon, die offen neben dem Herd stand, und schenkte sich ein weiteres Glas ein. Plötzlich hatte er eine Gabel vor dem Gesicht.
»Fe…fegato alla Ve…veneziana«, knurrte Gino und schob ihm gnadenlos die Kostprobe in den Mund. Obwohl er gar keinen Gusto auf geröstete Leber hatte, begann er langsam und mit Bedacht zu kauen. Nach und nach genoss er nun die Aromen der glasig gerösteten Zwiebeln und der fein gehackten Petersilie, die sich mit der zarten Süße der Leberstückchen harmonisch verbanden. Mit vollem Mund beschwerte er sich beim Koch, dass der Sauvignon nicht zur Leber passe. Darauf reichte ihm dieser wortlos eine andere offene Weinflasche: ein säure- und tanninreicher Raboso, der nicht übel zu der Leber mundete. Der lange, hagere Lupino hockte sich mit zwei Weingläsern in der Hand auf einen wackligen Stuhl in eine Ecke der Küche. Gino hob aus der mächtigen Pfanne, in der die Leber schmurgelte, eine mittelgroße Portion auf einen Teller, streute frische Petersilie drüber und stotterte:
»V…Vuoi la po…polenta?5«
Lupino grunzte zustimmend, und der Koch zirkelte auf dem Blech ein Stück knusprig gebackene Polenta ab und gab sie zu der Leber. Den Teller knallte er mit Schwung auf den Anrichtetisch, wo auch die Speisen für die Gäste der Trattoria landeten. Lupino stand ächzend auf, ging hinaus zu dem kleinen Tisch, wo er zuvor gesessen hatte, stellte dort das Glas Sauvignon ab, nahm eine Gabel und kehrte in die Küche zurück. Stehend aß er die Leber, nicht ohne immer wieder anerkennend zu murmeln:
»Köstlich … wunderbar. Wirklich köstlich!«
Das animierte Gino, während er Calamari in der Pfanne über großer Flamme scharf anbriet, ihn mit schriller Stimme nachzuäffen:
»K… k… kostlitsch … Wiwirtlitsch k… k… kostlitsch!«
Später, als das Abendgeschäft vorbei war, saßen Marcello, Lupino, Gino und Luciana an einem Tisch beisammen. Luciana verschlang eine Portion Spaghetti neri und starrte gebannt auf das kleine Fernsehgerät, das oben in der Ecke hinter der Bar lief. Eine Reporterin berichtete von dem ermordeten Knaben, ohne wirklich etwas Neues zu sagen. In diese Idylle platzte ein später Gast herein: Ludovico Ranieri. Doktor der Rechtswissenschaft, Germanist und Kommissar. In seiner bärtigen, zerknautschten Visage saßen die Gesichtszüge noch schiefer als sonst. Er knurrte ein »Buona sera« und setzte sich neben Lupino. Der musterte ihn kurz und sagte auf Deutsch:
»Hast du keine Familie? Als ordentlicher Familienvater solltest du schon längst daheim im warmen Bett bei deiner Frau liegen.«
»Schnauze!«, knurrte Ranieri, und Lupino musste wieder einmal über den norddeutschen Akzent des Kommissars grinsen. Ohne zu fragen brachte Marcello dem Kommissar eine Flasche Moretti-Bier. Mit geübtem Griff öffnete dieser den Drehverschluss und nahm einen kräftigen Schluck. Dann rülpste er leise.
»Ludwig! Benimm dich«, feixte Lupino und erntete einen bösen Blick. Der Kommissar machte einen weiteren Schluck und knurrte:
»Wölfchen, wir müssen reden.«
Lupino zuckte zusammen. Er hasste es, wenn Ranieri ihn Wölfchen nannte. Das war noch schlimmer als Lupino. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen.
»Eine Audienz bei König Ludwig. Was verschafft mir die Ehre?«
»Hör auf mich zu verkackeiern! Dieser Scheißknabenmörder zieht mir den letzten Nerv.«
Lupino zog fragend die Augenbrauen hoch:
»Aber du hast doch eine Tochter.«
»Arschloch. Es geht nicht um meine Familie. Beruflich nervt dieser Kerl.«
Lupino nahm einen Schluck Wein und dachte an die Zeit zurück, als Ranieri und er noch Kollegen waren. Damals, bevor der neue Vicequestore Dr. Renzo Mastrantonio gekommen war. Dieser hatte ihn binnen kürzester Zeit hinausgeschmissen. Von heute auf morgen musste er Abschied aus dem Polizeidienst nehmen. Ohne finanzielle Abfindung. Es gab einzig die Zusage, ihm beim Erwerb einer Schnüfflerlizenz keine Steine in den Weg zu legen. Also war er Privatdetektiv geworden. Ein lausiger Job, besonders in Venedig. Wer brauchte hier schon einen privaten Ermittler?
»Wolfgang, ich habe einen Klienten für dich.«
Lupino verschluckte sich. Ein Hustenanfall folgte. Sein Gesicht lief rot an, Luciana klopfte ihm mütterlich auf den Rücken. Schließlich krächzte er:
»Du hast einen Job für mich?«
Ranieri nickte, packte Lupino bei der Schulter und sagte ernst:
»Morgen wird dich dieser Österreicher, der Vater des ermordeten Buben, anrufen. Ich habe ihm deine Telefonnummer gegeben. Er möchte unbedingt einen privaten Ermittler engagieren. Also sei so gut und geh morgen an dein Handy.«
Ranieri gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter, stand auf und ging zur Tür.
Dort drehte er sich um und sagte mit sanfter Stimme:
»Marcello! La birra … la pagherò la prossima volta.6«
Und zu Lupino gewandt fügte er hinzu:
»Ich erwarte keinen Dank. Ich möchte dich nur um eines bitten: Halte mir diesen Mühleis, diesen österreichischen Vater, vom Leib.«
4Ein Glas Weißwein …
5Willst du Polenta?
6Marcello! Das Bier da bezahl ich das nächste Mal.
Fünf
Die Glocken einer der zahlreichen Kirchen Venedigs schlugen in der Ferne zehn Uhr. Ein bleicher, hagerer Mann mit kräftigen Händen und sehnigen Unterarmen sperrte die Tür seines Geschäftes auf. Es war eine Rahmenhandlung, wie es so manch andere auch in Venedig gab. Vollgeräumt mit üppigen, vergoldeten Bilderrahmen, mit denen mehr oder weniger wertvolle Schinken ins rechte Licht oder besser gesagt in ein besseres Licht gerückt wurden. Die Rahmenhandlung und Vergolderwerkstatt gab es schon seit Jahrzehnten. Da der bisherige Eigentümer plötzlich verreisen musste, war der hagere Mann als Vertretung eingesprungen und führte nun das Geschäft. Signora Umberti, die zwei schmale Gässchen weiter in einer riesigen Wohnung hauste, war sehr angetan von dem Neuen. Denn im Gegensatz zu dem Eigentümer des Ladens, der sich beharrlich geweigert hatte, ihre grottenschlechte Tintoretto-Kopie mit einem edlen Rahmen zu versehen, nahm die Aushilfe den Job an. Binnen zwei Wochen hatte er für das Gemälde einen so wundervollen Rahmen angefertigt, dass Signora Umberti beim ersten Anblick die Luft weggeblieben war. Dann aber verkündete sie in der gesamten Nachbarschaft das Lob über die handwerklichen Fähigkeiten des neuen Rahmenmachers. Und so kamen nun auch andere, neue Kunden, die zu dem alten Cecchetti, der ein echter Griesgram und dazu auch noch recht streitsüchtig war, niemals gekommen wären. Dem bleichen, hageren Mann war das alles nicht sonderlich recht. Doch er hatte gute Gründe, freundlich zu seinen Kunden zu sein. Schließlich war dieses Rahmengeschäft die perfekte Tarnung für seinen eigentlichen Job. Mit viel Sorgfalt und gar nicht so geringem Zeitaufwand hatten seine Verbindungsleute dieses Geschäft, zu dem auch ein ganzes Haus mit einem Wassergeschoss gehörte, ausgesucht. Letzteres garantierte einen direkten Zugang zu Venedigs Kanälen, was für die Erledigung seines Jobs wichtig war. Dann hatte er den alten Cecchetti gezwungen, die Geschichte von seiner bevorstehenden Reise und seiner Vertretung im Viertel herumzuerzählen. Als diese Nachricht die Runde gemacht hatte, hatte er den kleinen, krummen Alten erwürgt, ihn wie eine Salami verschnürt und ihn in den Abstellraum ganz hinten im Haus in einen mächtigen barocken Kasten gehängt. Cecchettis Tochter, die er zu Beginn dieses Jobs in New York in seine Gewalt gebracht hatte, war liquidiert worden. Im naiven Glauben, dass er das Leben seiner Tochter retten könnte, hatte Cecchetti bei dem ganzen Schwindel mitgespielt. Vergebens. Bei diesem Job brauchte der ›Sculptor‹ keine Zeugen. Und die Profis, mit denen er in New York zusammengearbeitet hatte, sahen das ähnlich. ›The Sculptor‹ war sein Spitzname diesseits und jenseits des Atlantiks. Dem bleichen, hageren Mann, der pünktlich um zehn Uhr die Vergolder- und Rahmenwerkstatt im Dorsoduro aufsperrte, sah man nichts von all dem an. Denn er hatte sich im Laufe der Jahrzehnte ein perfekt unauffälliges Auftreten zugelegt. Man könnte auch sagen: modelliert. Was für einen Künstler seines Kalibers zweifellos zutreffender war. Verschlafen gähnte er, als er kurz in der geöffneten Tür des Rahmengeschäftes stehen blieb und das morgendliche Treiben in der Gasse beobachtete. Sein Nachbar, Signor Veneto, sperrte gerade geräuschvoll den Rollladen seines Geschäftslokals auf. Einige Touristen trotteten vorbei. Zwischen ihnen fuhren Einheimische, die Waren in die umliegenden Geschäfte lieferten, mit voll gepackten Stechkarren hin und her. Nach kurzem Verweilen schloss er die Tür hinter sich und ging nach rückwärts in die Werkstatt. Er machte sich an die Arbeit, an das Ausgießen von Gipsabdrücken. Diese Teile würde er dann über einem Drahtgerüst zu einer nackten Knabenfigur zusammenfügen.
Sechs
Er saß bei seinem zweiten Glas Vino bianco und hatte den Blues. Es widerte ihn an, aufzustehen und nach San Marco zu gehen. Nein, er wollte heute das ekelhafte Touristenpack nicht sehen. Diese Schießbudenfiguren, die einen Stadtrundgang in deutscher Sprache gebucht hatten. Er wollte nicht mit einem lächerlichen Fähnchen auf hoch erhobenem Regenschirm voranschreiten und einen Haufen schlecht gekleideter Menschen durch die engen Gassen rund um den Markusplatz und durch den Markusdom dirigieren. Heute war es sonnig und warm, da würde es besonders schlimm werden. Frauen knapp vor oder bereits im Pensionsalter in kurzen Hosen und Röcken, die schamlos bläuliche Krampfader-Geflechte sowie käsig-weiße Cellulitis-Wucherungen entblößten. Männer mit üblen Haarschnitten, Bierbäuchen und in Birkenstock-Sandalen, die ihre ungepflegten Zehennägel und die von grindiger Hornhaut verunstalteten Fersen ungeniert zur Schau stellten. Ein kalter Schauder rieselte über Lupinos Rücken, und er bestellte ein weiteres Glas. Sollte er Laura anrufen und ihr vorjammern, dass er krank sei? Sie würde es ihm nicht glauben. Schließlich kannte sie ihn seit über zwei Jahrzehnten. Schon am Tonfall seiner Stimme würde sie erkennen, dass er nicht krank, sondern lustlos war. Und dann würde sie ihm vielleicht die tägliche Standardtour wegnehmen. Damit hätte er kein geregeltes Einkommen mehr. Wollte er das riskieren? Eigentlich war er nicht Fremdenführer, sondern Polizist. Mit Leib und Seele. Auch die Arbeit als Detektiv war ihm nicht zuwider. Leute beobachten, beschatten, ausforschen, Zusammenhänge aufdecken, Hintergrundinformationen besorgen, all das war okay für ihn. Nicht okay war hingegen, vor irgendwelchen wildfremden Leuten mit Trinkgeld heischendem Grinsen den Fremdenführer zu mimen, der er nicht war. In einem Schnellsiedeverfahren hatte ihn Laura Bagotti damals, als er aus dem Polizeidienst hinausgeflogen war, als Fremdenführer angelernt. Er half ihr, eine Lücke in ihrem Angebot zu schließen, denn es gab weit und breit keinen Venezianer, der so gut Deutsch sprach wie er. Als er gerade am vierten Glas Vino bianco nippte, läutete sein Handy. Dieser rabiate Klingelton war Laura. Er hob nicht ab. Stattdessen knallte er einen Geldschein auf die Theke des Bacaro ai Fiori und hetzte fort.
Eineinhalb Stunden später läutete sein Handy neuerlich. Er befand sich mit seiner Touristengruppe gerade im Museum, das dem Markusdom angeschlossen war. Das Display zeigte eine ihm unbekannte Nummer. Und plötzlich bekam er schweißnasse Hände. War das der Vater des ermordeten Knaben, dessen Anruf ihm Ranieri angekündigt hatte? Ohne auf seine Gruppe weiter zu achten, stürzte er hinaus auf die Loggia des Markusdoms. Dort, neben der Quadriga stehend, hob er ab.
»Pronto!«
Eine näselnde, männliche Stimme fragte in wienerisch gefärbtem Deutsch:
»Spreche ich mit Signor Severino?«
Nun schwitzte Lupino am ganzen Körper. Mit leicht schleimendem Ton in der Stimme antwortete er:
»Jawohl! Ich bin Wolfgang Severino. Privatdetektiv. Womit kann ich behilflich sein?«
Sieben
Die Sonne brannte unbarmherzig auf seinen Sitzplatz. Marco hatte Schweißperlen auf der Stirn und konnte der Lehrerin nur mit Mühe folgen. Die Hitze war Wahnsinn. Zum Glück rückte der Zeiger der Klassenuhr beharrlich vor. Nur mehr sechs Minuten, bis es läuten würde. Marco merkte, wie ihm Schweiß auf der linken Seite unter dem Kurzarmhemd, das ihm seine Mutter heute in der Früh noch schnell gebügelt hatte, herunterlief. Es kitzelte, und er musste lachen. Als ihn die Lehrerin fragte, was denn so lustig sei, schüttelte er verschämt den Kopf und blickte stur vor sich in sein Heft. Erst als sie sich wieder der Tafel zuwandte und weiter vortrug, blickte er auf. Nur noch drei Minuten. Seine Lippen waren trocken und die Zunge klebte am Gaumen. Jetzt ein Eis. Marco träumte von einer Tüte mit Erdbeer- und Vanilleeis, leckte sich die Lippen und übersah, dass der Zeiger der Uhr wieder vorgesprungen war. Das schrille Läuten der Schulglocke riss ihn aus seinen Träumen. Während die Lehrerin ihnen noch sagte, was sie bis zum nächsten Mal als Hausaufgabe hatten, warf Marco sein Heft und die Füllfeder in seinen kleinen Rucksack und stürmte, als sie endlich in die Freiheit entlassen wurden, wie ein Verrückter aus dem Klassenzimmer. Der Flur war angenehm kühl, dafür empfing ihn draußen vor der Tür ein Hitzeschock. Doch das war ihm egal. Er hatte nur ein Ziel: den Pizza- und Eisladen in seinem Wohnviertel.