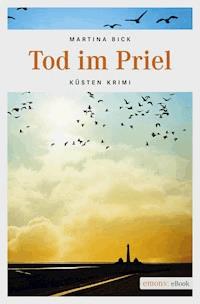3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Es wird dunkel in Berlin ... »Die Polizeipsychologin – Der Tote im Viktoriapark« von Martina Bick jetzt als eBook bei dotbooks. Eine Stadt voller Chancen – und Abgründe ... Anfang der 30er Jahre will die Psychologin Nina Norge in Berlin mit ihrem Verlobten, dem Kriminalkommissar Peter Jordan, einen Neuanfang wagen. Doch schon bald nimmt Peters neuster Fall ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch: Im Viktoriapark wurde die grausam verstümmelte Leiche eines Mannes gefunden. Die Hauptverdächtige ist seine unscheinbare Verlobte Melitta, denn die heimliche Bühnenautorin hat in ihrem Theaterstück »Die Kannibalen von Berlin« einen ganz ähnlichen Mordfall beschrieben. Nina ist jedoch überzeugt von ihrer Unschuld und versucht, die junge Frau zu retten – aber übersieht sie dabei eine lauernde Gefahr? Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Polizeipsychologin – Der Tote im Viktoriapark« von Martina Bick ist ein historischer Krimi für Fans von »Babylon Berlin« und Anne Stern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Stadt voller Chancen – und Abgründe ... Anfang der 30er Jahre will die Psychologin Nina Norge in Berlin mit ihrem Verlobten, dem Kriminalkommissar Peter Jordan, einen Neuanfang wagen. Doch schon bald nimmt Peters neuster Fall ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch: Im Viktoriapark wurde die grausam verstümmelte Leiche eines Mannes gefunden. Die Hauptverdächtige ist seine unscheinbare Verlobte Melitta, denn die heimliche Bühnenautorin hat in ihrem Theaterstück »Die Kannibalen von Berlin« einen ganz ähnlichen Mordfall beschrieben. Nina ist jedoch überzeugt von ihrer Unschuld und versucht, die junge Frau zu retten – aber übersieht sie dabei eine lauernde Gefahr?
Über die Autorin:
Martina Bick ist Autorin und Musikwissenschaftlerin und hat bis 2022 in der Hochschule für Musik und Theater Hamburg im Bereich Gleichstellung sowie Frauen- und Geschlechterforschung gearbeitet. Neben musikhistorischen und -biografischen Arbeiten veröffentlicht sie Kriminalromane, historische Romane und Kurzprosa und ist auch als Herausgeberin tätig. Sie erhielt verschiedene Stipendien und war 2001 „Krimistadtschreiberin“ in Flensburg.
Martina Bick veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romane »Unscharfe Männer«, »Die Landärztin« und die Fortsetzung »Neues von der Landärztin«, die im Sammelband »Das kleine Pfarrhaus auf dem Land« zusammengefasst sind, die 20er-Jahre-Krimis »Die Polizeipsychologin – Im Dunkel der Stadt« und »Die Polizeipsychologin – Der Tote im Viktoriapark« sowie die Krimi-Reihe um Hauptkommissarin Marie Maas, die folgende Bände umfasst:
»Der Tote und das Mädchen. Der erste Fall für Marie Maas«
»Tod auf der Werft. Der zweite Fall für Marie Maas«
»Die Tote am Kanal. Der dritte Fall für Marie Maas«
»Tödliche Prozession. Der vierte Fall für Marie Maas«
»Nordseegrab. Der fünfte Fall für Marie Maas«
»Tote Puppen lügen nicht. Der sechste Fall für Marie Maas«
»Totenreise. Der siebte Fall für Marie Maas«
»Heute schön, morgen tot. Der achte Fall für Marie Maas«
***
Originalausgabe September 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/The AI Middleman
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98952-181-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Martina Bick
Die Polizeipsychologin – Der Tote im Viktoriapark
Kriminalroman
dotbooks.
Kapitel 1
Donnerstag, 5. Februar 1931
Der Kittel des Frauenarztes war nicht ganz rein. Am Kragen entlang zeigte sich ein dunkler Streifen, und auf der Brust, neben der Knopfleiste, befand sich ein hellgelber Fleck wie von flüssigem Eigelb. Besser, man zog den weißen Kittel zu den Mahlzeiten aus, dachte Nina. Sie selbst hatte es so gelernt und handhabte es auch entsprechend. Der Arztkittel war steril und sollte es so lange wie möglich den Tag über bleiben. Der Kittel war schließlich auch ein Symbol, seine Reinheit – rein wie ein unbeschriebenes Blatt – sollte die Patientin glauben lassen, dass der Arzt nur für sie allein da war. Dass er um ihre Einzigartigkeit wusste und nicht vor ihr und nach ihr etliche andere Patientinnen untersuchte, in sie eindrang, ihre schwachen oder wunden Punkte berührte, ihre Gebrechen diagnostizierte und womöglich eine böse Diagnose aussprach. Er sollte Vertrauen eingeben, dieser knisternd gestärkte, in heißem Dampf gemangelte oder geplättete Leinen- oder Baumwollstoff, Kennzeichen auch für die gründliche Sauberkeit und zuverlässigen medizinischen Kenntnisse des Arztes. Und für die Illusion, dass er allein über Leben und Tod entscheiden konnte, nicht die Natur oder der Patient selbst, in bescheidenem Maße. ›So, wie man lebt, so stirbt man auch‹, hatte Onkel Christoph immer gesagt, und dies auch gern seinen Patienten gepredigt. Halb wahr, dachte Nina. Der Onkel war im Sommer am Schlagfluss gestorben. Zu viel Arbeit? Zu viel Machandel? Zu viel gebratene Pomucheln aus Marthas guter Danziger Küche? Oder einfach die Natur? Das Schicksal? Bestimmung?
»Nein, Kinder werden Sie sicher keine mehr bekommen können«, wiederholte der Doktor. »Das müsste schon mit dem Deibel zugehen.« Er lächelte und schüttelte den Kopf, als könnte er damit einer möglichen Widerrede gegen sein Urteil vorab begegnen. »Ein paar Stunden später, meine Liebe, und Sie säßen jetzt nicht mehr hier vor mir, gesund und munter. Freuen Sie sich lieber darüber, anstatt sich über Dinge zu grämen, die nicht mehr zu ändern sind. Eine Eileiterschwangerschaft mit Bauchfellentzündung überlebt nicht jede. Erst vorletzte Woche hatte ich hier eine junge Frau auf dem Stuhl, die ist mir einfach so weggerutscht. Sie war noch sehr jung, das Mädel, die erste Schwangerschaft, genau wie bei Ihnen. Aber unterernährt und rachitisch, dazu ein Kollaps, weg war sie. Und nicht mit Nähnadel und Bindfaden wieder zu flicken.«
Wenn er nur aufhören würde zu grinsen, dachte Nina und spürte den Impuls, aufzustehen und wegzugehen. Aber sie konnte nicht, sie hatte keine Kraft. Gut eine Woche war es erst her, dass die Schwangerschaft, die sie so glücklich begrüßt hatten, Peter und sie, sich gegen sie gekehrt hatte. Innerhalb von Stunden war ihr Leib aufgequollen und ein wütender, beißender Schmerz hatte ihr das Bewusstsein genommen. Zum Glück hatte sie im letzten Moment noch ihre zukünftige Schwiegermutter, Emmeline Jordan, bei der sie hier in Berlin wohnte, bitten können, rasch nach Doktor Brunnen zu schicken, der in der Teltower Straße eine frauenärztliche Praxis hatte. Er war sofort gekommen, hatte ihren Kreislauf gestützt und sie rasch in die Charité schaffen lassen. Gestern erst war sie von dort entlassen worden. Blass, in wenigen Tagen abgezehrt und vor allem ohne ihr Baby. Vier Monate nur, und schon war es ›ihr Baby‹ geworden. Vorbei.
»Ich würde sagen, mit der Arbeit warten wir noch ein paar Tage«, fuhr der Doktor fort. »Außerdem schreibe ich Ihnen ein Stärkungsmittel auf, ganz was Neues, B-Vitamine. Damit kommen Sie schnell wieder zu Kräften. Und jeden Tag ein Gang in der frischen Luft, Sie werden sehen, in vierzehn Tagen denken Sie gar nicht mehr an die ganze Sache. Schließlich haben Sie Ihren Beruf. Und in unserem Beruf verliert man nicht so schnell die Hoffnung, finden Sie nicht? Das Kinderkriegen überlassen Sie einfach den anderen.«
Nina wandte mühsam den Blick ab von der dunkelgrauen Putzmauer des Hinterhauses, die viel zu nah vor dem Fenster des Sprechzimmers aufragte. Bis zum Himmel dunkelgraue Putzfassaden – das war Berlin. Die berühmte Berliner Luft hatte sie noch nicht zu spüren bekommen. Nur dunkle Hinterhäuser und hochherrschaftliche Fronten, riesig breite Chausseen voller Automobile und bimmelnder elektrischer Straßenbahnen, Menschenmassen überall, auf den Bürgersteigen, auf den großen Plätzen, beim Schlangestehen oder beim Protestieren. Und überall ging es laut und hektisch zu.
»Ja, ich liebe meine Arbeit. Aber ich hätte auch mein Kind geliebt.« Nina stützte sich mit beiden Händen auf die Armlehnen ihres Stuhls und stemmte sich aus dem Sitz wie eine alte Frau. Der Kollege reichte ihr das Rezept, auf dem die Tinte der Unterschrift noch nicht getrocknet war. In seinem Blick stand Skepsis und Unwille. Sein Gesicht war breit wie das eines Boxers, die Augen kleine Schlitze, von schweren Tränensäcken unterfüttert. Ein paar wenige, dunkel gebliebene Haarsträhnen zogen sich fettig über die mehr oder weniger kahle Schädelplatte.
»Wenn sich Beschwerden einstellen, kommen Sie sofort her. Sie können auch oben an meiner Wohnungstür klingeln. Aber ich denke, Sie werden sich schnell wieder erholen. Sie sind ja noch jung.« Er lächelte. Dann stand er auf und reichte Nina die Hand.
Draußen hinter dem Eingangstresen saß wieder das fahle junge Mädchen mit der runden Brille, deren Gläser so dick waren, dass man ihre Augen dahinter kaum ausmachen konnte. Das Gesicht klein und dreieckig, der Körper mager, fast nicht auszumachen unter ihrem makellosen, hellblauen Kittel. Das braune Haar hatte sie straff zurückgekämmt und zu einem kleinen, abstehenden Knoten am Hinterkopf zusammengesteckt.
»Auf Wiedersehen, Frau Doktor Norge«, sagte sie akkurat. Ihre Stimme schien bei weitem das Kräftigste an ihr zu sein. »Und gute Besserung.«
»Danke«, sagte Nina und zog die Windfangtür mit einem Kraftaufwand auf, als ob sie auf der anderen Seite von jemandem festgehalten würde.
Die Wohnung von Emmeline Jordan lag in der Gneisenaustraße, eine breite Chaussee, die von den Yorckbrücken quer durch Kreuzberg bis nach Neukölln führte. Die Fahrbahnen wurden in der Mitte von einem baumbestandenen Grünstreifen getrennt, auf dem am Sonntag die Spaziergänger flanierten. Lebhaftes Handelstreiben herrschte in den Geschäften, die sich wie Perlen an einer Kette zu beiden Seiten der Straßen aufreihten: Lebensmittel, Tabakwaren, Leder und Stoffe, Geschirr; alles, was ein Haushalt brauchte, konnte man bei Einzelhändlern oder in kleineren Kaufhäusern bekommen. Darüber, fünf oder sechs Stockwerke hoch, befanden sich große, herrschaftliche Wohnungen mit einem Berliner Zimmer nach vorne hinaus, das so groß war, dass man darin einen Ball hätte feiern können. Nach hinten, in die Hinterhöfe hinein, wurden die Zimmer dafür umso kleiner: Schlafzimmer, Kinderzimmer, Zimmer für das Personal, Kleiderkammern und Rumpelkammern. In den Höfen reihten sich die Hinter- und Gartenhäuser aneinander, bildeten immer dunklere Höfe, je tiefer man hineinging in die Häuserschachteln. Dort waren die Fassaden fast schwarz vom Kohlenrauch, der im Winter Tag und Nacht in die Nase biss. So leicht und frisch die Luft wohl sein mochte in dieser Stadt, so leicht reicherte sie sich auch mit dem schweren, kohlschwarzen Staub an, der sich absetzte auf dem rauen Putz, auf den Simsen, auf den Fensterscheiben.
Es war Ende November gewesen, als Nina nach Berlin gekommen war, im tiefsten Herbst. In den ersten Wochen hatte sie nur grauen Dunst erlebt, Kohlendunst, selbst der Schnee, der über Weihnachten pünktlich zur Bescherung vom Himmel gefallen war, war in kürzester Zeit erst grau, dann schwarz geworden, ein Albtraum von Schnee. Nur auf den Dächern und in den Bäumen hatte der weiße Pelz noch leuchten und die dunkle Winterzeit auf natürliche Weise ein wenig heller machen können. Trotzdem hatte ihr Berlin auf Anhieb gefallen. Und sie war wählerisch. Sie war herumgekommen in ihrem knapp dreißigjährigen Leben. Sie war in Lübeck geboren und aufgewachsen – eine schöne Stadt mit prächtigen Gebäuden, reich und stolz. Das war der Maßstab. Sie hatte in München und Wien studiert – Weltstädte. Dann hatte sie in Danzig gelebt, fast vier Jahre lang. Und nun Berlin, hier sollte ihr Hafen sein. Hier wollten sie bleiben, Peter Jordan, ihr Verlobter, und sie. Er war Kriminalpolizist, Kommissar, und zurzeit noch in Danzig unabkömmlich. Erst nach der Hochzeit, die für Anfang Mai geplant war, würde er nach Berlin übersiedeln. Inzwischen sollte Nina eine Wohnung für sie finden, sich orientieren, sich heimisch machen. Sie hatte sich erst mal eine Arbeit in einem katholischen Krankenhaus in Tempelhof gesucht. Zuerst hatte sie dort in der Ambulanz gearbeitet, kleinere Unfälle, Brüche, Schnittwunden versorgt und Armutskrankheiten wie Hautausschläge, Krätze, die Folgen von Alkoholismus diagnostiziert. Dann wurde sie vom Schichtbetrieb ausgenommen wegen ihrer Schwangerschaft und arbeitete seitdem in der Geburtsklinik. Das war interessant und abwechslungsreich, und die Zeit verging wie im Fluge. Vor allem hatte sie hier nicht mehr mit den albernen Problemen zu tun, die ihr die Arbeit in der Danziger Praxis ihres Onkels so schwer gemacht hatten: misstrauische Patienten, die ihr als Frau nicht zutrauten, sie zu behandeln und beraten zu können. Trotzdem hatte sie schweren Herzens Danzig verlassen und die Vorstellung aufgegeben, die Praxis des Onkels weiterführen zu können. Aber als Georg, der Kutscher und Helfer in allen Lebenslagen, kurz nach dem Onkel ebenfalls starb und Martha, die Köchin, sich auf ihr Altenteil zurückzog, hatte Nina sich einfach nicht mehr wohlgefühlt in dem leeren Haus am Poggenpohl. Dann rief das Berliner Morddezernat seinen besten Mann zurück in die Hauptstadt, und Peter Jordan fragte sie, ob sie ihn nach Berlin begleiten und seine Frau werden wollte. Sie hatte nicht lange überlegen müssen und Ja gesagt. Besonders froh war sie nun, die Danziger Voreingenommenheit und Sturheit hinter sich gelassen zu haben.
Emmeline Jordan, ihre zukünftige Schwiegermutter, hatte sie gern aufgenommen und ihr in ihrer Wohnung in der Gneisenaustraße zwei hübsche Zimmer nach hinten heraus überlassen. Sie waren mit freundlichen, hellen Birkenholzmöbeln eingerichtet, die aus ihrem eigenen Jugendzimmer stammten. Ins Schlafzimmer schien am Morgen die Sonne, denn die Wohnung befand sich im vierten Stock, hoch über den finsteren Kohlenschächten der Höfe. Ihr Wohnzimmer war schmal, aber ebenfalls hell, wovon sie in dieser Zeit der Krankenruhe profitierte. Sie blieb den Vormittag über auf der Chaiselongue liegen und las die neuesten Romane: Menschen im Hotel von Vicky Baum und Gilgi, eine von uns von Irmgard Keun, aber auch die beeindruckenden Werke ihrer Arztkollegen Gottfried Benn oder Alfred Döblin. So lernte sie Berlin mehr durch die Literatur kennen als durch eigene Anschauung – zuerst, weil sie zu wenig Zeit hatte, um herumzuspazieren, und nun, weil sie wegen ihrer Erkrankung zu schwach war. Wie neugierig war sie auf die Theater und Varietés, die Tanzpaläste, Rummelplätze und Vergnügungslokale, von denen sie so viel gehört hatte. Zu Weihnachten war Peter für wenige Tage nach Berlin gekommen, aber auch zusammen hatten sie kaum Zeit gehabt, sich umzusehen. Erst nach Ostern, wenn er ganz hier sein würde, würden sie gemeinsam das Großstadtleben erkunden.
Emmeline war aus besserem Hause, wie sie gern betonte. Dabei wusste Nina von Peter, dass in diesem ›besseren Hause‹ schon vor Emmelines Geburt äußerst prekäre ökonomische Verhältnisse herrschten und die beiden Töchter als junge Mädchen in Haushalten in Charlottenburg ›in Stellung‹ gehen mussten.
»Arbeit bildet«, sagte Emmeline immer, wenn es um dieses Thema ging. »Natürlich nur, wenn man sich bilden lässt. Dazu gehören zwei.« Ihre gewählte Art zu sprechen, ihre kontrollierten Gesten und Mienen zeugten allerdings von einer gediegenen Erziehung. Vermutlich hatte sie sich auch deshalb rasch zu einer Art Gesellschafterin hochdienen können; unterhaltsam plaudern und teilnahmsvoll zuhören konnte sie noch immer sehr gut. Aber dann war der schneidige Wilhelm Otto August Jordan aufgetaucht und hatte sie weggeheiratet aus dem guten Elternhaus und dem noch besseren Haus, wo sie in Stellung war. Mit Anfang zwanzig hatte sie ihren Sohn Peter bekommen, dem leider keine weiteren Kinder folgen, denn schon 1916 war Wilhelm Jordan in Verdun gefallen. Emmeline brachte sich und ihren Sohn mehr schlecht als recht mit der Witwenrente und der Vermietung von Zimmern in ihrer großen Wohnung durch. Peter unterstützte sie heute großzügig, auch wenn sie dies nur mit Abwehr entgegennahm.
Emmeline versuchte, Nina gegenüber möglichst unaufdringlich und respektvoll aufzutreten, als ob sie deren Leben im Grunde nichts anginge. Diskretion war eine gefragte Tugend, die sie als Hausangestellte bestens eingeübt hatte. Sie wusste allerdings stets, wo Nina war, woher sie kam, wohin sie ging. Sie spähte hinter den Gardinen, wenn Nina ausging, und erkannte ihren Schritt vermutlich schon auf der Treppe, jedenfalls hatte Nina den Eindruck, dass ihr Kommen schon erwartet wurde, ehe sie den Schlüssel ins Schloss steckte. Häufig hatte Nina das Gefühl, dass sie in ihrem Zimmer gewesen war, manchmal erwähnte Emmeline, dass sie ein Fenster dort geschlossen oder nach dem Ofen gesehen habe. Ihre Post lag stets ordentlich nach Größe sortiert auf ihrem Tisch, die Anschrift nach oben gedreht. Nina achtete darauf, dass sie keinerlei Notizen oder Aufzeichnungen in ihrem Zimmer herumliegen ließ.
Anfangs hatte sie sich gern mit Emmeline unterhalten, lange Abende hatten sie zusammen an dem runden Tisch unter der elektrischen Lampe verbracht, Emmeline mit einer Handarbeit und Nina vor ihren Büchern oder Papieren, Berichten, Briefen, die sie dabei aber selten fertig bekam. Nach und nach fiel Nina auf, dass Emmeline sie häufig damit aus der Reserve lockte, dass sie ihr negative oder zumindest unpassende Beweggründe unterstellte.
»Sicher bist du noch nicht dazu gekommen, dir hier in Berlin Denkmäler oder Museen anzuschauen. Du hast ja auch viel zu viel zu tun und Wichtigeres im Kopf.«
»Ich war immerhin schon am Brandenburger Tor«, entgegnete Nina. »Und das Charlottenburger Schloss habe ich mir auch schon angesehen. Natürlich möchte ich mir unsere Hauptstadt anschauen.«
»Ich könnte dir ja einiges zeigen – aber sicher willst du nicht mit einer alten Frau wie mir durch die Straßen gehen. Bald kommt der Peter, dann werdet ihr jungen Leute zusammen die Stadt erobern.«
»Sehr gern gehe ich auch mit dir einmal spazieren. Du kennst dich so gut aus und kannst mir bestimmt viele Dinge zeigen, die ich übersehen würde.«
»Aber nur, wenn du es wirklich willst, Nina. Ich will mich nicht aufdrängen. Es war nur so eine Idee, damit du mal den Kopf freibekommst von deiner Arbeit.«
Oft fühlte Nina sich verleitet, ihre Motivationen und persönlichen Entscheidungen viel ausführlicher zu erläutern, als es ihre Art war. Dabei redete sie sich um Kopf und Kragen, nur um Emmelines negative Annahmen zu entkräften und ihr einmal einen positiven, verständnisvollen Kommentar zu entlocken. Der aber war von ihrer künftigen Schwiegermutter kaum zu bekommen.
»Es hat dich sicher stark belastet, dass du dich so früh schon um deine kranke Mutter kümmern musstest«, meinte sie zum Beispiel, als Nina ihr von der Krebserkrankung ihrer Mutter erzählte, an der diese vor wenigen Jahren – sie war nur achtundvierzig Jahre alt geworden – gestorben war. »In deinem Alter möchte man sich doch nicht um kranke Eltern kümmern, das sollten diese eigentlich auch nicht erwarten.«
»Es hat mich belastet, dass meine Mutter krank wurde, ich hatte große Angst um sie«, antwortete Nina. »Und ich hätte mich sehr gern um sie gekümmert, nur lebte ich ja schon lange nicht mehr in Lübeck, sondern weit weg in Wien zu dieser Zeit.«
»Das solltest du dir nicht so übel ankreiden, liebe Nina. Du warst jung und noch in der Ausbildung – du neigst offenbar wie viele junge Frauen dazu, dir Selbstvorwürfe zu machen, und bist wohl auch sehr ehrgeizig, nicht wahr?«
Daran war sicher etwas Wahres, dachte Nina, aber trotzdem fand sie die Beschreibung unpassend und irgendwie ging sie zu weit. So lange kannten sie sich ja noch gar nicht. Doch statt das Gespräch von den heiklen Themen wegzuleiten, legte sie wieder nach und erklärte, dass ihre Mutter im Übrigen auch gar nicht erwartet habe, dass ihre einzige Tochter sich um sie kümmerte.
»Natürlich würde ich das von meinem Sohn auch nicht erwarten«, protestierte Emmeline pikiert. »Ganz sicher nicht. Er muss an seinen Beruf denken, er steht ja gerade am Anfang von allem. Es würde mir das Herz brechen, wenn er wegen mir seine Zukunft aufs Spiel setzen würde, um Himmels willen. Ich würde ihm vermutlich nichts davon sagen, wenn mich eine solche Erkrankung träfe. Was natürlich jederzeit passieren kann. Man darf seine Söhne mit solchen Dingen auf keinen Fall von ihrem Weg abbringen. Oder was meinst du, liebe Nina, siehst du das ebenso?«
Nina zögerte mit der Antwort. Sie war ganz und gar nicht Emmelines Meinung. Außerdem witterte sie die Auffassung, dass Emmeline gern deutliche Unterschiede zwischen Söhnen und Töchtern machte. Aber sie hatte an diesem Abend noch zwei Berichte fertigzustellen, und sie war müde von einem langen Tag auf der Station. Wollte sie jetzt wirklich eine Grundsatzdiskussion mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter führen? Es würde ihnen beiden die Nachtruhe rauben, denn sie hatten vermutlich diametral entgegengesetzte Ansichten zum Umgang mit Kindern, Ehemännern und auch mit Krankheiten.
»Du wirst den Grübeleien einer alten Frau jetzt nicht deine kostbare Freizeit opfern wollen, liebe Nina. Entschuldige, wenn ich dich aufhalte. Es ist schon spät, ich werde ins Bett gehen und dich deiner Schreibarbeit überlassen. Ich will dir auch gar nicht zu nahe treten mit meinen Ansichten, ich will nur, dass es dir gut geht, meine Liebe. Dass es euch beiden gut geht.«
Mit einem bitteren Nachgeschmack und dem unbestimmten Gefühl von Bedrohung war Nina an diesem Abend am runden Tisch zurückgeblieben. Sie konnte Emmelines Gedankengängen so gar nichts Positives abgewinnen, sie waren für sie in keiner Weise tröstlich, auch wenn sie vielleicht so gemeint waren. Eher beunruhigten diese sie und sie empfand sie sogar als verdeckt boshaft. Hinter Emmelines Interpretationen und Unterstellungen verbarg sich das negative Weltbild einer verbitterten Frau, die sich voll Angst und Abwehr in einer ihr vermeintlich feindlich gesonnenen Welt bewegte. Oder war gerade das von Nina boshaft interpretiert und die alte Dame einfach nur realistischer und lebenserfahrener als sie selbst?
Nina seufzte schon auf der Treppe, als sie nach dem Arztbesuch am späten Vormittag die Windfangtür aufschloss und die Wohnung betrat. Wie befürchtet, hatte sie kaum ihren Mantel an die Garderobe gehängt, da erschien Emmeline schon im Flur, als ob sie zufällig gerade in die Küche hatte gehen wollen. Nina entschied sich rasch, ihrer Schwiegermutter vorerst von der bösen Neuigkeit noch nichts zu sagen. Sie musste erst einmal selbst damit fertig werden.
»Alles in Ordnung?«, fragte Emmeline und legte ein kleines Lächeln auf ihre kontrollierten Züge. Es geriet sehr klein und wie immer etwas bitter. Vermutlich ahnte sie mit ihrer Intuition einer Glucke schon wieder, dass etwas Außergewöhnliches passiert war, das sie womöglich auch selbst betraf – zum Beispiel ihren rechtmäßigen Anspruch auf eine fröhliche Schar von Enkelkindern gefährdete.
»Ja«, sagte Nina mit fester Stimme. »Alles in Ordnung. Ich soll mich noch ein paar Tage schonen.«
»Das ist vernünftig. Soll ich dir eine Tasse Tee machen? Aber du möchtest dich vielleicht lieber gleich zurückziehen. Ich kann dir den Tee auch ins Zimmer bringen.«
»Danke nein, ich möchte jetzt keinen Tee. Und ja, ich glaube, ich lege mich erst mal ein Weilchen hin.«
»Aber sicher, meine Liebe. Ich hoffe, dass du dir die schwere Arbeit in der Klinik noch nicht wieder zumuten wirst.«
»Ich werde mich bis zum Wochenende ausruhen. Am Sonntag habe ich Frühschicht und werde die Kolleginnen nicht sitzenlassen.« Nina merkte, dass Trotz und Ärger ihre Stimme streng machten. Sie wollte einfach in Ruhe gelassen werden, war denn das so schwer zu verstehen? Ganz besonders konnte sie es nicht leiden, wenn irgendjemand ihre Arbeitsmoral beurteilte. Stand dahinter nicht deutlich die Kritik an ihrer Berufstätigkeit? Wünschte Emmeline sich eine sorgende Hausfrau und Mutter für ihren Peter? Natürlich tat sie das, denn es war das Rollenmodell, das sie selbst gelebt hatte. Aber damit war sie bei Nina an der falschen Adresse. Nina war Ärztin und würde es immer sein.
»Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest«, sagte sie kühl und schob sich an ihrer Schwiegermutter vorbei in ihr Zimmer.
Emmeline strich ihr wie zufällig rasch über den Rücken. Es sollte vermutlich eine Geste des Mitgefühls und Trostes sein, aber Nina konnte sie nicht als solche annehmen und hätte am liebsten um sich geschlagen. Schnell zog sie die Tür hinter sich zu und ging vor, bis sie in den Sonnenkeil trat, der breit und wohlig warm in ihr Zimmer fiel. Sie legte sich auf die Chaiselongue und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen.
Kapitel 2
Freitag, 6. Februar
»Und der Haifisch, der hat Zähne / und die trägt er im Gesicht. / Und Macheath, der hat ein Messer, / und das Messer sieht man nicht.«
Hans Arlt wiederholte den Refrain noch zweimal mit seiner schönen, hellen Baritonstimme, dann fing Melitta an zu klatschen. Einige andere, die wie Melitta in ihren Fenstern zum Hof lehnten, klatschten mit. Der Drehorgelmann schwenkte seine Mütze und verbeugte sich, und Hans warf als Erster ein Zweipfennigstück aus seinem Fenster in die Mütze. Melittas blasses, spitzes Gesicht war für einen Augenblick verschwunden, dann erschien es wieder. Sie hatte sich ihre Brille aufgesetzt, um besser zielen zu können. Aber der Leiermann sammelte auch die Pfennige auf, die auf den Boden fielen, dann zog er die Mütze wieder in die Stirn und verließ einen Donauwalzer orgelnd den Hof. Bald waren wieder nur noch das Gebell der Hunde der Nachbarschaft und die Schreie der Jungen zu hören, die einen Hinterhof weiter gegen ihren abgeschabten Lederball traten, ihn immer wieder krachend gegen die Hauswände feuerten.
»Kommst du heute Abend hoch?«, rief Hans Melitta zu. »Du kannst auch wieder an die Maschine.«
»Oh ja, ich komme«, rief Melitta und winkte, ehe sie ihr Fenster schloss. Es war eigentlich viel zu kalt, um lange im Fenster zu lehnen.
Alle drei Zimmer der Wohnung, die Melitta mit ihrem Vater, dem Frauenarzt und Geburtshelfer Dr. Brunnen, in der Teltower Straße bewohnte, gingen nach Norden hinaus auf den Innenhof. »Im Hof ist es ruhiger, und im Norden hat man keine direkte Sonne«, sagte der Doktor immer. »In der Sonne verschleißen nur die Möbelstoffe.« Nicht dass an ihren Möbelstoffen noch viel zu verschleißen gewesen wäre. Es gab kaum einen bunten Fleck im Wohn- und Esszimmer. Alle Stoffe waren grau, braun oder schwarz gemustert, verblichen und ausgedünnt. Das Sofa stammte noch von der Großmutter des Doktors aus den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Es war schon bald wieder modern, ein frühes Jugendstilmöbel, solide gezimmert. Aber der ehemals dunkelrote Plüsch hatte allen Flor verloren, und man spürte die Sprungfedern unangenehm deutlich unter der Sitzfläche. Die antiken Kissenbezüge waren fadenscheinig und rochen, als hätten sie in einem Kartoffelkeller überwintert. Melitta wagte kaum noch, sie waschen zu lassen, aus Angst, dass sie dabei ganz auseinanderfielen. Aber Vater kaufte einfach nichts Neues.
»Lohnt nicht«, sagte er. »Für wen denn? Ich brauche nichts mehr, und für dich allein lohnt es auch nicht.«
Peng, da hatte sie es wieder. Sie war das Mauerblümchen, unscheinbar, unattraktiv mit ihrem dünnen, insektenhaften Körper und den schlechten Augen, die sie mit der schlimmen, schweren Brille korrigieren musste, wollte sie nicht ständig gegen die Möbel laufen oder auf der Straße von einem Wagen überfahren werden. Manchmal setzte sie die Brille aus Stolz oder Eitelkeit nicht auf und tappte halb blind durch die Gegend. Ihr herzförmiges Gesicht mit der gewölbten Stirn, der kurzen, geraden Nase und dem spitzen Kinn sah dann eigentlich ganz niedlich aus. Und wenn sie ihr Haar ondulieren ließ, gefiel sie sich fast selbst. Sie war eben der Typ Kindfrau und keine richtige Vollblutfrau.
»Du wirst bestimmt nicht heiraten«, sagte Vater immer. »Du hast es viel zu gut bei mir und bist mir eine tüchtige Hilfe, was willst du mehr?« Dass Melitta tatsächlich ›mehr‹ wollte, wusste er nicht, und es würde ihm auch nicht gefallen. Darum erzählte Melitta ihm niemals, wie sie sich ihr Leben vorstellte. Es war übrigens gar nicht so, dass sie keine Verehrer hätte. Im Prinzip hatte sie sogar einen Verlobten, Otto, einen Schlachtergesellen aus der Bergmannstraße. Sie hatte ihn im letzten Sommer beim Rummel auf dem Kreuzberg kennengelernt. Jeden Sonntag holte er sie seitdem ab, um mit ihr spazieren zu gehen, und er spendierte jedes Mal den Kuchen in einer Konditorei an der Bergmannstraße oder in der Hasenheide. Demnächst würde er seinen Meister machen, und dann wollte er sie heiraten, so stellte er es sich vor. Nur dass Melitta sich das ganz und gar nicht so vorstellte. Aber das wusste er bis jetzt noch nicht. Irgendwie musste sie es schaffen, aus dieser Sache heil wieder herauszukommen.
Am Freitag verließ Melitta die Praxis ihres Vaters schon zwei Stunden früher als sonst, weil Iwana, die Zugehfrau, am Nachmittag nach Hause ging. Sie hatte dann das Abendessen für den Doktor vorbereitet, Melitta musste nur noch die Kartoffeln schälen und kochen, das vorgebratene Fleisch noch einmal in die Backröhre schieben, die Soße binden und das Gemüse aufwärmen. Der Vater kam gegen sieben Uhr aus der Praxis herauf, die sich im Erdgeschoss desselben Hauses befand. Er setzte sich an den Esstisch, band sich die Serviette um den Hals und wartete darauf, dass Melitta ihm die Schüsseln reichte. Dann schenkte er sich ein Glas Rotwein ein und fing an, schweigend und systematisch das Essen in sich hineinzuschaufeln. Melitta saß ihm derweil gegenüber und sah zu, wie er die Kartoffeln in die Soße quetschte, die Erbsen über den Teller jagte, ehe er sie aufspießte und mit regelmäßig geschnittenen Fleischstücken zusammen in seinem Rachen verschwinden ließ. Wie eine Maschine streckte er von Zeit zu Zeit seinen Arm aus, ergriff, ohne hinzuschauen, das Weinglas und befeuchtete den Nahrungsbrei in seinem Mund. Dann tupfte er sich die Lippen mit der Serviette ab und fuhrwerkte, die Nase aufziehend, weiter auf seinem Teller, bis der blitzblank leergegessen war. Melitta schob ihm die Kartoffelschüssel hinüber. Meistens schüttelte er den Kopf. Er sah nie auf. Kein Dank, kein Wort darüber, ob es ihm geschmeckt hatte. Nur ein Reißen der Mundwinkel, um die Nahrungsreste mit der Zunge aus den Backenzähnen schieben zu können, dann flog die Serviette neben den Teller und der Doktor erhob sich, um noch einmal in seiner Praxis zu verschwinden, ein paar späte Patientinnen zu empfangen oder seinen Papierkram zu erledigen. Erst gegen zehn Uhr kam er endgültig herauf in die Wohnung, goss sich einen Schlaftrunk ein und verschwand damit, ohne ein Wort an seine Tochter zu verschwenden, in seinem Schlafzimmer. Bis zum nächsten Morgen um Punkt sechs Uhr tauchte er in der Regel nicht wieder auf.
Melitta hatte schon als Kind nie mit ihrem Vater zusammen die Mahlzeiten eingenommen. Da ihre Mutter bei ihrer Geburt gestorben war, hatte sie mit häufig wechselnden Kindermädchen in der Küche an dem karierten Wachstuchtisch gegessen und sich mit kleinen Happen Brot ohne Butter, aber mit Konfitüre füttern lassen. Käse, Wurst Fleisch oder Fisch mochte sie nicht, auch kaum Gemüse und Obst, höchstens ein bisschen Kompott. Trockene Kartoffeln naschte sie im Stehen aus der Schüssel. Nach dem Essen deckte sie die Fleisch- und Gemüsereste des Doktors ab und bewahrte sie im Winter draußen auf dem Fenstersims auf. Iwana würde sie am nächsten Tag aufbraten oder irgendwie wiederverwertet dem Vater vorsetzen. Sie war es auch, die ihm die Stullen für den Tag schmierte und zurechtlegte. Nur den Kaffee brühte Melitta jeden Morgen für sie beide. So kamen sie über die Runden, Tag für Tag, seit Jahren ein eingespieltes Duo.
Nachdem Melitta auch an diesem Freitagabend die kalten Kartoffeln verschlungen und die leeren Schüsseln und Teller abgespült hatte, band sie sich die Schürze ab und holte einen dicken Stapel Papier aus der Schublade des Tisches in ihrem Schlafzimmer. Die obersten Bögen waren in ihrer akkuraten, gleichmäßigen Handschrift beschrieben. Vom vielen Hervorholen und Blättern waren sie nicht mehr ganz sauber und hatten Eselsohren an allen vier Ecken. Melitta befeuchtete den Mittelfinger der rechten Hand und fing an zu blättern. Etwa nach der Hälfte der Seiten begann der mit Schreibmaschine geschriebene Teil des Manuskripts. Das Papier war dicker und fasste sich glatt und trocken an. Vorsichtig schichtete sie Blatt für Blatt um. Am Anfang waren die Seiten mit tiefschwarzen Lettern bedeckt, dann wurden die Buchstaben immer heller. Dafür gab es weniger Fehler – doppelt getippte oder mit der Hand durchgestrichene Buchstaben –, je weiter sie ans Ende des zwei Finger dicken Papierstapels kam. Ein paar Buchstaben waren heller als die anderen oder rutschten in der Zeile ein wenig nach oben, Hüpfer nannte Melitta sie. Es war immer das große E und manchmal das große M, weil ihr der Wagen mit der Walze, den man hochstemmen musste, zu schwer war, um von kleinen auf große Buchstaben zu wechseln. Manchmal verhakten sich die Typenhebel und hauchten nur einen einzigen, meistens den falschen, Buchstaben auf das Blatt, während die anderen sich in einem heillosen Chaos miteinander verstrickten und gegenseitig blockierten. Mit den Fingern voll Druckerschwärze musste sie die Hebel wieder richten. Meistens trugen Seiten, die ein solches Malheur überstanden hatten, am Ende schwarze Fingerabdrücke, weil Melitta nicht daran dachte, die Druckfarbe wieder abzuwaschen, ehe sie das fertig getippte Blatt anfasste, um es am Ende aus der Maschine zu ziehen.
Melitta zählte fünf neue, weiße Blätter ab – so viele konnte sie an einem Abend meist nicht beschreiben, aber sie hatte lieber ein oder zwei der kostenbaren, teuren Blätter zu viel als zu wenig dabei. Sie schob sie in eine große bestickte Stofftasche, die auch noch aus den Beständen ihrer seligen Großmutter stammte, kontrollierte, ob ihre Fingernägel auch nicht zu lang waren, und machte sich auf den Weg zu den Nachbarn.
Obwohl die Wohnung der Arlts im ersten Hinterhaus der Teltower Straße 36 gelegen war, war sie doch ganz genauso geschnitten wie die von Doktor Brunnen im zweiten Stock des Vorderhauses. Aber die Atmosphäre da oben im 5. Stock war ganz anders. Man erkannte die Räume mit den hellen, freundlichen Tapeten kaum wieder. Die Tür zwischen Wohnzimmer und Esszimmer – das eigentliche Esszimmer war in der Wohnung im Vorderhaus Melittas Schlafzimmer – stand immer offen und machte den Raum großzügig und weit. Die wenigen Sitzmöbel waren an die Wand gerückt. Im Zentrum des gastlichen Raumes stand ein großer Tisch, um den sich abends immer eine Reihe Gäste einfanden. Auf den Fensterbänken brannten Kerzen in fünf- und siebenarmigen Messingleuchtern, die Franziska auf Trödelmärkten erstand. Hans, der als Dramaturg am Theater am Schiffbauerdamm nahe dem Bahnhof Friedrichstraße arbeitete, hatte einen Hang zu exotischen Schnitzereien und indischem Tand, mit denen er die Wände dekorierte. Immer roch es bei ihnen nach Räucherstäbchen und parfümierten Tees. Außerdem vergaß Hans nie, für seine Frau Blumen mitzubringen – allerdings waren es meistens Pflanzen, die sich in einer Vase eher ungewöhnlich als hübsch ausnahmen. Fleischfressende Pflanzen zum Beispiel oder seltsam geformte Lianen, die er wer weiß wo erstand. Alles in allem war diese Wohnung der faszinierendste und ungewöhnlichste Ort, den Melitta inmitten der Kreuzberger Kleinbürgeridylle je betreten hatte.
Als sie an diesem Abend zu den Arlts kam, saßen wie üblich schon ein paar Gäste um den großen Tisch, der noch die Reste eines einfachen Abendessens trug. Zwei Weinflaschen standen dazwischen, die eine leer, die andere halb voll. Franziska Arlt, die hochschwanger war und die Melitta aus der Sprechstunde ihres Vaters kannte, winkte sie zu sich heran.
»Iss ein bisschen, Melitta. Es gibt noch Fleischsalat, den hat Gustav selbst gemacht. Gustav kennst du doch, oder? Er hat eine Zeitlang den Peachum gespielt. Du erinnerst dich sicher.«
Melitta erinnerte sich nicht an einzelne Schauspieler, obwohl sie die Dreigroschenoper mindestens zwanzig Mal gesehen hatte und dabei sicher auch einmal die Besetzung mit diesem Gustav als Peachum. Aber sie war immer wieder so fasziniert von der Geschichte, dass sie die Schauspieler nie als Menschen wahrnahm. Sie hatte außerdem kein gutes Gedächtnis für Gesichter. Vielleicht waren ihre Augen einfach zu schlecht, um auf der Bühne Gesichter so gut zu erkennen, dass sie sie später am Esstisch der Arlts wiedererkannte. Sie spürte nur, wie sich sogleich das prickelnde Gefühl einstellte, hier oben bei den echten, lebendigen Künstlerinnen und Schauspielern mitten im richtigen Leben anzukommen, mit Menschen zusammen zu sein, für die das Theater das Leben bedeutete. Das Leben, das Melitta auch führen wollte. Anstatt die Gattin eines braven Schlachtermeisters in Kreuzberg zu werden, von morgens bis in die Nacht in der Küche und hinter einem Fleischertresen zu stehen, oder aber in der Sprechstunde ihres Vaters schwangere Frauen zu betreuen und ihnen und ihrem brüllenden Nachwuchs die Zeit zu vertreiben, bis der Doktor Zeit für sie hatte. Nein, das war nicht ihre Sache! Sie wollte im Theater arbeiten oder besser: für das Theater. Eine Schauspielerin war sie nicht, das war klar. Dafür war sie viel zu schüchtern und vor allem zu unscheinbar, um eine Rolle wirklich ausfüllen zu können. Aber ein Theaterstück schreiben, das konnte sie. Et voilà, nun war es fast fertig, bald schon.
»Melitta – was macht dein Stück? Melitta schreibt ein Theaterstück«, erklärte Hans seinem Freund und Schauspielerkollegen. »Drei Akte sind schon fertig, stimmt’s? Und jede Menge Blut und Tränen fließen. Das könnte was für uns sein. Wenn es nur ordentlich zur Sache geht.«
Melitta wollte sich schnell an den Männern vorbeidrücken. Vorsichtig bewegte sie ihre große Tasche über Tisch und Stühle, damit das Papier darin nicht zerknickte, während sie sich hinter den Leuten vorbeidrückte.
Der andere Gast, vielleicht Gustavs Partnerin, war eine mondäne, ungefähr vierzigjährige Frau mit knabenhaft kurzem Haar. Sie trug ein Herrenjackett und saß neben Franziska. Ironisch lächelnd beobachtete sie Melitta, als würde sie kein Wort glauben von dem, was Hans sagte.
»Aha«, sagte sie schließlich, zog ausgiebig an ihrer Zigarettenspitze und entließ eine Rauchfahne aus ihrem Mund. »Das würde ich auch gern mal lesen.«
»Zaza, du sollst nicht immer so zynisch sein«, meinte Hans. »Zaza arbeitet für Die Freundin, das Journal kennst du doch sicher, Melitta?«
Melitta nickte und schob sich an der Wand entlang bis zur Tür, die ins angrenzende Schlafzimmer führte.
»Ich bin überhaupt nicht zynisch«, antwortete Zaza. »Ich entdecke auch gern junge Talente. Konkurrenz belebt nämlich das Geschäft. Vor allem unter faulen, einfallslosen Journalisten.«
»Ich glaube nicht, dass ich Talent für den Journalismus habe. Ich möchte nur für die Bühne schreiben«, sagte Melitta und erschrak, weil sie, kaum waren die Worte draußen, bemerkte, wie arrogant sie sich anhörten.
Alle brachen in Gelächter aus.
»Sieh mal einer an, ganz schön selbstbewusst«, rief Zaza. »Aber warum nicht, Fräulein ...«
»Brunnen. Melitta Brunnen.«
»Schicken Sie mir doch mal eine Arbeitsprobe, Fräulein Brunnen«, fuhr sie fort, um sich dann wieder den anderen Gesprächen am Tisch und ihrem leeren Glas zuzuwenden.
»Willst du auch einen Schluck Roten?«, rief Hans Melitta nach, während er Zazas Glas nachfüllte. »Wir stören dich dann auch nicht mehr.«
»Nein, danke«, flüsterte Melitta. Sie war knallrot geworden, verschwand schnell im Schlafzimmer und zog die Tür hinter sich zu. Vor ihr, auf einem kleinen Tisch am Fenster, thronte die wunderbare Schreibmaschine. Melitta biss sich auf die Unterlippe und atmete tief durch. Kein Mensch konnte ermessen, was diese Augenblicke für sie bedeuteten. Sie holte die weißen Papierbögen aus der Tasche und spannte den ersten zwischen die Walzen der Maschine. Die schwarzen Tasten mit den silbernen Ringen stiegen in fünf Reihen wie eine Treppe vor ihr auf. Während sie sich in das Buchstabenfeld vertiefte, wurden die beschwipsten Stimmen im Nebenzimmer langsam leiser, rückten immer weiter weg. Ihr Vater, der ungefähr um diese Zeit die Treppen aus der Praxis hinauf in die Wohnung stieg, den Schlüsselbund aus der Tasche holte und die Wohnungstür aufschloss – er verschwand wie ein Schemen hinter dem Horizont. Die Wohnung der Arlts, die Teltower Straße in Berlin-Kreuzberg, das eben begonnene Jahr 1931, alles verschwand um sie herum, als wäre es nur Kulisse, Aussichten aus einem fahrenden Zug, der in steigendem Tempo eine Landschaft verließ, um neue, fremde Landschaften zu erobern. Und in der schwarzen, spiegelnden Fensterscheibe vor ihr, hinter der die frostige Februarnacht knackte, begannen sich vor Melittas innerem Auge die Worte zu formieren, einen ersten Satz zu bilden, dann immer weitere, ein ganzes Bild, eine Szene, lebendig, als wäre es das Leben selbst. Als würde sie in ein anderes Leben eintreten, ein gänzlich frei gewähltes, selbst gestaltetes, das sie ganz allein unter Kontrolle hatte. Dann spannte sie die Hände über den Tasten auf und begann in erstaunlich raschem Tempo zu schreiben.
Kapitel 3
Samstag, 7. Februar
Nina stieg an der Gedächtniskirche aus, um den Kurfürstendamm hinunterzuschlendern. So konnte sie die notwendige Wohnungssuche mit dem Wunsch verbinden, sich Berlin anzuschauen, auszukundschaften und kennenzulernen. Außerdem wollte sie nicht allein eine hübsche Wohnung finden, sondern auch das Viertel drum herum musste ansprechend sein. Kindgerecht – hatte sie bis jetzt auch gedacht. Diesen Gedanken konnte sie nun ein für alle Mal begraben. Es schmerzte, Nina spürte wieder die Trauer, die sie taub machte für alle anderen Gefühle. Wo war die überschäumende Freude geblieben, mit der sie sich auf den Weg nach Berlin gemacht hatte? Die Neugier und Abenteuerlust? Die Stadt war ihr plötzlich fast gleichgültig, am liebsten würde sie wieder zurückfahren nach Danzig. Aber das kam gar nicht infrage. Sie musste das jetzt durchstehen: Die Enttäuschung, dass es dieses ganz andere Leben als bisher für sie jetzt und in Zukunft nicht geben würde; ein Leben in einer Familie, wie sie sie selbst nie gekannt hatte, war doch ihr Vater schon vor ihrer Geburt gestorben. Er war Arzt gewesen und hatte sich mit knapp vierzig bei einer Patientin mit Diphtherie angesteckt. Offenkundig sollte es ihr nun ebenso wenig wie ihren Eltern gelingen, so etwas wie eine normale, kleinbürgerliche Familie zu gründen. Sie musste sich damit abfinden, es gab keinen anderen Weg. Sie musste ihr Schicksal akzeptieren, und – wer weiß – vielleicht gab es auch Vorteile darin zu entdecken.
Gestern Abend am Telefon hatte sie noch nicht den Mut gehabt, Peter die ganze Wahrheit zu sagen.
»Wir werden andere Kinder haben«, hatte er sie zu trösten versucht, nachdem er gemerkt hatte, wie sehr sie unter der Fehlgeburt litt. Nina hatte geschwiegen, auch weil Emmeline sich wie immer im Hintergrund zu schaffen machte. Mit ihr wollte sie auf keinen Fall über all das sprechen. Eine gute Freundin könnte sie jetzt brauchen, eine, die nur zu ihr stand und nicht ihre eigenen Interessen mit ins Spiel brachte. Aber die Freundinnen aus Lübeck, München und Wien waren ihr durch die Ortswechsel nach und nach verloren gegangen. Sie hatte auch viel zu wenig Zeit zum Briefeschreiben. Vor allem, seitdem in Danzig Peter ins Spiel gekommen war – Verliebtheit war Gift für alte Freundschaften, das war schon immer so und würde wohl auch immer so bleiben. Sicher würde sie mit der Zeit neue Freunde in Berlin finden.
Aber mit Peter musste sie bald offen über alles sprechen, das war klar. Es fiel ihr nur so schwer am Telefon, aber anders ging es ja gerade nicht. Sie würde viel lieber spüren können, wie er es aufnahm. Vielleicht war es für ihn gar nicht so schlimm, dass sie keine Kinder zusammen haben würden? Er ging wie sie in seiner Arbeit auf, das war in Danzig so gewesen, das würde auch in Berlin so sein. Vielleicht würde er sie trösten und in den Arm nehmen, denn es war doch vor allem erst einmal ihr Kummer! Aber vor März würden sie sich nicht sehen. Mit der Reichsbahn waren es sieben Stunden Fahrt von Danzig bis Berlin, das machte man nicht mal eben so. Wenn sie ehrlich war, hatte sie auch ein bisschen Angst vor diesem Gespräch, egal in welcher Form. Es könnte schließlich auch ganz anders ausgehen, als sie es sich wünschte.
Vertieft in ihre Grübeleien, hatte Nina kaum einen Blick für die breiten Bürgersteige des Ku’damms, wo im Sommer die Gartencafés aufgebaut wurden. Die jungen Bäume würden bald eine prächtige Allee bilden. Sie freute sich schon darauf, hier im Café zu sitzen und die Passanten zu beobachten! Auch jetzt flanierten hier Frauen vor den Schaufenstern, die aussahen, als wenn sie nichts anderes zu tun hätten, als sich mit ihren todschicken Pelzmänteln und kostbaren Handtaschen sehen zu lassen. Es gab teure Geschäfte für Möbel oder Automobile ebenso wie kleine Kramläden für Mode, Strümpfe oder Miederwaren. Die Dekorationen waren so fantasievoll und exotisch, wie Nina es sonst nur aus Wien kannte. In manchen Fenstern zeigten lebensgroße Puppen die neueste Mode, manche bewegten sich mechanisch und führten irgendwelche Produkte vor. Vor einem prächtigen Juweliergeschäft blieb Nina stehen und konnte sich nicht sattsehen an den Perlencolliers und dem Brillantgeglitzer. Sie trug selbst keinen Schmuck, aber anschauen mochte sie ihn gern. Und dann fiel ihr wieder Emmeline ein und wie Peter es aufnehmen würde, dass seine Mutter nun keine Enkelkinder bekäme, und ihre gute Laune versank wie ein Lot im Wasser. Nein, so fing man eine Ehe nicht an, mit einer allgegenwärtigen Schwiegermutter, die Nina schon jetzt das Leben schwer machte. Dabei war sie bald dreißig Jahre alt, stand schon lange auf eigenen Füßen; sie hatte es einfach nicht nötig, sich von irgendjemandem in ihre Angelegenheiten hineinreden zu lassen.
An der Wilmersdorfer Straße bog Nina hinter einem piekfeinen Schuhgeschäft vom Ku'damm ab. Das Gerumpel der Straßenbahnen und der Lärm der Autos, Doppeldeckerbusse, Pferdefuhrwerke, Fahrradkarren und von unendlich vielen Fußgängern verebbte langsam hinter ihr. Über die beschauliche Mommsenstraße gelangte sie in die Gervinusstraße, die direkt am Damm der S-Bahntrasse entlangführte. In Richtung Osten sah sie dunkel und eng aus, dort gab es nur eine Eckkneipe, in der Schultheiß-Bier ausgeschenkt wurde, einen Reparaturschuster, einen Kohlenhändler und einen Krämerladen, der ein großes Fass mit Sauerkraut und eins mit Spreewälder Salzgurken trotz der Kälte auf dem Bürgersteig präsentierte. Nach Westen hin wurde der Abstand zum Bahndamm immer größer, sodass im Zwischenraum ein Grünstreifen entstanden war. Vor dem Mietshaus Nummer Vierzehn blieb Nina stehen. Gegenüber war der Grünstreifen zu einem richtigen Park gestaltet worden, sogar zwei Bänke standen dort. Dahinter erhob sich die Rückseite des Bahnhofs Charlottenburg, in dem man in die Stadtbahn einsteigen, aber auch in den Westen fahren konnte, nach Frankfurt, Hannover oder Köln. Der Eingang lag allerdings auf der anderen Seite der Gleise am Stuttgarter Platz. Der Schienenverkehr mit den Dampfloks hatte die Fassaden der relativ neuen fünf- oder sechsstöckigen Wohnblocks schon dunkel gefärbt. Von den Zügen aus konnte man vermutlich in die Wohnungen schauen – und umgekehrt.
Die Straße war nicht so prächtig wie viele andere in Charlottenburg – und lange nicht so belebt wie der Kiez in Kreuzberg um die Gneisenaustraße herum –, sie war nicht besonders freundlich und vermutlich nur am Morgen sonnig, aber Nina hatte schon hässlichere Straßen in Berlin gesehen. Sie suchte den Zettel aus ihrer Handtasche: Gervinusstraße 14, rechtes Gartenhaus, IV. Stock, Klingeln bei Tollbrink. Das hatte sie am Morgen aus der Zeitungsannonce abgeschrieben, ›Besichtigung ab 14 Uhr‹. Es war genau zehn nach zwei Uhr. Sie schob eine schwere Haustür auf, denn eine Klingelleiste gab es nicht.
Gartenhaus klang gemütlich, aber Emmeline hatte sie schon darüber aufgeklärt, dass ein Gartenhaus nur wenig besser war als das erste Hinterhaus, aber nicht viel. Gartenhäuser nannte man in Berlin die querstehenden Häuser zwischen den Vorder- und Hinterhäusern. Nina konnte sich trotzdem nicht richtig vorstellen, wie ein Gartenhaus anders aussehen sollte als die kleinen, grün oder rot gestrichenen Häuser auf den Parzellen, zwischen denen sie in ihrer Lübecker Kindheit Verstecken gespielt hatte. Ein Gartenhaus sollte doch zumindest in einem Garten stehen. Aber in diesem wie üblich grau und schwarz verrußten Berliner Hinterhof gab es kein einziges Bäumchen, nicht mal ein paar Büsche. Der Boden war mit unebenen Platten bedeckt, die Mülltonnen in der Ecke hatten keine Deckel mehr. Der Abfall quoll einfach so auf die Erde, ein paar magere Katzen wühlten in ihm herum. Man musste den Kopf weit ins Genick legen, um ein Stückchen des grauen Winterhimmels zu erspähen, der Schnee versprach. Vermutlich würde nicht einmal ein Löwenzahnpflänzchen unter diesen Bedingungen sein bescheidenes Dasein fristen können.
Nina wandte sich dem rechten Gartenhaus zu. Wieder keine Klingelleiste. Die Haustür war nur angelehnt. Wurde hier tagsüber nicht abgeschlossen? Und wie war es nachts? Und falls abgeschlossen wurde – wie kamen dann Gäste ins Haus, wenn man doch nirgends klingeln konnte? Ein Fenster im Erdgeschoss wurde aufgerissen.
»Wollen Sie zu Tollbrink? Vierter Stock, ganz oben. Da wo die Treppe schön gemacht ist, weil nicht jeder seine dreckigen Kloben abtritt wie unten.«
Eine Frau – oder war es ein Mann? – lauerte in einer Wohnungstür, als Nina das Haus betrat. Wirres graues Haar hing um ein von speckigen Falten gezeichnetes Gesicht, ein großes Ohr war freigelegt, auch das wirkte androgyn. Die Hand verriet schließlich die Frau, sie war zu klein für einen Mann, wenn auch voller Schwielen und mit schwarzen Fingernägeln, lang wie an einer Klaue. Diese Frau war vielleicht des Rätsels Lösung, wie man auch nachts hier in die Häuser gelangte: Es gab Concierges, Portiers oder einfach wachsame alte Leute, die sich gern in die Sachen anderer Leute einmischten. Kein Problem. Als Ärztin hatte Nina die Erfahrung gemacht, dass die meisten sich gern gut mit ihr stellten, wenn sie von ihrem Beruf erfuhren. Überhaupt hatte jeder gern einen Arzt im Haus, man konnte ja nie wissen.