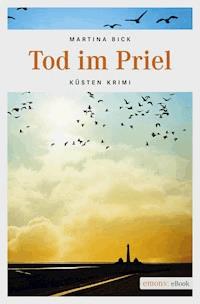5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Polizeipsychologin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dieser Kriminalroman ist auch als Hörbuch unter dem Titel »Die Polizeipsychologin – Spur der Träume« erhältlich. Die dunkle Seite der goldenen 20er: Der Spannungsroman »Die Polizeipsychologin – Im Dunkel der Stadt « von Martina Bick jetzt als eBook bei dotbooks. Sie hat in Wien bei Sigmund Freud studiert und in die Abgründe der menschlichen Seele geblickt – er soll in einer für ihn fremden Stadt das Morddezernat aufbauen: Zwei mysteriöse Todesfälle führen den Berliner Kommissar Peter Jordan und die junge, selbstbewusste Ärztin Nina Norge im Danzig der späten zwanziger Jahre zusammen. Gemeinsam versuchen die beiden, dem Täter auf die Spur zu kommen – er mit den neuesten Erkenntnissen moderner Kriminalistik, sie mit ihrem Wissen über die Psyche der Menschen. Doch Jordan und Norge ahnen nicht, wie sehr sie sich dadurch selbst in Gefahr bringen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Polizeipsychologin – Im Dunkel der Stadt« von Martina Bick ist ein Krimi mit viel Zeitkolorit, der Fans von Helene Sommerfeld, »Babylon Berlin« und der Bestsellerserie »Fräulein Gold« begeistern wird. Er war bereits unter den Titeln »Die Spur der Träume« und »Die Polizeipsychologin – Spur der Träume« erhältlich. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie hat in Wien bei Sigmund Freud studiert und in die Abgründe der menschlichen Seele geblickt – er soll in einer für ihn fremden Stadt das Morddezernat aufbauen: Zwei mysteriöse Todesfälle führen den Berliner Kommissar Peter Jordan und die junge, selbstbewusste Ärztin Nina Norge im Danzig der späten zwanziger Jahre zusammen. Gemeinsam versuchen die beiden, dem Täter auf die Spur zu kommen – er mit den neuesten Erkenntnissen moderner Kriminalistik, sie mit ihrem Wissen über die Psyche der Menschen. Doch Jordan und Norge ahnen nicht, wie sehr sie sich dadurch selbst in Gefahr bringen …
Über die Autorin:
Martina Bick wurde 1956 in Bremen geboren. Sie studierte Historische Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Gender Studies in Münster und Hamburg. Nach mehreren Auslandsaufenthalten lebt sie heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater arbeitet. Martina Bick veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane, Romane und Kurzgeschichten und war auch als Herausgeberin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2001 war sie die offizielle Krimistadtschreiberin von Flensburg.
Bei dotbooks veröffentliche Martina Bick die Romane »Unscharfe Männer«, »Die Landärztin« und die Fortsetzung »Neues von der Landärztin«, die im Sammelband »Das kleine Pfarrhaus auf dem Land« zusammengefasst sind sowie die Krimi-Reihe um Hauptkommissarin Marie Maas, die folgende Bände umfasst:
»Der Tote und das Mädchen. Der erste Fall für Marie Maas«
»Tod auf der Werft. Der zweite Fall für Marie Maas«
»Die Tote am Kanal. Der dritte Fall für Marie Maas«
»Tödliche Prozession. Der vierte Fall für Marie Maas«
»Nordseegrab. Der fünfte Fall für Marie Maas«
»Tote Puppen lügen nicht. Der sechste Fall für Marie Maas«
»Totenreise. Der siebte Fall für Marie Maas«
»Heute schön, morgen tot. Der achte Fall für Marie Maas«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022, Juni 2024
Dieses Buch erschien unter dem Titel »Die Spur der Träume« bereits 2001 bei Ullstein und 2014 bei dotbooks, außerdem 2022 unter dem Titel »Die Polizeipsychologin – Spur der Träume« bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2014, 2022, 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Konstantin Zaynakaev und AdobeStock/The AI Middleman
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-391-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Polizeipsychologin«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Martina Bick
Die Polizeipsychologin – Im Dunkel der Stadt
Roman
dotbooks.
Teil 1
Prolog
Seit siebzehn Tagen und Nächten hatte es in Danzig ununterbrochen gefroren, und alle Gassen und Wege waren so spiegelglatt wie die Rutschbahnen der Kinder auf dem Bischofsberg oder auf der zugefrorenen Radaune. Die Schneewälle an den Straßen waren vereist und die Bürgersteige wurden von Tag zu Tag holpriger und gefährlicher mit ihrer dicken Eiskruste. Asche, Sand, Schotter und Splitt waren hineingetreten in die Eisschichten und gaben niemandem mehr Halt.
Leopold Schaad war nicht bange vor dem Eis, aber Aida, seine Schimmelstute, wieherte unruhig, als er über den Hof glitschte, um sie loszubinden. Dabei hatte er Eisnägel in ihre Hufe geschlagen, und sie stand damit so sicher auf dem glatten Boden wie ein Schneepflug. Aus ihren Nüstern stieg der Atem in weißen Wolken in die Nachtluft auf.
Leo zog die Decke von ihrem Rücken, band die Zügel von dem alten Kutscherunterstand los und schwang sich elegant in den Sattel. Er legte die Schenkel an. Er trug leichte Reithosen und einen dicken Lammfellmantel darüber, der hinten geschlitzt war und bis über die Knie reichte. Vorsichtig dirigierte er den Schimmel durch den dunklen Hof. Rechts und links vom Kutscherunterstand erhoben sich auf einem u-förmigen Grundriss die vier Stockwerke des hochherrschaftlichen Mietshauses mit ihren riesigen Wohnungen. Alle Küchenfenster waren erleuchtet, denn es war der Silvesterabend und die Köchinnen und Küchenmädchen waren mit den Vorbereitungen für die Silvesterfeiern beschäftigt. Irgendwo wurde ein Fenster geöffnet und jemand rief etwas herunter. Leo hörte nicht hin. Er fasste die Zügel straffer. Die Tordurchfahrt war stockfinster, die Gaslampe war mal wieder kaputt. Plötzlich, als Aida den ersten Huf auf den Bürgersteig der kleinen Scharmachergasse setzte, scheute sie und warf den Kopf herum. Sie buckelte, so dass Leo die Zügel verlor, und dann stieg sie auf, von Schmerz und Angst gepeinigt.
Leo stand in den Steigbügeln und versuchte, sich an der kräftigen, schwarz-weiß gesprenkelten Mähne festzuklammern, aber dann, als das Pferd noch einmal aufstieg, flog er im hohen Bogen aus dem Sattel, während die Stute mit ihren genagelten Hufen an einem Eishügel hängen blieb und so unglücklich stürzte, dass sie schnaufend, mit dampfenden Nüstern auf dem Eis liegen blieb.
Bald liefen die ersten Passanten und Hausbewohner herbei und leuchteten mit Lampen und Lichtern das Unglück aus. Sie fanden den Studenten Leo Schaad neben seiner Stute in dem schmiedeeisernen Gatter hängen wie Jesus Christus am Kreuz. Ein eiserner Stab hatte seinen Rücken durchbohrt. Er war tot.
Unweit des Torwegs saß eine schwarze Katze und putzte sich sorgfältig ihre blutigen Pfoten. Als jemand sie aufnehmen wollte, sprang sie rasch davon.
Kapitel 1
Es war schon dunkel, als der Zug sich bei Dirschau der Grenze näherte. Die plombierten Wagen, die den so genannten polnischen Korridor verschlossen durchquert hatten, wurden weitergeleitet nach Königsberg, während die Reisenden nach Danzig von den Passbeamten des Freistaates Danzig und den polnischen Zöllnern kontrolliert wurden.
Nina Norge, die aus Lübeck kam, hievte die große Ledertasche aus dem Gepäcknetz über ihrem Sitz. Der freundliche Herr, der ihr in Berlin geholfen hatte, die Tasche hochzustemmen, hatte sich hinter Frankfurt an der Oder verabschiedet, um in ein Raucherabteil umzuziehen. Der polnische Zöllner fasste nicht mit an. Er beobachtete Nina schweigend und verzog mehrmals ungeduldig den Mund, als hätte er einen nervösen Tick. Ein anderer Zöllner forderte die ältere Frau am Fenster auf, ihren Haarknoten zu lösen. Sie hätte darin ja etwas in den Freistaat schmuggeln können.
»Ist das Ihr Koffer, Frau?«, fragte der polnische Zöllner mit dem zuckenden Mund. Er zeigte auf den großen, verschnürten Schrankkoffer, der auf dem Gang vor dem Abteil stand.
»Soll ich den auch öffnen?«, fragte Nina.
»Das ist ja der reinste Umzug«, mischte sich der Danziger Passbeamte ein.
»Es ist ein Umzug«, sagte Nina. »Ich übersiedele nach Danzig. Ich bin Ärztin. Ich werde in der Praxis meines Onkels arbeiten.«
»Ärztin«, wiederholte der Passbeamte und blätterte noch einmal in Ninas Pass. »Aus Lübeck, so. Ist Ihr Onkel etwa Doktor Norge im Poggenpfuhl?«
»Ja genau, das ist seine Anschrift, Poggenpfuhl 6.«
»Grüßen Sie ihn schön von mir. Mein Name ist Trzoska, Arthur Trzoska. Doktor Norge hat meinen Ältesten gerettet, als er fast am Keuchhusten gestorben wäre. Und alles Gute für Sie in Danzig.« Der Passbeamte salutierte andeutungsweise und sagte zu seinen polnischen Kollegen vom Zoll: »Ich denke, die Koffer dieser Dame sind schon in Ordnung.«
Wenige Minuten später wurde die Reise fortgesetzt.
Am Hauptbahnhof in Danzig standen die Gepäckträger Schlange und warteten auf Kundschaft aus dem einfahrenden Zug aus dem Altreich. Nina lud ihre Last einem Träger auf und suchte vergeblich in den vielen Gesichtern das eine vertraute des Onkels. Plötzlich hörte sie hinter sich eine bekannte Stimme laut ihren Namen rufen. Sie drehte sich um und entdeckte Georg, den Hausdiener.
»Fast hätte ich Sie verpasst«, keuchte Georg. »Der Doktor ist zu einem Notfall gerufen worden. Hat er mir doch die Uhrzeit falsch gesagt! Herrje, was hätte er geschimpft, wenn ich ohne Sie heimgekommen wäre! Herzlich willkommen in Danzig, liebes Fräulein Nina!«
Er sprach laut und gestikulierte, so dass die Leute sich nach ihnen umdrehten und Nina in ihrem modernen, dunkelbraunen Reisekostüm und die Gepäckkarre mit dem großen Schrankkoffer neugierig musterten. Georg zerdehnte die Vokale auf eine weiche, für Ninas norddeutsche Ohren ganz ungewohnte Art und Weise und gab den Worten eine singende, melancholische Note.
Im trüben Licht der Straßenlaternen stand der struppige Haflinger vor der Droschke und wartete. Das Lederverdeck glänzte vom feinen Sprühregen, der sich wie Nebel um die Lampen und Lichter legte. Von weitem hörte man die Glocken der Elisabeth-Kirche zur Vesper läuten. Die elektrische Straßenbahn bog bimmelnd um die Ecke und spuckte eilende, eingemummte Menschenscharen auf den Bahnhofsplatz. Eine Böe feuchter, nach Salz und Fisch schmeckender Luft verschlug Nina den Atem.
Das war Danzig, ihre neue Heimat. Hier sollte sie von nun an leben und arbeiten. Es war Freitag, der 15. März 1927, ihr sechsundzwanzigster Geburtstag.
Christoph Norge war Junggeselle und wohnte allein in der unteren Etage eines großzügigen Danziger Kaufmannshauses in einem ruhigen, einfachen Wohnviertel der Vorstadt. Er war der ältere Bruder von Ninas Mutter, die kurz nach Weihnachten in Lübeck viel zu jung an einem Krebsleiden gestorben war. Da Nina genau wie er ohne weitere Angehörige ganz allein dastand, hatte er sie mit einem langen, einfühlsamen Brief überredet, nach Danzig zu kommen und ihn in seiner Hausarztpraxis zu unterstützen mit der Aussicht, diese später einmal zu übernehmen.
Seinem Haus schräg gegenüber reckte die Petri-und-Pauli-Kirche ihren quadratischen, sich in Treppengiebeln verjüngenden Turm in den Himmel. Gleich hinter dem Winterplatz führte die stille Ankerschmiedegasse auf die Lange Brücke an der Mottlau, die sich träge und schwarz schimmernd unter den zahlreichen Brücken der Stadt dahin wälzte, um dann, mit der Weichsel vereint, in die nahe Ostsee zu münden. Über die Lange Brücke gelangte man durch sieben Tore in die Gassen der Rechtstadt, eines schöner und hübscher als das andere, bis hin zum berühmtesten von allen, zum Wahrzeichen der Stadt: dem mächtigen Krantor.
Auch die Türme der Marienkirche, ihre spitzigen Hütchen und den breiten Glockenturm konnte man von Christoph Norges Haustür aus sehen. In weniger als zehn Minuten war man zu Fuß auf der Langgasse und am Zeughaus, mitten im geschäftigen Getriebe der alten Hansestadt, die vom Handel reich geworden war und wegen ihrer strategisch günstigen Lage von den einzelnen Nationen immer wieder umkämpft wurde.
»Es tut mir Leid«, rief der Doktor und öffnete die Arme, um seine Nichte zu empfangen. »Im letzten Augenblick klingelte das Telefon und ich musste zu einer Patientin – ich hoffe, Georg hat dich gebührend empfangen?«
Nina nahm seine Geburtstagsglückwünsche entgegen und schob sich an ihm vorbei in die Diele, wo Martha, die Köchin, schon auf sie wartete.
»Endlich ist das Kind da«, rief Martha. »Und endlich für immer. Wie oft habe ich mir das früher gewünscht. Auch wenn ich der lieben Frau Irina ihr Kind nicht neiden wollte, Gott hab sie selig.« Sie wischte sich mit dem Schürzenzipfel eine Träne von der Wange und verschwand in der Küche, während Georg das Gepäck ins Haus trug.
»Ist das alles, was du mitbringst, oder hast du noch Gepäck aufgegeben«, fragte der Onkel.
»Ich habe ein paar Möbel und einige Kisten mit Mutters Sachen in Lübeck untergestellt. Ich kann sie später bringen lassen, wenn ich eine eigene Wohnung gefunden habe. Fürs Erste ist das hier alles.«
»Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht zu Irinas Beerdigung gekommen bin. Aber ich konnte meine Patienten einfach nicht im Stich lassen. Hast du die Reise gut überstanden?«
Nina nickte. »Von Lübeck ist es ja nicht so weit wie von Wien. Mutters Wohnung ist aufgelöst, nur der Flügel ist noch nicht verkauft. Ich habe aber einen sehr guten Händler gefunden, der ihn in Kommission genommen hat.«
»Er ist wahrscheinlich das Wertvollste, was deine Mutter dir hinterlassen hat.«
»Viel, viel wertvoller noch sind für mich mein Studium und die Ausbildung in Wien. Ich werde ihr immer dankbar sein, dass sie mir das ermöglicht hat.«
»Das war für sie eine Selbstverständlichkeit. Du machst dir doch nicht immer noch Vorwürfe, dass du in ihrer letzten Stunde nicht bei ihr warst? Ich habe deiner Mutter mehrmals angeboten, hierher zu kommen. Wir hätten sie gepflegt, Martha und ich wären Tag und Nacht für sie da gewesen. Sie wollte es nicht.«
Der Doktor nahm Nina Mantel und Schal ab und führte sie ins Esszimmer, wo Martha den Tisch mit einem Geburtstagsgesteck aus Kerzen und Schleierkraut geschmückt hatte. Sie brachte eine dampfende Schüssel aus der Küche herein.
»Hühnersuppe und danach gibt es gebratene Pomucheln«, sagte sie. »Extra für unser Geburtstagskind.«
Man setzte sich zu Tisch. Es war lange her, dass Nina so verwöhnt worden war. Die Suppe schmeckte köstlich.
»Was hatte denn deine Patientin? Einen Blinddarmdurchbruch? Eine Gallenkolik?«
»Wo denkst du hin. So etwas passiert doch nur mitten in der Nacht. Ich war bei den Levendieks, mal wieder bei der ältesten Tochter. Selbstmordversuch«, flüsterte der Doktor hinter vorgehaltener Hand. »Völlig ungefährlicher Schnitt am linken Handgelenk, aber ein Schreck für die Familie. Vor ein paar Wochen ist dem Mädchen der Bräutigam gestorben. Reitunfall. Direkt vor ihrer Haustür. Das war natürlich ein Schock. Seitdem liegt sie im Bett und kümmert.«
»Die Arme«, sagte Nina. »Wie alt ist sie?«
»Neunzehn. Ein bildhübsches Mädchen. Wird Zeit, dass sie unter die Haube kommt.«
»Vielleicht ist sie in eine Melancholie geraten. Das geschieht leicht nach schweren Verlusten.«
»Papperlapapp. Melancholie – so weit kommen wir noch. Willst du den Fall übernehmen?«
»Ich werde gleich morgen früh zu ihr gehen.«
»Schwere Verluste – wir sind doch nicht im Krieg. Hat dir das dieser Professor Freud beigebracht?« Kopfschüttelnd stellte der Doktor seinen Suppenteller beiseite und ließ sich von Martha ein knuspriges Stück Dorsch vorlegen.
Kapitel 2
Schon im Treppenhaus hörte Charlotte Friedemanns Violine. Er spielte das Menuett von Boccherini, Andante grazioso.
Charlotte ging ganz langsam die Treppe hinauf und schloss leise die Wohnungstür auf. Friedemann begann mit dem Trio. Er spielte schnell und mit leichtem Bogen. Die kleine Pause vor der Wiederholung des Andantes verstand das Publikum falsch und fing an zu klatschen, genau in dem Augenblick, in dem Friedemann den Bogen aufsetzte. Er ließ sich nicht beirren und spielte bis zum fine.
Onkel Adolfs laute Stimme drang durch die geschlossene Tür des Salons. »Wunderbar, hervorragend. Der Junge ist wirklich eine Begabung, so ein Talent habe ich noch nie gehört.«
Mutter und Tante Henriette hörten nicht auf zu klatschen. Charlotte sah Friedemanns selbstgefälliges Lächeln vor sich, mit dem er sich in seinem ungeteilten Ruhm sonnte. Sie ließ sich gleich hinter dem Windfang auf der geschnitzten schwarzen Eichentruhe nieder. Die Truhe stand hier, damit man sich im Sitzen die Schuhe anziehen konnte. In ihrem Innern wurden die Wintermützen, Schals und Handschuhe für die ganze Familie aufbewahrt. Sie rochen immer etwas muffig, wenn man sie am Herbstanfang hervorholte, und Mutter beteuerte jedes Jahr aufs Neue, dass sie im Frühjahr alles gründlich hatte waschen lassen.
Charlotte stupste sich die Stiefel von den Füßen, ohne die Schnürbänder ganz zu lösen. Wenn Friedemann allein vorgespielt hatte, brauchte sie ja gar nicht erst hineinzugehen. Immer wieder schaffte es der kleine Bruder, sie auszubooten. Dabei übten sie seit Wochen zusammen Mozarts Violinsonate A-Dur. Friedemann war drei Jahre jünger als Charlotte, aber er spielte schon viel besser Violine als sie Klavier. Manchmal musste er extra langsamer spielen, damit sie mitkam. Und er ließ keine Gelegenheit aus, sie seine Herablassung fühlen zu lassen. Am liebsten spielte er sowieso allein. Sollte er doch – sie spielte auch lieber mit ihrer großen Schwester vierhändig Klavier. Almut konnte gut zählen und sie war nie zu schnell. Sie spielte die erste Stimme und Charlotte die zweite. Ihre Lieblingsstücke waren die Walzer von Brahms oder die Ungarischen Tänze, wobei dort beide Stimmen gleich schwierig waren.
»Ich darf alles essen, einfach alles«, dröhnte Onkel Adolf und wechselte damit übergangslos zu seinem Lieblingsthema. »Ich bin im Grunde kerngesund. Das hat der Arzt mir bestätigt.«
Onkel Adolf, der Schwede, sprach Deutsch, als ob er eine heiße Kartoffel im Mund hätte. Während er um diese wie um einen Hohlraum herum artikulierte, spritzten fortwährend kleine Tröpfchen aus seinem Mund auf die unter ihm stehenden Zuhörer. Er war groß und enorm dick. Einmal im Jahr fuhren er und seine Frau Henriette, Gustav Levendieks älteste Schwester, zur Kur nach Deutschland. Auf dem Rückweg besuchten sie die deutschen Verwandten: Tante Ameli, die einen armen Schullehrer im Rheinland geheiratet hatte, mit dem sie zwei farblose Töchter aufzog. Gustav und Loretta Levendiek mit ihren Kindern Almut, Friedemann und Charlotte in Danzig. Und zum Abschluss Tante Frederike und ihren Mann Wilhelm, die dort wohnten, wo Mutter am liebsten auch hingezogen wäre: im hochherrschaftlichen Seebad Zoppot, keine zwanzig Kilometer von Danzig an der Ostseeküste gelegen, mit Spielkasino und allem, was dazugehörte. Mit den anderen drei Brüdern von Vater hatten die Schweden keine Last mehr: Friedrich war im Weltkrieg gefallen und Hans August hatte in Berlin eine Tänzerin geheiratet. Die ganze Familie hatte den Kontakt zu ihm abgebrochen. Wilhelm, der Jüngste, war ein fleißiger Handwerker geworden und lebte irgendwo weit weg in Amerika. Zu Weihnachten schrieb er allen eine Postkarte. Jedes Jahr machten die Schweden der Reihe nach ihre Besuche, drückten viele Hände, streichelten die zahlreichen Kinderköpfe, maßen nach, wie groß die Neffen und Nichten geworden waren und fraßen sich bei der Verwandtschaft durch, wie Vater mürrisch meinte. Bei den Levendieks sollten sie sich darum ruhig die Konzerte der musikalischen Kinder anhören, die Dank Lorettas künstlerischer Ambitionen jedes Jahr ein bisschen länger wurden.
»Wie schade, dass ihr Almut und Charlotte nicht hören könnt. Sie spielen wie zwei Engelchen Klavier. Ich verstehe gar nicht, wo Charlotte bleibt.«
Das war Mutters Stimme.
»Es tut mir so Leid für Almut«, sagte Tante Henriette. »Dass sie in ihrem Alter schon solchen Kummer erleben muss! Aber die Zeit heilt alle Wunden. Ist sie nicht im Sternzeichen des Stiers geboren?«
»Sie hat am 19. April Geburtstag.«
»Dann ist sie gerade noch ein Widder. Die haben es oft am Anfang schwer. Zu heißes Blut. Ihr habt doch einen guten Hausarzt?«
»Doktor Norge ist sofort gekommen und hat ihr eine Spritze gegeben. Nun schläft sie.«
Die Glastür des Salons flog auf und Friedemann stürmte auf den Korridor. Er fiel fast über Charlottes Füße. »Warum hockst du denn hier und lauschst? Warum kommst du nicht rein?«
»Da ist ja unsere Kleine«, rief Tante Henriette und guckte um die Ecke. »Wir haben schon auf dich gewartet, Charlotte. Dein Bruder hat wunderschön auf der Violine gespielt.«
Charlotte wurde in den Salon gezogen und knickste vor den Verwandten. Onkel Adolf schien noch fetter geworden zu sein und Tante Henriette trug einen enormen Federhut, mit dem sie fast den Kronleuchter an der Decke putzte. Sie drückte Charlotte an ihren großen Busen und reichte sie an ihren Mann weiter.
»Charlottchen«, dröhnte Onkel Adolf. »Die gerät ganz nach uns, was Henriette?«
Charlotte wurde rot bis an die Haarwurzeln. Sie war schon immer ein Pummelchen gewesen, ganz im Gegensatz zu ihren Geschwistern. In letzter Zeit aber war sie richtig in die Breite gegangen. Kein einziger Rock ging mehr zu und die Knöpfe sprangen andauernd vom Mantel.
»Du hast ja wieder die kurzärmelige Bluse an«, sagte Loretta Levendiek und zog nervös an Charlottes Puffärmeln. »Die Wintersachen passen ihr alle nicht mehr. Kaum hat sie ein neues Kleid, da ist es auch schon wieder zu klein. Ich weiß nicht, wohin das Mädchen noch wachsen will. Ständig ist die Schneiderin im Haus.«
»Das wird ein kräftiges Fröken«, sagte Onkel Adolf. »Und wie alt bist du jetzt?«
»Ich werde im September vierzehn«, sagte Charlotte. Ihr Gesicht brannte wie Feuer. Sie konnte Onkel Adolf nicht in die Augen sehen. Um nichts in der Welt wollte sie nach ihm und Tante Henriette geraten! Alles, nur das nicht.
»Eigentlich könnte Lottchen auch einmal allein auf dem Klavier vorspielen«, sagte Loretta Levendiek, aber sie fand kein Gehör, denn Greta tauchte in der Tür auf und kündigte an, dass das Abendessen angerichtet sei. Hände reibend machte sich Onkel Adolf sofort auf den Weg ins Esszimmer. Gustav Levendiek war noch im Kontor und sollte jeden Augenblick heimkommen.
Charlotte trat an den Flügel und strich sanft über die weißen, elfenbeinernen Tasten. Sie waren wie immer wunderbar glatt und kühl. Auf dem polierten Holz des Instruments lag Friedemanns Geige. Charlottes Lippen wurden ganz weiß, so fest presste sie sie zusammen. Sie hatte Lust, ihm eine Saite zu zerreißen. Wer vorspielte, bekam eine extra Belohnung von Mutter. Wahrscheinlich bekam Friedemann jetzt auch noch ihren Groschen dazu. Mit einem Knall ließ sie den Deckel über die Tasten fallen. Die Saiten des Flügels beklagten sich mit einem zarten Wimmern.
Kapitel 3
»Wo Glaube, da Liebe, wo Liebe, da Gott, wo Gott, da keine Not«, stand in gotischen Lettern mit einer schwarzen Feder auf Pergament geschrieben. Das Bild war gerahmt und hing genau in der Mitte über dem Kopfende des Bettes. Das Bett stand links von der Tür. Gegenüber befand sich die Waschkommode mit der großen, weißen Porzellanschüssel und der Kanne, in die Martha jeden Abend frisches heißes Wasser füllte. Handtücher lagen auf dem Stuhl unter dem Fenster.
Nina hatte die große Ledertasche heraufbringen lassen, aber keine Kraft mehr, sie auszupacken. Sie zog sich aus und legte sich nackt unter die kühle Federdecke. Martha hatte den Kachelofen geheizt, es war nicht kalt im Zimmer. Sie fühlte sich warm und müde nach dem guten Essen und dem Wein, den Onkel Christoph ausgeschenkt hatte, und sie freute sich auf den nächsten Morgen, auf den Anblick der vertrauten Stadt, die sie mit ewigen Ferien verband.
Die Fenster waren mit schweren roten Vorhängen verhüllt. Nina wusste, dass sie auf den Schulhof des Lyzeums gingen, mit Blick auf hohe Kastanienbäume, die jetzt noch kahl ihre schwarzen, knorrigen Äste in den nordischen Winterhimmel streckten. In Danzig war sie mit Mutter vor allem im Winter zu Besuch gewesen, im Herbst oder in der Osterzeit. Im Sommer waren sie an die Küste gefahren, nach Zoppot und nach Heubude, einmal waren sie auch in Nickelswalde an der Weichselmündung gewesen. Nina erinnerte sich nicht an Danzig im Sommer. Ihr Bild von der Stadt war geprägt von den glitzernden Lichtern der frühen Winterabende, von weihnachtlich geschmückten Schaufenstern und Geschäften, engen, dunklen Gassen, in denen die Menschen in dicke Winterpelze eingemummt herumliefen, eilig und geschäftig. Vieles an dieser Stadt erinnerte sie an Lübeck, wo sie geboren und aufgewachsen war.
Ihre Mutter, Irina Elisabeth Norge, war genau wie ihr Bruder Christoph in Wilna geboren. In Ninas Kindheitserinnerungen vermischten sich diese drei Orte zu einer einzigen, heimeligen Brutstätte: die Heimatstadt ihrer Mutter, die sie nur aus Erzählungen kannte, ihre eigene Heimatstadt Lübeck und Danzig, wo ihr einziger Onkel lebte, der sich immer viel Mühe gegeben hatte, ihr den Vater zu ersetzen.
Ihr leiblicher Vater, der Lübecker Arzt Felix Mai, hatte sich bei einem Patienten angesteckt und war noch vor ihrer Geburt und zwei Tage vor der geplanten Hochzeit mit ihrer Mutter an einer schweren septischen Diphtherie gestorben. Nun war die Mutter ihm gefolgt, in ihrem neunundvierzigsten Jahr. Sie war Pianistin gewesen und hatte nach einer kurzen, viel versprechenden Karriere in jungen Jahren ihre große Liebe kennengelernt und einfach alles hinter sich gelassen: Wilna, die Mutter, den Vater und den Großvater, der aus Lübeck stammte und sie und ihre Flucht als einziger verstehen konnte.
Als der Arzt Felix Mai, Ninas Vater, starb, und seine zukünftige Frau mit dem Ungeborenen zurückließ, war ihre Mutter zu stolz gewesen, nach Wilna zurückzugehen. Christoph hatte sich inzwischen als Arzt in Danzig niedergelassen. Er sah es als seine Aufgabe an, ihr zu helfen, doch ihre Mutter hatte es Zeit ihres Lebens abgelehnt, nach Danzig zu ziehen. Sie suchte sich in Lübeck Klavierschüler und unterrichtete sie zu Hause, während Nina in einem Laufgitter mit Wollmäusen spielte und vor sich hin brabbelte. Bis heute konnte Nina Klaviermusik nur schwer ertragen. Wie eine schwarze Wolke zog die Erinnerung in ihr herauf, wenn sie in einem Treppenhaus oder auf der Straße irgendjemanden zögernd und unrhythmisch Tonleitern üben hörte. Immer noch spürte sie die schreckliche Einsamkeit und Wut, die sie als Kind empfunden hatte, wenn die Schüler kamen und ihr die Mutter wegnahmen. Lange Stunden hatte sie still und stumm allein in ihrem Zimmer verbringen müssen, während sich die Mutter mit ihrer liebsten und freundlichsten Stimme diesen fremden Kindern widmete. Sie hörte mit Engelsgeduld die Sorgen und Nöte ihrer Schüler an, ließ sie wieder und wieder die gleichen Partien üben und ertrug mit Nachsicht auch die untalentiertesten und faulsten Musikanten. Ihr, Nina, gegenüber hatte sie diese Geduld nie aufgebracht. Ihr gegenüber war sie streng wie ein Soldat gewesen. Sie verzieh ihr kein Weinen und Jammern, sondern schickte sie gnadenlos vor die Tür, wenn sie sich einmal gehen ließ.
»Wir können es uns nicht leisten, wehleidig zu sein«, sagte sie. »Wir haben niemanden, der für uns die Zeche bezahlt. Dein Vater war ein stolzer Mann, der sich für die Kranken aufgeopfert hat. Mach ihm keine Schande und hör auf zu flennen.«
Um sich zu rächen, hatte Nina niemals das Klavier angerührt, so flehentlich die Mutter sie auch darum gebeten hatte. Stattdessen nahm sie sich vor, dem Vater und dem Onkel nachzueifern. Solange sie zurückdenken konnte, war sie fest entschlossen gewesen, Ärztin zu werden. Es war wie ein Versprechen, das sie einlösen musste, wie ein Schwur.
Sie hatte sich an der medizinischen Fakultät der Leopolds-Universität in München eingeschrieben, wo sie zu den ersten Frauen gehörte, die zum Studium zugelassen wurden. Nach dem Examen beschloss sie, sich auf dem Gebiet der Neurologie weiterzubilden und trat im Landeskrankenhaus Wien eine Stelle als Assistenzärztin an. Gleich am ersten Tag hörte sie den Namen Sigmund Freud. Sie besuchte seine Vorlesung. Nie würde sie den Tag vergessen, an dem sie ihn zum ersten Mal dozieren hörte. Das war in Bellevue gewesen, an der medizinischen Fakultät der Wiener Universität, wo der Professor einen Vortrag über die Psychoanalyse hielt. Sie hatte diese Einführungsvorlesung später oft nachgelesen. Doch der Geist, der diesem Text innewohnte, hatte sie schon beim ersten Zuhören gefesselt und bis heute nicht wieder losgelassen. Ihre Begeisterung für die Schärfe seines Denkens und die Einfachheit seiner Sprache war schon mit dem ersten Satz entbrannt. Mit jedem Wort, schien es ihr, riss Freud die Vorhänge entzwei, hinter denen das wirkliche Leben verborgen lag. So also sah die Welt aus, so war der Mensch beschaffen, auch sie und ihre Mitmenschen. Das also waren die wirklichen Antriebskräfte des Lebens und das, was sie bisher für das Wirkliche gehalten hatte, war nur Fassade und Schein.
Sie las alles, was Freud veröffentlichte, und das war nicht wenig. Hätte sie das Geld gehabt, wäre sie sofort seine Patientin und Schülerin geworden. Aber eine solche Behandlung kostete ein Vermögen. Und sie verdiente im Krankenhaus trotz schwerer Arbeit nur so wenig, dass sie sich schon ihre geliebten Theaterbesuche vom Munde absparen musste. Ihr Gehalt reichte gerade mal für ihre Zimmermiete in Nussbaum, für die notwendigsten Kleidungsstücke und für etwas zu essen. Freuds Patientinnen waren in der Regel amerikanische Millionärinnen oder russische Adelige, denen es gelungen war, ihr Leben und ein paar kostbare Schmuckstücke vor den Bolschewisten zu retten.
Nina haderte mit ihrem Schicksal, bis sie sich endlich ein Herz fasste und den Professor nach seiner Vorlesung ansprach. Sie war fleißig und klug. Sie war neugierig. Sie war wissensdurstig. Sie hatte also etwas zu bieten. Der Professor ließ sich lächelnd zu ihr herab und lud sie ein, ihn einmal zu Hause in der Berggasse zu besuchen. Sie hatte es geschafft! Sie sollte Zutritt gewinnen zum geheiligten Kreis des Meisters.
Nina lernte Martha kennen, seine Frau, Minna, die Schwägerin, und auch Anna, seine jüngste Tochter, die mit Dorothy Burlingham und deren Kindern eine Etage höher zusammenlebte. Dann gelang es ihr, mit einem Aufsatz Freuds Aufmerksamkeit zu erregen, so dass er sie in sein berühmtes Arbeitszimmer hinter dem Zimmer mit der noch berühmteren Couch zitierte. Nach einem prüfenden Gespräch bot er ihr eine Lehranalyse an – kostenlos. Als Gegenleistung erwartete er nur, sich hundertprozentig auf sie verlassen zu können. Sie dürfe Wien während der Analyse nicht verlassen.
Für eine Reise nach Lübeck zu ihrer kranken Mutter blieb keine Zeit.
Nina wälzte sich zwischen den Laken. Gab es etwas, was sie sich vorwerfen musste? Sie hatte so viel gelernt und studiert, Prüfungen bestanden, gebüffelt und gepaukt, aber sie hatte nicht einen Tag des Lebens ihrer Mutter retten können. Sie war nicht da gewesen, als ihre Mutter sie gebraucht hatte.
Als sie krank wurde, hatte Nina ihr regelmäßig geschrieben, doch ihre Mutter hatte nie verlangt, sie zu sehen. Als sie ihr zum letzten Weihnachtsfest mitteilte, dass sie nicht nach Hause kommen könnte, schrieb ihre Mutter nicht, wie schlimm es wirklich um sie stand. Drei Wochen später war sie tot.
Als die Nachricht sie erreichte, hätte sie den Arztkittel am liebsten ausgezogen. Sie hatte ihre Sachen gepackt und Wien für immer verlassen.
Nina tastete nach dem Lichtschalter. Auch in Danzig gab es neuerdings überall elektrisches Licht. Ihre Lampe hatte einen hübschen, goldgelben Schirm. Sie knipste sie wieder aus und starrte in die Dunkelheit.
Sie musste versuchen, ihre Schuldgefühle zu überwinden. Sie hatte nun mal diesen Beruf gelernt und keinen anderen. Sie musste sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren. Verbände wechseln, kleine Wunden nähen, Hustensaft verschreiben und die schweren Fälle zu einem Spezialisten ins Krankenhaus überweisen. Sie musste versuchen, das spartanische Leben einer Hausärztin in der Provinz zu führen. Es gab keinen Weg zurück nach Wien. Dieses Kapitel war endgültig abgeschlossen. Es war ihr nicht gegeben, Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu finden. Antworten zu finden, war vielleicht ein Privileg, das nur wenigen Menschen vorbehalten war.
Kapitel 4
Am Morgen wehte in Danzig eine leichte, fast frühlingshaft warme Brise. Die Straßen waren blank vom Regen, als Nina mit festen Schritten durch die Langgasse ging, das Lange Tor passierte, am Stockturm vorbei auf den Kohlenmarkt bog und hinter der Zeughauspassage an der Haustür eines hohen Wohnhauses klingelte.
Ganz Danzig hatte die Grippe. Vor allem die Alten und die Kinder waren angegriffen. Schon vor sieben Uhr war der Onkel aufgebrochen, um Hausbesuche zu machen, Spritzen zu geben, fiebersenkende Wickel anzulegen, Hustensäfte und Gurgelwasser zu verschreiben. Er hatte Nina ein paar Karteikarten mit kurzen Krankenberichten hingelegt und eine Tasche mit Medikamenten dazugestellt. Mit etwas Glück würde sie ihn beim Mittagessen zu sehen bekommen, sonst war sie bis zum Abend auf sich selbst gestellt.
Greta, das Hausmädchen der Levendieks, öffnete ihr die Tür. Nina stellte sich vor und erklärte, dass sie heute an Stelle ihres Onkels Almut Levendiek betreuen würde.
»Das Fräulein schläft noch«, sagte Greta. »Warten Sie bitte einen Augenblick, ich sage Frau Levendiek Bescheid.«
Das Hausmädchen verschwand hinter einer geschliffenen Glastür. Als sie zurückkam, bat sie Nina in den Salon.
Rechts von einem mächtigen Konzertflügel, der mitten in dem großen, mit englischen Möbeln ausgestatteten Raum stand, saß die Hausherrin an einem Sekretär und öffnete die Post. Als Nina den Raum betrat, erhob sie sich und eilte auf die Ärztin zu. Sie war sehr schlank, fast so groß wie Nina, trug ihr Haar streng am Kopf gescheitelt und im Nacken zu einem schweren Knoten gebunden. Ein schlichtes dunkles Kleid betonte ihre gute Figur. Luxuriös waren nur die seidenen Pantoffeln, die kostbar bestickt und mit Perlen besetzt waren.
»Willkommen in Danzig, Frau Doktor Norge. Ihr Onkel hat uns schon von Ihnen erzählt. Er ist sehr glücklich, dass Sie gekommen sind, um ihm zu helfen. Und ich bin froh, dass wir nun als Erste Ihre Bekanntschaft machen dürfen. Sicher werden Sie unserer Tochter helfen können. Es ist ja nur das Unglück, das sie krank gemacht hat. Nichts als das Unglück.«
»Mein Onkel erzählte mir, dass Ihre Tochter vor einigen Wochen ihren Bräutigam verloren hat.«
»Leo stürzte vom Pferd, direkt vor unserem Haus. Es geschah in der Silvesternacht. Es hatte seit Tagen geschneit und stark gefroren. Die Schneedecke war hart und glatt, sein Pferd muss ausgerutscht sein. Er stürzte so unglücklich, dass er vom eisernen Gatter aufgespießt wurde. Er war sofort tot.«
»War Ihre Tochter dabei, als das Unglück geschah?«
»Nein, sie war hier oben und machte sich zurecht für die Silvesterfeier. Wir wollten alle zusammen bei meiner Schwägerin in Zoppot feiern. Bei dem Wetter trauten wir uns jedoch nicht mit dem Automobil auf die Straße. Leo hatte freundlicherweise angeboten, uns zu kutschieren. Er war ein Pferdenarr. Er wollte seinen Pferdeschlitten aus Ohra holen, wo er ihn bei einem Freund untergestellt hatte.«
»Ein ziemlicher Schock für Ihre Tochter.«
»Ein entsetzlicher Schock für uns alle. Leo stand kurz vor dem Examen. Er studierte Juristerei in Königsberg und machte hier sein Referendariat. Eine Katastrophe. Almut ist ein liebes Mädchen. Sehr gutartig. Aber ein wenig schwach. Nicht im Charakter, aber in der Gesundheit. Sie wollte unbedingt die Schule abschließen, obwohl es sie körperlich sehr anstrengte. Sie ging auf die Viktoriaschule. Wir hofften, dass sie durch die Ehe ein wenig ruhiger werden und im Familienleben schließlich ihre wirkliche Bestimmung finden würde. Sie wird sicher mal eine ausgezeichnete Mutter werden.«
»Leo war ihre erste große Liebe?«
»Natürlich«, sagte Frau Levendiek bestimmt. Sie ließ sich an einem kleinen, messingbeschlagenen Tischchen nieder und forderte Nina auf, sich ihr gegenüberzusetzen. Sie hatte noch immer den Brieföffner in der Hand. »Natürlich hat sie ihn geliebt. Obwohl ich Ihnen ganz ehrlich sagen muss, dass ich anfangs meine Zweifel an der Richtigkeit dieser Eheschließung hatte. Sie müssen wissen – Sie werden es ja gleich selbst sehen –, meine Tochter ist sehr hübsch. Ich sage das ohne Eitelkeit. Sie wird eine sehr schöne Frau werden. Und Leo war eigentlich nur ein mittelmäßiger Mann. Gut aussehend, aber nicht blendend. Er wäre wahrscheinlich ein guter Verwaltungsbeamter geworden, aber kein besonders erfolgreicher Mann. Eine solide Partie, wie man so sagt. Ich weiß nicht, ob meine Tochter mit ihm wirklich auf Dauer glücklich geworden wäre.«
»Wie verhält sie sich in ihrer Depression?«
»Depression«, wiederholte Frau Levendiek leise. »Hat Ihr Onkel es so ausgedrückt? Was für ein schreckliches Wort. So negativ.« Sie legte den Brieföffner sanft auf den Tisch und faltete die Hände im Schoß. »Almut isst kaum noch etwas und weigert sich ihr Zimmer zu verlassen. Seit zweieinhalb Monaten war sie nicht mehr an der frischen Luft. Sie liest nicht, sie setzt sich nicht mehr an das Piano, sie spricht kaum, sie lacht nicht, oder wenn, dann vollkommen hysterisch. Sie hat sich völlig in sich selbst zurückgezogen. Und gestern fanden wir sie dann im Bad, sie hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Die Wunde sei nicht gefährlich, sagt Ihr Onkel, aber sie hat doch eine Menge Blut verloren. Zu allem Unglück haben wir gerade Besuch von Verwandten meines Mannes aus Schweden. Wir wollten nicht, dass die Angelegenheit sich herumspricht. Wir haben deshalb so getan, als hätte Almut nur einen Schwächeanfall gehabt. Ich bitte auch Sie um Diskretion ...«
»Das versteht sich von selbst. Ich bin Ärztin.«
Loretta Levendiek nickte und stand auf. »Meine Tochter ... eine Depression«, wiederholte sie kopfschüttelnd. »Kommen Sie, ich bringe Sie jetzt zu ihr.«
Kapitel 5
Nina folgte der Hausherrin bis zum Ende des langen Korridors. Ein kurzer, weniger hübsch ausgestatteter Flur tat sich vor ihnen auf, von dem vier Türen abgingen. Frau Levendiek klopfte an die erste Tür und lauschte auf eine Antwort. Auf einem Hocker neben der Tür stand ein Tablett mit einer Tasse Schokolade und zwei Scheiben Röstbrot mit Butter. Die Kranke hatte ihr Frühstück nicht angerührt. Loretta Levendiek öffnete sachte die Tür zum Krankenzimmer, gerade so weit, dass sie hindurchschlüpfen konnte.
Während Nina wartete, öffnete sich einen Spaltbreit die Tür gegenüber. Es war dämmrig im Flur, den kein Tageslicht erreichte. Auf einem Schuhschrank flackerte müde ein ›Ewiges Licht‹, ein kleines Flämmchen in einem dunkelroten Glas. Nina spürte, dass zwei Augen auf ihr ruhten. Und dann hörte sie eine Stimme, die flüsterte:
»Wer sind Sie?«
Ehe sie antworten konnte, öffnete sich die Tür des Krankenzimmers und Loretta Levendiek kam mit einer ärgerlichen Miene heraus.
»Sie zieht eine alberne Grimasse und spricht nicht mit mir. Ich weiß mir bald keinen Rat mehr. Vielleicht ist es das Beste, wenn Sie erst einmal allein hineingehen?«
Nina betrat das Krankenzimmer. Die Fenster waren abgedunkelt. Zwei große, mehrarmige Kerzenleuchter standen auf einem runden Tisch zwischen den Fenstern. Das schwarze Eichenbett hatte auf seinen vier gedrechselten Säulen früher einmal einen Himmel getragen. Die Vorhänge waren entfernt worden.
Aufrecht in den Kissen saß ein junges Mädchen mit offenen, schwarzen Haaren, die bis über ihre Brust auf das weiße Nachthemd herunterfielen. Sie hatte die Hände auf der Bettdecke gefaltet und sah aus, als hätte sie gerade auf eine Zitrone gebissen: Ihr hübscher Mund war breit gezogen wie der eines Froschs, sie hatte die Augen weit aufgerissen und die helle, hohe Stirn in Falten gelegt. Sie verzog keine Miene, als die Ärztin näher trat.
»Guten Morgen, Almut. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Haben Sie gut geschlafen?«
Almuts Grimasse entspannte sich plötzlich, ihr Gesicht nahm wieder seine natürliche, ebenmäßig hübsche Form an. Dann lachte die Kranke und schlug mit den Händen auf die Bettdecke. »Ich danke Ihnen, Sie haben mich soeben gerettet. Und ich hatte schon befürchtet, den ganzen Tag so verbringen zu müssen. Die Uhr, sehen Sie die Uhr?«
Nina drehte sich um. Hinter ihr, in einer Ecke des Zimmers, befand sich eine große Standuhr. Sie zeigte auf halb zehn, das war korrekt. Aber das Pendel hinter der Glasscheibe stand still.
»Sie ist eben stehen geblieben«, flüsterte Almut.
Ihre Haut war auch von ganz nahem betrachtet makellos rein wie die Haut eines Babys. Ihre Augen leuchteten klar und glänzten, die Iris war grün und hatte hellbraune, interessante Pünktchen. Ihre dichten Augenbrauen wölbten sich wie zwei Brückenbogen über den Augenhöhlen. Weiche, dunkle Haarlocken legten sich geschmeidig um die Wangen.
»Man sagt doch, wenn die Uhr stehen bleibt und man gerade eine Grimasse zieht, muss man diese so lange tragen, bis einen jemand erlöst.«
Almut versuchte die Ärztin mit einem Lächeln zu gewinnen.
»Sind Sie so abergläubisch?«
»Aber ja. Ich bin schrecklich abergläubisch. Sie etwa nicht?«
»Nein. Außerdem heißt es, wenn die Uhr schlägt und man gerade eine Grimasse zieht, muss man diese tragen bis ans Lebensende. So etwas erzählt man kleinen Kindern, die beim Essen Faxen machen.«
Almut lachte. Es klang künstlich und übertrieben. »Sie finden mich albern, nicht wahr?«, rief sie und legte das linke Handgelenk mit dem Verband an die Lippen. »Sagen Sie es ruhig. Ich weiß es ja sowieso. Ich lese es in Ihren Augen.«
»Hellsehen können Sie auch?« Nina setzte sich auf die Bettkante. Sie griff nach der Hand des Mädchens und öffnete rasch den Verband. Die Hand war kalt und klamm, doch die kleine Wunde hatte sich bereits sauber geschlossen. Almuts Puls ging schwach aber regelmäßig.
»Ich bin Doktor Nina Norge, die Nichte von Doktor Norge, und werde von nun an Ihre Ärztin sein. Ich hoffe, ich werde Ihnen helfen können, Almut. Ihre Eltern machen sich sehr große Sorgen um Sie.«
Das Mädchen sank vollständig in sich zusammen. Der manische Glanz erlosch in ihren Augen, sie wandte den Kopf ab und ließ ihn auf die rechte Schulter sinken. »Ich bin müde. Ich bin so schrecklich müde.«
»Ich werde jetzt Ihre Temperatur messen. Und dann würde ich mich gern ein wenig mit Ihnen unterhalten, um herauszufinden, was Ihnen fehlt.«
»Ich bin wirklich entsetzlich müde«, wiederholte Almut.
»Dann werde ich ein anderes Mal wiederkommen, wenn Sie ausgeschlafen sind«, sagte Nina und schob Almut das heruntergeschlagene Fieberthermometer in den Mund.
Almut betrachtete die Ärztin mit halb geschlossenen Lidern.
»Worüber wollen Sie sich denn mit mir unterhalten?«, murmelte sie, ohne das Thermometer aus dem Mund rutschen zu lassen.
»Zum Beispiel darüber, was Sie in der letzten Nacht geträumt haben.«
Almut schlug die Augen auf und stieß einen hohen, überraschten Laut aus.