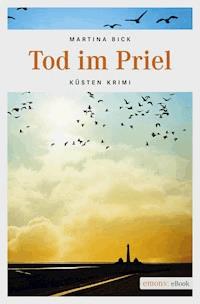9,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Zwei Romane, die Herz und Seele berühren: Der gefühlvolle Sammelband »Das kleine Pfarrhaus auf dem Land« von Martina Bick jetzt als eBook bei dotbooks. Weite goldene Felder, saftige grüne Wiesen und ein kuscheliges Häuschen mittendrin … Zunächst ist die junge Ärztin Barbara Pauli wenig begeistert, von Hamburg in ein kleines Pfarrhaus im beschaulichen Ostholstein ziehen zu müssen – aber was tut man nicht alles für die Liebe? Doch dann beschließt ihr Freund Thomas, dass es ihm erst einmal wichtiger ist, als Musiker durch Deutschland zu touren … und noch dazu muss sich die zu Unrecht als ›eingebildete Städterin‹ abgestempelte Barbara von den gebürtigen Ostholsteinern einiges anhören. Aber so leicht gibt sie nicht auf! Beherzt greift Barbara den kauzigen Dörflern unter die Arme und hilft als Landärztin, wo sie nur kann. Doch reicht das, um in der Fremde neue Wurzeln schlagen zu können … und wird Thomas einsehen, dass er ohne sie genau so unglücklich ist wie sie ohne ihn? Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das kleine Pfarrhaus auf dem Land«, der Sammelband mit zwei Landliebe-Romanen von Martina Bick. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Ähnliche
Über dieses Buch:
Weite goldene Felder, saftige grüne Wiesen und ein kuscheliges Häuschen mittendrin … Zunächst ist die junge Ärztin Barbara Pauli wenig begeistert, von Hamburg in ein kleines Pfarrhaus im beschaulichen Ostholstein ziehen zu müssen – aber was tut man nicht alles für die Liebe? Doch dann beschließt ihr Freund Thomas, dass es ihm erst einmal wichtiger ist, als Musiker durch Deutschland zu touren … und noch dazu muss sich die zu Unrecht als ›eingebildete Städterin‹ abgestempelte Barbara von den gebürtigen Ostholsteinern einiges anhören. Aber so leicht gibt sie nicht auf! Beherzt greift Barbara den kauzigen Dörflern unter die Arme und hilft als Landärztin, wo sie nur kann. Doch reicht das, um in der Fremde neue Wurzeln schlagen zu können … und wird Thomas einsehen, dass er ohne sie genau so unglücklich ist wie sie ohne ihn?
Über die Autorin:
Martina Bick wurde 1956 in Bremen geboren. Sie studierte Historische Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Gender Studies in Münster und Hamburg. Nach mehreren Auslandsaufenthalten lebt sie heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater arbeitet. Martina Bick veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane, Romane und Kurzgeschichten und war auch als Herausgeberin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2001 war sie die offizielle Krimistadtschreiberin von Flensburg.
Bei dotbooks erscheinen die Romane »Unscharfe Männer«, »Die Landärztin« und die Fortsetzung »Neues von der Landärztin«, die im Sammelband »Das kleine Pfarrhaus auf dem Land« zusammengefasst sind sowie die Krimi-Reihe um Hauptkommissarin Marie Maas, die folgende Bände umfasst:
»Der Tote und das Mädchen. Der erste Fall für Marie Maas«
»Tod auf der Werft. Der zweite Fall für Marie Maas«
»Die Tote am Kanal. Der dritte Fall für Marie Maas«
»Tödliche Prozession. Der vierte Fall für Marie Maas«
»Nordseegrab. Der fünfte Fall für Marie Maas«
»Tote Puppen lügen nicht. Der sechste Fall für Marie Maas«
»Totenreise. Der siebte Fall für Marie Maas«
»Heute schön, morgen tot. Der achte Fall für Marie Maas«
***
eBook-Sammelband-Originalausgabe Juli 2020
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München, eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / photolive / LedyX / LUMIKK555 / Pawel Kazmierczak sowie © 123RF / anagram1
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-494-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das kleine Pfarrhaus auf dem Land« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Martina Bick
Das kleine Pfarrhaus auf dem Land
Zwei Romane in einem eBook
dotbooks.
Die Landärztin
Die junge Ärztin Barbara Pauli zieht von Hamburg in das 750-Seelen-Kaff Bevenstedt in Ostholstein, ihrem Freund zuliebe. Doch der hat plötzlich kein Interesse mehr am alternativen Landleben, und Barbara muss sich alleine zurechtfinden. Noch dazu wird sie von den Nachbarn misstrauisch beäugt – das scheint kein guter Start in ihr neues Leben zu werden … Als Barbara dann auch noch den Sohn des Dorfsäufers bei sich aufnimmt, ist die Empörung groß: So viel Einmischung von einer Städterin geht einfach zu weit! Der Gedanke, Bevenstedt hinter sich zu lassen und nach Hamburg zurückzukehren, ist verlockend. Aber so schnell gibt Barbara nicht auf – denn sie hat das Herz am rechten Fleck.
Kapitel 1
Das Fahrrad lehnte einfach so an einem Baum gegenüber vom Rathaus. Es war schlicht schwarz lackiert, hatte kurze, flache Schutzbleche über dicken Gummireifen, damit der Schmutz bei einer Geländefahrt nicht so sehr gegen die Beine des Radlers spritzte, einen geraden, kurzen Lenker, eine 12-Gang-Schaltung, Handbremsen, einen Gelsattel und sonst nichts. Keine Lichtanlage, keinen Gepäckträger, kein Körbchen – das war sowieso nur etwas für Muttis – und weder Klingel noch Pumpe. Nur eine Halterung für eine Wasserflasche. Ein Rad für Könner. Ein Rad zum Fahren, zum Treten, bergauf, bergab, durch jedes Gelände. Sogar am Strand und im seichten Wasser konnte man damit vorwärtskommen. Ein Mountainbike für echte Mountainbiker.
Freddi war schon dreimal daran vorbeigegangen. Das Städtchen Lensahn, wo er zur Schule ging, lag im tiefsten morgendlichen Frieden. Vor dem Bäckerladen war es still geworden, im Gemeindebüro hatte Frau Lockstedt Sprechstunde, so stand es jedenfalls draußen angeschrieben. Sicher hatte sie keine Zeit, aus dem Fenster zu schauen. Sonst hätte sie das Rad direkt im Blickfeld gehabt. Gehören tat es ihr bestimmt nicht. Ihr gehörte höchstens der alte Drahtesel mit dem altmodischen bunten Netz über dem Hinterrad, der ordentlich abgeschlossen neben der Rathaustür stand.
Freddi drehte noch eine Runde um den Rathausplatz, das Mountainbike immer im Auge. Zum x-ten Male war heute morgen von seinem Rad die Kette abgesprungen. Er hatte sie einfach nicht wieder draufgekriegt. Seine Hände waren schwarz von Schmiere, und er war so wütend gewesen, daß er am liebsten auf dem Fahrgestell herumgesprungen wäre. Er hatte das alte Ding noch nie leiden können. Es war älter als er selbst, kaputt und zerkratzt, ein Geschenk von irgendeinem Nachbarn, der sich ein neues gekauft hatte.
»Für den Jungen ist es noch gut genug«, hatte sein Vater gesagt und ihm zum Geburtstag ein paar neue Reifen aufgezogen. Seitdem mußte Freddi mit dem blöden Ding herumfahren. Jeden Morgen zehn Kilometer von Bevenstedt nach Lensahn und mittags nach der Schule wieder zurück. Im Sommer und im Winter, bei jedem Wetter, sogar bei hohem Schnee. Zur Schule gefahren werden, das gab es bei ihm zu Hause nicht. Vater fuhr mit dem Wagen in die Fabrik, morgens um halb sechs zur Frühschicht. Mutter hatte kein Auto, nicht mal den Führerschein. Der Schulbus kostete Geld, und Geld war bei Familie Scholz immer knapp. Also mußte Freddi mit dem Rad fahren. Genau wie Timmi es später müßte, wenn er einmal größer wäre. Und die kleine Rosi, die jetzt noch nicht mal laufen konnte. Und wie Mutter es tat, mittags, wenn Omi kam, um die Kinder am Nachmittag zu beaufsichtigen. Auch Mutter fuhr mit dem Rad den Weg in die Holzfabrik und zurück. Nur selten, wenn er früher heimkam, brachte Vater sie hin, und wenn er ausnahmsweise, gute Laune hatte, holte er sie abends ab. Wenn er dann noch nicht zu betrunken war.
Freddi war wieder vor dem Rad angelangt. Es sah so ungeheuer schick aus, daß es ihm fast weh tat in der Brust. Es war wie Verliebtsein. Er mußte es einfach haben. Und es war da, ganz einfach so, als hätte es jemand dort für ihn abgestellt. Er mußte an Mareike denken, und wie es wäre, wenn er ihr auf diesem Fahrrad begegnen würde. Er würde an ihr vorbeiflitzen wie ein Windstoß. Sie würde staunen. Und er würde auch nicht mehr zu spät zur Schule kommen, wie heute. Er würde nicht mehr die Schule schwänzen müssen, weil er so spät dran war, daß kein Lehrer ihm noch eine Entschuldigung abnahm.
Freddi ließ seine Finger über das schwarze Metall des Rahmens gleiten. Er war makellos glatt und neu. Er umfaßte den stumpfen Gummigriff am Lenker mit der Linken und zog das Rad vom Baum weg. Es war wirklich nicht abgeschlossen. Und kein Mensch kam angelaufen, um es ihm wegzunehmen. Freddi legte die Rechte auf den Sattel, er hatte genau die richtige Höhe für ihn. Zwölf Gänge. Er musterte die Kettenräder am Hinterrad. Die Kette glänzte schwarz, sie war fachkundig gespannt und nicht zu stark eingefettet. Langsam schob er das Rad an den Rand des Rathausplatzes. Er sah sich nicht um. Noch konnte er sagen, er hätte es sich einfach einmal ansehen wollen. Eigentlich wollte er das ja auch nur. Er wollte nur mal wissen, wie sich so etwas anfühlte. Es lief so leicht neben ihm her, wie ein Hund, den man an einer Leine führt. Obwohl es so stabil war, bewegte es sich federleicht. Freddi schwang ein Bein über den Sattel. Der Lenker stand viel tiefer als der an seinem alten Hollandrad. Blitzschnell umfaßte er über den Lenker und trat instinktiv in die Pedale, um nicht umzufallen. Wie ein Pfeil schoß das Rad mit ihm davon, leichtgängig, sicher und schnell, als würden die Reifen den Boden gar nicht berühren. Auf der Ausfallstraße Richtung Schönwalde gab er ordentlich Gas. Er flog nur so über den Radweg. Die Straße war ein wenig abschüssig, gerade genug, um ihm Schwung zu geben. Er schaltete hoch bis in den zehnten Gang. Im Leerlauf trat er rückwärts und genoß das Tickern der Schaltung. Hinter dem Lensahner Hof war der Radweg zu Ende, und Freddi bog ab in den Wald. Die Wege waren noch feucht vom letzten Regen und voller Pfützen und Schlammlöcher. Freddi preschte auf seinem Mountainbike mitten hindurch und stellte sich in die Pedale, um die Steigungen des Weges mit einem möglichst hohen Gang nehmen zu können. Als er oben am Teich ankam, war er naß bis auf die Haut von Schweiß und Spritzwasser. Das Fahrrad war nicht wiederzuerkennen. Freddi war glücklich.
Kapitel 2
Barbara drehte den großen Regler für die Lautstärke an der Hi-Fi-Anlage etwas höher und wippte mit der Fußspitze den Takt zu Strange Angel, ihrem Lieblingssong von Laurie Anderson. Es war schon etwas zu kühl, um noch bei offenem Fenster zu sitzen, aber der Abend war so schön, ihr erster richtiger Sonnenuntergang in Bevenstedt, daß sie das Fenster einfach nicht schließen mochte.
Die Amsel hatte ihr großes Konzert beendet. Sie hockte noch eine Weile vor ihrem offenen Fenster auf der Fernsehantenne des Nachbarhauses, aber sie ließ sich keine neuen Strophen mehr einfallen. Es duftete nach Wald und Erde, nicht mehr nach Dieselabgasen, Dünger und Kuhmist wie tagsüber. Wenn man sich sehr konzentrierte, konnte man sogar einen Hauch Meeresbrise erschnuppern. Die Ostsee war so nah. Wenn sie die Augen schloß, konnte Barbara sich mit ein bißchen Phantasie vorstellen, daß ein Teil ihrer Träume vom Landleben schon wahr geworden war, trotz dieser häßlichen Zweizimmerwohnung in Witwe Claasens Einfamilienhaus, ohne Balkon, geschweige denn einem Garten, direkt an der Hauptstraße. Die beiden Zimmer waren mit wenig abgenutzten, aber gräßlich altmodischen Polstermöbeln vollgestellt. Eine Küche gab es nicht, nur ein enges Bad mit einer vergilbten Sitzbadewanne und einem winzigen Handwaschbecken. Auf dem Flur stand ein monströser Kleiderschrank, der nach Mottenkugeln und Kölnisch Wasser roch. Alle Räume hatten schräge Wände, weil die Einliegerwohnung unter dem Dach lag, und waren mit einer dezent gestreiften Tapete ausgestattet. Irgend jemand hatte hier alt werden sollen, es dann wohl aber nicht gewollt. Barbara wollte es auch nicht. Doch zumindest hatte sie vom Wohnzimmerfenster aus den Blick auf das Wäldchen und den Sonnenuntergang dahinter.
Seufzend griff sie wieder nach der Wochenendausgabe des Holsteiner Anzeigers. Ihre Augen glitten über die letzte Spalte der Immobilienanzeigen. Sie hatte sie alle schon gelesen. Es war nicht ein Objekt dabei, das für sie in Frage käme. Ein Resthof war zu pachten, aber er schien so baufällig zu sein, daß man ihn wahrscheinlich am besten abriß und neu aufbaute. Außerdem war kaum Land dabei. Das war unmöglich. Eine sonnige Terrasse, ein großzügiger Bauerngarten mit kräftigen Blumenstauden, die jedes Jahr größer wurden, ein paar Reihen mit Gemüse, ein Kräuterbeet und drum herum ein paar Beerensträucher mußten schon drin sein. Sonst hätte sie ja in der Stadt bleiben können. Thomas’ Träume von Weideland für ein paar Schafe oder Ziegen, einem eigenen Fußballfeld und allerlei Scheunen und Remisen teilte sie gar nicht. Erst mal klein anfangen und sich eingewöhnen in die fremden Lebensumstände war ihr Grundsatz. Erst mal Abschied nehmen von der Stadt.
Um kurz nach acht Uhr klingelte wie erwartet das Telefon.
»Wie sieht’s aus?« fragte Barbara. Ihre Stimme klang kühler, als sie wollte.
»Total ausverkauft!« brüllte Thomas ins Telefon. »Die Veranstalter sind selbst von den Socken. Das ist jetzt schon der dritte Laden, der aus den Nähten platzt, wenn wir anrollen.«
»Gratuliere«, sagte Barbara trocken.
»Bist du etwa immer noch sauer, mia bella?« fragte Thomas. »Freust du dich gar nicht, daß wir endlich ein bißchen Erfolg haben?«
Barbara nickte, obwohl Thomas das natürlich nicht sehen konnte. Ja, ja, sie freute sich über seinen Erfolg, aber mußte der sich gerade jetzt einstellen? Schließlich war er es gewesen, der die Idee aufgebracht hatte, aufs Land zu ziehen. Und nun? Nun hockte sie hier mutterseelenallein am Ende der Welt, und er gondelte mit seiner Band durch Deutschland und jagte von einem Erfolg zum nächsten. Auf diese Situation war sie nicht vorbereitet gewesen. Dabei war es schon schwer genug, nach ihrer Zeit als Assistenzärztin im Krankenhaus jetzt die ersten Patienten ambulant in einer Hausarztpraxis zu betreuen. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie diese Erfahrungen lieber in Hamburg gesammelt.
»Aber ja doch«, murmelte sie. »Toi, toi, toi für euch heute abend. Was werdet ihr spielen?«
»Was sagst du? Ich kann dich so schlecht verstehen, auf der Bühne ist gerade Soundcheck. Habe ich dir schon gesagt, daß wir am Wochenende noch einen Extra-Gig in der Nähe von Köln haben? Ist das nicht super?«
»Am Wochenende? Und wann sollen wir uns hier nach einem Haus umsehen?«
»Barbarina, ich komme, ich fliege, sowie wir die Tournee hinter uns haben. Für immer und ewig, sind das nicht gute Aussichten? Du kennst mich doch: Ich halte mein Wort, wenn auch nicht sofort.«
»Ach«, sagte Barbara und versuchte ihre Enttäuschung hinter einem Gähnen zu verstecken. Vielleicht wäre es besser, ihn anzufauchen und ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, aber sie hatte nun einmal gelernt, einzustecken und sich nicht zu beklagen. Sie beendete das Gespräch einsilbig und ein bißchen melancholisch. Thomas merkte nichts.
Nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte, sprang sie auf und zerknüllte den Holsteiner Anzeiger, bis ihr die Hände weh taten.
Kapitel 3
Rund um den Dorfteich, der zwischen den Grundstücken von Großbauer Petersen und der Landgärtnerei Bruhns lag, hatten sich in Windeseile eine ganze Menge Menschen eingefunden, ehe die Ärztin aus der Gemeinschaftspraxis herbeigelaufen kam. Den Wagen zu nehmen hatte sich nicht gelohnt, denn die Praxis lag gleich um die Ecke. Man machte ihr Platz und wies ihr aufgeregt den Weg zum Unfallort.
Timmi Scholz, vier Jahre alt, lag auf einer braunen Pferdedecke auf dem Bauch, den Kopf unnatürlich eingerollt. Jemand war dabei, ihm die klitschnassen Sachen auszuziehen.
»Ist der Doktor nicht da?« fragte eine ältere Frau in Kittelschürze. »Ich habe doch eben mit ihm gesprochen.«
»Ich bin auch Ärztin«, sagte Barbara Pauli und bat die Leute, etwas zurückzutreten. Dann faßte sie das Kind an den Beinen und stellte es auf den Kopf, bis ihm das Wasser aus dem Mund lief. Es begann zu husten und schnappte nach Luft. Barbara legte den Jungen vorsichtig zurück auf den Boden. Nun griff sie in seine Mundhöhle und machte die Atemwege frei. Der Junge schlug die Augen auf.
Als die Polizei eintraf, atmete er schon wieder gleichmäßig. Barbara horchte ihn ab und kontrollierte seinen Puls; seine Herztöne waren kräftig. Sie packte das Stethoskop zusammen und wickelte das Kind fest in die braune Decke.
Inzwischen hatte sich eine ältere Frau mit grauen, halblangen Haaren, die mit einer Spange seitlich gehalten wurden, durch die Menge gedrängt und beugte sich über das Kind.
»Timmi, mein Junge, was denn mit dir passiert? Mein Gott, er ist ja ganz naß! Er kann doch noch gar nicht schwimmen!«
»Wo wohnen Sie? Er muß sofort ins Warme, wir brauchen Wärmflaschen und heißen Tee.«
»Ich bin Oma Hagen, das ist mein Enkeljunge«, erklärte die Frau und nahm der Ärztin den Jungen ab. »Wir wohnen gleich da drüben; ich hab’ heißes Wasser auf dem Herd stehen. Wie konnte das bloß passieren? Der Freddi sollte doch auf ihn aufpassen.«
»Ich gehe mit«, sagte Barbara zu dem Polizisten, der unschlüssig neben seinem Wagen stehengeblieben war. Die Leute gingen langsam zurück in ihre Häuser.
»Soll ich nicht doch sicherheitshalber einen Krankenwagen rufen?«
»Ist wirklich nicht nötig, vielen Dank«, sagte Barbara und reichte dem Beamten die Hand.
»Dr. Barbara Pauli, ich arbeite seit einer Woche in der Gemeinschaftspraxis bei Dr. Stähr.«
Der Polizist legte zum Gruß einen Finger an die Mütze.
»Angenehm, Ellmeier, Oberwachtmeister aus Lensahn. Dann fahre ich mal wieder.«
Vor dem Gartenzaun des Landarbeiterhäuschens von Familie Scholz lehnte ein drahtiger, großer Junge mit messerkurz geschnittenen, dunklen Haaren und einer schwarzen Bomberjacke. Die Hosenbeine seiner Jeans waren schlammbespritzt, auch die Jacke trug Spuren von Sand und Dreck. Seine Hand lag auf dem Lenker eines nagelneuen Mountainbikes, das am Gartenzaun lehnte. Er starrte den beiden Frauen mit mißtrauischer Miene entgegen.
»Was ist denn los?« meinte er und trat hinter ihnen ins Haus. »Was ist denn mit Timmi?«
»Das wirst du schon sehen, was passiert ist«, keifte seine Großmutter. »Das ist Freddi, der älteste Sohn von meiner Tochter«, sagte sie, an Barbara gewandt. »Solltest du nicht auf Timmi aufpassen, nach der Schule? Wo warst du überhaupt? Los jetzt, geh nach oben und hole deine Schwester aus dem Bett. Ich kann nicht alles alleine machen. Timmi wäre fast ertrunken. Gleich kommt dein Vater, dann wirst du was zu hören kriegen.«
Oma Hagen stieß mit dem Ellenbogen die Tür zur Stube auf und ließ das Deckenbündel auf ein schmuddeliges graues Sofa gleiten, auf dem ein paar Kissen in selbstgehäkelten Bezügen prangten. Dazwischen lag Babyspielzeug herum und eine fleckige weiße Stoffwindel, die als Lätzchen gedient hatte und Spuren von Karottenmus trug. Auf dem Couchtisch vor dem Sofa standen ein Aschenbecher voller Kippen und ein halbleerer Kaffeebecher. Daneben lagen ein paar zerfledderte Zeitschriften. In einer Ecke stand ein riesiger Fernseher, in der anderen gab es einen Kachelofen, der muffige Wärme ausstrahlte. Neben dem Wohnzimmerschrank quoll ein Wäschetrockner über von klammer Kinder- und Babykleidung. Die Tapeten, helle Streifen mit Streublümchen, waren zerkratzt und stark nachgedunkelt. Die Luft im Zimmer war feucht und stickig und roch nach kaltem Rauch.
Während die Großmutter in die Küche eilte, um Wärmflaschen und heißen Tee zuzubereiten, nahm Barbara ein paar trockene Sachen vom Wäscheständer und zog sie dem Jungen über. Seine Beine waren mit blauen Flecken übersät, auch an den Armen trug er diese Male. Er war noch ein bißchen benommen und fing an, leise zu weinen. Barbara wickelte ihn fest in eine der Häkeldecken vom Sofa und lehnte ihn halb aufrecht in die Kissen. Dabei redete sie beruhigend auf ihn ein.
»Ich habe zwei Löffel Honig in den Tee getan«, sagte Frau Hagen und reichte der Ärztin den Becher. Er war glühend heiß. »Pfefferminztee. Den mag er wohl trinken.«
Freddi kam mit einem Baby auf dem Arm ins Zimmer. Das Kind war verschlafen und fing an zu weinen, als seine Großmutter es ihm abnahm. Es trug ein ziemlich schmutziges, ehemals rosafarbenes Hemdchen und hatte nackte Füße.
»Was ist denn hier los. Große Versammlung?«
Wie eine Wand stand plötzlich Walter Scholz in der Tür. Seine Stimme klang mürrisch. Er schwankte ein wenig, während er einen Schritt auf Freddi zuging, der zurückwich.
Frau Hagen schilderte mit kurzen, zusammenhanglosen Sätzen, was vorgefallen war. Ihre Stimme klang weinerlich. Das Baby auf ihrem Arm quengelte.
»Und wo hast du dich herumgetrieben, während dein Bruder fast ertrunken wäre?« wandte sich Scholz an seinen ältesten Sohn. Er griff mit der Rechten nach Freddis Wange und packte sie, wie man einen jungen Hund im Nacken faßt und zappeln läßt. Freddi versuchte sich zu befreien, er stieß einen unterdrückten Schmerzensschrei aus. Sein Vater packte noch fester zu.
»Ich war doch gar nicht hier«, rief Freddi heiser. Er hielt den Kopf unnatürlich schief, um den Schmerz zu lindern. Seine Füße in den dicken Baseballschuhen tanzten auf dem Boden.
Walter Scholz ließ ihn für einen Moment los, holte aus und warf seine große Pranke so heftig ins Gesicht des Jungen, daß sein Kopf gegen die Wand schlug. Freddi lehnte einen Augenblick wie betäubt an der Tapete.
Barbara schnappte nach Luft.
»Aufhören!« rief sie und legte einen schützenden Arm um den kleinen Timmi, der apathisch in den Kissen lehnte. Scholz beachtete sie nicht.
»Du weißt schon, wofür« brüllte er. »Was soll das Fahrrad noch da draußen? Hab’ ich dir nicht gestern schon gesagt, du sollst es wieder zurückbringen?«
Freddi riß schützend einen Arm vors Gesicht und duckte sich, ehe ein zweiter Schlag ihn zu Boden strecken konnte. Walter Scholz schien sich zu besinnen und zog mit einem lauten Geräusch die Nase hoch. Vor Erregung hatte er einen hochroten Kopf.
»Was ist nun?« sagte er etwas ruhiger. »Was ist hier los?«
»Nichts, Walter«, antwortete seine Schwiegermutter rasch. »Es ist alles in Ordnung. Timmi geht es schon wieder besser. Frau Doktor hat sich um ihn gekümmert, ihm ist nichts passiert. Er hat nur ordentlich Wasser geschluckt.«
»Petersen sollte doch einen Zaun um den Teich ziehen. Dem werd’ ich was erzählen«, sagte Scholz. »Verklagen werde ich den. Und du kommst jetzt mit, Freundchen«, er stieß Freddi aus dem Zimmer. »Und danach krieg’ ich wohl endlich was zu essen!« brüllte er vom Flur her. Klatschende Geräusche ließen erkennen, daß er erneut auf Freddi einschlug. Dann hörte man die beiden die Treppe hinaufstolpern.
Barbara Pauli schloß ihre Notarzttasche und versicherte sich mit einem letzten Blick, daß ihr kleiner Schützling wirklich über den Berg war. Der Tee war inzwischen so weit abgekühlt, daß er ihn allein trinken konnte. Sie gab der Großmutter noch ein paar Anweisungen und verließ das Haus, mit Erleichterung die frische Luft aufnehmend. Das Mountainbike lehnte noch immer am Gartenzaun. Als sie sich noch einmal umsah, glaubte sie für einen Augenblick, Freddis Gesicht hinter dem runden Giebelfenster unter dem Dach gesehen zu haben.
Dann machte sie sich auf den Weg in die Praxis zur Nachmittagssprechstunde.
Kapitel 4
Doktor Jürgen Stähr war ein hochgewachsener Mann, und durch seine schlanke Figur und die schmale hohe Stirn wirkte er noch größer. Er mußte sich ein Stückchen hinunterbeugen, während er in der obersten Schublade des Karteischranks herumsuchte; dabei pfiff er unablässig immer dieselbe Melodie.
»Hallo Barbara, der kleine Timmi ist schon wieder über den Berg, habe ich gehört? Wie gut, daß Sie gerade hier waren.«
Barbara stellte ihre Arzttasche auf der Theke vor dem Wartezimmer ab. Frau Claasen, die Arzthelferin, war wohl noch nicht aus der Mittagspause zurück. Im Wartezimmer saßen schon eine Menge Patienten.
»Aber Sie sehen ja ganz blaß aus, bekommt Ihnen unsere gute Landluft nicht?« fuhr er fort.
»Es sind wohl eher die Sitten und Gebräuche hier, die mir noch nicht so richtig bekommen, Doktor. Aber ich werde mich schon eingewöhnen.«
»Daran zweifle ich nicht«, sagte Dr. Stähr. Er betrachtete Barbara nachdenklich. »Aber sehr begeistert klingt das nicht.«
»Es geht schon. Ich habe nur gerade Walter Scholz kennengelernt, den Vater vom kleinen Timmi.«
»Ich weiß. Ich habe seine Frau entbunden. Dreimal.«
»Natürlich«, sagte Barbara. »Aber warum eigentlich«, rief sie plötzlich. »Warum bekommen solche Leute Kinder, wenn sie doch nicht mit ihnen umgehen können?«
Dr. Stähr schob Barbara rasch in sein Behandlungszimmer.
»Bevenstedt ist nicht Hamburg«, sagte er und drückte Barbara in den Stuhl, auf dem sonst seine Patienten Platz nahmen. »Es ist bestimmt eine große Umstellung für Sie. Aber in anderthalb Stunden sind Sie mit dem Auto in der Stadt. Sie wissen doch, daß Sie sich jederzeit einen Tag frei nehmen können. Gönnen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen, um hier anzukommen. Zwingen Sie sich nicht, man kann diesen Prozeß nicht beschleunigen, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Man braucht sehr lange, um die Menschen hier kennenzulernen. Auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht. Manchmal denke ich, sie sind uns Städtern fremder als die Eingeborenen von Papua-Neuguinea.«
Er lachte. Barbara mußte auch lachen.
»Vielen Dank«, sagte sie und unterdrückte ihr Bedürfnis, sich bei ihm auszuweinen. »Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich erst mal ein paar Wochen hierbleibe, um mich mit allem vertraut zu machen.«
»Dann machen Sie jetzt die Hausbesuche«, sagte Stähr. »Mit der Nachmittagssprechstunde werde ich schon allein fertig. Es ist die übliche Runde, wie wir sie neulich besprochen haben.«
Das waren ein paar chronisch Kranke, hauptsächlich alte Leute, die zu Hause versorgt wurden und regelmäßig mit dem Besuch des Doktors rechneten. Meistens genügte ihnen die Gelegenheit, ein bißchen über ihr Leiden zu klagen, manchmal mußte ein Verband gewechselt, eine Dosierung geändert oder eine neue Packung Tabletten verschrieben werden.
Hin und wieder jedoch spitzte sich der eine oder der andere Fall zu, so daß eine Einweisung ins Krankenhaus nach Oldenburg oder Neustadt erforderlich war.
»Und heute abend oder morgen früh schauen Sie mal bei Jupp Putensen vorbei. Er hat angerufen, sein Bein schmerzt ihn wieder. Er hat linksseitig eine oberflächliche Thrombophlebitis. Übrigens, sieht man Sie eigentlich morgen abend auf dem Feuerwehrball?
Barbara nickte vage.
»Ich denke schon«, sagte sie lau. Wenn Thomas hier wäre, hätten sie sich sicher vergnügt auf einem Dorffest. Was sie allein dort anfangen sollte, war ihr noch nicht recht klar. Wahrscheinlich würde sie die ganze Zeit mit Frau Claasen an einem Tisch sitzen und Likör trinken müssen oder von ein paar Patienten umschwärmt werden, die ein Faible für junge Ärztinnen hatten.
»Werden Sie denn hingehen?«
»Leider bin ich kein großer Tänzer«, sagte der Doktor und deutete auf sein verkürztes Bein. Er hatte in der Jugend Kinderlähmung gehabt und hinkte seitdem. Jeder Weg aus dem Haus war für ihn ein beschwerliches Unternehmen. Außer wenn er mit dem Fahrrad fuhr, was er aus unerfindlichen Gründen fast jeden Abend zu tun pflegte. Barbara hatte es schon mehrmals beobachtet.
»Aber ich werde mich natürlich blicken lassen«, fuhr der Arzt fort.
»Es soll immer sehr gute Grillwürste geben auf den Festen der Feuerwehr«, sagte Barbara und lächelte.
»Das wäre natürlich ein Argument«, meinte Jürgen Stähr. »Es sei denn, man ist Vegetarier. Sehen Sie, jetzt lächeln Sie schon wieder.« Der Doktor ging einen Schritt auf Barbara zu und legte eine Hand auf ihren Arm. »Sie passen wunderbar hierher. Sie sind genau richtig. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, daß ich Sie gefunden habe. Mahlzeit, Frau Claasen.«
Die Arzthelferin war so leise ins Zimmer gekommen, daß Barbara sie gar nicht gehört hatte. Sie wurde ein bißchen rot, dabei gab es ja keinerlei Grund dafür. Der Doktor drückte ihren Arm noch einmal und zog dann seine Hand zurück.
»Ich wunderte mich nur, daß die Arzttasche hier auf meinem Platz steht«, sagte Frau Claasen kurz.
Barbara sprang auf und nahm ihr die Tasche aus der Hand.
»Vielen Dank, Herr Stähr«, wiederholte sie und drückte sich an Frau Claasen vorbei. »Ich werde morgen abend natürlich auch kommen.«
Als sie an der Empfangstheke vorbeiging, hatte sie den Eindruck, daß die Miene der Arzthelferin sich ein wenig verdüstert hatte und nicht ganz so honigsüß war wie sonst. Aber vielleicht bildete sie sich das auch nur ein.
Kapitel 5
Freddi hatte die ganze Nacht auf den harten Dielen des Dachbodens wach gelegen und gefroren. Sein Kopf tat ihm weh von den Schlägen, und am Arm hatte er eine Platzwunde; dort hatte Vaters Uhr ihn getroffen. Am meisten aber schmerzte ihn die Scham über die Prügel, über die Strafe und über das Eingesperrtsein. Nicht einmal zur Schule durfte er gehen. Vater hatte gestern abend noch selbst mit seinem Klassenlehrer, Herrn Ochs, telefoniert und ihn entschuldigt. Er sei krank, er habe eine Ohrenentzündung, hatte er als Grund angeführt. Dann hatte er das Mountainbike mit dem Transporter der Firma nach Lensahn zurückgeschafft. Freddi hatte ihn vom Dachfenster aus beobachtet, wie er das tolle Rad einlud. Wahrscheinlich klaute es dort heute abend ein anderer. Er, Freddi jedenfalls, würde es nie wiedersehen.
Als es dunkel geworden war auf dem Dachboden, war Mutter hochgestiegen. Sie hatte ihm etwas zu essen durch die Tür geschoben und war, ohne hereinzukommen, wieder nach unten gegangen. Durch die Tür hindurch hatte sie nur gesagt:
»Timmi schläft jetzt. Aber er hat Fieber.«
Als wäre er schuld daran, daß Timmi in den Scheißteich gefallen war! Immer mußte er auf seine kleinen Geschwister aufpassen! Und wenn sie Unsinn machten, gaben die Großen ihm die Schuld dafür. Er hatte es reichlich satt. Am liebsten hätte er irgend etwas kaputtgemacht, so wütend war er. Aber hier oben auf dem Boden gab es nicht das geringste, was er hätte zerdeppern können. Nur ein altes, leeres Faß in der Ecke, die dünne, gelbe Plastikwäscheleine und den Klammerbeutel. Er könnte sich höchstens eine Schlinge knüpfen und sich am Dachbalken aufhängen. Dann würde Vater schön doof gucken morgen früh. Er wäre schon kalt und starr. Und Vater und Mutter wären schuld daran. Und Timmi.
Freddi überlegte, wie der Knoten beschaffen sein mußte, damit die Schlinge sich auch gut zuzog. Bis ihm einfiel, daß er Onkel Jupp einmal zugesehen hatte, als der einen Knoten knüpfte, um für Schlappi, den Bluthund, einen Würger zu basteln. Wenn er ein wenig übte, würde er ihn schon wieder fertigbringen. Aber dann war es so finster, daß er beschloß, erst einmal eine Runde zu schlafen, bis der Mond aufginge.
Aber der Mond ging nicht auf in dieser Nacht, und Freddi wachte und schlief ein und träumte und wurde ganz schwach davon. Als der Morgen dämmerte, war er so steifgefroren, daß er sich gar nicht mehr bewegen konnte. Er kroch zur Tür, aß ein paar Bissen Brot, auf das seine Mutter dünn Margarine gestrichen hatte, und trank ein paar Schluck Wasser. Mit dem restlichen Wasser kämmte er sich mit den Fingern die Haare. Dann fühlte er sich ein bißchen besser. Er nahm sich zusammen und beschloß, sich nicht unterkriegen zu lassen. Als er Vaters Auto abfahren hörte – er war nicht hochgekommen, um ihn wieder rauszulassen, was Freddi im stillen gehofft hatte –, fing er an, Kniebeugen zu machen, bis ihm ein bißchen warm wurde. Er ließ die Arme kreisen, bis die Gelenke knackten, und warf sich schließlich auf den Boden für ein paar Liegestütze. Am Ende fing er an, mit kleinen, dribbelnden Schritten den Dachboden zu umkreisen. Er fühlte sich deutlich besser, wenn auch immer noch zerschlagen und müde.
Irgendwann kam seine Großmutter hoch und klopfte an die Tür.
»Freddi? Hast du gut geschlafen, Junge? Ich bringe dir später etwas Warmes zu essen. Hast du denn auch etwas zu trinken?
»Bring mir ein paar Dosen Cola«, flüsterte Freddi und lehnte sich mit der Wange gegen das alte Holz der Bodentür. Er hörte Großmutter keuchen. Sie hatte wieder ihren schlimmen Husten.
»Das darf ich doch nicht, Junge. Nur Wasser und Brot, hat dein Vater gesagt. Bis Sonntag morgen.«
»Sonntag?« rief Freddi. »Der spinnt ja! Ich will morgen abend auf den Feuerwehrball! Laß mich hier raus, Oma, es ist gemein, mich einzusperren.«
»Psst«, machte seine Großmutter. »Sei nicht so ungezogen. Wir müssen froh sein, daß dein Bruder noch lebt. Nachher kommt der Doktor und sieht nach ihm. Er hat schlimmes Fieber und weint. Vielleicht hat er doch noch Wasser in der Lunge.«
»Aber dafür kann ich doch nichts. Ich war doch gar nicht da!«
Er hörte, wie seine Großmutter sich wieder entfernte, und schlug wütend mit der Faust gegen die Tür. Noch zwei ganze Tage! Und zwei Nächte! Das konnte er unmöglich aushalten! Und er hatte doch gar nichts getan!
Kapitel 6
Die Apfelplantage von Jupp Putensen lag etwas außerhalb des Dorfes an der Landstraße nach Grömitz. Am Straßenrand machte ein großes Schild in Form eines Apfels auf den Obstverkauf aufmerksam, auch wenn das Angebot sich jetzt saisonbedingt auf ein paar übriggebliebene Kisten Apfelmost beschränkte. Touristen, die in den nahen Ostseebädern ihren Urlaub verbrachten, hielten trotzdem zuweilen an, um frische Äpfel zu kaufen. Kopfschüttelnd schickte Jupp sie dann wieder weg.
Barbara Pauli fuhr mit ihrem Ford Fiesta bis auf den Hof und parkte den Wagen vor einem baufälligen Hühnerstall. Die Hühner hatten in dem morschen Zaun, der ihren Auslauf eingrenzen sollte, ein Schlupfloch gefunden und pickten zwischen dem Gerümpel, das überall herumstand. An einer flachen Baracke lehnte ein etwas kleineres Apfelschild, und über der Tür ließ sich mit etwas Mühe ein ins Holz gebrannter Schriftzug entziffern: Hofladen. Besonders vertrauenserweckend sah das Geschäft gerade nicht aus.
Auf der anderen Seite des Hofplatzes erstreckte sich eine zweite flache Baracke mit einer großen, verglasten Veranda, die offenbar das Wohnhaus darstellte. Neben der Tür lehnte ein altmodisches Fahrrad mit Hilfsmotor. Halb im Gestrüpp verborgen, war ein verbeulter Ford Transit geparkt, auf dessen Seiten der unvermeidliche Apfel prangte. Zwei Hunde kläfften ohne Unterlaß in ihrem Verschlag. Auf der Fensterbank der Veranda saß eine Katze und betrachtete die Ärztin aus verschlafen blinzelnden Augen. Von Jupp Putensen war weit und breit keine Spur.
Barbara klopfte an die Scheiben der Behausung und rief laut seinen Namen. Kurz darauf tauchte der alte Mann am anderen Ende des Hofes auf. Humpelnd, den langen grauen Bart vorne ins Hemd gesteckt, eine fleckige Schlägermütze im Genick. Er trug lange Gummihandschuhe.
»Frau Doktor, wenn mich nicht alles täuscht«, sagte der Apfelbauer und hielt seine behandschuhten Hände hoch, als wolle er sich ergeben. »Tut mir leid, ich mache mich gleich hübsch. Mußte gerade die große Giftspritze saubermachen.«
Barbara holte ihre Tasche aus dem Wagen und wartete ein wenig ärgerlich neben der Veranda. Ganz so schlecht schien es dem Kranken ja nicht zu gehen, wenn er noch arbeitsfähig war.
»Immer rein in die gute Stube«, sagte Jupp Putensen und scheuchte Barbara wie ein Huhn ins Haus. »Keine Bange, ich beiße nicht. Man muß ja froh sein, wenn die Ärzte heute noch auf dem Land leben wollen, nicht wahr?«
Er machte für Barbara einen Stuhl am Küchentisch frei. Im Hause herrschte die gleiche Unordnung wie draußen auf dem Hof. Nur die Luft war schlechter. Es war stickig und roch stark nach Kohlenstaub. Der alte Küchenherd wurde trotz des milden Wetters beheizt.
Der Alte ließ sich auf dem zweiten Küchenstuhl nieder und sah die Ärztin an, als wolle er ergründen, was er für sie tun könne. Als Barbara schwieg, wurde er ernst.
»Ich war nur mal eben draußen nachsehen, ob die Spritzen alle in Ordnung sind. In ein paar Tagen fängt die Plantage an zu blühen, dann muß alles parat sein, verstehen Sie?«
»Eigentlich bin ich hier, um mir Ihr krankes Bein anzuschauen«, sagte Barbara kühl. »Vielleicht wären Sie mal so freundlich und machen Ihren Unterschenkel frei. Dr. Stähr sagte, Sie hätten große Schmerzen.«
»Nun mal langsam, junge Deern. Wir sind doch hier nicht beim Militär. Erst mal genehmigen wir uns einen Klaren, wenn Sie gestatten. Oder trinken Sie nicht im Dienst?«
Barbara schnappte nach Luft und trommelte mit zwei Fingern ungeduldig auf ihre Ledertasche.
Jupp Putensen schien zu verstehen, daß seine Masche nicht ankam. Er beobachtete die Ärztin, schüttelte den Kopf und ließ seine Hand ratlos auf die Tischplatte fallen.
»Daß ihr jungen Leute so gar keine Lebensart mehr habt. Immer nur schnell, schnell, nicht wahr? Kein Wort zuviel, bloß keine Zeit verlieren. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Zeit eigentlich ist, junge Frau?«
»Wenn Sie sich so wohl fühlen«, sagte Barbara scharf, »könnten Sie ebensogut am Montag in die Sprechstunde kommen, Herr Putensen. Die Hausbesuche machen wir eigentlich nur bei Patienten, die sich selbst nicht helfen können. Wie ich sehe, sind Sie durchaus noch fähig, mit dem Wagen in die Praxis zu fahren.«
»Mit welchem Wagen?«
»Draußen steht ein Transporter.«
»Der steht da, aber das heißt doch nicht, daß er auch fährt«, konterte Putensen. »Wenn ich Glück habe, springt er nach der Ernte an, wenn ich ausliefern muß. Und im Herbst, wenn ich in die Mosterei fahre. Im Winter darf er ruhn, genau wie die Bäume – und wie die Menschen es auch hin und wieder tun sollten. Wollen Sie nun meinen Apfelschnaps probieren, oder soll ich mit mir selbst anstoßen?«
»Also gut, aber nur einen kleinen. Ich habe ja bald Feierabend.«
»Das hört sich schon besser an, junge Frau. Wenn unser Doktor nicht so von Ihnen geschwärmt hätte, hätte man eben meinen können, Sie wären von der Polizei. Man muß sich doch mal kennenlernen, bevor man die Hosen runterläßt, nicht wahr?« Er lachte und goß zwei kleine Schnapsgläser randvoll mit einem bernsteinklaren Selbstgebrannten. »Prosit.«
»Prost, Herr Putensen.«
»So.« Der Apfelbauer stellte sein Glas zurück auf den Tisch und fing an, das linke Hosenbein seiner braunen, schmierigen Stoffhose hochzukrempeln. »Da haben wir den Salat«, kommentierte er die böse Venenentzündung.
Barbara stand auf und legte sein Bein auf einen Stuhl, um es besser untersuchen zu können. Der Mann hatte bestimmt Schmerzen, die er mit seiner burschikosen Art und mit Hilfe von diversen Schnäpsen überspielte.
»Leben Sie hier ganz alleine?« fragte sie, während sie die Schwellungen und Verfärbungen sorgfältig in Augenschein nahm. »Haben Sie keine Hilfe auf dem Hof?
Jupp Putensen lachte. Es klang ein bißchen resigniert.
»Eine Hilfe hatten wir nie, meine Frau und ich. Und seitdem sie letztes Jahr gestorben ist, Gott hab’ sie selig, da muß ich eben allein zurechtkommen. Nun, was sagen Sie? Muß das Bein ab?«
»So schlimm ist es wohl noch nicht, Herr Putensen.«
»Ich heiße Jupp. So heiße ich schon immer und für alle. Auch für Frau Doktor, ist das klar?«
»Klar«, sagte Barbara und legte eine Gummimanschette um seinen Oberarm, um den Blutdruck zu messen. Das Ergebnis war miserabel. »Aber klar ist auch, daß Sie viel zu hohen Blutdruck haben. Wußten Sie das schon? Am liebsten würde ich Sie ins Krankenhaus einweisen, Jupp. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?«
Sie holte ihr Handy aus der Jackentasche und begann die Nummer des Krankenhauses in Oldenburg zu wählen.
»Kommt gar nicht in die Tüte«, sagte Jupp Putensen ruhig und fing an, sein Hosenbein wieder herunterzukrempeln. »Ins Krankenhaus gehe ich nicht, da brauchen Sie gar nicht erst zu telefonieren.«
»Sie müssen unbedingt gründlich untersucht und medikamentös eingestellt werden. Ich kann so die Verantwortung für Sie nicht übernehmen.«
»Das sollen Sie auch gar nicht. Sie sollen mir nur eine neue Salbe verschreiben. Meine ist nämlich alle. Schön wäre es natürlich auch, wenn Sie gleich eine Tube dabeihätten. Dann muß ich nicht erst in die Apotheke nach Lensahn. Bis ich da hinkomme, bin ich schon halb krepiert.«
»Es gibt keine Salbe, die Ihnen helfen könnte«, sagte Barbara.
»Natürlich gibt es die. Hat der Doktor mir doch gegeben. Diese gelbe, wie heißt sie noch? Hier liegt ja noch die alte Tube. Arnika, genau. Wie die Schwester von der Schwägerin meiner Frau, Arnika.«
»Arnikasalbe kann Ihre Beschwerden ein kleines bißchen lindern, mehr nicht. Wir müssen aber etwas gegen Ihren Bluthochdruck tun. Sie könnten sonst einen Schlaganfall bekommen, Jupp. Ihr Herz könnte versagen. Es ist ernst, wirklich.«
»Ach wo, der Doktor kennt mich schon zwanzig Jahre, der weiß, daß er mich von hier nicht wegkriegt. Alles halb so schlimm. Ich habe nur die blöden Stützstrümpfe nicht getragen, in der letzten Zeit. Ist so schwer, sie anzuziehen am Morgen, verstehen Sie? Ich bin nicht mehr so gelenkig. Und jetzt geben Sie mir meine Salbe, und dann trinken wir noch einen Schnaps.«
Barbara steckte das Telefon wieder in die Tasche und holte ihren Rezeptblock heraus.
»Ich schreibe Ihnen außer der Salbe einen Betablocker auf. Haben Sie jemanden, der die Medikamente für Sie abholt? Sonst kann der Apotheker sie Ihnen auch bringen lassen. Es kann sein, daß Sie kalte Füße bekommen von den Tabletten und daß Sie häufig zur Toilette müssen. Das ist normal. Ich werde natürlich auch mit Dr. Stähr über Ihren Fall sprechen.«
»Tun Sie das. Der Doktor weiß, daß Unkraut nicht so leicht vergeht.«
»Außerdem sollten Sie das kranke Bein hochlagern, wenn Sie sitzen, und unbedingt die Stützstrümpfe wieder anziehen. Ich werde jemanden vorbeischicken, damit man Ihnen in den nächsten Tagen dabei hilft. Und überlegen Sie sich bitte, ob Sie sich nicht doch lieber für eine Weile ins Krankenhaus legen wollen. Es geht vor allem darum, daß Sie unter Kontrolle sind, und um eine gründliche Untersuchung.«
Jupp Putensen grinste und stöpselte die Flasche erneut auf.
»Noch ‘nen Kleinen, Frau Doktor?«
»Nein, danke, ich muß jetzt los.«
»Und ich dachte, Sie erzählen mir noch, wie es meinem kleinen Freund Timmi geht. Ich habe gehört, er ist in den Feuerwehrteich gefallen.«
»Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Gestern abend hatte er noch ziemlich hohes Fieber, aber heute morgen war es schon runter auf achtunddreißig fünf. Übermorgen kann er sicher wieder aufstehen.«
Jupp Putensen kippte den Schnaps in einem Zug herunter und nickte.
»Ich kenne sie alle, die Jungs aus unserem Dorf. Sind alle gute Jungs, auch der Freddi. Darf man nichts drauf geben, was die Leute reden.«
Barbara griff nach ihrer Tasche.
»Ich glaube, sein Vater ist zur Zeit anderer Ansicht.«
»Anderer Ansicht«, wiederholte Putensen. »Walter wird mit dem Jungen nicht fertig, so ist das. So war das schon immer. Verprügelt hat er ihn, als würde er davon besser werden. Dabei hat der Junge einen guten Kern. Das spüre ich. Aber auf mich hört ja keiner. Tun Sie mir einen Gefallen? Passen Sie ein bißchen auf Freddi auf. Sie können das.«
Barbara machte ein skeptisches Gesicht.
»Doch, doch, Sie können das.«
Barbara winkte und deutete an, daß der Alte wegen ihr nicht extra aufstehen mußte. In seinen Augen lag ein seidiger Glanz, ob es der Alkohol war oder ob ein Hauch von Sentimentalität ihn streifte – sie wußte es nicht.
Kapitel 7
Gleich hinter der Farm des Apfelbauern begann der Koppelweg, eine Stichstraße in die Felder, die zwar asphaltiert, jedoch so schmal war, daß zwei Autos nicht aneinander vorbeipaßten. Am Anfang der Pappelallee, hinter der ersten Kurve, lag das ehemalige Pfarrhaus, das seit Jahren leer stand. Ein halbverrottetes Schild mit der Aufschrift »Zu verkaufen« hing an dem morschen Bretterzaun, der das Grundstück einfaßte. Hohes Gestrüpp, Brennesseln und Knöterich überwucherten die Nebengebäude und die große Scheune, die ziemlich baufällig aussah.
Barbara parkte ihren Wagen so nah wie möglich am Haus und rüttelte an der Gartenpforte. Sie war abgeschlossen und der Griff so eingerostet, daß er sich gar nicht mehr bewegen ließ. Sie holte ihre Gummistiefel aus dem Wagen und machte sich daran, eine Lücke im Zaun zu suchen.
Sie wurde rasch fündig. Wo die hohe Pappelallee begann, die man auch vom Dorf aus sehen konnte, hörte der Zaun abrupt auf und gab über einen schmalen, trockenen Graben den Weg auf das Grundstück frei.
Das Wohnhaus war ein kleines, zweistöckiges Gebäude mit spitzem Giebel und zwei flachen Erkern rechts und links neben der Eingangstür. Die Fenster waren alle noch heil, aber so zugewachsen, daß man kaum ins Innere des Hauses sehen konnte. Barbara riß ein paar Ranken des Knöterichs ab und trat die Brennesseln vor den Fenstern herunter.
Das Zimmer links neben der Haustür war einmal die gute Stube gewesen. Ein paar Plüschmöbel staubten noch vor sich hin. Ein alter Sekretär, in dem sicher der Holzwurm wohnte, stand an der Wand dem Fenster gegenüber. Er war wahrscheinlich einmal das Prunkstück des Zimmers gewesen. Die Deckenlampe war von Spinnweben ganz zugewachsen. Das Zimmer hatte den Charme einer altmodischen, gutbürgerlichen Stube; jedenfalls war es nicht bäuerlich eingerichtet.
Durch die kleinen Fenster in der Haustür konnte man den Flur erkennen, der mit schwarzweißem Terrazzo belegt war. Eine solide wirkende Holztreppe führte in den ersten Stock. Vor dem Zimmer rechts neben der Haustür waren die Fensterläden geschlossen. Barbara bahnte sich einen Weg durch das Gestrüpp rund um das Haus herum und entdeckte als nächstes das Fenster einer großen Wohnküche, die noch vollständig eingerichtet zu sein schien. Sogar der Brotkorb stand noch auf dem Tisch.
Aber am besten gefiel Barbara der verwunschene Garten hinter dem Haus. Es war ein Garten wie aus einem Märchenbuch. Vor der großen Terrasse, von der wahrscheinlich eine Hintertür in den Flur oder in die Küche des Hauses führte, waren noch die Blumenrabatten zu erkennen, die durch niedrige Buchsbaumhecken unterteilt waren. Zwischen allen möglichen Wildkräutern blühten Goldköpfchen und wilde Rosen, eine riesige falsche Johannisbeere war über und über mit roten und lilafarbenen Blütendolden bedeckt ebenso wie der Fliederbusch auf der anderen Seite der Terrasse. Zwischen den Steinplatten, die ganz mit Moos bedeckt waren, sprossen Gänseblümchen und blaue Veilchen, und die alte Obstbaumwiese hinter den Beeten war gelb vom Löwenzahn.
Ein kleiner Teich war hoch mit Schilf umwachsen.
Genauso hatte sie sich ihren Garten vorgestellt: Da war Platz für Blumenbeete und eine große Wiese, Büsche und Bäume für Beeren und Obst. Rechts hinter der Scheune lag eine wilde Dornenwiese, die aussah, als wäre sie jahrelang nicht gemäht worden. Hier könnte man eine Ziege anpflocken oder ein paar Gänse laufen lassen. Sogar Enten konnte man halten, wenn es einen Teich gab, hatte Thomas aus einem seiner Bücher über das alternative Landleben ihr vorgelesen. Der Gedanke an Thomas kühlte Barbaras Begeisterung schlagartig ab.
»Könnte man ganz hübsch machen, hier«, sagte plötzlich jemand so dicht hinter ihr, daß Barbara bis ins Mark erschrak.
»Entschuldigen Sie, aber Ihr Wagen blockiert die Straße. Ich komme leider nicht daran vorbei. Sind Sie die neue Besitzerin? Mein Name ist Ochs, Hans-Peter Ochs. Wir wohnen etwa hundert Meter weiter auf dem alten Resthof vom Sattlerbauern.«
Barbara musterte den Mann, der lächelnd in die Sonne blinzelte. Er sah aus, wie einer Camel-Reklame entsprungen. Er trug beige Baumwollhosen mit großen Taschen auf den Oberschenkeln, ein kariertes Flanellhemd, eine Wildlederweste und dunkle Sportschuhe. Er hatte dichte, schwarzgelockte Haare und ein markantes, ebenmäßiges Gesicht mit einem einnehmenden Lächeln. Seine Augenbrauen waren zusammengewachsen, was ihm ein burschikoses Aussehen gab.
Barbara nannte ihren Namen und reichte ihm die Hand.
»Vor allem der Garten«, sagte Peter Ochs. »Den hat die alte Dame immer besonders gut in Ordnung gehalten.«
»Kannten Sie die früheren Besitzer?« fragte Barbara.
»Kennen wäre zuviel gesagt. Colette, meine Frau, war ein paarmal bei der alten Dame, kurz bevor sie ins Altersheim gebracht wurde. Ihr Mann war schon lange tot. Die beiden Kinder sind weggezogen. Der Sohn lebt, glaube ich, in Amerika. Die Tochter hat sich nie um die Mutter gekümmert. Wahrscheinlich ist sie inzwischen verstorben, und die Kinder wollen das Haus nun verkaufen. Haben Sie den Tip von einem Makler?«
»Nein. Frau Claasen, unsere Arzthelferin, hat mir gesagt, daß das Haus leer steht.«
»Sind Sie etwa die neue Ärztin aus der Gemeinschaftspraxis? Komisch, irgendwie habe ich mir das gleich gedacht«, sagte Ochs. »Ich bin hier der Lehrer. Bevenstedt hat natürlich keine eigene Schule mehr, aber man ist trotzdem noch so etwas wie der Dorflehrer. Da fällt mir ein, haben nicht die Plettenbergs das alte Pfarrhaus gekauft? Da gab es doch eine Versteigerung – ich erinnere mich nicht mehr genau. Bestimmt weiß Colette, wem es jetzt gehört. Colette bekommt jeden Dorfklatsch mit, auch wenn sie immer sagt, daß sie mit den Leuten gar nichts zu tun haben will.«
»Wir wollten eigentlich auf einem richtigen Bauernhof leben«, sagte Barbara. »Dies ist ja mehr – ein Haus eben. Ohne Diele, ohne Tenne, verstehen Sie?«
»Die echten Dorfromantiker, wie? Kommen Sie aus Hamburg? Das merkt man gleich. Ich habe auch in Hamburg studiert. Aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und meine Frau auch, allerdings in Frankreich. Aber das macht nicht soviel Unterschied. Provinz ist Provinz, das gilt wahrscheinlich überall.«
»Leben Sie schon lange in Bevenstedt?
»Sechs Jahre. Reichlich lange. Wir haben zwei Kinder, Xenia kommt jetzt in die Schule. Sie müssen uns mal besuchen. Einfach immer weiter geradeaus gehen, bis der asphaltierte Weg zu Ende ist. Ein Feldweg führt noch weiter durch die Rapsfelder.«
»Ist es nicht sehr einsam hier? Ich weiß gar nicht, ob ich nicht lieber näher am Dorf wohnen würde.«
»Um Gottes willen. Mir reicht das Dorf, wenn ich am Mittag aus der Schule komme. Ich bin aufs Land gezogen, weil ich meine Ruhe haben wollte. Nicht, um dauernd die Motorsägen, Rasenmäher, Trecker und alle möglichen Landmaschinen meiner Nachbarn ertragen zu müssen.«
»Da haben Sie auch wieder recht.«
»Wollen Sie allein hier einziehen?«
»Wenn ich das wüßte«, murmelte Barbara.
Der Lehrer grinste.
»Noch nicht so festgelegt, wie?«
Barbara schüttelte den Kopf.
»Mein Freund ist Musiker. Er ist viel unterwegs.«
»Das kann sich schnell ändern. Wenn man erst mal ein Haus hat, kommt die Familie wie von allein hinterher. Uns soll es jedenfalls recht sein. Eine Ärztin in der Nachbarschaft – was kann man sich Besseres wünschen. Und Ihr Freund kann hier soviel Musik machen, wie er will, hier stört er niemanden. Wenn Sie Hilfe brauchen, wir sind in ein paar Minuten hier. Außerdem kennen wir alle wichtigen Handwerker persönlich, das ist was wert auf dem Land. Die Leute arbeiten hier mehr oder weniger mit Familien- und Nachbarschaftshilfe. Als Zugezogener einen guten Handwerker zu finden ist ziemlich kompliziert. Wir können ein Liedchen davon singen. Wir haben drei Jahre lang renoviert. Fragen Sie uns ruhig, wenn es losgeht mit dem Umbau.«
Bei dem Wort Umbau wurde es Barbara mulmig – plötzlich sah sie einen Berg Arbeit vor sich, an den sie bisher noch nicht gedacht hatte. Ein Haus kaufen konnte man auch allein, wenn man das nötige Geld dazu hatte. Aber umbauen? Instand setzen? Einrichten? Mit Handwerkern verhandeln? Dazu mußte sie ihren beruflichen Pflichten nachkommen, den Garten in Ordnung bringen, und eigentlich hatte sie auch ihre Freunde in Hamburg nicht ganz vernachlässigen wollen. Wie sollte das alles zusammengehen?
»Wenn Sie bei Doktor Stähr in der Praxis arbeiten, sehen wir uns sowieso bald wieder. Der Doktor hat mir Krankengymnastik verordnet. Vielleicht habe ich jetzt Lust, öfter mal zu üben. Sind Sie auch so eine Naturheilkundlerin?«
»Mein Spezialgebiet ist die Geburtshilfe«, sagte Barbara. »Außerdem habe ich eine Ausbildung in Chirurgie.«
»Oje, ich kann kein Blut sehen. Jetzt muß ich aber machen, daß ich nach Hause komme«, sagte der Lehrer und trat zurück in den Schatten. »Wenn Sie Ihren Wagen ein paar Meter weiter vor in den Feldweg stellen, kann ich mühelos dran vorbeifahren.«
Barbara warf einen letzen Blick auf »ihren« Garten und ging hinter dem Lehrer her ums Haus herum.
»Kommen Sie heute abend auch auf den Feuerwehrball?« rief Peter Ochs aus dem Auto heraus. »Dann lernen Sie gleich meine Frau kennen. Sie ist immer schrecklich neugierig auf neue Leute im Dorf. Außerdem sucht sie dringend eine Freundin.«
Er lachte freundlich, als Barbara ihn passieren ließ, und winkte, als sie sich mit einem kurzen Hupen verabschiedete.
Kapitel 8
So kalt, wie es nachts auf dem verdammten Dachboden war, so warm wurde es tagsüber, wenn die Sonne auf das Dach schien. Freddi lag auf der Luftmatratze, die seine Mutter ihm vor der zweiten Nacht heimlich gebracht hatte. Sie war hereingekommen, als es dunkel war. Freddi hatte schon geschlafen und einen ordentlichen Schrecken gekriegt, als sie plötzlich vor ihm stand, im Licht einer Taschenlampe. Sie hatte ihm die Matratze zum Aufblasen gegeben und einen Schlafsack dazu. Dann hatte sie sich mit ihm hingesetzt und ein Abendgebet gesprochen. Das hatte ihm wirklich am wenigsten gefehlt. Aber seine Mutter kam aus der Gegend von Paderborn, aus einer streng katholischen Familie. Ihrem Mann zuliebe war sie evangelisch geworden. Als sein Vater vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten war, um die Kirchensteuer zu sparen, hätte sie sich am liebsten scheiden lassen, wenn das nicht ebenso unvereinbar mit ihrem Glauben gewesen wäre. Also verzieh sie ihrem Mann, konvertierte aber nochmals und wurde wieder katholisch. Die Kinder nahm sie mit von einer Konfession in die andere. Für den evangelischen Konfirmationsunterricht war Freddi damals noch zu jung gewesen. Als er katholisch wurde, war er eigentlich schon zu alt für den Kommunionsunterricht. Außerdem mußte er jede Woche mit dem Bus nach Neustadt fahren, wo es die nächste katholische Gemeinde gab. Erst hatte er versucht, Mutter von dem Vorhaben abzubringen. Aber sie bestand darauf, daß er zur Erstkommunion ging. Also stieg Freddi jede Woche in den Bus nach Neustadt, und an der nächsten Station stieg er wieder aus. Von dem Geld für die teure Busfahrkarte kaufte er sich Zigaretten – bis sie dahinterkam und er eine ordentliche Tracht Prügel bezog. An seinem vierzehnten Geburtstag war Freddi aus der Kirche ausgetreten, seitdem war das Thema für ihn erledigt.
Am Samstag nachmittag war die Sonne langsam von einer Seite des Daches zur anderen gewandert, und gegen fünf Uhr wurde die Luft endlich wieder frischer. Freddi hängte sich in das Dachfenster. Das Wetter wäre phantastisch, um angeln zu gehen. Überdies mußte er unbedingt zum Feuerwehrball. Er konnte von hier aus die Hinterseite vom Gasthof Mohr sehen, wo der junge Kellner, den die Familie Mohr immer am Wochenende anheuerte, wenn viel Betrieb war, auf dem Hof die roten Läufer ausbürstete, die auf der Treppe vor der Bühne lagen. Alle würden dasein heute abend, alle, nur er nicht. Mareike würde vergebens auf ihn warten, und dann würde wahrscheinlich ein anderer kommen und mit ihr flirten.
Wütend ballte Freddi die Fäuste. Er machte einen Klimmzug am Fensterrahmen, und das Blech bog sich gefährlich unter seinem Gewicht. Er war schon einmal draußen auf dem Dach gewesen, damals, mit seinem Vater, als der Sturm etliche Dachziegel weggerissen hatte. Aber das war weiter oben in der Nähe des Schornsteins gewesen. Der Vater hatte eine Leiter auf den First gelegt, so daß man sich gut festhalten konnte. Schwindelig war Freddi nicht gewesen. Im Gegenteil, er hatte den Ausblick über das leicht hügelige Land mit den grünen und gelben Ackerflächen genossen. Sogar die Ostsee hatte er von da oben aus sehen können, zum Greifen nah.
Freddi sah sich um, und sein Blick fiel auf das alte Faß, das unter der Dachschräge stand. Es war leer, er hatte es schon am ersten Tag inspiziert. Er rollte es unter das Dachfenster und stellte sich in die Luke. Bis zur Regenrinne sah es gar nicht weit aus. Er konnte sich noch am Dachfenster festklammern, während er mit den Füßen versuchte, an dem Schneegitter Halt zu finden. Vom Dach bis zum Boden mochten es sechs oder sieben Meter sein. Vielleicht auch etwas mehr. Er mußte es so einrichten, daß er auf dem Dach des Geräteschuppens landete, das allerdings von hier aus nicht zu sehen war. Der Schuppen war knapp zwei Meter hoch und mit Teerpappe gedeckt, dort konnte der Aufprall nicht allzu hart ausfallen. Der Zeitpunkt war günstig. Sein Vater saß sicher schon am Tresen und war nicht mehr ganz nüchtern, und seine Mutter war mit dem Haushalt und den Vorbereitungen für Sonntag beschäftigt. Timmi mußte noch das Bett hüten, und Rosi war zu klein, um ihm in die Quere zu kommen. Die Großmutter blieb samstags immer in ihrem Zimmer und ruhte sich aus.
Von der Tonne aus war es leicht, sich in die Dachluke hochzustemmen, und mit Schwung landete Freddi mit dem Po auf dem Fensterrahmen, während seine Beine noch im Bodenraum schlenkerten. Keine Wolke war am Himmel, die Luft war sommerlich lau. Freddi war froh, dem stickigen Dachbodengefängnis entronnen zu sein. Wie hatte er es nur so lange dort aushalten können? Er wagte einen Blick über den Rand des Daches, indem er sich so weit wie möglich vorbeugte. Er zog seinen Gürtel aus der Hose und befestigte ihn an dem Metallring, durch den die Dachluke verschlossen wurde. Nun hatte er über einen Meter Länge gewonnen. Vorsichtig zog er die Beine aus der Dachluke und ließ sich, beide Hände um den Ledergürtel geschlungen, langsam auf dem Dach hinuntergleiten, bis seine Füße in der Regenrinne Halt fanden. Es fühlte sich fest und stabil unter seinen Füßen an, aber Freddi war vorsichtig. Er war schon über zu viele morsche Dächer gekrabbelt, wie alle Jungen aus dem Dorf. Er wußte, daß man Regenrinnen und Schneegittern nicht trauen konnte. Er wagte einen vorsichtigen Blick nach unten. Bingo. Er hing genau über dem Geräteschuppen. Wenn er es schaffte, senkrecht nach unten zu fallen, mußte er genau auf dem Dach landen. Hoffentlich brach das alte Ding nicht unter ihm zusammen.
Er rutschte mit den Füßen vorsichtig über die Dachrinne, den unteren Teil des Gürtels umklammernd, doch plötzlich rutschte ihm das Ende aus den verschwitzten Händen. Der Sturz war rasend schnell und kurz. Freddi hörte, wie er auf die Dachpappe krachte und wie ein paar Holzbalken unter ihm nachgaben. Schmerz verspürte er keinen. Er rappelte sich rasch auf, rutschte vom Schuppen und spähte um die Hausecke. Niemand hatte den Lärm gehört. Geduckt, unter den Fenstern entlang, rannte er vom Grundstück.
Kapitel 9
Zuerst hatte Barbara das flaschengrüne Samtkleid anziehen wollen. Aber als sie es am Nachmittag anprobierte, kam es ihr viel zu fein vor für einen Feuerwehrball. Die Frauen aus dem Dorf würden denken, sie hielte sich für etwas Besseres, wenn sie in so einem stadtfeinen Kleid ankäme. Die schwarzen Lackpumps waren auch nicht für eine Tanzdiele in einem Dorfgasthof gemacht. Ratlos inspizierte sie ihren Kleiderschrank. Das dunkelblaue Kostüm, das sie zur Staatsprüfung getragen hatte, war zu streng für einen Ball. Das helle Sommerkleid mit den Puffärmeln wäre womöglich zu kühl, der schwarze Hosenanzug zu keß, die Samthose mit dem indischen Hemd zu ausgefallen. Aber sie trug nun einmal keine Dirndl und Glockenröcke.
Kurz nach sieben sah sie die ersten Dorfbewohner über die Straße gehen und dem Gasthof zustreben. Frau Bruhns, die Mutter des neuen Lehrlings in der Arztpraxis, Besitzerin der Landgärtnerei Bruhns, trug ein bodenlanges, mit großen Blüten bedrucktes Kleid mit gewagtem Dekolleté und Spaghettiträgern, dazu silberne Sandaletten und eine Pelzstola. Ihr Mann stolzierte in einem weißen Smoking neben ihr her, offenbar schon jetzt nicht mehr ganz nüchtern. Junge, Junge, da hätte sie sich aber blamiert in einem Dirndl. Als nächstes entstieg dem Taxi aus Lensahn vor dem Gasthof eine stattliche Dame in einem perlenbesetzten schwarzen Goldlamékleid, das ihr in früheren Zeiten vielleicht einmal gepaßt hatte. Jetzt sah es aus wie eine Wurstpelle. Wenn sie sich nicht täuschte, handelte es sich bei der Dame um Anna-Luisa Täck, die ortsansässige Redakteurin des Holsteiner Anzeigers. Barbara hatte schon ein paar mal mit Vergnügen ihre Kolumne »An Land beobachtet« gelesen. Sie war mit einem Kapitän zur See verheiratet gewesen, hatte Frau Claasen berichtet, der von irgendeiner großen Fahrt nicht zurückgekommen war. Aus Langeweile hatte die gut versorgte Witwe zu schreiben begonnen, und inzwischen war sie für die Lokalnachrichten aus ganz Ostholstein zuständig.
Wachtmeister Ellmeier – in nagelneuer Uniform – schloß gerade sein Fahrrad neben dem Gasthof ab und reichte Frau Täck spontan seinen Arm, um sie feierlich in den Saal zu geleiten.
Also kam Barbara doch auf das Flaschengrüne zurück, das schon ein bißchen nach ihrem Kleiderschrank – Mottenkugeln und Kölnisch Wasser – roch. Sie nahm reichlich Chanel No. 5, frisierte sich die kurzen Haare mit Haarspray und einem klebrigen Haarlack aus Thomas’ Beständen und stolperte eilig in ihren schwarzen Lackschuhen über das Kopfsteinpflaster zum Gasthof Mohr. Vorsichtshalber hatte sie sich noch rasch ihre schwarze Strickjacke über die Schultern gelegt, obwohl es im Laufe des Abends drinnen im Saal sicher bullenheiß werden würde.
Vor der Tür des Gasthofs prallte sie mit Jupp Putensen zusammen, der aussah wie frisch gebadet. Er hatte seine Haare mit einer gehörigen Portion Pomade gebändigt und im Nacken mit einem roten Gummiband zusammengebunden. Sein schwarzes Jackett war so kräftig ausgebürstet worden, daß es auf den Schultern glänzte wie die Haut eines Räucheraals. Seine Hosenbeine waren zu lang, aber sauber und legten sich über den frisch gewichsten Schuhen in Falten. Jupp drängte Barbara seinen Arm geradezu auf. Einen Kopf kleiner als sie, aber stolz wie ein Pfau humpelte er neben ihr in den Saal.
»Heute habe ich mal die schönste Frau des Dorfes an meiner Seite«, raunte er ihr zu und klemmte sie fest an sich, den ganzen Saal bis zur Bühne durchmessend. Dann rückte er ihr einen Stuhl zurecht.
Barbara sah sich hilfesuchend um. War denn nirgendwo anders ein Platz für sie reserviert? Warum war sie nicht mit Frau Claasen zusammen hergekommen, dann wäre sie gar nicht erst in die Verlegenheit geraten, einem Kavalier wie Jupp entrinnen zu müssen.