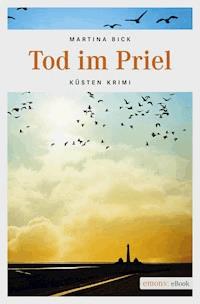3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marie Maas
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Kriminalkommissarin Marie Maas ist immer im Einsatz: „Nordseegrab“ von Martina Bick – jetzt als eBook bei dotbooks. Die Hamburger Kriminalkommissarin Marie Maas will sich auf der Nordsee-Insel Föhr vom Großstadtstress erholen. Doch das mysteriöse Verschwinden einer Kellnerin lässt ihr keine Ruhe. Sie vermutet, dass mehr dahinter steckt – und macht sich auf die Suche nach der Vermissten. Schnell erkennt Marie, dass auf Föhr nichts vergeben und vergessen wird … Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Nordseegrab – Der fünfte Fall für Marie Maas“ von Martina Bick. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Hamburger Kriminalkommissarin Marie Maas will sich auf der Nordsee-Insel Föhr vom Großstadtstress erholen. Doch das mysteriöse Verschwinden einer Kellnerin lässt ihr keine Ruhe. Sie vermutet, dass mehr dahinter steckt – und macht sich auf die Suche nach der Vermissten. Schnell erkennt Marie, dass auf Föhr nichts vergeben und vergessen wird …
Der vierte Fall für Marie Maas – eine außergewöhnliche Kommissarin stellt sich vor.
Über die Autorin:
Martina Bick wurde 1956 in Bremen geboren. Sie studierte Historische Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Gender Studies in Münster und Hamburg. Nach mehreren Auslandsaufenthalten lebt sie heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater arbeitet. Martina Bick veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane, Romane und Kurzgeschichten und war auch als Herausgeberin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2001 war sie die offizielle Krimistadtschreiberin von Flensburg. Bei dotbooks erschienen von Martina Bick auch die ersten vier Fälle für Kriminalhauptkommissarin Marie Maas: Der Tote und das Mädchen, Tod auf der Werft, Der Tote am Kanal und Tödliche Prozession.
***
Neuausgabe September 2014
Dieses Buch erschien bereits 1995 unter dem Titel Tödliche Ostern in dem Doppelband Mordsee bei Knaur.
Copyright © der Originalausgabe 1997 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: © istockphoto; shutterstock; Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-646-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Marie Maas an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
Martina Bick
Nordseegrab
Der fünfte Fall für Marie Maas
dotbooks.
1
Carmen legte den Telefonhörer leise auf. Überflüssige Vorsicht, niemand konnte sie hören. Und außerdem war das Telefonieren vom Tresen aus nicht verboten.
Sie drehte den Kopf und starrte in die Rosensträucher, die im Sommer durch das offene Fenster hereinwuchsen. Ein kleines Fenster, ein ehemaliges Stallfenster, einfach verglast, mit einem eisernen Fensterkreuz; ein Viertelchen davon konnte man öffnen. Hinter ihr im Restaurant blieb es immer dunkel und kühl, auch wenn draußen die Sonne schien und auf den glatten, gewachsten Rosenblättern glänzte, als wären sie aus Silber. Die hellen, pastellfarbenen Blüten leuchteten dann dazu wie Pailletten auf einem Abendkleid.
Vor diesem Fenster war immer Festtagsleuchten. Aber es zeigte nur einen winzig kleinen Ausschnitt der Insel. Dreißig mal dreißig Zentimeter, gerade genug, um die Feriengäste zu betören. Aber nicht genug, um das Leben hier sehen zu können. Lange nicht genug.
Carmen rutschte vom Barhocker, dessen Lederbezug so abgewetzt war, daß man Mühe hatte, sich oben zu halten. Für sie war dieses Leben nun abgeschlossen. Zwölf Jahre auf Föhr, zehn Jahre Ehe, fast zehn Jahre Mutter von einem, zwei, dann drei Kindern. Zwölf Jahre Arbeit, tagaus, tagein. Putzen, bedienen, kellnern, putzen, und noch mal putzen. Schluß damit. Bevor es endgültig zu spät war.
Sorgfältig stellte sie das Telefon wieder an seinen Platz unterhalb des Tresens. Rückte das Kabel gerade, damit man nicht darin hängenblieb, abends, das Tablett voller Gläser oder mit drei vollen Speisetellern auf dem Arm. Rennen, rennen, rennen – was war sie auf diesem Fußboden hier herumgerannt! Wie viele Kilometer mochten es wohl sein? Tausend? Mehr. Fünftausend. Einmal rund um den Globus vielleicht.
Sie lachte. Leise, in sich hinein. Bloß niemanden aufwecken. Die Chefin schlief mittags immer, und der Koch hatte sich auch irgendwo im Haus verzogen. Und Margarete, die sie selbst angelernt hatte im letzten Jahr, mußte sie nicht fürchten. Obwohl die immer still und leise durchs Haus geisterte.
Carmen warf einen letzten Blick hinter sich über die Tische: alles in Ordnung. Auf jedem Tisch standen ein paar Rosen, ein sauberer Aschenbecher mit einem Päckchen Streichhölzer darin und ein Teelicht, das die Gäste selbst anzünden konnten, wenn sie Kerzenlicht mochten. Die Speisekarten wurden erst ausgegeben, wenn die Gäste sich hingesetzt hatten. Von ihr ausgegeben. Jetzt nicht mehr von ihr. Auch wenn das noch niemand sonst wußte.
Wieder dieses Lachen, das ganz aus dem Bauch kam. Hoffentlich wurde sie nicht hysterisch. In solch einem Zustand verriet man sich zu leicht, geriet außer Kontrolle, verlor den Überblick. Nur das nicht, nur jetzt schön ruhig und cool bleiben und die Insel ohne Aufhebens verlassen. Und nie wieder Sönke Ley sehen. Nie wieder, nicht einmal von weitem. Dieser Gedanke machte sie nüchtern. Das Beben im Zwerchfell ließ sofort nach. Sie wurde wieder tot und kalt wie ein Fisch. So wie sie sich in den letzten Jahren immer gefühlt hatte. Lebendig begraben. Gefangen auf dieser Insel. Die Gefangene von Föhr.
Sie drehte sich auf dem Absatz um. Sie hinterließ ihren Arbeitsplatz sauber und geordnet. Sie war nicht unersetzbar. Sie nahm nichts mit, was nicht ihr gehörte. Sie ging ohne Abschied, ohne fristgerechte Kündigung; wenn man ihr denn unbedingt etwas vorwerfen wollte, dann war es das. Aber das würde Kreske schon verstehen. Später mal. Auf dem Kies des Parkplatzes hörte sie einen Wagen vorfahren. Schwer knirschten die Räder auf den Kieseln und Muschelsplittern. So schwer, wie es nur ein Mercedes tut. Nun zitterten ihre Hände doch und waren klamm vor Aufregung. Sie sah sich mit geübtem Blick um und entdeckte ein paar Fingertapser an der blanken Tür der Kühlbox, aber sie wischte sie nicht ab. Sie tappte durch die Küche, am Abwaschtisch vorbei, vorsichtig, ohne gegen die Abfalltonnen zu stoßen, und verschwand durch die Hintertür, sie sorgfältig hinter sich zuziehend. Die Mercedestür klappte dumpf, dann knirschten die Reifen wieder über den Kies. Und dann war es wieder still vor dem »Pferdestall«. Die ersten Rosenknospen schüttelten sich im Frühlingswind und schlugen mit leisen Klopfzeichen gegen die Fenster.
2
Marie Maas blätterte vorsichtshalber noch eine Seite weiter in der Getränkekarte bis zu den Bieren.
»Es gibt Warsteiner und Jever vom Faß. Hast du das gesehen?«
Tomkin antwortete nicht. Er hielt den Kopf stur nach links gewandt, während die Kommissarin rechts von ihm an der kurzen Seite des Tisches saß. Irritiert ließ sie die Karte sinken und suchte den niedrigen, mit unzähligen essenden, schwatzenden, krakeelenden und trinkenden Menschen gefüllten Raum ab nach einem Ereignis, das Tomkin so sehr fesseln mochte, daß er auf deutsche Biernamen nicht reagierte.
»Was ist denn los? Voll ist es hier.«
Tomkin stieß einen undefinierbaren Laut aus, zumindest war das Rudiment undefinierbar, das durch den Geräuschwall und durch das Sprechen mit abgewandtem Gesicht bei der Kommissarin ankam.
»Was sagst du?«
Endlich wandte Tomkin sich zu ihr um und reckte sich so weit über die blaßblau gemusterte Tischdecke, daß er mit den Lippen ihr Ohrläppchen berührte. Eine angenehme Berührung, fand Marie Maas und fühlte sich an den Nachmittag erinnert.
Gleich nach ihrer Ankunft auf der Insel, nach einer stürmischen Überfahrt, hatten sie ihr winziges Pensionszimmerchen in Süderende bezogen. Tomkin hatte auf der Fähre die ganze Zeit im Gang gestanden, angeblich um das Gepäck zu bewachen. In Wahrheit war ihm speiübel gewesen, was er als Insulaner – Engländer, der er war – natürlich nicht zugeben konnte. In ihrem Zimmer gab es nur ein einziges Möbelstück: ein riesengroßes Doppelbett. Die Übernachtung mit Frühstück kostete nur dreißig Mark pro Person, was nicht teuer war auf Föhr direkt über Ostern, dafür konnte man hier eben auch nur übernachten und andere Dinge tun, für die man weder Tisch noch Stuhl brauchte. Nicht einmal seine Kleider konnte man ordentlich ablegen, weil es einfach keine Gelegenheit dafür gab. Es gab nur dieses monströse Bett und eine meterlange Schrankwand, weiß Schleiflack mit goldverzierter Kante, und links davon, direkt am Fenster, ein Waschbecken. Hinter diesem Fenster aber lag die Nordseeinsel Föhr! Und vor ihnen lag ein Ferienwochenende an der Nordsee, weit und so sicher wie möglich von zu Hause entfernt. Die Kommissarin fand die Sturmböen phantastisch, die auf der Autobahn von Hamburg nach Heide aufgekommen waren und sich in Dagebüll am Fähranleger so richtig ins Zeug legten. Die kargen Sträucher, die den riesigen Parkplatz säumten, bogen sich, bis sie fast waagerecht im Wind lagen. Schwarzbraune Wolkenberge wurde volle Kraft voraus über den eisgrauen, niedrigen Himmel getrieben. Die zarten Frühlingsanfänge, die sie in Hamburg und die Tomkin in London schon entdeckt hatten, von ihnen fand sich hier keine Spur. Sie kehrten zurück in den Winter. Sie setzten sich ab aus dem milden Stadtklima, sie würden mit einer dieser sanft schaukelnden, zuverlässig breit ausschauenden Fähren das flache Wattenmeer durchkreuzen, und dann hätte man ihretwegen den Fährverkehr nach Föhr einstellen können. Jedenfalls bis nach Ostern. So lange wollten sie mindestens hierbleiben. Und mit ihnen etwa zehntausend andere Touristen, stadt- und wintermüde Familien, blasse, aufgeregte Kinder, Alte und Junge mit zerzausten, vom Wind gestreckten Frisuren. Alle sahen aus wie Kobolde, in ihren knallbunten Regenjacken, mit flatternden Schals und Tüchern und straffen Gesichtern, die sich dem hart peitschenden Wind stellen mußten.
Genau das suchten sie: ein Stück Natur, dem man sich stellen mußte. Und dann irgendwo einkehren, einen heißen Grog trinken, ein Stück Friesentorte essen, zuckersüß mit dicker, fetter Sahne von einheimischen Kühen, und am Abend gab es irgendwo einen sauren Hering oder mild gesalzenen Matjes, dem man den Wind und das Salzwasser noch abschmeckte. Sie brauchten keine verfrühten Sonnenbäder, keinen vorverlegten Sommeranfang. Sie waren alle herbe Naturen. Sie wollten immer wieder den Unterschied spüren: hier die bissige Kälte, die ausgehalten werden will; dort die milde, besänftigende Wärme, der man sich hingeben kann.
Marie Maas und Tomkin hatten also das große, weiße Schleiflackbett ausprobiert, anschließend die Dusche, und dann hatte Tomkin begonnen, seine Büchertasche auszupacken. Es waren noch mehr Bücher als sonst. Seitdem er seinen ersten Roman beendet hatte, war er ziellos im Lesen. Er wußte nicht, wie es weitergehen sollte. Und in den letzten drei Wochen, seitdem das schöne, dicke Buch erschienen war, war er mehr als ziellos: Er war kopflos. Er erwartete eine Reaktion. Eine Woche nach Auslieferung des Buches wagte er zum ersten Mal, aus dem Haus zu gehen und sein Telefon aus dem Auge zu lassen. Was der arme Apparat hätte verkünden sollen, war unklar. Aber Tomkin war wohl davon überzeugt gewesen, daß er klingeln müßte, um irgend etwas Tolles anzukündigen.
Schließlich hatte er ein Buch geschrieben, er, Tomkin Quest, einen langen Roman mit vierhundertzwanzig Seiten, an dem er mehr als drei Jahre gearbeitet hatte, den er mehr als zwölfmal neu begonnen und unzählige Male umgeschrieben, korrigiert und redigiert hatte. Und dann war er endlich fertig gewesen, und Tomkin hatte einen meterhohen Stapel Fotokopien angefertigt, um das Manuskript an alle in Frage kommenden englischen Verlage zu senden, hatte ein Vermögen an Briefmarken und Verpackungsmaterial investiert. Und tatsächlich einen Verleger gefunden, der bereit war, das Risiko einzugehen, einen jungen, unbekannten Londoner Werbetexter herauszubringen, der meinte, seine Kindheit aufarbeiten zu müssen und dies in viele Worte zu fassen. Und der das Buch im Laufe weiterer, endloser vierzehn Monate auf den Markt brachte. Und dann, endlich, waren die Korrekturen abgeschlossen, die Fahnen gelesen und korrigiert, der Kummer über das Cover – völlig unpassend – überwunden, der Klappentext – wie primitiv! – verdaut, die erste Werbeanzeige, unverhofft in einer ungeeigneten Zeitschrift – Pädagogik – entdeckt und trotzdem ausgeschnitten, stolz wie ein Pfau, und schließlich war das Paket mit den Belegexemplaren gekommen. Und gleichzeitig, zufälligerweise, war Marie Maas aus Hamburg angekommen und hatte Tomkin so vorgefunden, schon in Sorge, weil er sie zum ersten Mal nicht vom Flughafen abgeholt hatte. Hatte ihn gefunden wie einen kleinen Jungen inmitten seiner Bücher auf dem Fußboden vor dem Kamin, lesend, an den Büchern riechend, ein glücklicher, völlig aus dem Gleis geratener junger Mann am Ziel seiner Wünsche.
Sie hatte sich das Ganze ein paar Tage lang angesehen. Natürlich geschah darüber hinaus nichts. Was sollte sich denn auch ereignen? Sie machten sich einen Spaß daraus, in verschiedenen Londoner Buchhandlungen herumzulaufen und nach seinem Buch zu suchen, freuten sich wie die Spatzen, wenn sie es irgendwo im Schaufenster sahen, und waren erbost und beleidigt, wenn ein Buchhändler den Titel weder führte noch kannte. Na, so etwas! Dann mußte er es eben ordern! Sie bestellten rund zwanzig Exemplare in den Buchhandlungen rund um Piccadilly Circus und hatten das Gefühl, damit wenigstens für ein Minimum an Werbung gesorgt zu haben.
Natürlich hatte Marie Maas den Roman gelesen. Mehrmals. In allen Fassungen, alle Streichungen inklusive. Der Text war ihr etwa so bekannt wie ihre Dienstvorschrift, und die hatte man ihr auf der Polizeischule eingetrichtert wie das Einmaleins in der Schule. Sie konnte sie rückwärts buchstabieren. So ähnlich ging es ihr mit Tomkins Roman. Wenn sie nicht so wahrheitsliebend wäre, könnte sie sich einbilden, sie hätte ihn selbst geschrieben, so vertraut waren ihr manche Sätze. Ihr Englisch hatte bedeutende Fortschritte gemacht in dieser Zeit. Wenn sie ein bißchen Muße hätte und ein bißchen Talent, hätte sie sich sogar zugetraut, ihn ins Deutsche zu übersetzen. Mit Tomkins Hilfe natürlich.
Aber von Muße konnte bei ihr wie üblich keine Rede sein. Sie war zusammen mit Johnson, ihrem Chef, abkommandiert worden zu einer überregionalen Sonderkommission, die sich mit einer Bande Betrüger befaßte, die sich mit Betrug und Fälschungen Millionen ergaunert hatten und ihr Leben in irgendeinem Karibikstaat fortführen würden, wenn sie es nicht schafften, sie vorher zu schnappen. Zwei Verhaftungen standen kurz bevor, aber Johnson, Chef des Morddezernats und Marie Maas' direkter Vorgesetzter, setzte auf Zeit, um alle auf frischer Tat zu erwischen, und ordnete noch eine Runde Observation an. Daraufhin hatte die Kommissarin ihren Urlaub eingereicht. Wenn ihnen die Bande durch die Lappen ging, wollte sie wenigstens nicht dabeisein.
Sie hatte Tomkin angerufen und ihn aus der nachschöpferischen Lethargie gerissen.
»Laß uns einfach ein paar Tage ans Meer fahren, mein Lieber. Du verpaßt nichts. Wir verpassen beide nichts, wenn wir uns einfach verdrücken.«
»Wenn nun jemand ein Interview haben will? Und ich bin nicht erreichbar?«
Marie Maas verkniff sich die Frage, weshalb jemand ein Interview von ihm haben wollen sollte angesichts der enormen Zahl von Neuerscheinungen jeden Monat auf dem englischen Büchermarkt zu Gott weiß welchen brandaktuellen Themen. Mit Vernunft aber ist jungen Müttern und Schriftstellern nicht beizukommen. Das hatte sie schon begriffen.
»Setz deinen Anrufbeantworter in Betrieb. Sprich drauf, daß du zurückrufst. Ach, Tomkin, du weißt doch, daß so schnell nichts anbrennt. Fahren wir also?«
Nachdem Susanne Bollmann in letzter Minute dieses Zimmerchen in Süderende über den Zimmernachweis auf Föhr für sie hatte reservieren lassen können, buchte die Kommissarin für Tomkin einfach einen Flug von London nach Hamburg mit der Abendmaschine, ließ ihm das Ticket per Boten zustellen und fuhr nach Hause, um ihre Taschen zu packen.
»Ich habe gesagt, es ist verdammt voll hier«, brüllte Tomkin der Kommissarin ins Ohr. So laut war es nun auch wieder nicht, daß man so schreien mußte. Erschrocken rieb sie ihre von Wind und plötzlicher Wärme glühenden Ohrmuscheln.
»Es gibt Warsteiner und Jever«, wiederholte sie.
»Aber es gibt keine Bedienung«, sagte Tomkin mit normaler Stimme und Entfernung von ihrer Ohrmuschel.
Die Kommissarin sah ihn verdutzt an und zeigte auf die Frau, die an ihren Tisch gerannt kam, in letzter Minute bremste und mit gezwungener Ruhe ihren Block zückte.
»Kann ich bei Ihnen schon die Getränke aufnehmen?« fragte sie atemlos.
»Schon« ist gut, dachte Marie Maas und wiederholte dann laut zum dritten Mal ihre Entdeckung: »Es gibt hier Warsteiner und Jever.
»Ich nehme ein Warsteiner«, sagte Tomkin und strahlte die Bedienung an.
»Und für mich einen weißen Burgunder, bitte.»
Ehe sie dazu kamen, Knoblauchbrot, Krabbensuppe, Scholle und Rumpsteak mit Champignons zu bestellen, war die Kellnerin schon wieder im Gewühl der Gäste verschwunden. Marie Maas nahm ergeben Tomkins Hand und freute sich, wie schön warm und fest sie war.
3
Es war acht Uhr dreißig, als Magnus Pleß wie jeden Morgen an der Ecke zum alten Kaufladen von links Jensens Bäckerwagen entgegenkam. Das Zeichen, daß bei Brodersen gerade die frischen Brötchen eingetroffen waren. Nichts haßte Magnus so sehr wie Semmeln vom Vortag.
Er trug seine dicke Winterjoppe, Wollmütze und feste Stiefel. Zum Glück war für die Ostertage schönes Wetter angesagt. Bei Neumond war der Himmel blau gewesen, und ein starker Nordwester hatte geblasen, da standen die Chancen gut für ein paar klare Sonnentage. Vielleicht würde er sogar schon die Dachstube aufmachen können. Endlich wieder richtiges Licht zum Malen. Nicht diese Leuchtröhrenkonstruktionen in der Stube. Ein Wunder, daß er im Winter überhaupt etwas zuwege brachte.
Da flitzte Meta in ihrem weißen Kittel auf dem Fahrrad vorbei. Punkt halb neun. Sommers wie winters. Meta bediente schon seit zwanzig Jahren hinter Brodersens Fleischertresen. Genauso lange, wie er, Magnus, auf der Insel lebte.
»Moin, Magnus«, grüßte Rickmer Brodersen über die Schulter, während er weiter die Preise in die Kasse tippte. Leif Asmussen stand hinter dem schwarzen Fließband und schob seine ersten beiden Biere darauf. Wie der es, immer noch schaffte, eine gerade Mauer hochzuziehen, war Magnus Pleß ein Rätsel. Er war selbst beileibe kein Antialkoholiker, im Gegenteil, es hatte Zeiten gegeben, da war er ohne eine Flasche Whisky nicht über den Tag gekommen. Jetzt hatte er auf Wein umgestellt, den er sich kistenweise von einem Händler vom Festland liefern ließ, um nicht auf den teuren Wein bei Brodersen angewiesen zu sein.
»Moin, Edith, moin, Lorenz«, grüßte er die weißgekittelte Verkäuferin und den Verkäufer aus der Gemüseabteilung. »Was, ihr habt schon Erdbeeren? Aus Spanien?«
»Marokko«, sagte Lorenz und beugte sich zu dem Maler und zu den Erdbeerkörbchen hinunter. Er war knapp zwei Meter lang, eine schwierige Länge für einen Verkäufer, zu dem man schließlich nicht aufsehen möchte. Lorenz hatte sich deshalb eine halbschiefe Körperhaltung zugelegt, die er nur begradigte, wenn er mit langen Schritten im Lager verschwand. Magnus Pleß murmelte etwas in seinen Bart, der lang und grau auf sein Jeanshemd hinunterfiel, und schob seinen Einkaufswagen weiter durch die Gemüseabteilung, ohne etwas hineinzutun.
»Alles von Freitag«, murrte er. »Hat das ganze Wochenende im Kühlhaus gestanden. Wird Zeit, daß Fanny wieder in den Garten geht. Aber bis dahin ...«
»Moin, Magnus.«
»Moin, Kreske.«
Rasch schob der Maler seinen Wagen weiter zur Kühltruhe. Er lud zwei Liter Milch und zweimal Butter ein und ging schnell und grußlos an zwei Müttern mit ihren Kleinkindern im Wagen vorbei, die in ein Gespräch vertieft waren und ihn ebenfalls ignorierten. Am Brot- und Käsestand hatte die Wirtin vom »Pferdestall« gerade Alice Brodersen ins Kühlhaus geschickt, um eine Palette Sahne zu holen. Harro Martens wartete ebenfalls darauf, bedient zu werden.
»Und? Ist bei dir schon was los?«
»Voller Betrieb«, antwortete Kreske.
Magnus Pleß studierte angestrengt ein Sonderangebot mit dänischen Fischdosen. Daß man ihn bloß nicht ins Gespräch zog! Aus purer Verlegenheit legte er drei Dosen Fisch in seinen Wagen. Als er Alice aus dem Kühlhaus kommen sah, schob er sich rasch hinter Kreske an den Brotstand.
»Bei dir soll ja gestern viel los gewesen sein«, sagte Alice, während sie Kreske die Palette Sahne rüberreichte.
»Muß ja auch«, sagte Kreske kurz angebunden und packte die Palette mit beiden Händen. »Gibst du mir rasch noch ein Kürbiskernbrot oben drauf?«
»Ja, ja, Arbeit ist das halbe Leben und die andere Hälfte auch«, zitierte Alice Brodersen wehmütig und sah der jungen Frau mit den streichholzkurzen Haaren einen Augenblick lang nach.
»Soll ja Probleme mit dem Personal haben«, sagte Harro und zeigte dann auf die dicke Rolle Holtenser Tilsiter. »Schneid mir davon mal drei Scheiben ab, bitte, aber nicht so dünn. Und dann zwei Roggenbrötchen, aufgeschnitten.«
Magnus Pleß spürte, wie er sich wieder entspannte. Die Begegnung mit Kreske Lieuwering war ihm heftig unter die Haut gegangen. Als er endlich an der Reihe war, klang seine Stimme belegt und quietschte wie eine alte Tür.
»Vier Kaiserbrötchen«, stieß er hervor.
»Vier sagst du? Hast du Besuch?« fragte Alice Brodersen freundlich, während sie die Brötchen in die Tüte steckte. »Oder bringst du für Fanny welche mit? Geht's ihr gut?«
»Ja«, sagte der Maler und warf die Brötchentüte in seinen Einkaufswagen. Ohne ein weiteres Wort schob er weiter, am Fleischtresen vorbei und direkt auf die Kasse zu. Den Rest mußte Fanny einkaufen. Ihm reichte es für heute.
»Wenn du Brötchen holst, koche ich Kaffee«, murmelte Tomkin und wickelte sich noch einmal so in seine Decke ein, daß Marie Maas überzeugt war, würde sie jetzt Brötchen holen gehen, könnte sie den Kaffee hinterher auch selbst kochen.
»Kommt gar nicht in Frage. Ich will Kaffee am Bett, Mr. Quest. Ich habe Urlaub, vergessen?«
»O nein, bitte nicht!«
»Kein Urlaub? Ich soll jetzt gleich zum Dienst eilen und dich zum Mittagessen wecken? Du bist wohl ganz und gar von Sinnen!«
Tomkin zog die Decke noch höher.
»Es ist gleich zehn Uhr, und wenn du nicht bald losläufst, werden wir überhaupt nichts mehr zu essen bekommen.« Das half. Tomkin gehörte trotz seiner fünfunddreißig Jahre noch immer zu den Menschen, die unendlich viel essen können und müssen, um nicht vom Fleisch zu fallen. Er setzte nie Fett an. Obwohl er auf keinerlei körperliche Arbeit verweisen konnte und es auch sonst vermied, Kalorien zu verbrauchen. Er hatte einfach einen flotten Stoffwechsel. Voll Neid beobachtete die Kommissarin die Unmengen von Kuchen, die Tomkin in sich hineinstopfen konnte, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, in welchen Fettpölsterchen sie sich wiederfinden würden. Immerhin hatte diese ungerechte Fähigkeit zur Folge, daß er auch anderen Menschen zubilligte, so viel essen zu dürfen, wie er selbst es tat. Ohne abfällige Kommentare oder gemeine Spitzen von sich zu geben, was ihre Unbeherrschtheit, Völlerei oder Naschhaftigkeit betraf. Im Gegenteil, wenn Marie Maas sich aufgrund schlechter Laune oder Frust oder Streß mit Schokoladenkeksen oder den feinen, gesäuerten englischen Kartoffelchips vollstopfte und anschließend Bauchschmerzen bekam, bedauerte er sie aufrichtig und dachte gar nicht daran, ihr Unwohlsein auf Maßlosigkeit im Essen zurückzuführen. Statt dessen bot er an, ihr eine zweite Tüte Chips zu besorgen. Er war, kurz gesagt, in dieser Hinsicht ein Schatz. Probleme gab es nur, wenn nicht genug zu essen da war. Zum Beispiel überfiel ihn im Auto manchmal ein solcher Hunger, daß er sofort an einer Raststätte halten mußte und ein Wiener Schnitzel mit einer doppelten Portion Pommes frites und einen großen Salatteller in sich hineinschlang.
»Wenn ich an diese Krabbensuppe denke, wie die duftete!« Tomkin hatte sich jetzt auf den Rücken gedreht und sah mit weitaufgerissenen Augen an die Decke. »Wenn ich doch nur einen Löffel voll davon bekommen hätte.«
»Ich habe ein paar Spritzer von meiner Hand abgeleckt. Sie war phantastisch. Eine Spur Curry darin.«
»Tatsächlich?«
Tomkin stützte den Kopf auf die rechte Hand.
»Meinst du, wir könnten so etwas in der Dose bekommen?
»Um Gottes willen. Das probieren wir nicht einmal. Wir werden einfach noch einmal in den ›Pferdestall‹ gehen. Heute abend zum Beispiel.«
»Noch so ein Abend ...«
Sie hatten ihr Warsteiner und den weißen Burgunder schon bekommen, an diesem denkwürdigen Abend. Aber das Bier war schal gewesen und der Wein lauwarm. Trotzdem hatten sie beides längst ausgetrunken, als die Kellnerin, die im Laufe des Abends immer mehr aus der Fassung geriet, endlich wieder an ihrem Tisch auftauchte, um die Essensbestellung aufzunehmen.
»Einmal die Krabbensuppe und ein Knoblauchbrot«, hatte Tomkin für sie beide als Vorspeise bestellt. »Und dann für mich eine ganze Scholle gebraten mit Kartoffelsalat und für dich ...«
»Ein Rumpsteak mit Champignons, englisch, bitte.«
Ohne Kommentar war die Frau wieder abgezischt, hatte sich mit ihrem Block in der Hand und dem runden Tablett in der anderen wie mit Schild und Speer bewaffnet einen Weg durch die Horden von Gästen gebahnt, die in dem Gang des Restaurants standen und auf frei werdende Tische warteten, um dann wieder eine Ewigkeit lang nicht aufzutauchen. Was war bloß los in diesem Laden? Das Essen, das an ihrem Tisch vorbeigetragen wurde, sah fabelhaft aus. Gierig sogen sie die Düfte ein, die an ihnen vorbeizogen. Nur zu voll war es und dazu voller unbeherrschter, hungriger Leute, die herumbrüllten und kommandierten, als wären sie in einem Lazarett für Seenotopfer gelandet und es ginge um Leben und Tod. Irgendwann stellte ihnen ein junger Mann, der ihnen keinen Blick und kein Gehör schenkte, die zweite Runde Getränke hin. Dann war wieder Pause. Endlos lange. Und dann plötzlich erschien die Kellnerin mit einer Suppentasse und einem Teller, auf dem gefährlich lang und glatt eine halbe Baguette schaukelte, die wahnsinnig gut nach Knoblauchbutter duftete. Die aßen sie dann auch auf. Beide zusammen. Die Suppe nämlich erreichte leider nicht einmal die Tischkante, sondern ergoß sich, zusammen mit der stolpernden Kellnerin, über Marie Maas' Schoß, Strümpfe sowie auf den Boden. Kein Löffel voll hatte seinen hungrigen Magen erreicht, wie Tomkin ganz richtig bemerkte. Statt daß nun schleunigst für Ersatz gesorgt wurde, nachdem die Kommissarin sich schon bereit erklärt hatte, auf eine Reinigung ihrer Hose zu verzichten, und selbst rasch auf der Toilette den gröbsten Schaden beseitigte. Aber es wurde ihnen nur verkündet, die Suppe sei alle. Keine Krabbensuppe mehr.
In der Scholle, mußte Tomkin feststellen, befand sich eine Grätenkonstruktion, mit der er nicht klarkam. Dabei war er selbst ein guter Koch und vor allem ein motivierter Esser. Aber es lag wohl an der verunglückten Krabbensuppe, vielleicht auch an der stürmischen Überfahrt, den Anstrengungen am Nachmittag, der langen Warterei am Abend: Tomkin schaffte es nicht, den Fisch zu zerlegen. Er resignierte vor seinem vollen Teller. Mit größtmöglicher Beherrschung eines höflichen Engländers beförderte er den kalten Kartoffelsalat in sich hinein, probierte einen kleinen Bissen von Maries phantastischem Rumpsteak, wollte aber nicht mehr haben, denn er mochte kein rohes Fleisch – und ging hungrig ins Bett. Ganz schlechte Voraussetzungen, um einen Tag nun auch noch ohne Frühstück zu beginnen.
»Immerhin fand ich es nett, daß sie uns zum Schluß den Friesengeist ausgegeben haben. Oder wie hieß das Zeug?«
»Ich glaube, es hieß so. Und es war nicht ein einziger Tropfen übergeschwappt.«
»Hat ja auch die Chefin persönlich an den Tisch gebracht.«
»Du, mein Essen war tadellos«, sagte Marie Maas. »Einfach phantastisch.«
Tomkin knurrte Unverständliches.
»Kreske Lieuwering kann wirklich kochen. Und dazu so ein großes Restaurant auf die Beine stellen, dabei ist sie noch keine Dreißig.«
Brummen.
»Fandest du sie nicht sympathisch? Mal abgesehen von deinem knurrenden Magen?«
»Ich war viel zu betrunken, um sie überhaupt noch wahrzunehmen. Drei Warsteiner und ein Friesengeist auf nüchternen Magen.«
»Das ist ja auch ein Alptraum, wenn einem die Kellnerin abhaut. Direkt zu Ostern.«
»Welche Kellnerin?«
»Na die, die nicht da war.«
»Da habe ich wohl etwas verpaßt. Da war doch eine Kellnerin ...«
»Die war neu. Das hat sie doch erzählt, ihre Hauptkellnerin ist einfach nicht aufgetaucht gestern abend.«
»Okay. Wie war das jetzt mit dem Frühstück?«
Marie Maas dachte einen Augenblick lang über ihre eigenen Worte nach. Eine davongelaufene Kellnerin. Was da wohl passiert war? Ob sie woanders einen besseren Job gefunden hatte? Ob sie sich mit der resoluten Kreske Lieuwering angelegt hatte? Oder ob sie einfach lebensmüde war oder einen Frühjahrskoller bekommen hatte und davongelaufen war? Ein Inselflüchtling. Eine Insel war einfach immer gut für ein Abenteuer.
Jedenfalls würden sie der freundlichen Einladung der Wirtin folgen und heute abend den reservierten Tisch, an dem sie höchstpersönlich bedienen wollte, in Anspruch nehmen. Tomkin würde zur Entschädigung zwei Krabbensuppen bekommen und sie ... zwei Knoblauchbrote ...«
»Übrigens.« Marie Maas blieb auf dem Bettvorleger stehen und überlegte, wo sie ihre Kleider am vergangenen Abend abgelegt haben mochte. Sie waren nicht zu finden. »Mir fällt gerade ein, Darling, wir haben ja ein Zimmer mit Frühstück!«
4
Fanny Ley trug die rotgefärbten Haare meistens offen. Sie waren dick wie Pferdehaare, elastisch und naturgewellt. Auch ungefärbt, schlicht dunkelblond, waren sie noch gut anzusehen gewesen. Ansonsten war Fanny keine Schönheit, und mit den Jahren wurde sie, wie die meisten Menschen, auch nicht schöner. Dafür hatte sie fast immer unwiderstehlich gute Laune. Das war wahrscheinlich der Grund, warum Magnus Pleß sie eingestellt hatte und vor allem, warum sie es schon so lange miteinander aushielten. Fanny kam jeden Morgen, außer sonntags, und räumte dem Maler die Wohnung auf. Sie machte sein Bett, wusch das Geschirr und die Gläser vom Vortag ab, setzte ihm ein Mittagessen auf, für das er selbst bei Brodersen die Zutaten einkaufte, und erledigte jeden Dienstag und Freitag seine Wäsche. Sie nahm sie mit zu sich nach Hause, denn Magnus hatte keine Waschmaschine. Manchmal wusch sie auch noch die Wäsche ihrer Schwägerin Carmen, die im Nachbarhaus mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebte. Sie war ein paar Jahre jünger als Fanny, aber zwei Jahre älter als Sönke, ihr Bruder. Ihre Kinder Malke und Klaus-Erland waren elf und neun, und Gerdine-Sonja war etwa im gleichen Alter wie Fannys kleine Sina, die gerade sieben geworden war. Da Fanny sowieso zu Hause sein mußte, versorgte sie auch Carmens Kinder, wenn sie als Kellnerin im »Pferdestall« arbeiten ging und Sönke sich mal wieder nicht sehen ließ.
Heute trug Fanny ihr Haar zu einem dicken Zopf geflochten. Magnus Pleß fiel es gleich auf, als er vom Einkaufen nach Hause kam. Er konnte diese Art Zöpfe nicht leiden. Sie erinnerten ihn an seine Mutter. Abends, wenn sie ins Bett ging, hatte sie immer ihren Haarknoten aufgemacht und einen langen Zopf herabgelassen, den er für alle Zeiten mit Verboten und Maßregelungen verband. Auch war ihm seine gestrenge Mutter in diesem Zustand immer lächerlich erschienen, irgendwie verletzlich. Und Kinder mögen es nicht, wenn die Macht sich bloß und lächerlich zeigt.
»Moin, Magnus«, sagte Fanny, und ihre Stimme klang belegt.
Magnus ließ den Gruß unerwidert und setzte sich wortlos an den gedeckten Frühstückstisch. Fanny hatte Kaffee gekocht, ein weiches gekochtes Ei, Schinken und Konfitüre auf den Tisch gestellt. Aber statt zu verschwinden und sich dem Haushalt zu widmen, stand sie weiter am Küchentisch herum und zupfte an ihrer Kittelschürze.
»Du hast ja so viele Brötchen mitgebracht heute. Hast du so großen Hunger?«
Magnus grunzte unwirsch und schlug seine Zeitung auf. Was ging es die Leute verdammt noch mal an, wie viele Brötchen er aß? War er denn im Zuchthaus? Konnte er sich nicht so viele Brötchen kaufen, wie es ihm in den Kram paßte? Sie sollte bloß verschwinden, mit ihrem Zopf. Er blätterte laut und heftig im Inselboten und griff dann nach den Brötchen, um sie aufzuschneiden.
Plötzlich fing Fanny an zu weinen. Sie drückte beide Fäuste ins Gesicht und hatte den Mund zu einer breiten, geschwungenen Linie verzogen, durch die sie geräuschvoll Luft einsog. Sie schluchzte aus vollem Herzen.
»Was in Herrgotts Namen ist denn los?« brüllte Magnus Pleß und hieb mit der Faust in die Zeitung, die sich nicht richtig entfalten lassen wollte. »Kann man hier nicht mal in Ruhe frühstücken? Was ist denn in dich gefahren, Fanny?
Fanny jaulte wie ein getretener Hund, biß sich dann in den Handballen und schluchzte stumm weiter.
»Carmen«, stammelte sie. »Carmen ist verschwunden.«
Magnus Pleß erstarrte mitsamt seiner Faust im Zeitungsknäuel, beide Arme ausgestreckt, als wolle er sich alle Probleme vom Leib halten. Wenn er es doch nur könnte! Wenn er sich doch nie auf die ganze Sache eingelassen hätte!
»Red vernünftig, Fanny. Was ist mit Carmen? Hat sie sich verspätet?«
»Was sollte sie sich denn verspäten! Wo denn? Bei was denn? Sie ist nicht nach Hause gekommen gestern abend. Die ganze Nacht nicht. Sie ist auch nicht zur Arbeit erschienen. Kreske hat angerufen, bei Sönke, später bei mir. Was meinst du, wie fuchsteufelswild die war! Mitten im Ostergeschäft! Und niemand weiß, wo sie ist!«
Wieder Schluchzen, wieder Tränen. Magnus wand sich innerlich wie ein Wurm, wenn man ihm das auch nicht ansah, hinter seinem dicken Fell, unter seinem langen Bart und der struppigen, grauen Künstlermähne. Er hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst und wurde noch einmal an seine Jugendtage erinnert, als er sich unter der Schelte von Mutter und Vater immer nach Paris gewünscht hatte, in ein wüstes Bohemeleben, weit fort von den Zwängen und Pflichten ihres kleinbürgerlichen, kleinstädtischen Kaufmannsdaseins. Und wo war er gelandet? An einem Föhrer Küchentisch, mit einer flennenden Zugehfrau, inmitten einer Inselgesellschaft, in der jeder Nachbar zum Verwandten wurde, in der jeder alles wußte und alles weitertratschte, schlimmer, als die spießigste Bürgerexistenz in irgendeiner Kleinstadt ihn hätte treffen können. Und was das Schlimmste war, er liebte dieses Leben, diese Insel und diese verdammten Nachbarn-Verwandten. Nur heute, heute könnte er sie alle ins Watt schicken bei auflaufend Wasser. Heute könnte er gut eine Insel für sich allein brauchen.
»Sie hat sich bestimmt was angetan«, stöhnte Fanny und holte ein Taschentuch aus ihrer Schürze.
»Unsinn«, sagte Magnus so bestimmt, daß Fanny zusammenzuckte. »Vielleicht ist sie aufs Festland gefahren. Sie hat doch da ihre Dings, ihre Verwandten.«
»Ohne mir etwas davon zu erzählen?«
Fanny und Carmen standen wie Schwestern zueinander, und die Vorstellung, daß die eine aufs Festland fuhr, ohne die andere davon zu unterrichten, war abenteuerlich. Das mußte auch einem Ignoranten wie Magnus Pleß einleuchten. Wo doch die ganze Insel immer darüber unterrichtet war, wer gerade wann und weshalb aufs Festland fuhr und wann er oder sie zurückerwartet wurde. Auch wenn die Fahrt aufs Festland heute nicht mehr war als eine dreiviertelstündige Schiffsreise, nicht mehr Aufwand, als wenn ein Hamburger mit der S-Bahn von Wandsbek nach Blankenese fuhr. Eigentlich überhaupt kein Aufwand.
»Dann hatte sie vielleicht keine Lust zu arbeiten. Oder hat sich gestritten mit Kreske, wäre ja kein Wunder«, murmelte er in seinen Bart.
»Sie hat sich etwas angetan«, beharrte Fanny, und angesichts der Gefühlskälte ihres Dienstherrn setzte sie eine herzzerreißende Märtyrermiene auf und verließ mit Staubsauger und Wischeimer die Küche. Er würde ja sehen, wie schlimm das Schicksal mit ihr umsprang, wenn erst mal Carmen gefunden werden würde, vielmehr ihre Leiche ...
Noch vom Flur her hörte Magnus Pleß ihr Schluchzen und biß grimmig in sein krosses Brötchen.
5
Kriminalrat Johnson knallte den Hörer auf die Gabel und starrte auf sein Telefon wie auf einen soeben einer Straftat überführten Gewaltverbrecher. Er hatte noch einen alten, grauen Postapparat, den konnte man wenigstens ordentlich auf den Schreibtisch krachen lassen. Die neuen Dinger hielten das ja nicht mehr aus.