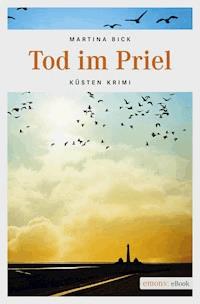3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marie Maas
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein Mordfall ohne Leiche? Kriminalkommissarin Marie Maas lässt sich nichts vormachen. „Die Tote am Kanal“ von Martina Bick – jetzt als eBook bei dotbooks. Es könnte alles so schön sein: Marie Maas hat gerade einen erholsamen Urlaub hinter. Entspannt kehrt sie nach Hamburg zurück, und schon gibt es einen Mord. Oder etwa doch nicht? Eine Journalistin behauptet, an einem Kanal eine tote Frau gefunden zu haben – doch als die Polizei dort eintrifft, ist diese verschwunden. Die Zeugin bleibt bei ihrer Aussage und Marie Maas beschließt, Nachforschungen anzustellen … aber wie macht man das in einem Mordfall, in dem es nicht einmal eine Leiche gibt? Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Die Tote am Kanal – Der dritte Fall für Marie Maas“ von Martina Bick. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es könnte alles so schön sein: Marie Maas hat gerade einen erholsamen Urlaub hinter. Entspannt kehrt sie nach Hamburg zurück, und schon gibt es einen Mord. Oder etwa doch nicht? Eine Journalistin behauptet, an einem Kanal eine tote Frau gefunden zu haben – doch als die Polizei dort eintrifft, ist diese verschwunden. Die Zeugin bleibt bei ihrer Aussage und Marie Maas beschließt, Nachforschungen anzustellen … aber wie macht man das in einem Mordfall, in dem es nicht einmal eine Leiche gibt?
Über die Autorin:
Martina Bick wurde 1956 in Bremen geboren. Sie studierte Historische Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Gender Studies in Münster und Hamburg. Nach mehreren Auslandsaufenthalten lebt sie heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater arbeitet. Martina Bick veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane, Romane und Kurzgeschichten und war auch als Herausgeberin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2001 war sie die offizielle Krimistadtschreiberin von Flensburg.
***
Neuausgabe August 2014
Copyright © der Originalausgabe 1996 Knaur
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel
Titelbildabbildung: © istockphoto; shutterstock; Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-636-9
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Marie Maas 3 an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
Martina Bick
Die Tote am Kanal
Der dritte Fall für Marie Maas
dotbooks.
1
Die Maschine landete nach ein paar kleinen Hopsern sicher auf dem harten Beton der Landepiste des Hamburger Flughafens. Mit einem ohrenbetäubenden Schnauben wurden die Turbinen abgebremst. Noch einmal tönte die beruhigende Stimme der Stewardeß aus den Bordlautsprechern.
»... möchten wir Sie bitten, angeschnallt zu bleiben und auf Ihren Plätzen zu warten, bis die Maschine ihren endgültigen Standort erreicht hat. Wir hoffen, Sie haben sich bei uns an Bord wohl gefühlt, und möchten uns ganz herzlich von Ihnen verabschieden.«
Aus den hinteren Reihen der Maschine kam lauer Beifall. Kriminalhauptkommissarin Marie Maas konnte sich nicht entschließen, ihre Zeitschrift aus der Hand zu legen und sich an diesem Dankeschön der Passagiere zu beteiligen. Aus bisher ungeklärten Gründen war sie in diesem Urlaub zu einer faulen und entsprechend unhöflichen Zeitgenossin geworden.
»Vielleicht liegt es an der Hitze«, sagte Tomkin; für ihn als echten englischen Gentleman war Höflichkeit geradezu ein Charakterzug. Leichthändig hob er Maries Koffer vom Förderband an der Gepäckausgabe, schnallte sich seine beiden schwarzen Reisetaschen kreuzweise über die Schultern und marschierte los in Richtung Ausgang.
»Das würde ja heißen, daß alle Griechen, überhaupt alle Südländer, ein faules und unhöfliches Pack wären. Das könnte ich weder ideologisch vertreten, noch entspricht es auch nur im geringsten der Realität. Denk nur mal, wie freundlich Marias ›Kalimera‹ immer klang. Es hat mir richtig das Herz gewärmt.«
»Freundlich. Nicht höflich.«
»Worauf willst du hinaus?«
Der Taxifahrer öffnete den Kofferraum und verstaute das Gepäck. Tomkin setzte sich auf den Beifahrersitz und drehte sich um zu Marie, wobei er sein großes, von einer Unmasse rotblonder Haare umrandetes Gesicht an die Kopfstütze seines Sitzes drückte.
»Bitte keine neue Ermittlung mehr, für diesmal, ja? Du hast zwei Wochen lang all deine kriminalistische Energie auf meine armselige Person konzentriert – laß uns noch einen letzten Tag Frieden halten, und dann bin ich wieder in London ...«
»... auf Nummer Sicher ...«
»... auf Nummer Sicher, genau. Ich habe nur andeuten wollen, daß du fleißiges deutsches Lieschen eventuell unter dem Einfluß der griechischen Sonne in einen gewissen Entspannungsprozeß geraten bist, der dir ungewohnt ist und als Faulheit erscheint. Außerdem hast du dich von antrainierten Konventionen befreit – du springst nicht mehr auf, wenn der Lehrer zur Tür hereinkommt. Und findest dich nun unhöflich, leidest unter Strafangst und stehst in der Ungewißheit der freien ...«
»Okay, okay! Es reicht.« Marie Maas hob beide Hände gegen den Vordersitz. »Roonstraße bitte«, sagte sie Richtung Fahrer und spürte einen Augenblick lang den Wunsch, direkt ins Präsidium zu fahren. Nicht aus Arbeitswut oder weil sie ein »fleißiges deutsches Lieschen« war, sondern weil sie in ihrem Büro das Recht hatte, die Tür hinter sich zuzumachen, ohne daß deswegen jemand beleidigt wäre oder diese Selbstschutzmaßnahme persönlich nehmen würde. Was für ein Glück, einen Beruf zu haben. Irgendeinen. Und sei es nur, um sich vor seinen Liebsten zu schützen. Damit sie einen nicht auffressen mit Haut und Haaren. Daß Tomkin den ganzen Urlaub, zwei komplette Wochen, damit verbracht hatte, das vierte Kapitel seines ersten Romans umzuarbeiten, umzuschreiben, neu zu schreiben, davon war jetzt natürlich keine Rede. Das war seine künstlerische Berufung, die ihn keine Sekunde ruhen ließ und die dazu führte, daß er solche bürgerlichen Dinge wie Urlaub und Feierabend einfach nicht kannte. Daß er wie ein stets hungriger Wolf Tag und Nacht durch die Welt schleichen mußte auf der Suche nach dem richtigen Wort, dem einzigen wahren Wort, diesem Satz, der aus einer einfachen Kette von Begriffen eine Aussage von jahrtausendeübergreifender Wahrheit machen würde, und ihn, den Schöpfer, die Mutter sozusagen, unsterblich.
Marie Maas seufzte und lehnte sich zurück in die dicken Polster des Mercedes, der sich langsam durch einen Stau auf der Fuhlsbütteler Straße schob.
»Ist dir warm? Soll ich die Lüftung anstellen?« fragte Tomkin besorgt.
Marie lächelte und schüttelte den Kopf.
»Wir sind in Hamburg, Tomkin. Es nieselt, und es sind etwa acht Grad Celsius. Wenn du ein bißchen die Heizung aufdrehst, tust du mir einen Gefallen.«
Am nächsten Morgen, nach einem ausgiebigen Frühstück, der Lektüre mehrerer Zeitungen und einem zweiten, gründlicheren Durchsehen der Post, brach Marie Maas auf zu einem kleinen Gang durchs Viertel. Sie kaufte Waschpulver in »ihrer« Drogerie und »ihren« Schinken bei »ihrem« Schlachter im Eppendorfer Weg. Sie genoß die ausführlichen Gespräche über unwesentliche Unterschiede in der Qualität der Waren und über das Wetter. Kein deutsches Wort würde jemals so freundlich und musikalisch – mehr als höflich, dachte sie trotzig – klingen wie Marias »Kalimera« auf Skopelos, aber dafür hatte die deutsche Sprache den Vorteil, daß die Kommissarin sie verstand. Und ausgeruht wie sie war, sah sie lange von der Brücke am Lehmweg aus in die trübe Brühe des Isebekkanals und philosophierte darüber, welche Bedeutung der Klang einer Sprache haben mochte in bezug auf das Verstehen ihres Sinngehalts. Abschließend kaufte sie noch Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Schafskäse beim türkischen Gemüsehändler, um für sich und Tomkin ein letztes griechisches Abschiedsessen zuzubereiten.
»Das Telefon hat zweimal geklingelt. Ich bin nicht rangegangen«, empfing Tomkin sie, ohne dabei von der Zeitschrift aufzublicken, die Marie aus dem Flugzeug mitgebracht hatte.
»Was liest du da? Den Artikel über diesen Industriedesigner?«
»Es war bisher immer so, daß du an unserem letzten Abend noch wegen irgend etwas ins Büro gerufen wirst. Dabei kann es überhaupt nichts so Wichtiges geben, daß es nicht bis morgen warten könnte. Du hast schließlich in Griechenland auch kein Telefon gehabt. Und Hamburg steht noch und ist nicht mit Leichen gepflastert.«
Die Kommissarin packte das Gemüse aus und drapierte es liebevoll in einen Korb. Rot, grün, weiß. Auf Skopelos wäre nun noch das Blau des Himmels dazugekommen. Keine Zwischentöne. Klare Formen. Geradlinige, tiefe Schatten. »Nur ein Grieche kann sich solche Formen einfallen lassen, findest du nicht?«
Sie hockte sich auf Tomkins Sessellehne und sah mit ihm gemeinsam in die Zeitschrift. Ein braungebranntes Gesicht mit Augen, so wach und leuchtend wie die eines kleinen Jungen, und trotz der kurzgeschnittenen grauen Haare ebenso jung aussehend, strahlte ihr auf einem der Fotos entgegen.
Alexander Wegener, Industriedesigner griechisch-deutscher Abstammung, lebt heute in Mailand und auf Syros, einer kleinen Insel in der nördlichen Ägäis. Daneben waren eine Espressomaschine, ein Fernseher und ein Kugelschreiber abgebildet, die er entworfen hatte. Der Fernseher, vielmehr seine Form, erinnerte die Kommissarin ganz ungemein an Griechenland. »Der weiß, wo es schön ist«, sagte sie und lehnte sich ein bißchen an Tomkins kräftige Schulter.
»Bitte, stell das Telefon leise, ja? Nur heute, nur bis morgen früh, nur einmal, ausnahmsweise.« Er ließ die Zeitschrift sinken und zog Marie Maas von der Lehne auf seine Knie. Sie machte sich sanft los und hätte hinterher schwören können, daß sie gerade aufstehen wollte, um seiner Bitte nachzukommen und den verdammten Apparat wirklich leise zu stellen. Aber wer glaubt einem schon hinterher die gute Absicht? Nicht mal so ein guter Freund wie Tomkin. Tatsache war jedenfalls, daß es genau in diesem Augenblick zu klingeln begann. Marie Maas sah an die Zimmerdecke und nahm nach einem abgrundtiefen Seufzer den Hörer auf.
2
Die Kommissarin blieb einen Augenblick im Wagen sitzen und wartete ab, bis Pinchas Zukerman den ersten Satz von Max Bruchs Violinkonzert beendet hatte. Ein paar Regentropfen liefen noch über die Windschutzscheibe, aber sie waren von den Birken und Akazien gefallen, unter denen sie ihren Wagen geparkt hatte; sie konnte ihren schwarzen Dienstregenschirm im Auto lassen. »Bachstraße«, stand in großen Lettern, Schwarz auf Weiß, auf dem Schild am Anleger auf dem Osterbekkanal. So ein Schild, wie es sonst nur auf Kleinstadtbahnhöfen zu finden ist, groß und deutlich, denn die Züge halten dort nur kurz, und es gibt keine Lautsprecherdurchsagen; man sitzt schön auf dem trockenen, wenn man die Station verpaßt hat. Aber hier fuhr kein Zug, lediglich ein Dampfer des Hamburger Verkehrsvereins, und auch das nur in der Sommersaison. »Bachstraße«, so hieß der Fall jetzt erst mal, mangels anderer Bezeichnung und, ja, mangels Leiche.
Marie Maas schlenderte ein Stück am Ufer entlang. Hier war ein kleiner Park angelegt worden, ein paar Bänke, die jetzt, zwischen zwei Regenschauern, leer waren. Unter der einen Bank waren ein paar leere Bierdosen zurückgeblieben, und vor dem Gebüsch, das einen winzigen Spielplatz abteilte, lag ein weißes Paket, das sehr nach einer zusammengepackten Windel aussah. Die Papierkörbe leer bis auf eine nasse, zerknüllte Bildzeitung. Auf der anderen Seite des Kanals, sieben oder acht Meter entfernt, ragte die rotbraune Ziegelwand der Kampnagelfabrik auf, Halle vier. Oder war es die Requisite? Vielleicht hatte von dort aus jemand etwas gesehen oder gehört? Sie würde jemanden hinschicken, der sich umhören sollte. Man konnte diesen kleinen Parkflecken hier sowohl von der Barmbeker Straße als auch von der Weidestraße aus einsehen und natürlich von der Osterbekstraße, die direkt am Kanal entlangführte. Und wenn man aus der Bachstraße kam, sah man sogar den Bootsanleger. Aber sie konnten unmöglich alle Anwohner befragen.
Ein rot-weiß-grüner VW-Bus mit DLRG-Aufdruck bog jetzt aus der Weidestraße in die Osterbekstraße ein und suchte einen Parkplatz. Die Taucher. Die würden durch ihre Aktivitäten vielleicht ein paar Zeugen anlocken. Marie Maas ging langsam an dem Wagen, aus dem zwei kräftige Männer ausstiegen, vorbei, ohne sich zu erkennen zu geben. Sie mußte erst einmal in die Osterbekstraße.
Die junge Frau war etwa einen Meter fünfundsiebzig groß, sehr schlank und drahtig und öffnete der Kommissarin mit einer Miene die Tür, aus der sie schleunigst ein Grinsen wegzuwischen versuchte. Ein spöttisches Zucken um die Mundwinkel blieb zurück. Ein Blitzen in den Augenwinkeln, das sie verbarg, indem sie permanent den Kopf hin und her drehte.
»Wollen Sie sich setzen? Oder stehen Sie lieber? Meine Erfahrungen mit der Polizei beschränken sich bisher aufs Fernsehen, wissen Sie.«
Sie wies auf eine hellbraune Ledergarnitur und dann aufs Fenster, dort befanden sich offenbar die Stehplätze.
Die Kommissarin, die sich beherrschen mußte, um nicht etwas verlegen an ihrem Trenchcoat herumzuzupfen, der sicherlich wieder vor dem Bauch beulte und über den Hüften zu viele Falten warf – das tat er immer, wenn er kritisch beäugt wurde –, zog es vor, sich erst mal ans Fenster zu begeben. Hier hatte sie eine Wand im Rücken, das hieß, von dort aus konnte niemand sie beobachten oder sich über sie amüsieren. Außerdem hatte sie von hier aus den Überblick über die Osterbekstraße und den Kanal, über den Tatort also – oder den Fundort, oder wie sollte man einen Ort nennen, an dem eine Leiche gesehen worden war? Nur ein einziges Mal gesehen, und zwar von dieser jungen Frau hier: »Frau Pop, das ist richtig, ja? Frau Theresa Pop.«
»Das ist richtig.«
Theresa Pop hatte sich auf die Couch gesetzt, die dem Fenster gegenüberstand. Breitbeinig, beide Ellbogen weit über die Rückenlehne gehängt und wieder mit diesem Gesichtsausdruck, als würde sie gleich platzen vor Lachen. Marie Maas merkte, wie ihre Verlegenheit sich langsam in Ärger verwandelte. Frau Pop hatte offenbar vor, ihr die Eröffnung zu überlassen. In Ordnung, sie sollte ihren Willen bekommen. Entschlossen verknotete die Kommissarin ihre Hände auf dem Rücken und begann einen Rundgang durch das Zimmer, das Kinn fest auf die Brust gedrückt und ohne die Gesten und die Mimik der jungen Frau weiter zu beachten.
»Sie sind dreißig Jahre alt, ledig, keine Kinderjournalistin, freie Journalistin, nicht wahr?« Sie drehte sich auf dem Absatz um und sah Theresa Pop an. Die hatte den Mund leicht geöffnet und lauschte dem Vortrag ihrer biographischen Daten wie ein Kind dem Weihnachtsmärchen.
»Ja.«
»Und Ihr Fachgebiet ist Grafik ...«
»Design. Ich arbeite für die Design Review. Ist das irgendwie wichtig, Frau Kommissarin? Ich meine: wichtig für die Aufklärung dieses mysteriösen Mordfalles?«
Nun gelang auch Marie Maas ein feines falsches Grinsen. Nur noch einen ganz kleinen Augenblick, und dann würde sie sich wieder völlig im Griff haben. Selten kam es vor, daß jemand allein mit Dreistigkeit sie so aus der Fassung brachte. Sie langte in ihre Handtasche und zog einen etwas zerfledderten Stenoblock heraus. Der Bleistift fand sich ganz unten in der Tasche zwischen Tabakkrümeln und einem verklebten Bonbonpapier.
»Erzählen Sie mir doch noch einmal der Reihe nach, was Sie gestern morgen gesehen haben, Frau Pop. Ich wurde gestern, an meinem letzten Urlaubstag, gegen vierzehn Uhr darüber unterrichtet, daß hier am Osterbekkanal, auf dem Anleger ›Bachstraße‹, am Morgen eine Frauenleiche gefunden, vielmehr gesehen worden war, die jedoch gegen elf Uhr, als meine Kollegen hier eintrafen, bereits verschwunden war. Die Spurensicherung fand nur eine dunkelblaue Sandale der Firma Birkenstock, Größe vierzig.« Die Kommissarin hatte sich gegenüber Frau Pop auf einem sehr stabil aussehenden Hocker niedergelassen, der sich nun, als sie darauf saß, als ein mit vielen Schichten Papier beklebtes Holzgestell entpuppte. Hoffentlich hielt das Ding. Sie war nicht bereit, ihre mühsam wiedererlangte Selbstsicherheit wegen eines in die Brüche gehenden Papierhockers, eines Designerscherzes, erneut zu opfern. Sie hob ihren Blick einen Zentimeter über den Notizblock hin zu Theresa Pops Füßen. Größe vierzig, das könnte hinkommen. Aber eine Quadratlatsche von Birkenstock an diesem schmalen Fuß? Unvorstellbar. Dieser Fuß hier würde sich verloren vorkommen in einem solchen Gesundheitsschuh. Theresa Pop legte den Gegenstand der Betrachtung auf das rechte Knie und den Kopf ganz in den Nacken und schloß die Augen
»Ich bin wie gewohnt gegen halb acht aufgestanden, habe mich angezogen und war gegen zehn vor acht Uhr unten zum Joggen. Manchmal fahre ich rüber in den Stadtpark, aber gestern hatte ich dazu keine Lust.« Sie machte die Augen auf, einen Spalt weit jedenfalls, so daß sie die Kommissarin kurz mustern konnte. »Gestern hatte ich keine Zeit dazu, wollte ich sagen.« Sie räusperte sich und faltete plötzlich mit einer blitzschnellen, gewandten Bewegung ihre sämtlichen langen Gliedmaßen wieder zusammen und saß sehr züchtig, sehr aufrecht ihrer Gesprächspartnerin gegenüber. Ihre Stimme erinnerte jetzt leicht an den Tonfall eines etwa zehn Jahre alten Mädchens. »Ich lief und lief, und was soll ich Ihnen berichten? Da lag sie plötzlich. Die Leiche.«
»So«, sagte die Kommissarin nach einer Pause, in der sie mit zusammengebissenen Zähnen bis zehn gezählt hatte, um nicht vorzeitig zu explodieren. »Da lag die Leiche und trug blaue Sandalen.«
Theresa Pop zögerte kurz und kicherte dann.
»So muß es wohl gewesen sein.«
Marie Maas gelang es, dank ihrer zwanzigjährigen Berufserfahrung, jetzt ganz cool aufzustehen, wieder einen kleinen Gang durch das große, helle Zimmer zu absolvieren, dann ganz dicht vor der in Kleinmädchenpose erstarrten Theresa Pop stehenzubleiben und erstaunlich ruhig zu sprechen.
»Frau Pop, ich bin vom Gesetz her verpflichtet, jedem angezeigten Kapitalverbrechen nachzugehen und dafür zu sorgen, daß die Täter gefaßt werden und nicht weiteres Unheil anrichten können. In diesem Fall, in Ihrem Falle möchte ich mal sagen, gehe ich sehr stark davon aus, daß Sie –aus welchen Gründen auch immer – mit meiner Funktion und Aufgabe einen Scherz treiben wollen. Vielleicht wollen Sie sich nur wichtig machen – das ist Ihnen gelungen. Die Presse war gestern hier, Sie haben Ihre Publicity gehabt. Ist es jetzt genug? Wollen wir das Spielchen nicht beenden? Meine Zeit ist kostbar und recht teuer für den Steuerzahler. Wissen Sie, was so ein Tauchereinsatz da draußen pro Stunde kostet?«
Theresa Pop starrte ein Weilchen auf ihre brav im Schoß zusammengelegten Hände und stand dann langsam auf. Sie war eine Schönheit, so wie sie sich bewegte. Ihr ungleichmäßiges, kantiges Gesicht konnte einen Augenblick lang überwältigend sein durch die Kraft und Energie, die diese Frau durchströmten. Schönheit von der Art, wie Tiere schön sein können. Pferde. Ja, daran erinnerte diese Frau Marie Maas: an ein wildes, ungebändigtes Fohlen.
Theresa Pop stellte sich an den Kaminsims – es gab nur diesen Sims und keinen Kamin darunter, wohl aber die Andeutung eines Schornsteins darüber, ein einfacher weißer Absatz in der Wand –, legte eine Hand auf die Steine und ließ das Schulterblatt unter ihrem Seidenhemd spielen. »Und wenn ich nun Angst habe, Frau Kommissarin?«
»Wir können uns über die Folgen verständigen.«
»Nein, nein, Sie verstehen mich falsch.«
Sie drehte sich um und sah der Kommissarin direkt in die Augen. Zum ersten Mal.
»Ich habe Angst vor einem Mann.«
»Große Scheiße«, sagte Marie Maas und hängte ihren Mantel am Kragen auf den Garderobenhaken. Der Aufhänger war schon vor dem Urlaub abgerissen. Schon vor dem Sommer. Sie wurde allmählich genauso schlampig wie ihre Kollegen. Nur daß die alle eine Ehefrau zu Hause hatten, die sich damit abmühte, einen guten Eindruck zu machen. Na, so ganz stimmte dieses Klischee auch nicht mehr. Tatsächlich waren die meisten Kollegen inzwischen geschieden oder gleich Junggesellen geblieben, jedenfalls die auf ihrer Dienstgradebene. »Ganz große Scheiße, Karsten. Ich wünschte, ich wäre in Griechenland geblieben. Oder hätte zumindest das Flugzeug verpaßt. Eine Woche länger Oliven und Retsina und die Sonne, nichts als Sonne.«
»Ich fürchte, dann würdest du jetzt auf einem griechischen Flughafen rumsitzen und dich ganz schön ärgern, Chefin. Na ja.« Er gähnte und füllte mit ein paar verlegenen Gesten seines übermäßig langen Körpers den engen Büroraum aus. Wie rührend, Karsten Scholz freute sich offenbar, daß sie wieder da war.
»Na ja was?«
»Na, schön daß du wieder da bist. Nicht nur wegen der ›Bachstraße‹, aber deswegen auch.«
»Was hältst du von der Angelegenheit?«
Karsten verzog sein hageres, langes Gesicht zu einer ganz verzweifelten Grimasse.
»Ehrlich gesagt: gar nichts.«
»Hab' ich auch erst gedacht.«
»Hm.«
»Hat das Labor schon was ausgespuckt?«
»Wozu denn? Keine Spuren, nichts. Nicht mal ein Haar auf der Wiese. Keine Blutspuren, nirgends, keine Schleifspuren. Die Tote muß quasi von allein ins Wasser gerollt sein.«
»Vielleicht ist sie gar nicht im Wasser gelandet.«
»Klar. Vielleicht kam gerade ein Alsterdampfer und hat sie mitgenommen. Gibt es da nicht eine direkte Verbindung zum Ohlsdorfer Friedhof?«
Marie Maas grinste und packte ihren Stenoblock aus. Den Bleistift ließ sie angesichts des beklagenswerten Zustands ihres Taschenbodens lieber, wo er war, und griff statt dessen nach einem versteckten Kugelschreiber in der Schreibtischschublade. Oberirdisch herrschte im Präsidium der gleiche Griffelklau wie in jedem anderen, Büro. Man mußte alles verstecken.
»Sie könnte zum Beispiel von einem Auto abtransportiert worden sein.«
»Am hellichten Tag! Am Mittwoch morgen zwischen halb neun und half elf! Na klar. Schließlich hat sie ja auch außer dieser Dame Pop niemand gesehen. Die Barmbeker haben ja alle Tomaten auf den Augen. Wenn du meine Meinung wissen willst: Die Lady hat gesponnen. Ganz große Spinnerin, schon von Berufs wegen. Meine Meinung.«
Er drehte seine gespreizten Hände gegen Maries Schreibtischfront und erhob sich abrupt wieder von dem Stuhl, auf dem er sich gerade zusammengefaltet hatte. Offenbar hatte Theresa Pop nicht nur Marie Maas auf die Palme gebracht. »Ich verstehe dich vollkommen, Karsten. Aber jetzt hör dir mal das an. Hat die junge Frau ihrer Aussage von gestern hinzugefügt. Es sollte auch erst mal unter uns bleiben. Theresa Pop hatte gestern nacht Herrenbesuch. Man ist im Streit auseinandergegangen. Der Mann – ich sage dir gleich mehr über ihn – hat im Hausflur laut gerufen: ›Ich dreh' dir den Hals um‹, ehe er abgehauen ist. Dafür gibt es eine Zeugin, eine Nachbarin aus dem vierten Stock. Die hat diesen Satz zwei Etagen höher noch gehört.«
»Wann war das?«
»Gegen Morgen. Es war noch dunkel. Sechs Uhr etwa.«
»Und wer ist der Mann?«
»Das ist das Problem. Er ist ziemlich bekannt, ein Kollege von ihr. Ein Designer. Hat gerade einen Preis bekommen. Sie hat ein Interview mit ihm gemacht, hinterher sind sie was trinken gegangen, man gefiel sich, kam sich näher und so weiter, sie hat ihn noch zu einem Kaffee mit nach Hause genommen, und dann wurde er plötzlich zudringlich. Jähzornig. Hat sie bedroht. Sie war jedenfalls froh, als er endlich verschwand, und hat sich noch einen Augenblick schlafen gelegt. Dann ist sie wie gewohnt um halb acht Uhr aufgestanden und joggen gegangen. Und da lag dann die Tote auf dem Anleger. Und das – man kann es Frau Pop nicht ganz verübeln – hat ihr Angst eingejagt. Besonders angesichts der Tatsache, daß der toten Frau auf dem Anleger im wahrsten Sinne des Wortes der Hals umgedreht worden war. Als sie das sah, mußte sie an die nächtliche Szene und die Drohung denken und ist in Panik davongerannt. Erst eine Stunde später war sie fähig, zum Telefon zu greifen und die Polizei zu rufen.«
Karsten Scholz zuckte die Achseln. Er hatte, gleich als er Theresa Pop kennengelernt hatte, beschlossen, von diesem Fall möglichst die Finger zu lassen. Er konnte damit nichts anfangen, weder mit dieser durchgestylten, extravaganten Frau noch mit einer wie auch immer gearteten verschwundenen Toten, und Barmbek als Stadtteil konnte er sowieso nicht leiden. Sollte doch Susanne Bollmann der Chefin Beistand leisten, die wohnte ja da in der Nähe und konnte sich eher in diese ungenießbare Mischung von Yuppietum und biederer Arbeiterromantik hineinversetzen, die dem Fall Bachstraße anzuhängen schien.
»Zudringlicher, abgewiesener Liebhaber, der inkognito bleiben muß, weil er berühmt ist, na Mahlzeit«, brummte Karsten.
»Wer hat denn was von inkognito gesagt? Sein Name ist Roland Schapp. Du schüttelst den Kopf? Sagt dir der Name nichts?«
»Ich kann nichts damit anfangen, Marie. Ehrlich nicht.«
»Na gut. Aber ich bin neugierig, und du kannst dich in der Zwischenzeit ja selber beschäftigen.«
3
Es war schon dunkel, als Marie Maas nach Hause kam, und statt das Flurlicht anzuknipsen, ging sie direkt in ihr Wohnzimmer und hinüber zur Stehlampe. Ihre Augen waren zu müde für helles Deckenlicht. Einen Augenblick lang hielt sie den eckigen, kleinen Plastikschalter fest und tastete ihn mit den Fingerspitzen ab. Weiß, dachte sie und wunderte sich, daß das schon alles war, was ihr einfiel. Weiß und spitze Ecken. Ja, sie gehörte auch zu den Menschen ohne Geschmack und Formempfinden. Auf dem Fußboden zwischen Lampenfuß und Sessel stand das Telefon. Grün. Warum? Sie hatte einfach »grün« eingetragen in dem Antragsformular, ohne lange zu überlegen. Warum hatte sie inzwischen kein neues Telefon bestellt, kein formschöneres? Es gab doch hübschere als diese alten, bei denen der Hörer quer über der Wählscheibe lag wie ein Puppenarm. Sie wählte immer nur danach aus, ob etwas sie an etwas anderes, Vertrautes erinnerte. Oh, Himmel, sie war offenbar ein zutiefst konservativer Mensch.
Mit einem leisen Zischlaut ließ sie die Luft aus den Lungen und plumpste in einen Sessel, ohne Mantel und Schuhe auszuziehen. Der Tisch, die Vorhänge, das Bücherregal, der Glasschrank, der Teppichboden – alles war von Menschenhand geformt. Nichts hier um sie herum war gewachsen. Die Straße, die Stadt, das ganze Land, ganz Alteuropa war durchgestaltet von Menschenhand – seit Jahrhunderten. Ein Baum, konnte man sagen, war noch ein Stückchen eigenwillige Natur. Aber selbst das stimmte nicht mehr ganz, die Bäume waren zurechtgestutzt und zurechtgezüchtet, und demnächst, mit dem Fortschreiten der Gentechnologie, würde es auch dafür keine zuverlässigen Kriterien mehr geben. Und sie, Kriminalhauptkommissarin Marie Maas, die sich durchaus für einen bewußt lebenden, auf eigene Ansichten und Einschätzungen bauenden Menschen hielt, hatte noch nie im Leben einen Gedanken an die Form verschwendet. An die Form der Dinge um sie herum, an ihre Gestaltung. Daß sie zwischen rund oder eckig entschied, war das höchste der Gefühle, oder zwischen zwei Farben, aber warum sie so und nicht anders entschied – keine Ahnung. Warum ihr etwas gefiel – einziger Anhaltspunkt: Es erinnerte sie an etwas Bekanntes. Wie schrecklich! Wie rückwärtsgewandt, wie statisch, genau das, was sie nie hatte werden wollen! Und warum war sie so geworden? Aus Dummheit, aus Hilflosigkeit, aus mangelnder Aufmerksamkeit?
Entschlossen stand sie auf und tappte in die Küche. Gelb und trüb war der Lichtkegel, den die Lampe auf den Küchentisch warf. Die Arbeitsflächen an der Längsseite blieben im Dunkeln. Die Neonröhre über der Spüle war schon lange defekt, sie flatterte wie ein sterbender Vogel und wurde nicht mehr benutzt, aber auch nicht ersetzt. Wie gewohnt im Halbdunkel, sich selbst im Licht stehend, hantierte die Kommissarin mit dem Wasserkessel. Er war so ziemlich das unpraktischste Gerät in ihrer Küche. Rot emailliert, mit einer ganz dünnen, hoch aufgerichteten Tülle, so daß der Deckel geradezu vom Kessel fallen mußte, wenn man die untere Hälfte des Wassers aus dem Kessel goß. Sofern man sich nicht schon vorher die Hand verbrüht oder die Geduld verloren hatte mit dem langsam rinnenden Wasserstrahl. Warum gab sie sich mit solchem Schund zufrieden? Lieferte sie bei ihrer Arbeit auch so lausige Ergebnisse ab? Und gaben sich die Untersuchungsrichter und vor allem die Beschuldigten und ihre Anwälte mit löchrigen Beweisketten und widersprüchlichen Zeugenaussagen zufrieden? Ärgerlich riß sie ein Streichholz an und hielt lange den Gasknopf fest, damit die Flamme anblieb. Gewohnheiten. Man gewöhnte sich an all diese unpraktischen, unfertigen, schlecht ausgedachten, schlecht gemachten Werkzeuge, die den Alltag erleichtern sollten. Eine Massengesellschaft: Für jeden einzelnen Menschen eine Küche, ein Gasherd, ein Wasserkessel, eine Teekanne, da kann nicht jeder das Feinste vom Feinen haben. Da muß man sich mit Serienerzeugnissen zufriedengeben, mit billigem, schlecht verarbeitetem, minderwertigem Material. Oder wieder zusammenrücken, um einen großen Tisch, mit einem großen, soliden, gut durchdachten Kupferkessel, der ein ganzes Menschenleben lang hielt.
Oh, Himmel. Marie Maas schlug die Hände vors Gesicht und lehnte sich müde gegen die Anrichte. Sie wagte nicht, zur Küchenuhr zu sehen, aus Angst vor dem nächsten Designschock. Sie wußte, daß diese weiße Plastikuhr, die sie vor ein paar Jahren ganz billig im Fotoladen Ecke Wrangelstraße gekauft hatte – ja, sie hatte sie gekauft, weil sie so billig war und weil sie gerade eine Uhr in der Küche haben wollte, um beim Frühstück mit einem Blick zu wissen, wie spät es war und ob sie das Feuilleton noch in Ruhe zu Ende lesen konnte oder nicht –, diese Uhr war sterbenshäßlich. Sie sah nicht hin. Sie schlich aus der Küche, zog im Flur nicht nur den Mantel und die Schuhe aus, sondern auch alles übrige, tapste nackend ins Bad und wickelte sich, ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen, in ihren alten, formlosen Bademantel und ging zurück ins Wohnzimmer und an die Stereoanlage. Was hatte sie heute morgen im Autoradio gehört? Max Bruch, Violinkonzert. Sie fand die Platte, wenn auch nicht mit Pinchas Zukerman als Solist. Entspannt ruhte ihr Blick auf den schwarzen Flächen und Feldern des Hi-Fi-Turms. Keine drei Monate alt. Ein Markenartikel. Neues Design. Hatte viel Geld gekostet. Aber mal mußte man sich was richtig Gutes gönnen. Es sich was kosten lassen. Offenbar waren ihr ihre Ohren und Hörerlebnisse mehr wert als die anderen Sinnesorgane und deren Bedürfnisse. Den Schmutz und Schund, die Häßlichkeit, die sie ihren Augen zumutete, würden ihre Ohren nie dulden. Gut so.
»Die meisten Menschen haben überhaupt keinen Geschmack«, hatte Theresa Pop gesagt. »Man denkt, sie hätten einen schlechten Geschmack, aber das ist nicht richtig. Sie haben gar keinen Geschmack. Sie kaufen einfach, worüber sie gerade stolpern, was ihnen die Verkäufer empfehlen, was die Nachbarn auch haben oder was die Werbung ihnen präsentiert.«
»Aber es muß doch schrecklich sein für einen Designer, für solche Menschen zu arbeiten. Das heißt doch, in den leeren Raum hinein zu arbeiten.«
»Na und? Sie sind vielleicht romantisch. Wird man so bei der Polizei?«
Marie Maas hatte erstaunt geschwiegen. Das hatte sie sich noch nie gefragt.
Theresa Pop war in der Küche verschwunden, die sich mit einem offenen Durchgang ans Wohnzimmer anschloß, und mit einem hellbraunen Umschlag in der Hand zurückgekommen.