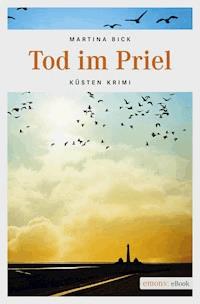3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marie Maas
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ihr neuer Fall führt Kriminalkommissarin Marie Maas bis nach Mexiko-City: „Totenreise“ von Martina Bick – jetzt als eBook bei dotbooks. Als im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel bei Baggerarbeiten das Skelett eines Unbekannten gefunden wird, ist Kriminalkommissarin Marie Maas sofort zur Stelle. Wer war dieser Mann? Hatte er einen tragischen Unfall – oder ist er das Opfer eines Verbrechens geworden? Marie findet eine Spur, die nach Mexiko-City führt, wo die Nichte des Verstorbenen ein Leben in Saus und Braus führt. Und so muss Marie sich auf eine lange Reise machen – nicht ahnend, dass diese vielleicht ihre letzte sein könnte … Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Totenreise“ – Der siebte Fall für Marie Maas“ von Martina Bick. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel bei Baggerarbeiten das Skelett eines Unbekannten gefunden wird, ist Kriminalkommissarin Marie Maas sofort zur Stelle. Wer war dieser Mann? Hatte er einen tragischen Unfall – oder ist er das Opfer eines Verbrechens geworden? Marie findet eine Spur, die nach Mexiko-City führt, wo die Nichte des Verstorbenen ein Leben in Saus und Braus führt. Und so muss Marie sich auf eine lange Reise machen – nicht ahnend, dass diese vielleicht ihre letzte sein könnte …
Über die Autorin:
Martina Bick wurde 1956 in Bremen geboren. Sie studierte Historische Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Gender Studies in Münster und Hamburg. Nach mehreren Auslandsaufenthalten lebt sie heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater arbeitet. Martina Bick veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane, Romane und Kurzgeschichten und war auch als Herausgeberin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2001 war sie die offizielle Krimistadtschreiberin von Flensburg.
Die Krimi-Reihe rund um Hauptkommissarin Marie Maas umfasst folgende Bände : Der Tote und das Mädchen. Der erste Fall für Marie MaasTod auf der Werft. Der zweite Fall für Marie MaasDie Tote am Kanal. Der dritte Fall für Marie MaasTödliche Prozession. Der vierte Fall für Marie MaasNordseegrab. Der fünfte Fall für Marie Maas
Tote Puppen lügen nicht. Der sechste Fall für Marie MaasTotenreise. Der siebte Fall für Marie Maas
Heute schön, morgen tot. Der achte Fall für Marie Maas
***
Neuausgabe Oktober 2014
Dieses Buch erschien bereits 2001 unter dem Titel Blutsbande bei Argument Verlag
Copyright © der Originalausgabe 2001 Argument Verlag, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: © Thinkstock; Maria Seidel
ISBN 978-3-95520-793-9
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Totenreise an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Martina Bick
Totenreise
Der siebte Fall für Marie Maas
dotbooks.
Prolog – Oktober 1962
Aus Gründen, die ganz allein in meiner Person liegen, teile ich Ihnen heute mit, dass die Firma Mahlmann, Drogeriewaren, ab Ultimo des laufenden Monats liquidiert und die Geschäfte in Hamburg eingestellt werden. Ich danke Ihnen allen für Ihre wertvolle Arbeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.
August Mahlmann, Mexiko City, den 22. Oktober 1962
»Dreiundzwanzig Jahre«, murmelte Hedwig Conrad und ließ das Telegramm vor sich auf den Schreibtisch sinken. »Und kein einziges persönliches Wort.«
Die Sekretärin stand auf und ging langsam durch die Verbindungstür, die immer offen stand, in das Zimmer des Chefs. Das großzügig bemessene Direktionsbüro im dritten Stock des Kontorhauses am Nikolaifleet lag im Dämmerlicht. Es war immer etwas stiller darin als in ihrem Büro, weil die Wände durch eine dunkle Palisanderholz-Verkleidung schallgedämmt waren. Über dem prächtigen Kamin, den sie in den dreiundzwanzig Jahren, die sie in dieser Firma arbeitete, nicht ein einziges Mal hatte brennen sehen, schimmerte matt ein großer goldgerahmter Spiegel. Rechts und links davon prangten die Porträts der Firmengründer: Friedrich Mahlmann mit seinem wilhelminisch geschwungenen Schnurrbart auf der einen Seite, Hans-Wilhelm, der Vater von August Mahlmann, dem jetzigen Besitzer, auf der anderen.
Hedwig zog die Vorhänge auf, die sie während der Abwesenheit des Chefs geschlossen hielt. Das Licht flutete in den Raum und ließ Staubpartikelchen tanzen. Schwere Teppiche schluckten ihre Schritte.
Sie strich über die Lehnen der ledernen Sitzgruppe, die bereit standen für kleine, höchst vertrauliche Konferenzrunden. Wie oft war sie dabei gewesen und hatte den Herren assistiert. Mit Herrn Mahlmann immer in Augenkontakt, für den Fall, dass er irgendetwas brauchte. Ehe er etwas anordnen konnte, war sie schon unterwegs, um es auszuführen.
Das hatte sie bei seinem Vater gelernt, dem alten Patriarchen. Bei ihm hatte man sich wie eine Prinzessin gefühlt, wenn man ein Diktat für ihn aufnehmen durfte. Er hatte es sie nie merken lassen, dass sie nur eine kleine Angestellte aus ganz einfachen Verhältnissen war. Ihr Vater war Arbeiter gewesen und hatte gewollt, dass sie es einmal besser hätte. Darum ließ er sie zur Schule gehen und einen Beruf lernen. Sie hatte in der Registratur des Drogeriewarenhandels angefangen, dann im Schreibbüro gelernt, schließlich im Sekretariat. Als August Mahlmann die Firma übernahm, machte er sie zu seiner Chefsekretärin. Er war genau ein Jahr älter als sie. Sie waren beide im Sternzeichen des Löwen geboren. Aber sie waren sich nicht nur ähnlich, sie waren seelenverwandt.
Hedwig ging zum Schreibtisch und blieb an »ihrer Seite« stehen. Sie war klein, knapp einen Meter sechzig groß und zierlich. Wenn sie die Fäuste ballte, konnte sie sie direkt auf der Schreibtischplatte aufsetzen. So hatte sie immer dagestanden, kerzengerade, den Blick fest auf das vertraute Gesicht des Chefs gerichtet. Seine Gedanken ablesend, ehe er sie ausgesprochen hatte, vielleicht ehe er sie zu Ende gedacht hatte. Nun fiel ihr Blick auf seinen leeren Sessel, die aufgeräumte Schreibtischplatte, die leere Vase für den immer frischen Blumenstrauß, für den sie sorgte, wenn er hier war, schließlich auf das Foto seiner Nichte Jutta und ihrer mexikanischen Mutter im schweren Silberrahmen. Jutta war darauf vier Jahre alt, ein bezauberndes Geschöpf mit ihrer milchkaffeebraunen Haut und den dichten dunklen Locken. Sie würde mal genauso eine Schönheit werden wie ihre Mutter. Wollte Herr Mahlmann etwa in Mexiko bleiben? Warum? Und warum löste er deswegen die ganze Firma in Hamburg auf?
Hedwig spürte Tränen aufsteigen und schluckte sie wütend hinunter. Sie schlug mit den Fingerknöcheln auf die Schreibtischplatte. Dahinter konnte nur sein Bruder Heinrich stecken, dieser Taugenichts.
Sie ging zurück in ihr Büro und legte das Telegramm in die große Postmappe für den ersten Prokuristen, der in der Abwesenheit vom Chef die Geschäfte führte. Sie sah sich um. Sie hatte hier nichts mehr zu tun. Sie räumte ein paar persönliche Gegenstände aus dem Schreibtisch und verstaute sie in ihrer Handtasche. Dann legte sie ihre Schlüssel auf den Schreibtisch, zog ihren Mantel über und warf die Tür hinter sich ins Schloss.
Kapitel 1 – Dezember 1999
Die Schaufeln des Baggers gruben sich wie riesige Krebsscheren in die Erde, schlossen sich, dann schwenkte der eiserne Arm des Baufahrzeugs im Radius von einhundertachtzig Grad um das Führerhaus, um seine braune, klebrig nasse Fracht auf den Anhänger neben der Straße hinabpoltern zu lassen. Von Zeit zu Zeit kam ein Lkw und karrte den Aushub davon.
Zwischen den Baubuden standen drei Männer. Einer trug grobe Manchesterhosen und eine Öljacke, die beiden anderen schützten sich mit langen Wollmänteln und Regenschirmen vor dem feuchten Wetter. Sie waren schon am frühen Morgen gekommen und beobachteten seitdem, die Fäuste in die Manteltaschen gestemmt, das Abtragen der Erdschichten.
»Jürgen, Hans-Dieter, das Essen steht auf dem Tisch!«
Großmutters Stimme tönte schwach durch das Gebrumm der Baumaschine, obwohl Jürgen das Fenster in seinem Zimmer im ersten Stock geschlossen hatte. Seine Finger tasteten nach dem Stück Knetgummi, das er schon seit heute Morgen in der Hosentasche hatte. Inzwischen war es ganz warm und weich geworden. Er hatte es irgendwo bei den Sachen seines Vaters für die Modellbahnanlage gefunden. Er war so nervös, dass er ständig im Zimmer hin und her wanderte, während seine innere Stimme Teile des großen Monologs wiederholte, den er gerade einstudierte.
»So macht Gewissen Feige aus uns allen;
der angebornen Farbe der Entschließung
wird des Gedankens Blässe angekränkelt.«
***
Freitag war es so weit.
Die Tage vor einem Vorsprechen vergingen immer schneller als die anderen. Sie rasten unaufhaltsam auf das schreckliche Ereignis zu. Lampenfieber. Das kannte er schon. So war es ihm auch auf der Schauspielschule gegangen. Beim Examen war es nicht anders gewesen. Vor Nervosität hätte er fast gekotzt, und dann hatte doch alles wie am Schnürchen geklappt. Lampenfieber war ein gutes Zeichen, meinten seine Lehrer. Nur ein nervöser Schauspieler ist ein guter Schauspieler. Nur wer Lampenfieber hat, ist in der Lage, auch die letzten Energien in sich zu mobilisieren. Wer cool bleibt, gibt nicht alles.
»Ich komme!«
Jürgen presste den Gummiklumpen so heftig zusammen, dass sich seine Fingernägel in die Handfläche bohrten. Er zog die Hand aus der Hosentasche und sprang wie ein Kung-Fu-Kämpfer in Abwehrposition, beide Fäuste geballt, den ganzen durchtrainierten Körper angespannt. Sollten sie doch alle kommen, er würde es ihnen schon zeigen!
Er riss mit Schwung die Gardine zurück, stieß das Fenster auf und brüllte etwas hinaus. Der Bagger war so laut, dass er seine eigene Stimme nicht verstehen konnte. Das Nachbargrundstück war eine einzige Schlammwüste. Wo der Schieber am Freitag seine Arbeit begonnen hatte, stand eine tiefe Pfütze. Die Mitte des über tausend Quadratmeter großen Grundstücks war aufgerissen wie eine Bauchwunde. Die hohe bunte Wiese, auf der er und die Nachbarskinder den größten Teil ihrer Kindheit verbracht hatten, war verschwunden.
Ernüchtert schloss er das Fenster und schlich leise, wie immer ohne Schuhe und Strümpfe, die Treppe hinunter, routiniert den Gleisen der Modellbahn ausweichend, die überall im Hause verlegt waren.
Der Alte war schon im Esszimmer und stand am Fenster hinter der Gardine. »Sie graben alles auf«, sagte er leise und schüttelte den Kopf. Seine Hand schwebte vor der Gardine, als wagte er nicht, sie zu berühren.
»Na und?« Jürgen flegelte sich auf seinen Platz an der Längsseite des Tisches. »Such nicht beständig mit gesenkten Wimpern nach deinem edlen Vater in dem Staub.«
»Willst du wohl still sein!« Hans-Dieter Ewerling drehte sich um. Seine Mundwinkel zuckten.
Jürgen sah ihn verächtlich an. Seitdem der Alte arbeitslos war, war mit ihm nichts mehr anzufangen. Als Ma starb und als er, Jürgen, ansagte, dass er auf die Schauspielschule gehen werde, das hatte er noch weggesteckt. Auch die Sache mit Opa. Aber als die Bundesbahn ihn vor die Tür setzte, war er abgedreht. Seitdem ließ er sich hängen. Lebte nur noch für seine dämliche Modellbahn. Stumpfsinnig. Peinlich. »Das war Hamlet, Papa. Erster Aufzug, zweite Szene.«
Oma Ewerling betrat das Esszimmer mit einer dampfenden Suppenterrine.
»Setz dich doch, Hans-Dieter. Worauf wartest du? Ich hoffe, die Bauarbeiter werden die christliche Mittagszeit einhalten, damit wir in Ruhe essen können. Otto lässt sich entschuldigen, er kann heute nicht zum Essen herunterkommen. Er fühlt sich nicht wohl«, fügte sie leise hinzu und sah nicht auf, während sie Suppe auf die Teller von Sohn und Enkelsohn füllte.
Die Männer fingen an zu löffeln. Ihre Blicke kreuzten sich einen Augenblick lang. Genau wie immer, alles war genau wie jeden Mittag.
Im gleichen Augenblick verstummte draußen das Gebrumm des Schaufelbaggers. Man hörte einen der Männer etwas rufen, dann fingen plötzlich alle an zu laufen.
Kapitel 2
»Hier, hör mal, Marie«, sagte Tomkin und schlug das Prospektheft so um, dass er es in einer Hand halten konnte, während er mit der anderen ausladende Gesten beschrieb. »Mexiko – Land der Kontraste. Grandiose Zeugnisse vergangener Hochkulturen, prächtige Kolonialstädte, lebendige Traditionen, Naturparadiese und traumhafte Karibikstrände. Erlebnis Mexiko City.«
»Zu weit weg«, murmelte Marie unter ihrem Handtuch. Sie inhalierte über einer Schüssel mit heißem Kamillentee, um einen aufkommenden Schnupfen zu bekämpfen. »Gibst du mir mal bitte die Papiertaschentücher? Sie liegen irgendwo auf dem Küchenschrank.«
»Dann fahren wir also über Weihnachten wieder an die Nordsee, wie jedes Jahr.« Tomkin schob ihr ein frisches Taschentuch unter das Handtuch. »Wie wäre es mal wieder mit Wyk auf Föhr? Kurz vor dem ersten Abendessen klingelt dein Handy, und du fährst mit der letzten Fähre zurück aufs Festland, rufst mich täglich einmal zwischen zwei Verhören an und kommst mit Glück zehn Minuten vor Silvester zurück, um so zu tun, als wäre absolut nichts gewesen.«
Marie schnaubte sich ausgiebig die Nase.
»In London hat es den ganzen Sommer über geregnet«, fuhr Tomkin fort. »Der Spätsommer war ein einziges Desaster, der Herbst zu kühl, nächste Woche ist Winteranfang, und es regnet schon wieder. Letzte Woche war ich krank, jetzt bist du dran. Wir müssen auch mal etwas für unsere Gesundheit tun, Marie, und ein bisschen Sonne tanken.«
»Dazu müssen wir doch nicht so weit weg fliegen. Südfrankreich würde vollkommen genügen.«
»Onyda hat uns aber eingeladen, und sie wohnt zur Zeit nun mal in Mexiko City. Ich weiß wirklich nicht, was du immer gegen meine Verwandten hast. – Was sagst du?«
»Ist mir zu heiß.«
»Im Hochland von Mexiko herrscht um diese Zeit feines Frühsommerwetter. Und in der Karibik liegt die Wassertemperatur ganzjährig zwischen 23 und 29 Grad. Auch nicht schlecht, finde ich.«
»Mir ist es zu heiß unter dem Handtuch«, wiederholte Marie und schob die Schüssel weg. Ihr Gesicht war rot geschwollen, die Augen glänzten fiebrig, ihre Haare hingen strähnig in die Stirn. »Außerdem will ich nicht nach Mexiko. Es reizt mich überhaupt nicht, stundenlang in einem engen Flugzeug zu hocken, um dann zu einer völlig verrückten Zeit in einem fremden Land mit Kakteen an allen Straßenecken und der höchsten Kriminalitätsrate der Welt anzukommen und meine kostbaren und dringend benötigten Urlaubstage zwischen Weihnachten und Neujahr mit einer Magen-Darm-Verstimmung auf der Toilette zu verbringen. O Gott, fühle ich mich elend. Mich hat es voll erwischt.«
»Vorurteile hast du keine, oder? Soll ich dir sagen, warum du nicht nach Mexiko willst? Weil dein verdammtes Büro dich dort nicht erreichen kann.«
»Das stimmt nicht. Du weißt selbst, wie sehr ich es hasse, ständig im Einsatz zu sein. Ich würde sofort mit dir an den Nordpol fahren, wenn es dort nicht so kalt wäre. Hauptsache, wir wären ungestört.«
»Gelogen«, sagte Tomkin und räumte Maries Handtuch und die Schüssel mit dem Kamillensud vom Küchentisch. Dann ging er ins Schlafzimmer, um seine Sachen zu packen. Das Taxi zum Flughafen war schon bestellt.
»Wie wär's, wenn du allein fährst?«, schlug Marie vor. »Dann könnte ich Weihnachten Bereitschaft machen und hätte Silvester frei. Wir könnten endlich mal den Jahreswechsel zusammen feiern. Wo du willst. Ohne Handy, ohne Telefon, ohne alles. Versprochen. Was hältst du davon?«
Keine Antwort. Marie stand auf und schlich ins Bad. Im Medizinschränkchen fand sie eine angebrochene Schachtel mit Halstabletten, jede Menge Aspirin und eine halb leere Flasche Echinazin. Sie sah vorsichtshalber nicht auf das Ablaufdatum und tropfte sich die stark alkoholisierten Kräutertropfen direkt in den Rachen. Als sie in den Flur zurückkam, stand Tomkin vor der Garderobe und kämpfte mit finsterer Miene mit dem Reißverschluss seines neuen Anoraks. Hatte sie ihm geschenkt. Wind- und wetterdicht. Für die Ferien an der Nordsee. Na ja. Seufzend ging sie auf ihn zu. Die Türglocke schellte heftig.
»Dein Taxi.«
»Du musst meine Familie ja nicht mögen«, sagte Tomkin und griff nach seiner Reisetasche. »Eine andere kann ich dir aber leider nicht bieten. Ich habe nur diese.«
Marie nahm ihm die Reisetasche wieder ab und legte ihre Arme um seinen Hals. Einen Augenblick lang drückte sie ihr fieberheißes Gesicht an den kühlen Stoff seiner Jacke. Warum mussten sie sich immer streiten, bevor sie sich trennten? Sie schien ernsthaft krank zu sein. Sie neigte zu Sentimentalitäten.
»Ich werde noch mal drüber schlafen, okay? Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, um uns zu entscheiden.«
Tomkins Gesicht blieb abweisend, eines seiner zwei Abreisegesichter. Das andere war traurig. Ihr war immer gerade das lieber, das er nicht zeigte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihm einen vorsichtigen Kuss aufs Kinn zu setzen. Er kam ihr nicht einen Millimeter entgegen. Wütend klappte sie die Kapuze ihres Bademantels hoch.
»Korinthenkacker.«
»Das habe ich nicht gehört«, bellte Tomkin.
»Ich habe es wahrscheinlich auch nicht so gemeint.«
Manche Leute lernten es eben auch in fünf Jahren Wochenendbeziehung nicht, sich wie erwachsene Menschen voneinander zu verabschieden.
Kapitel 3
Kollege Karsten Scholz wäre in der aufgeregten Menge auf der Baustelle kaum auszumachen gewesen, hätte er nicht aufgrund seiner außerordentlichen Körpergröße die Anwesenden um Haupteslänge überragt. Männer in Öljacken, zwei Herren in dunklen Anzügen, mehrere Gestalten in Jeans und Blazer, zwei ältere Herren in Wintermänteln – alles war vertreten. Und alle trugen die gleichen dreckverkrusteten Schuhe, weil sie kreuz und quer über den Acker liefen, immer um die große Baumaschine herum, die in der Mitte des Grundstücks vor einem Dreckhügel thronte, die offene Grabschaufel drohend erhoben wie ein kleiner gelber Elefant.
Marie wickelte sich in ihren Trenchcoat, denn der Wind pfiff schneidend über das flache Grundstück. Im Hintergrund erhob sich der S-Bahnwall, rechts und links waren einfache Landarbeiterhäuser hinter mehr oder weniger gepflegtem Gebüsch verborgen. Sie hatte das Gefühl, ungeschützt, halb nackt diesem spätherbstlichen Sturmwind ausgesetzt zu sein, der nur dazu dienen würde, ihr Fieber anzufachen wie eine schwelende Glut. Ihre Stirn war heiß, und beim Autofahren war ihr das Schalten und Lenken ungewöhnlich schwer und mühselig vorgekommen. Es gab zwei Sorten Arbeitnehmer, was das Verhalten bei Krankheit anging: Die einen nahmen eine eingeklemmte Augenwimper zum Anlass, um über Tage und Wochen krankzufeiern. Die anderen schleppten sich noch mit einer akuten Blinddarmentzündung kurz vor der OP ins Büro. Beide Varianten schienen ihr nicht sehr vernünftig zu sein. Aus unerfindlichen Gründen gehörte sie zur zweiten Kategorie. Außer Pflichtbewusstsein spielte da sicher noch etwas anderes eine Rolle. Die Angst, etwas zu verpassen, das Beste womöglich. Angst, loszulassen und in diesem Augenblick zu der Einsicht zu gelangen, wie müßig und sinnlos ihre Tätigkeit war. Angst, in einer kurzen Auszeit plötzlich zu begreifen, dass sie ihr Leben falsch lebte. Dass sie, einmal aus dem Trott entlassen, nie wieder hineinfinden würde. Na und? Was machte es aus? Warum sollte sie nicht einmal ein paar Jahre nicht arbeiten? Ihr Kontostand war gar nicht so übel, kam sie doch kaum dazu, ihr schwer verdientes Geld auszugeben. Außer, wenn Tomkin sie dazu anhielt.
Vorsichtig setzte sie einen Fuß auf die breite Raupenspur, die Gras und hohes Gestrüpp unter sich begraben hatte. Karsten löste sich kurz aus einer Gruppe von Männern, die unentwegt auf ihn einredeten, und machte ihr ein Zeichen für den Fall, dass sie ihn noch nicht ausgemacht hätte. Zweimal versank sie mit ihren Wildlederschnürschuhen im Matsch, dann erreichte sie die Männer, die eine Gasse für sie bildeten bis zu der Grube, in der Doktor Salz von der Gerichtsmedizin hockte. Sie trat vorsichtig bis zum Rand vor. Auf dem sandigen Grund, etwa einen Meter tief, lag ein menschliches Skelett, komplett bis auf den Schädel. Der war auf einer Plane neben der Grube drapiert. Nur der Unterkiefer fehlte.
Marie atmete mit offenem Mund, dann biss sie die Zähne zusammen. Ihr war ein bisschen schwindelig, das musste an der Erkältung liegen. Schließlich war sie keine Anfängerin.
Die Männer waren still geworden. Nur der trockene Husten eines der älteren Herren im Wollmantel war zu hören. Er räusperte sich und trat zusammen mit einem anderen Herrn im Mantel an Marie heran. »Mein Name ist Mannheim und dies ist Helmut Georgi, Doktor Helmut Georgi. Er ist, vielmehr er war Studienrat am hiesigen Albert-Schweitzer-Gymnasium für Altphilologie und Geschichte. Ich habe ebenfalls dort unterrichtet. Unser gemeinsames Hobby ist die Archäologie, und wir haben diese Baustelle deswegen im Auge behalten.«
Er räusperte sich und spreizte seine Hände, als würde er gerade ein neues Paar Handschuhe anprobieren und wollte sie auf ihre Elastizität hin testen. »Wenn ich Ihnen den Hergang kurz schildern darf ...«
»Später, bitte«, murmelte Marie und warf Karsten einen hilfesuchenden Blick zu. Der sah geschafft aus. Doktor Salz krabbelte aus der Grube.
»Männliche Leiche, auf den ersten Blick keine Einwirkung von Gewalt festzustellen, soweit diese sich im Skelett hätte dokumentieren können. Liegt schätzungsweise vier Jahre hier, Einzelheiten nach der Bodenanalyse. Aber nicht länger, denn es gibt noch Knorpel- und Sehnenreste.«
»Können Sie schon etwas über das Alter sagen?«
»Auf jeden Fall über sechzig. Leider keine Zähne mehr im Oberkiefer, den Unterkiefer haben wir noch nicht gefunden. Die Verknöcherung der Schädelnähte, die Knorpel von Rippen und Kehlkopf sprechen für ein reiferes Alter. Vermutlich können wir auch senile Osteoporose feststellen, warten Sie den Röntgenbefund ab, Kommissarin.«
»Und die Größe?«
Doktor Salz verzog das Gesicht. Er liebte keine Spekulationen.
»Eher klein. Unter einssiebzig«, antwortete er und ging wie ein Storch mit langen Schritten über das Grundstück zurück zu seinem Kombi-Bus, wo zwei seiner Mitarbeiter bereits die Vorbereitungen für den vorsichtigen Abtransport der Gebeine trafen.
***
»Wellingsbüttel wurde in den zwanziger Jahren von der ATAG, der Alstertal-Terrain-Aktien-Gesellschaft aufgesiedelt«, erklärte Doktor Georgi und klapperte mit dem Löffel heftig in seinem Teeglas. Er war so schwerhörig, dass der meiste Lärm der Außenwelt nicht mehr bis zu ihm vordrang. Sein Freund und Helfer, Herr Mannheim, hatte sich nach Hause zum Mittagessen empfohlen.
Georgi hatte ein kleines zartes Gesichtchen mit einer mehlweißen pergamentdünnen Haut. Er war sorgfältig rasiert und frisiert, soweit man die wenigen dunkelgrauen Strähnen auf dem von Altersflecken gezeichneten Haupt noch als Frisur bezeichnen konnte. Über sein Alter hatte er gleich Klarheit hergestellt: »Ich bin einundneunzig Jahre alt, liebe Frau Kommissarin. Das hätten Sie nicht gedacht, nicht wahr? Und mir können Sie nichts vormachen, ich kenne Wellingsbüttel wie meine Westentasche.«
Marie hatte gar nicht vorgehabt, ihm irgendetwas vorzumachen, aber sie war viel zu heiser, um sich zu verteidigen.
»Davon haben Sie natürlich keine Ahnung, liebe Frau, das können Sie auch gar nicht, denn Sie haben ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gelebt.« Er amüsierte sich.
Marie lächelte nachsichtig. Einem so ehrwürdigen Alter musste man natürlich eine Menge nachsehen. Georgi schien genau wie jüngere Leute Spaß daran zu haben, seine Grenzen auszutesten.
»Die ATAG hat das ganze Gelände von dem Hamburger Makler Johann Vincent Wentzel gekauft, der den Grundbesitz der großen Güter im Alstertal erschlossen hat. Doller Kerl, dieser Wentzel. Ihm haben wir übrigens auch die S-Bahn zu verdanken, die so genannte Alstertalbahn. Das war ein riesiger Fortschritt damals, das können Sie sich sicher vorstellen, nicht wahr? Schließlich gab es noch kaum Autos.«
Marie nickte brav.
»Dadurch konnte Wellingsbüttel sich vom Dorf zum Villenvorort von Hamburg entwickeln. Was redet der nur, denken Sie jetzt ...« Georgi nahm vorsichtig einen Schluck Tee. Seine Gelenke waren von Arthritis oder Rheuma geschwollen, und das schwere Glas zitterte in seiner Hand. »Wann kommt der Greis endlich auf den Punkt? Warten Sie ab. Der alte Georgi redet vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, aber darum vergisst er noch lange nicht den Kasus Knacktus.«
Der Kellner brachte eine dampfende Suppe für Marie und stellte dem alten Lehrer einen Malteser im geeisten Glas hin.
»Das Amt für Bo-den-denk-mal-pfle-ge«, Georgi sprach das Wort sorgfältig in Silben aus, als handle es sich um eine wichtige griechische oder lateinische Vokabel, »also, die sind zuständig, wenn in Hamburg ein Grundstück erschlossen und erstmalig bebaut wird. Die haben ordentlich was zu tun gekriegt, als die ATAG hier anfing zu bauen. Was glauben Sie, was wir hier alles ausgebuddelt haben: Urnenfelder, Ur-nen-fel-der haben wir gefunden. Hier gleich nebenan. Ich war dabei, als Walter Krohse das größte entdeckt hat, drüben am Alsterabhang. Und dann erst der Grabhügel am Knasterberg. Na, davon haben Sie doch sicher schon mal gehört?«
Marie schüttelte den Kopf und holte Atem, um den alten Herrn so langsam mal zu unterbrechen. Aber Georgi griff nach ihrem Handgelenk und umklammerte es mit eisernem Griff. Seine Augen leuchteten unter den dichten eisgrauen Büscheln der Augenbrauen. Wahrscheinlich hatte er schon lange keine Gelegenheit mehr gehabt, sein Wissen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also ließ sie ihm noch ein Weilchen die Freude.
»Ja, Mädchen, haben Sie sich denn noch nie mit Vor- und Frühgeschichte beschäftigt? Woher kommt der Mensch, was ist los hier in unserem schönen Heimatland? Wo wohnen wir, wo leben wir, wie haben unsere Vorfahren hier gelebt? Das fragt man sich doch, auch wenn man noch so jung und schön ist wie Sie.«
»Ich bin sechsundvierzig Jahre alt«, sagte Marie laut und deutlich. Das »Mädchen« konnte sie nun doch nicht auf sich sitzen lassen. Aber niemand schien ihnen zuzuhören. Die Kriminalbeamten am Nebentisch aßen ungerührt weiter. Karsten saß etwas abseits am Stammtisch vor einer Tasse Kaffee und schrieb an seinem Protokoll. Er musste schon arg im Stress sein, wenn er aufs Mittagessen verzichtete. Der Lärmpegel in dem Restaurant, das früher mal eine einfache deutsche Dorfkneipe gewesen war, war erheblich. Ein persischer Kellner flitzte zwischen den Tischen herum und verteilte griechische Grillteller, gab Cola, Bier und Kaffee aus. Die meisten Gäste waren wegen des Leichenfunds hier. Kripobeamte, Spurensicherung, Bauprüfamt. Dann der Bauingenieur und die Arbeiter von der Tiefbaufirma. Auch den Architekten hatte ihr irgendjemand vorgestellt. Der Laden brummte, obwohl die Mittagszeit schon lange vorbei war.
»Sag ich doch. Jung und schön«, fuhr Georgi ungerührt fort. »Jedenfalls bin ich der Ansicht, dass man wachsam bleiben sollte, auch wenn das Amt für Bodendenkmalpflege meint, in Wellingsbüttel wäre schon alles gefunden worden. Wenn ich höre, dass irgendwo ein Grundstück aufgerissen wird, dann bin ich da. Ich bin alt, ich störe niemanden, ich habe Zeit und keiner wartet mehr auf mich. Wenn die Bauarbeiter abziehen – Feierabend ist ja heutzutage schon um zwei Uhr –, dann gehe ich mit meinem kleinen Kratzer oder der Harke durch das aufgeworfene Erdreich. Stört ja keinen, und meine Frau, Gott hab sie selig, ist auch nicht mehr da, um hinterher über meine schmutzigen Schuhe zu schimpfen.«
»Gut. Aber nun erzählen Sie mir bitte, wie und wann Sie den Leichnam gefunden haben. Das ist im Augenblick nämlich unser Hauptproblem, Herr Doktor Georgi.«
»Wie bitte?« Georgi legte eine Hand ans Ohr. »Sie sprechen so leise.« Er nippte an seinem Malteser.
Marie verlor so langsam die Geduld. Sie schickte einen entnervten Blick in die Runde. Ein Kollege am Nebentisch zwinkerte und prostete ihr mit seinem Colaglas zu.
»Was soll ich Ihnen sagen«, fuhr Georgi fort. »Wollen Sie wissen, wie man fachmännisch einen Fundort freilegt?«
»Nein«, rief Marie so laut, dass der Alte zusammenzuckte. »Bitte nicht. Beantworten Sie jetzt einfach nur meine Fragen. Mir wurde gesagt, Sie hätten den Leichnam gestern Abend entdeckt. Warum ist er dann erst heute Mittag geborgen worden?«
»Das ist es ja, verehrte Frau Kommissarin. Auf mich hört ja niemand. Sonst wäre das sicher alles nicht passiert. Ich habe natürlich als Erstes gestern Abend bei unserer Wache in Volksdorf angerufen.«
»Polizeidirektion Ost.«
»Heute Morgen habe ich wieder angerufen. Aber niemand konnte mir sagen, ob der Bau nun gestoppt worden ist oder nicht. Erst um halb elf Uhr gelang es mir, jemanden im Bauprüfamt zu erreichen. Dann bin ich stracks zur Baustelle gegangen – und da war der Bagger schon wieder am Buddeln. Die Arbeiter haben natürlich auch nicht auf mich gehört. Erst als sie den Schädelknochen auf der Schaufel hatten, haben sie die Maschinen ausgestellt. Aber da war es zu spät. Die ganze Fundstätte war aufgerissen.« Georgi schüttelte den Kopf. »Der reinste Vandalismus. Nun ist der Unterkiefer weg. Wie durch ein Wunder ist der Rest des Skeletts unversehrt.«
»Wir haben Ihnen zu danken.«
Der Doktor nickte und schlürfte seinen Tee. »Erst dachte ich, ein altes Erdgrab aufgetan zu haben. Aber es liegt viel zu hoch, um Teil eines Megalithgrabes zu sein, außerdem fehlt die typische Steinsetzung. Der Fall muss jünger sein, fällt nicht in mein Resort ...« Georgi ließ den Kopf hängen. Sein Vortrag war zu Ende. Seine Kraft offenbar auch.
»Soll ich Ihnen ein Taxirufen?«, fragte Marie. Der Alte tat ihr plötzlich Leid. War sie mal wieder zu ungeduldig gewesen?
Georgi schüttelte den Kopf. »Danke. Ich bin noch ganz rüstig.«
»Dann fahre ich Sie nach Haus. Zahlen, bitte! Sie sind natürlich mein Gast.«
Kapitel 4
»Ich bin krank«, sagte Marie und wunderte sich selbst über ihren Tonfall. Jammern war sonst nicht ihre Art. Schon gar nicht, wenn sie mit Josiane telefonierte, die beim leisesten Anzeichen von Schwäche sofort alle Freundschaft vergaß und sich wie ein Marder in die Seele ihres Gesprächspartners hineinfraß. Sie war von Beruf Ärztin und Psychotherapeutin. »Und was Mexiko angeht – vielleicht habe ich Angst vorm Fliegen. Das gibt es doch, oder?«
»Ich glaube eher, du hast Angst davor, mit Tomkin so weit weg zu fahren und damit auch ein erhebliches Stück deiner Unabhängigkeit einzubüßen«, meinte Josiane. »In Mexiko kannst du nicht so einfach weglaufen, wenn du mal verschnupft sein solltest – ich meine verschnupft im zwischenmenschlichen Bereich ...«
»Bitte, Josiane, ich bin nicht verschnupft im zwischenmenschlichen Bereich. Ich habe eine handfeste Infektion. Und ansonsten habe ich einfach keine Lust, für eine Woche so weit wegzufahren. Das ist alles.«
»Du bist also krank – aber im Dienst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja? Du stehst mit dem Auto im Stau auf der Hoheluftchaussee und ich höre dein Funkgerät quaken.«
»Du kannst mir ja eine Krankschreibung schicken, mal sehen, was die Kollegen dazu sagen. Wir haben gerade ein Skelett gefunden, mitten in Wellingsbüttel. Gruselig, was? Außerdem bin ich quasi schon auf dem Weg nach Hause. Ich muss nur noch eine kurze Befragung hinter mich bringen, dann gehe ich sofort ins Bett.«
»Wenn du dich endlich mal auskurieren willst, kriegst du von mir sofort eine Krankschreibung. Aber sag mal, glaubt ihr eigentlich wirklich, dass ihr jetzt noch Tickets bekommt für einen Flug nach Mexiko City? Die Maschinen sind doch sicher längst ausgebucht.«
»Ausgebucht«, wiederholte Marie. »Du bist ein Schatz. Das Argument hat mir heute Morgen gefehlt.«
»Ich könnte natürlich mal Lothar fragen. Erinnerst du dich noch an ihn? Er heißt jetzt übrigens Lola. Er hat sich erfolgreich operieren lassen. Er beziehungsweise sie arbeitet jetzt als Hostess in der VIP-Lounge am Flughafen.« Josiane machte eine kunstvolle Pause. »Sie hat mir extra gesagt, wenn wir mal in letzter Minute einen Flug bräuchten, sollten wir sie einfach anrufen.«
»Ein Krankenbett wäre mir lieber.«
»Dann ab nach Haus mit dir, schlaf dich gesund. Den gelben Zettel hast du morgen früh im Briefkasten.«