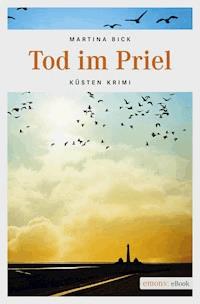3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marie Maas
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der Fall, der Kommissarin Marie Maas an ihre Grenzen führt – entdecken Sie Martina Bicks „Heute schön, morgen tot“ jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn Wissen tödlich ist: Mit eingeschlagenem Schädel wird eine Hamburger Dozentin über ihrem Schreibtisch aufgefunden. Kriminalkommissarin Marie Maas folgt einem Hinweis nach Flensburg. Die lebhafte Studentenstadt birgt ein dunkles Geheimnis: Neue Spuren führen Marie in die nationalsozialistische Vergangenheit des deutsch-dänischen Grenzgebiets – und dessen Bedeutung im Zweiten Weltkrieg. Als sie sich immer tiefer in die Abgründe der deutschen Geschichte wagt, ahnt sie nicht, welche gefährliche Wahrheit dort auf sie lauert … Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Heute schön, morgen tot“ von Martina Bick. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn Wissen tödlich ist: Mit eingeschlagenem Schädel wird eine Hamburger Dozentin über ihrem Schreibtisch aufgefunden. Kriminalkommissarin Marie Maas folgt einem Hinweis nach Flensburg. Die lebhafte Studentenstadt birgt ein dunkles Geheimnis: Neue Spuren führen Marie in die nationalsozialistische Vergangenheit des deutsch-dänischen Grenzgebiets – und dessen Bedeutung im Zweiten Weltkrieg. Als sie sich immer tiefer in die Abgründe der deutschen Geschichte wagt, ahnt sie nicht, welche gefährliche Wahrheit dort auf sie lauert …
Über die Autorin:
Martina Bick wurde 1956 in Bremen geboren. Sie studierte Historische Musikwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Gender Studies in Münster und Hamburg. Nach mehreren Auslandsaufenthalten lebt sie heute in Hamburg, wo sie an der Hochschule für Musik und Theater arbeitet. Martina Bick veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane, Romane und Kurzgeschichten und war auch als Herausgeberin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2001 war sie die offizielle Krimistadtschreiberin von Flensburg.
Die Krimi-Reihe rund um Hauptkommissarin Marie Maas umfasst folgende Bände:
Der Tote und das Mädchen. Der erste Fall für Marie Maas
Tod auf der Werft. Der zweite Fall für Marie Maas
Die Tote am Kanal. Der dritte Fall für Marie Maas
Tödliche Prozession. Der vierte Fall für Marie Maas
Nordseegrab. Der fünfte Fall für Marie Maas
Tote Puppen lügen nicht. Der sechste Fall für Marie Maas
Totenreise. Der siebte Fall für Marie Maas
Heute schön, morgen tot. Der achte Fall für Marie Maas
***
Neuausgabe November 2014
Copyright © der Originalausgabe 2002 Argument Verlag, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: © istockphoto; shutterstock; Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-842-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Marie Maas an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
Martina Bick
Heute schön, morgen tot
Der achte Fall für Marie Maas
dotbooks.
Kapitel 1
Pünktlich um neun Uhr siebzehn erreichte der Interregio aus Flensburg den Hamburger Hauptbahnhof. Inga Blatt stieg direkt an der Rolltreppe aus dem Zug und fuhr hinauf in die Wandelhalle. Dort blieb sie erst mal stehen, obwohl die Leute hinter und neben ihr schubsten und drängelten und sich ärgerlich an ihr vorbeidrückten. Links hinunter ging es zu den S- und U-Bahn-Schächten. Aber Inga wandte sich nicht nach links, sondern überquerte rechts die Gleisbrücke. Durch einen Tunnel gelangte sie wieder über eine Rolltreppe in die Mönckebergstraße, wo der dumpfe Bahnhofslärm abgelöst wurde vom ohrenbetäubenden Presslufthämmern einer staubigen Großbaustelle. Sie flüchtete hinter den ersten besten gläsernen Eingang. Kein Kaufhaus, eine Parfümerie.
Inga ging tiefer in das Geschäft hinein, eine glitzernde, duftende Märchenhöhle. Das warme Licht tat ihren Augen gut, und in den verspiegelten Wänden sah sie, dass es auch ihrem Teint schmeichelte. Sie blieb stehen und schaute aufmerksam an, was sie sah: ein ernstes rundliches Gesicht, wachsame graublaue Augen mit harten Schatten unter den Lidern, zwei steile Falten zwischen Wange und Nase. Unter dem Kinn begann sich ein Doppelkinn abzuzeichnen. Ihre ungezupften Augenbrauen schienen ihr heute breiter und dunkler zu sein als sonst. Das grau melierte Haar war frisch geschnitten, sie trug es schlicht halblang; praktisch, aber streng. Der neue Schnitt betonte die Rundheit ihres Gesichts. Der Mund zuletzt ließ keinen Zweifel an ihrer Geisteshaltung: Er war nur ein schmaler Strich.
Inga hob die linke Hand – in der rechten trug sie ihren Lederrucksack – und ließ sie wieder sinken. Sie lächelte. Schon vor Jahren, damals, als sie begann, nicht mehr jung und frisch und offen für alles und jedes auszusehen, hatte sie beschlossen, sich mit ihrem Gesicht anzufreunden. Sie hatte sich dafür entschieden, auf Charakter zu setzen, nicht auf Schönheit.
Mit einem kleinen Schwung hängte sie ihren schwarzen Rucksack über die rechte Schulter und schlenderte an den Regalen mit teuren Kosmetika vorbei. Vor einem großen Ständer mit Lippenstiften blieb sie stehen – Dior, Shiseido, Yves St. Laurent, Namen wie Städte, Urlaubsversprechen, Schönheitsversprechen. Sie ließ ihre Augen über die Probestifte gleiten, die in allen denkbaren Rot-, Rosa- und Brauntönen nebeneinander aufgereiht waren wie auf einer Farbpalette. Am besten gefiel ihr das dunkle Blutrot. Ein Mund wie eine Rose.
Hinter den Lippenstiften begann das Reich der Düfte. Das Licht wurde gedämpfter, die Luft schwer von Moschus und Rosenöl. Niemand stand vor den Regalen mit den sündhaft teuren Fläschchen. »Shalimar« las Inga und bewegte dabei stumm die Lippen. Elsas Lieblingsparfüm. Inga langte nach dem Probeflakon aus dunklem Glas und sprühte einen Hauch auf einen Teststreifen. Augenblicklich verbreitete sich der bittere, fast widerlich strenge Geruch, der die Schleimhäute reizte, als würde man seine Nase zu tief in einen duftenden Blumenstrauß stecken. Sobald die Flüssigkeit auftrocknete, wurde der Geruch sanfter und fing an, seine köstlichen vielfältigen Noten zu entfalten – etwas Mildes, Beruhigendes, wie Kamille oder eine sanfte Creme, etwas abenteuerlich Asiatisches, schwer verdaulich, aber geheimnisvoll, dazu ein Hauch Blütenduft, der vor dem inneren Auge Farben auferstehen ließ. Nichts Süßliches, nichts Frisches. Eher etwas Dunkles, Verschwiegenes, das perfekt zu Elsa passte, so wie sie sich selbst sah.
Chamade, Liu, L’heure bleue, Vol de nuit. Inga griff nach dem letzten Flakon und testete ihn. Wieder der ungenießbare Anfang, dann das Auffächern von tausenderlei Komponenten, wie nur ein schweres, teures Parfüm sie besitzt, die Konsolidierung der Duftnoten, und dann, wie in einer Zeitlupe, das Aufblühen der endgültigen, dauerhaften Bestandteile. Ein wunderbarer nächtlicher Duft, wie er einem bei einem Abendspaziergang zwischen Sommergärten in die Nase steigt. Zu romantisch für Inga Blatt. Viel zu romantisch für das, was sie heute vorhatte. Zu ernst nach allem, was sie dafür hatte tun müssen.
Jardin de Bagatelle las sie als Nächstes und griff rasch nach dem Flakon. Was für ein Name: »Garten der Kleinigkeiten«. Als hätte der Hersteller ihn speziell für sie erfunden. Wenn er hielt, was er versprach, war das genau der Duft, der von nun an zu ihr passen würde. Sie sprühte einen Hauch auf beide Handgelenke und wartete nicht ab, bis die Duftnoten sich entfalteten. Sie angelte einen der weißen goldverzierten Kartons aus dem Regal und stellte sich vor der Kasse an, wo ein elfenzartes Wesen das Parfüm auf Nachfrage in einer Einkaufstüte versenkte, ohne es extra in farbiges Seidenpapier einzuhüllen. Inga legte ihre Kreditkarte auf den Tresen und ließ einhundertneununddreißig Mark von ihrem Konto abbuchen. Als sie wieder auf die Straße trat, schnappte sie gierig nach frischer Luft. Hamburg roch immer fischig und klamm und ein bisschen nach Maschinenöl. Flensburg roch anders.
Wie einen Seidenschal ließ sie den schweren Parfümduft hinter sich herflattern und eilte, tief den fremden Odem dieser Stadt inhalierend, die Mönckebergstraße hinunter Richtung Jungfernstieg.
Kapitel 2
Der Dekan klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch. Die andere hielt er wie einen Schirm vor die Augen, die Sonne blendete heftig. Dann zogen wieder Wolken auf und verdunkelten den großen Sitzungsraum. Es lohnte sich nicht, die schweren gummierten Vorhänge zu schließen.
Der Tumult legte sich. Die Mitglieder des Fachbereichsrats beruhigten sich nach und nach und stellten ihre Privatgespräche ein. Nur Lydia Kockelin, Professorin für Grundschulpädagogik, redete unbeirrt weiter mit ihrem Tischnachbarn, dem geschäftsführenden Direktor des Instituts für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Professor Bamm. Der nickte fortwährend mit gesenktem Kopf, sank immer tiefer in die Polster seines Sessels, als könne er der Kollegin auf diesem Weg entkommen oder sie zumindest dazu bewegen, leiser zu sprechen. Ohne Erfolg.
»Ich finde es wirklich unmöglich, dass man das erst jetzt erfährt«, wiederholte Frau Kockelin an die ganze Runde gewandt.
Alle Blicke ruhten sowieso auf ihr, das heißt, die Blicke der sieben anderen Professorinnen und Professoren, der beiden Studierenden, von Frau Gräbert aus der Verwaltung und Herrn Paul, dem Planer des Fachbereichs. Nur die Protokollantin sah nicht auf, und auch die Gäste, Herr Butz und Frau Nölte, waren mit ihren Unterlagen beschäftigt. Sie waren nur anwesend, um unter Tagesordnungspunkt acht die Ausschreibung für eine neue Professur an ihrem Institut vorzustellen.
Jens Knudsen, Professor für Freizeitpädagogik am Institut IV des Fachbereichs Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg sah unauffällig auf die Uhr. Schon zwölf, und nicht mal die Hälfte des öffentlichen Teils der Sitzung geschafft. Dabei hatte er gehofft, um zwei Uhr fertig zu sein, damit sie rechtzeitig auf die Autobahn Richtung Flensburg kamen, ehe die Nachmittagstaus begannen.
»So einfach werde ich das nicht durchgehen lassen«, beharrte Kockelin. »Wir brauchen die beiden C3-Stellen an unserem Institut. Mit noch mehr Lehrbeauftragten ist niemandem geholfen. Vor allem nicht den Studierenden. Schon weil Lehrbeauftragte, wie wir alle wissen, nicht prüfungsberechtigt sind.« Sie fixierte die beiden Vertreter der Studentenschaft ihr gegenüber.
»Liebe Kollegin, ich bitte Sie. Noch ist gar nichts geschehen«, versuchte der Dekan, der an der Stirnseite des Tisches präsidierte, zu beruhigen.
Er war wie immer sehr förmlich gekleidet, mit Anzug, Schlips und Kragen, registrierte Knudsen. Auch die anderen schwitzten in ihren Anzügen und Kostümen. Nur er, Knudsen, machte seinem Ruf als Däne mal wieder alle Ehre. Er trug ein kariertes kurzärmliges Hemd, Jeans und eine Weste mit tausend Taschen, wie er sie beim Segeln trug.
»Ich weiß gar nicht, was Sie immer gegen die Lehrbeauftragten haben, Frau Kockelin«, mischte er sich in die Diskussion. »Die haben wenigstens noch Ehrgeiz und Fantasie, sitzen hier nicht nur ihre Zeit ab und verkriechen sich in Forschungsprojekten. Sehen Sie sich nur mal das Lehrangebot einiger Kollegen an.« Sein Deutsch war tadellos und sein kleiner dänischer Akzent –die etwas schärfer gesprochenen Konsonanten und Zischlaute sowie die leicht singende Wortmelodie – wurde von den Kollegen immer wieder mit Sympathie aufgenommen. Die verflog heute jedoch, noch ehe er ganz ausgesprochen hatte.
»Nur weil Ihre Frau es nicht geschafft hat, sich eine feste Stelle zu ergattern, brauchen Sie jetzt nicht das Lager zu wechseln«, schoss Lydia Kockelin scharf zurück. Das allgemeine Gemurmel erreichte einen neuen Höhepunkt.
»Ich bitte Sie«, fuhr der Dekan dazwischen. »Wir diskutieren hier heute nicht das Lehrangebot. Ich schlage vor, wir vertagen die Diskussion auf die nächste Sitzung, wenn klar ist, in welchem Rahmen wir mit Einsparungen rechnen müssen. Wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt sieben, Bericht aus dem Ausschuss für Lehre und Studium. Bitte, Herr Woller, Sie haben das Wort.« Er lehnte sich zurück, während Helmut Woller, Prodekan für Lehre und Studium, anfing zu reden.
Woller, mit achtundvierzig Jahren einer der jüngsten Kollegen am Fachbereich, warf der Kollegin Kockelin, die immer noch wie ein Maschinengewehr auf ihren Sitznachbarn einredete, von Zeit zu Zeit einen knappen abschätzigen Blick zu und erläuterte ansonsten ohne sich irritieren zu lassen die Tischvorlage, die von der Protokollantin herumgegeben wurde.
Es gab Wissenschaftler in Deutschland, die nur durch ihre Rhetorik bestachen und die so lange reden konnten, bis sie einem ein X für ein U vorgemacht hatten. Knudsen hatte den Eindruck, sie wussten oft gar nicht so genau, wovon sie sprachen. Es war eigentlich auch ganz egal. Sie beherrschten nur die Kunst, sich mit Worten so in eine Idee hineinzuschrauben, dass schließlich auch die ärgsten Zweifler es aufgaben, ihre Argumentationen auf Tatsachen hin abzuklopfen und gegebenenfalls aus den Angeln zu heben. Woller gehörte nicht zu ihnen. Er war zwar ein Mann mit einer begnadeten Stimme, klangvoll, kräftig und beherrscht, und er verfügte auch über ein perfektes, glasklares Argumentationsvermögen. Aber seine große Liebe gehörte den Zahlen. Die allerdings verstand er so spannend aufzubereiten wie einen Kriminalroman. Sein Vortrag über die Verteilung von Tutorenmitteln nach einem sorgfältig ausgetüftelten Schlüssel führte die Mitglieder des Rats weit weg von den brisanten Eröffnungen des Dekans über die anstehenden Streichungen von Haushaltsmitteln im nächsten Planungszeitraum. Auch Lydia Kockelin hörte irgendwann auf zu flüstern und studierte mit gezücktem Stift die Tabellen auf der Tischvorlage.
Irgendwann ging leise die Tür auf. Frau Hacke aus dem Dekanat schlüpfte in den Raum, orientierte sich kurz und nahm dann auf dem nächsten besten Stuhl neben der Tür Platz. Dann ging noch einmal die Tür auf und ein verspäteter Student, Timo Becker, stellvertretendes Mitglied des Fachbereichsrats, kam herein. Er sah zerzaust aus, als wäre er den ganzen Weg von zu Hause gerannt. Knudsen kannte ihn aus einem Proseminar. Schon in der Orientierungseinheit war der Junge ihm aufgefallen, vor allem seine Fähigkeit, wissenschaftlich zu denken. Er schien zudem ein Zahlengenie zu sein. Er verstand es genau wie Professor Woller, der am Fachbereich den Lehrstuhl für quantitative Methoden innehatte, eine nüchterne Statistik nicht nur zu verstehen, sondern auch weniger talentierten Zeitgenossen plausibel zu machen. Nur Elsa hatte mal Probleme mit ihm gehabt. Er hatte es mit der Anwesenheitspflicht in den Proseminaren wohl nicht so genau genommen. Womöglich würde man von ihm noch hören. Dennoch einer der Guten.
Auch bei einer so schwer zu fassenden Materie wie die Pädagogik es nun einmal war, fand Knudsen es wichtig, dass die Studierenden Strukturen erkennen und wissenschaftliches Material auf Punkt und Komma genau auswerten konnten. Aber manchmal hatte er den Eindruck, dass er unter seinen Kollegen mit diesem Ziel recht einsam auf weiter Flur dastand. Die Schwafler mit den wortgewaltigen Gedankenzöpfen, die sie wie Stricklieseln pausenlos vor sich hin produzierten, blieben immer in der Überzahl. In Dänemark hätten solche Kollegen keine Chance in der Wissenschaft. Auch in Amerika bekämen sie keinen Fuß auf den Boden. Nur in Deutschland war man so höflich, ihnen zuzuhören. Sicherlich hatte er, Knudsen, es unter ihnen nur deshalb so weit gebracht, weil er es verstand, seine nüchternen Ansichten in einem trockenen, humorigen und unbedingt kurzen Redestil vorzubringen. Zudem polarisierte er gern. Das mochten die Kollegen. Alle Menschen lachen gern, auch und gerade Wissenschaftler.
Als der Kollege Woller mit seinem Tagesordnungspunkt fertig war, stand Frau Hacke leise auf, schlich um den Tisch herum zu Knudsen und beugte sich zu ihm hinunter. Professor Woller blickte schweigend in seine Unterlagen und wartete auf Wortmeldungen aus dem Gremium. Es war mucksmäuschenstill im Raum. Alle sahen auf Frau Hacke und Knudsen, der nicht zu verstehen schien, was die Sekretärin ihm ins Ohr flüsterte. Auch Lydia Kockelin schwieg, zupfte nur nervös mit den Fingern an einer Erdnusstüte, die sie seit Beginn der Sitzung im Begriff war leer zu knabbern. Der Dekan starrte stirnrunzelnd auf die große, aus vielen einzelnen Elementen zusammengeschobene Tischfläche zwischen ihnen. Die Protokollantin kontrollierte das Bandgerät. Sie würde demnächst die Kassette auswechseln müssen, wofür sie gern die Gesprächspausen nutzte. Aber noch lief das Band.
Jens Knudsen sprang auf. »Es tut mir Leid. Ich muss fort.«
Der Dekan sah überrascht auf. Die Sekretärin, winzig klein auch neben Knudsen, der nur knappe ein Meter fünfundsiebzig maß, zuckte hilflos die Achseln.
»Es ist –«, begann sie und brach gleich wieder ab.
»… meine Frau«, stotterte Knudsen, sammelte sich dann und machte sich sehr gerade. »Ich habe eben erfahren, dass meine Frau verstorben ist. Bitte entschuldigen Sie mich.«
»Um Himmels willen«, murmelte der Dekan. »Die Sitzung ist unterbrochen.«
Kapitel 3
Oft ist es nur eine einzige Komponente, eine winzige Kleinigkeit, die so entscheidende Dinge wie Leben und Tod für uns sichtbar macht. So hatte Marie es sich einmal von einem Kunsthistoriker erklären lassen. Leichenblass – das sagte man so dahin. Wenn man dann wirklich einen Toten sah, wurde einem die Bedeutung des Wortes erst richtig bewusst. Wie Porzellan, so hell und zart ist seine Haut, aus der alles Blut gewichen ist. Er ist ein Engelchen. Er sieht aus wie wir, ist aber nicht mehr einer von uns.
Von hinten sah es aus, als ob Elsa Knudsen-Hoppe über ihren Schreibtisch gebeugt nur eingeschlafen wäre. Die blassen Arme waren in einem sanften Halbrund vor ihr ausgebreitet, der Kopf ruhte mit der rechten Schläfe auf der Tischplatte. Die kupferrot gefärbten Locken waren ihr ins Gesicht gefallen. Auf den ersten Blick konnte man unter dem üppigen Haar die Stelle nicht ausmachen, wo der Schlag auf den Hinterkopf sie getroffen hatte. Die Augen hatte man ihr schon geschlossen.
»Können Sie etwas über den Todeszeitpunkt sagen, Doktor?«, fragte Marie Dr. Salz von der Gerichtsmedizin, der zusammen mit der Spurensicherung den Tatort bereits untersucht hatte.
»Ich berechne gerade den Temperaturausgleich. Zwischen fünfzig und sechzig Kilo, schätze ich, wiegt die Tote. Was meinen Sie?«
Marie trat einen Schritt zurück. Elsa Knudsen-Hoppe war schlank, etwa so groß wie sie selbst, aber viel dünner. Sie nickte.
»Also fünfundfünfzig Kilo, die Raumtemperatur beträgt zweiundzwanzig Grad, Rektaltemperatur fünfunddreißig Grad, das macht – Augenblick bitte …« Der Doktor legte ein abgenutztes Holzlineal an eine kurvenreiche Tabelle und zog mit dem Kugelschreiber eine Linie durch ein Fadenkreuz. »Zwei Komma fünf Stunden bei einer Abweichung von zwei Komma acht Stunden. Der Todeszeitpunkt liegt also etwa zwischen halb neun und halb zwölf Uhr heute Morgen. Die Leichenflecken lassen sich noch gut wegdrücken. Totenstarre setzt gerade ein. Ich schätze, sie liegt unter drei Stunden.« Er sah auf seine Uhr. Es war kurz vor eins. »Zehn Uhr, plus minus eine gute Stunde.«
Marie seufzte. Die Tote hatte wunderbar zarte, manikürte Hände. Sicherlich gab es eine Geschirrspülmaschine in der Küche.
»Sieht aus, als hätte sie irgendetwas festgehalten.«
Dr. Salz schüttelte den Kopf. Er strich das Haar der Toten auseinander und blickte kritisch auf die Kopfwunde, aus der nur wenig Blut ausgetreten war. »Die war sofort tot. Vielleicht ist ihr das hier aus der Hand gefallen.« Er zog ein schmales Buch unter ihrem Oberkörper hervor.
»Schuldgefühl und Schuldkomplex«, las Marie halblaut vor. »›Untersuchung über die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Gesellschaft und in der Schule – Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors – vorgelegt von Elsa Nadine Knudsen-Hoppe geborene Hoppe aus Flensburg. August 1982.‹« Marie blätterte die Seite um. »›Für I.‹, eine Widmung.« Sie ließ das Buch sinken und sah über den Rücken der Toten hinweg durch ein hohes, geteiltes Fenster in einen Garten, der vor Grün fast zu platzen schien. Die hellgelbe Wand des gegenüberliegenden Hauses – das musste die Rückseite der Haynstraße sein – war nahezu vollständig vom Laub verdeckt. Nur die beiden obersten Stockwerke lugten durch den Urwald aus Buchen, Erlen, alten Rosensträuchern, voll erblühten Rhododendren, Flieder- und Holunderbüschen. An so einem Platz konnte man sicher gut arbeiten, sich konzentrieren. Tags den Blick ins Grüne, abends wunderbare Ruhe. Marie steckte die Dissertation in ihre Handtasche.
Das rechte Ende der Schreibtischplatte reichte bis an das Bücherregal, das die gesamte rückwärtige Wand des Zimmers von der Decke bis zum Boden einnahm. Am linken Ende stand ein moderner Computertisch. Er war leer bis auf ein loses Kabel und ein rechteckiges Mouse-Pad. Der Tisch hatte Rollen und ließ sich nach Belieben an den Arbeitsplatz heranziehen.
Warum hatte die Tote sich mit ihrer Dissertation beschäftigt, ehe ihr Mörder sie mit diesem Kristallaschenbecher, der neben dem Stuhl auf dem Boden lag, in den Tod geschickt hatte? Rechts und links der weißen Arme lagen Papiere, sorgfältig gestapelt, die unberührt aussahen, nicht durchsucht oder durchwühlt. »Sexualität und Wahrheit – über Michel Foucaults Theorie ›Der Wille zum Wissen«‹, »Lernen als Verschriftlichung – Eine Datenanalyse«, »Schrift und Bürgertum. Zur Sozialgeschichte des Schreibens«. Seminararbeiten aus dem Sommersemester 2001.
Marie zog das Vorlesungsverzeichnis der Hamburger Universität aus dem rechten Stapel und blätterte so lange, bis sie das Inhaltsverzeichnis am Ende des dicken Büchleins fand. Knudsen-Hoppe hielt zwei Seminare bei den Erziehungswissenschaftlern, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft: Geschlecht, Differenz und Erziehungswissenschaft, zweistündig dienstags, 14 bis 16 Uhr. Unter »Weiterführende Seminare« tauchte noch einmal der Name der Toten auf. Das Textbegehren und seine Supervision, donnerstags, 12 bis 14 Uhr.
Donnerstag, das war heute. Jemand sollte in der Uni anrufen und den Nachmittagskurs absagen.
»Sie scheint überrascht worden zu sein, was meinen Sie?«, fragte Marie und drehte sich nach dem Doktor um, den sie eben noch hinter sich hatte rumoren hören. Aber er hatte den Raum mittlerweile verlassen. Nur seine Tasche stand noch geöffnet vor der hellen Biedermeierkommode. Marie legte einen Finger zwischen die Seiten des Vorlesungsverzeichnisses und überquerte den Flur auf der Suche nach dem Zimmer, aus dem die Stimmen der Kollegen kamen. Die Spurensicherung hatte sich inzwischen die Küche vorgenommen. Der Fotograf packte sein Stativ schon wieder zusammen. Karsten Scholz und Susanne Bollmann von der Kripo standen mit Dr. Salz auf dem Balkon des Schlafzimmers und starrten auf die Kreuzung der beiden Kanäle, die man von hier aus zwischen dem Grün der Ufervegetation erkennen konnte. Der Doktor hatte sich gerade eine seiner ekelhaften Havannas angezündet. Marie drückte Susanne das Vorlesungsverzeichnis in die Hand und bat sie, die Geschäftsstelle zu verständigen.
»Sie muss überrascht worden sein. Sie hatte keine Chance, sich zu wehren, oder?«, wiederholte Marie ihre Frage an den Doktor.
»Das werden wir heute Nachmittag bei der Obduktion sehen. Aber Sie haben Recht, es sieht ganz so aus.«
»Das heißt, sie ist an ihrem Schreibtisch umgebracht worden.« »Würde ich sagen. Sonst gäbe es Blut- und Schleifspuren auf den Böden.«
Marie ging zurück in die Wohnung. Der Balkon gehörte zum Schlafzimmer. Das breite französische Bett war ordentlich gemacht und mit einer dunklen Tagesdecke überworfen worden. Der rechte Nachttisch war leer bis auf die Lampe. Kein Buch, kein Päckchen Taschentücher, keine Pillen, weder Stift noch Creme noch Wasserglas oder was man sonst so brauchte im Laufe der Nacht. Ein dünner Staubfilm lag auf dem Rauchglas der Tischplatte. Auf dem linken Nachttisch stand ein Wecker. Die Weckzeit war auf sieben Uhr eingestellt.
Die Rückseite des Raumes nahm ein großer Kleiderschrank mit Rolltüren ein. Davor lag ein heller Berber. Eine plüschbezogene Bank, auf der ausgezogene Kleidung abgelegt werden konnte, stand links in der Ecke. Aber nichts lag darauf herum. Wer auch immer dieses Zimmer bewohnte, er war ein sehr ordentlicher Mensch.
»Ich schlafe im Augenblick auch nicht im Schlafzimmer«, meinte Karsten, der sich hinter Marie in der Tür aufgebaut hatte und mit seinen fast zwei Metern Körpergroße leicht über ihre Schulter schauen konnte. »Die Baustelle an der Fuhlsbüttler Straße«, fügte er hinzu. »Ich lege mich lieber aufs Sofa im Wohnzimmer, und Rita schläft bei dem Baby.«
»Aber hier gibt es weder eine Baustelle unter dem Schlafzimmerfenster noch ein Baby, oder?« Marie orientierte sich in dem langen Flur. Rechts ging es ins Bad, daneben lag die Küche. Auf der anderen Seite befanden sich zwei Zimmer, die mit einer Flügeltür verbunden waren und offenbar als Wohn- und Esszimmer genutzt wurden. Außer dem Schlafzimmer und dem Arbeitszimmer der Toten gab es noch zwei Zimmer rechts und links von der Wohnungstür. Das rechte trug deutlich die Spuren eines jugendlichen Bewohners: Sport- und Pop-Poster an den Wänden, in der Ecke lehnte eine Klampfe, davor ein kleiner Berg Motorsport-Zeitschriften. Das letzte Zimmer links schien das Arbeitszimmer des Gatten zu sein. Es war getäfelt und mit einem modernen Schreibtischensemble aus hellem Holz ausgestattet. Die Arbeitsflächen quollen über von Papieren. In der Ecke stand ein großes Bett, dessen Decken nur flüchtig aufgeworfen waren. Das niedrige Regal neben dem Bett diente offenkundig als Abstellfläche.
Marie ging tiefer in das Zimmer hinein und blieb vor dem Schreibtisch stehen. Hier wurde fleißig gearbeitet. Auf dem Computertisch in diesem Zimmer war ein Rechner mit Drucker und Bildschirm aufgebaut.
»Na bitte, da haben wir ja das zweite Bett«, sagte Karsten, der hinter ihr ins Zimmer getreten war.
»Fehlt nur noch der Ehemann.«
»Ist schon unterwegs.«
»Professor Knudsen, ja?«
»Professor Doktor Jens Knudsen, Fachbereich Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg. Ein Däne, lebt aber seit fast dreißig Jahren in Deutschland. Er müsste jeden Augenblick hier sein.«
»Und wo ist die Putzfrau, die die Tote gefunden hat?«
»Sitzt in der Küche und wartet auf dich. Sie kommt übrigens zweimal in der Woche, montags und donnerstags, immer von elf bis fünfzehn Uhr.«
Marie machte Karsten ein Zeichen, ihr zu folgen, und ging ihm voraus an die Wohnungstür. »Einbruchspuren?«
Karsten schüttelte den Kopf und strich mit der Handkante über den Türstock. »Nichts. Nicht mal eine Schramme. Aber das hat nicht viel zu sagen bei diesen alten Türen. Die kann man mit einer Scheckkarte öffnen.«
»Die Fenster? Die Balkontür? Badezimmer, Gäste-WC?«
»Negativ. Wir haben alles kontrolliert.«
»Sie könnte also ihren Täter in die Wohnung gelassen haben.«
»Oder er hatte selbst einen Schlüssel.«
»Fehlt was?«
»Die Putzfrau konnte nichts feststellen.«
»Knudsen-Hoppe muss ihrem Mörder recht vertrauensvoll den Rücken zugewandt haben, um in dieser Position am Schreibtisch erschlagen worden zu sein. Sie sollte ihn gut gekannt haben.«
»Oder sie hat ihn nicht bemerkt.«
Marie seufzte. Unter dem allerersten Eindruck eines Tatorts war man der Lösung für ein paar Minuten, vielleicht waren es auch nur Sekunden, immer ganz nahe. Wie ein Medium, eine unwissende, unschuldige, unbelastete Fremde, die mehr intuitiv als logisch die Fakten in sich aufnahm, ohne sie auszuwerten, zuzuordnen, zu durchleuchten, zu hinterfragen, ließ sie sie in dieser einfachen, quasi ursprünglichen Form an sich vorbeiziehen, fügte sie ineinander, so frisch und unverbraucht sie sich ihr darboten oder wie der Täter oder die Täterin sie hinterlassen hatte. Wie man einen zerbrochenen Krug rasch wieder zusammenfügen konnte, solange die Scherben noch unverändert am Boden lagen. Was später mühevoll oder unmöglich wurde, wenn man die Reste erst säuberlich auf einem Tisch ausgebreitet hatte und sortieren, das Muster rekonstruieren, die verschiedenen Möglichkeiten durchspielten musste. Dann war dies erste Wissen vor allem Verstehen schon wieder vorbei. Schweren Herzens verabschiedete Marie sich von diesem Augenblick. Das Hineinbohren in die Tatbestände, das Auswerten von Labordaten, Analysen, Theorien, das Aufnehmen von Zeugenberichten, Verhören, Befragungen begann. Eine ungeheure Datenmenge würde gesammelt und sortiert werden, eine verwirrende Vielfalt, die täglich größer werden würde. Intuition war nicht mehr gefragt. Stattdessen waren Gedächtnis, Logik und Fleiß gefordert. Die Langstrecke, nicht der Sprint. Geduld, nicht Eleganz. Der Alltag kehrte ein in ihrem Job. Marie holte tief Luft, um mit Karsten die Abfolge der Zeugenbefragungen zu klären. Da wurde von außen die Wohnungstür aufgeschlossen und ein mittelgroßer blonder Mann in Jeans und Sommerhemd betrat die Wohnung, die Tür sachte hinter sich ins Schloss ziehend.
»Knudsen«, sagte er, und in seinem Blick stand nackte Panik. Er sah an den beiden Kommissaren vorbei bis in das Arbeitszimmer seiner Frau, bis zum Schreibtisch, machte einen Schritt auf das Zimmer zu, blieb stehen. »Meine Frau … ?«
Marie nickte und machte Platz, damit er das Zimmer betreten konnte. Sie ließ ihn einen Augenblick mit der Toten allein. Dann ging sie hinter ihm her.
Kapitel 4
»Wir können ins Wohnzimmer gehen«, sagte Knudsen, den Blick starr auf den Leichnam seiner Frau gerichtet. Dann wandte er sich abrupt um und ging Marie voran den Flur hinunter, bis in das große Zimmer mit der offenen Flügeltür. »Bitte.« Er wies auf eine mit Segeltuch bezogene Couch.
Die Zugehfrau stand plötzlich in der Tür und sah den Professor mit schwimmenden Augen an. Sie bekam kein Wort heraus, schüttelte nur den Kopf. Knudsen ging auf sie zu und legte kurz einen Arm um ihre Schultern.
»Danke, Elsbieta. Gehen Sie jetzt ruhig nach Hause. – Oder brauchen Sie sie noch?«
Marie schüttelte den Kopf. »Später vielleicht.«
Knudsen schloss die Tür und ließ sich in einem der Sessel nieder.
Das Wohnzimmer war ganz in Weiß- und Beigetönen eingerichtet. Weiße Wände, weißer Spannteppich, skandinavische Möbel, helles Holz. Es war aufgeräumt und sah ein wenig verstaubt aus wie das Schlafzimmer. Vor der Durchgangstür ins Esszimmer stand ein großer Fernseher auf einem niedrigen Kiefernregal.
»Sie kommen direkt aus der Universität?«
»Aus einer Sitzung, ja.«
»Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt lebend gesehen?«
»Heute Morgen, als ich das Haus verließ. Etwa kurz nach acht.«
»Was hatte sie heute Morgen vor?«
Knudsen zuckte die Achseln. »Nichts Besonderes, soweit ich weiß. Wir wollten am Nachmittag nach Flensburg fahren. Wir haben da unser Boot liegen. Wir sind quasi jedes Wochenende dort.«
»Musste Ihre Frau heute nicht unterrichten?«
»Nein.«
»Aber sie hat doch donnerstags immer ein Seminar abgehalten.«
»Die Vorlesungszeit ist beendet. Ich musste nur noch diese Sitzung hinter mich bringen.«
»Hat Ihre Frau heute Morgen irgendjemanden erwartet? Eine Freundin vielleicht oder einen Handwerker?«
»Nicht dass ich wüsste. Wie gesagt, wir wollten zeitig fahren.«
Knudsen setzte sich zurecht. Er sprach langsam und schwerfällig, als müsste er sich mühsam konzentrieren und seine Gedanken immer wieder neu sortieren. Kein Wunder, er stand unter Schock. Im Übrigen war es drückend warm in diesem Zimmer. Die Fenster waren alle geschlossen, die Luft roch abgestanden und ein wenig nach feuchter Wolle und muffigem Segeltuch.
»Seit wann sind Sie verheiratet – ich würde mir gern ein Bild machen von Ihrer Frau«, sagte Marie. Sie wollte dem Mann außerdem Gelegenheit geben, sich auf die ihm bekannten Tatsachen zu besinnen.
»Wir sind – wir waren zweiundzwanzig Jahre verheiratet. Seit 1979. Wir haben uns als Studenten kennen gelernt. In Kiel –meine Frau stammt aus Flensburg, ich selbst bin Däne. Ich komme aus Aabenraa, Apenrade zu Deutsch, das liegt nahe der deutschen Grenze. Von Kiel aus sind wir zusammen nach Hamburg gegangen.«
»Ihre Frau unterrichtete genau wie Sie an der Universität?«
»Nicht ganz. Meine Frau war Lehrbeauftragte. Sie hat an ihrer Habilitation gearbeitet.«
»Sie haben Kinder, nicht wahr?«
»Einen Sohn.«
Knudsen bedeckte das Gesicht mit den Händen. Er stellte sich vermutlich vor, wie er seinem Sohn die Nachricht vom Tod seiner Mutter beibringen musste.
»Lebt Ihr Sohn noch bei Ihnen zu Hause?«
»Nein.« Er fasste sich wieder und ließ die Hände sinken. »Torben macht zur Zeit seinen Zivildienst in Bayern. Wie ist Elsa eigentlich … gestorben?«
»Ein Schlag auf den Hinterkopf. Sie muss sofort tot gewesen sein.«
Sie schwiegen beide einen Augenblick.
»Haben Sie irgendeine Idee, wen Ihre Frau so gut kannte, dass sie ihn in die Wohnung ließ, und der zu so einer Tat fähig war?«, begann Marie wieder.
Knudsen schüttelte entschieden den Kopf.
»Es tut mir Leid, aber ich muss Ihr Alibi ganz genau prüfen. Sie haben das Haus heute Morgen um kurz nach acht Uhr verlassen. Sind Sie direkt in die Uni gefahren?«
»Nein. Die Sitzung begann um zehn Uhr.«
»Was haben Sie in der Zwischenzeit getan?«
»Ich war noch im Baumarkt am Loogestieg, um Bootslack zu kaufen.«
»Für Ihr Boot in Flensburg?«
Knudsen zuckte die Achseln. »Wir hätten das auch heute Nachmittag machen können, aber ich dachte, dann wäre das schon mal erledigt. Die Autobahn ist immer so voll, wenn man später fährt.«
»Und wann waren Sie dann in der Uni?«
»Gegen neun Uhr. Ich bin erst mal ins Geschäftszimmer gegangen und habe die Post geholt.«
»Dort gibt es doch sicher eine Sekretärin, die das bestätigen könnte?«
Knudsen sah Marie erschrocken an. Dann nickte er. »Natürlich. Frau Poppenhäger hat mich ja gesehen. Ich habe mit ihr gesprochen.«
»Wunderbar. Das ist doch schon mal was.«
»Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie glauben, ich hätte meine Frau …«