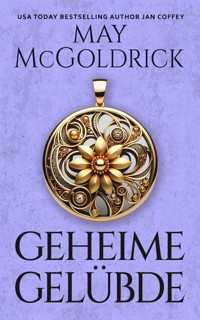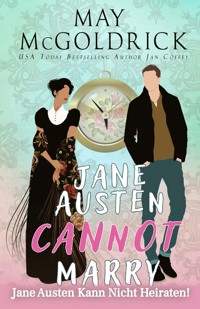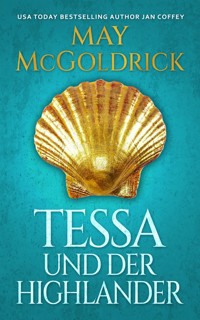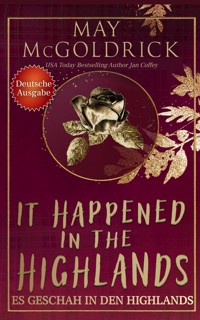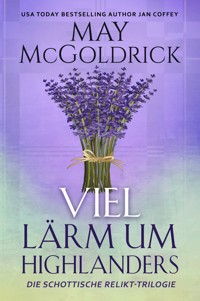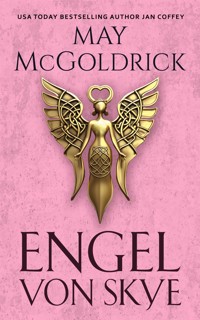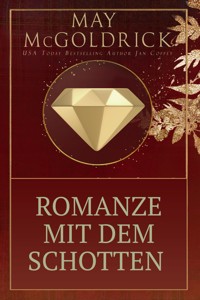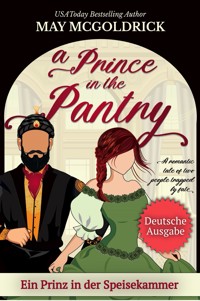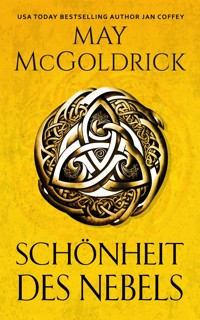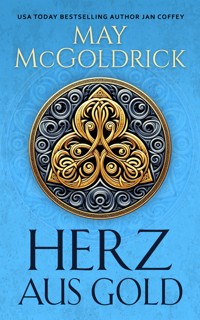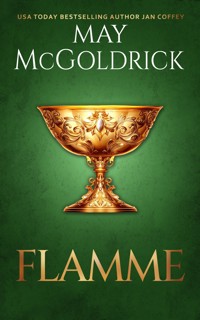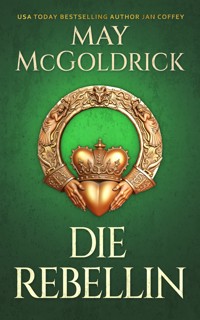
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Pennington Familie Serie
- Sprache: Deutsch
Gewinner des Holt-Medaillons! GESUCHT ... wegen Verbrechen gegen den König. Als Vergeltung für die Brutalität der englischen Truppen schlägt die irische Rebellin Egan zurück, führt eine geheime Gruppe von Revolutionären an - und baut eine Legende im ganzen Land auf. ABGELEHNT ... von ihrer eigenen Familie. Jane Purefoy ist eine Frau mit Vergangenheit. Als Tochter eines englischen Richters musste sie mit ansehen, wie ihr irischer Liebhaber am Galgen starb. Jetzt ist Janes Ruf ruiniert - und in den Augen ihrer Familie hat sie fast aufgehört zu existieren. Begehrt ... mit einer verbotenen Leidenschaft. Sir Nicholas Spencer ist auf dem Weg nach Woodfield House, um der jüngsten Purefoy-Schwester den Hof zu machen, als er dem berüchtigten Egan über den Weg läuft. Nicholas lässt sich nicht einschüchtern, ringt den Rebellen zu Boden und entlarvt ihn - nur um Janes liebliches Antlitz zu enthüllen. Verzaubert von dem temperamentvollen Mädchen beschließt Nicholas, ihr Geheimnis zu bewahren, während er sich auf einen riskanten Verführungsplan einlässt - einen Plan, der ihre Familie ins Chaos, das Land in die Rebellion und sein Herz in den Strudel einer Liebe stürzen wird, die niemals sein kann...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
The Rebel
DIE REBELLIN
2nd German Edition
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Urheberrecht
Danke, dass Sie sich für Die Rebellin entschiedenhaben. Falls Ihnen dieses Buch gefällt, sollten Sie es weiterempfehlen, indem Sie eine Rezension hinterlassen oder mit den Autoren in Kontakt treten.
Die Rebellin (The Rebel) © 2011 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Deutsche Übersetzung © 2024 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension ist die Vervielfältigung oder Verwertung dieses Werkes im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form durch jegliche elektronische, mechanische oder andere Mittel, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, einschließlich Xerographie, Fotokopie und Aufzeichnung, oder in jeglichem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt: Book Duo Creative.
Erstmals veröffentlicht von NAL, einem Imprint von Dutton Signet, einer Abteilung von Penguin Books, USA, Inc. 2002
Umschlag von Dar Albert, WickedSmartDesigns.com
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Über den Autor
Für Carol Palermo
Freundin, Impulsgeberin, Planerin und Förderin höchsten Ranges
KapitelEins
London, Dezember 1770
Wie weißer Zuckerguss lag der Schnee auf den stattlichen Platanen und den Gehwegen des Berkeley Square. Die in feine wollene Umhänge und Pelzmäntel gehüllten Dinnergäste, die aus dem warmen Interieur des Hauses von Lord und Lady Stanmore traten, hatten freilich kaum einen Blick für das pittoreske Ambiente übrig, sondern eilten schnurstracks zu ihren bereit stehenden Kutschen. Vom Fluss her wehte ein scharfer Wind über den Platz. Schneeflocken wirbelten auf und tanzten schimmernd im Licht, das aus den Fenstern des prächtigen Stadthauses strömte. Der die Pflastersteine bedeckende Schnee dämpfte die Geräusche der abfahrenden Kutschen, die bis auf eine bald alle in der Dunkelheit verschwunden waren.
Sir Nicholas Spencer stand in der hell erleuchteten Eingangshalle des Hauses und ließ sich von einem Lakaien Handschuhe und Mantel reichen. Dann drehte er sich seinen Gastgebern zu, um sich endgültig von ihnen zu verabschieden.
»Wie kann man denn Weihnachten allein verbringen!«, schalt Rebecca ihn mit sanfter Stimme. »Bitte, Nicholas, du musst über die Feiertage mit uns nach Solgrave kommen.«
»Und mich in euer erstes gemeinsames Weihnachtsfest drängen?« Nicholas schüttelte lächelnd den Kopf. »Da sollte die Familie ganz unter sich bleiben. Ich denke nicht im Traum daran, euch zur Last zu fallen.«
Rebecca trat von der Seite ihres Mannes weg und griff nach Nicholas’ Hand. »Du fällst uns überhaupt nicht zur Last. Meine Güte, dafür sind Freunde doch da. Wenn ich an all die Jahre denke, in denen James und ich in Philadelphia allein waren! Wenn die Gastfreundschaft unserer Freunde nicht gewesen wäre – besonders an den Feiertagen –, wären wir wahrscheinlich sehr einsam gewesen!«
Nicholas führte die Hand der jungen Frau an seine Lippen. »Deine Freundlichkeit rührt mich zutiefst, Rebecca, und du weißt, dass ich dir normalerweise nichts abschlagen kann. Aber ich habe mit diesem Burschen, den du als deinen Ehemann bezeichnest, schon öfter Weihnachten verbracht, als mir lieb ist. Außerdem habe ich gehört, dass es eine freudige Neuigkeit gibt, die du dem jungen James wirst mitteilen wollen …«
Lady Stanmore errötete zart und warf ihrem Mann einen Blick zu.
»Es gelingt mir wesentlich besser, Staatsgeheimnisse für mich zu behalten, meine Liebe«, sagte Stanmore und schloss sie fest in die Arme.
Nicholas stand da und sah zu, wie seine Freunde in eine Welt hinüberglitten, die nur aus ihnen beiden bestand. Das Band, das ihre Herzen und ihre Seelen miteinander verknüpfte, war so ausgeprägt, so offenkundig … und dennoch rief das Ganze, so sehr er sich für die zwei freute, zwiespältige Gefühle in ihm hervor, die Nicholas mit einem Stirnrunzeln quittierte.
Rasch blickte er weg und verscheuchte das Stirnrunzeln aus seinem Gesicht. Es war töricht, auf eine Lebensform neidisch zu sein, die er stets wie die Pest gemieden hatte.
Er hatte bereits seinen Mantel an und war gerade dabei, sich die Handschuhe anzuziehen, als die zwei sich seiner wieder bewusst wurden. Nicholas kam nicht umhin zu bemerken, wie Stanmores Hand beschützend auf Rebeccas Hüfte lag und Rebeccas Finger sich liebevoll mit denen ihres Mannes verflochten.
»Komm trotzdem«, sagte Stanmore. »Komm nach Weihnachten, wenn du meinst, die Feiertage nicht bei uns verbringen zu können. Du weißt, dass meine Familie sich immer über deinen Besuch freut … obwohl Gott allein weiß, warum. Aber Spaß beiseite – ich weiß, dass James ganz erpicht darauf ist, dir von seinem Trimester in Eton zu erzählen, und dass es Mrs. Trent großes Vergnügen bereiten wird, dich zu verwöhnen.«
Nicholas nickte. »Einverstanden … Das heißt, vorausgesetzt, meine Mutter und meine Schwester machen ihre Drohung, von Brüssel herüberzukommen und mich zu besuchen, nicht wahr. Dem letzten Brief meiner Mutter nach zu urteilen wird sie mit dieser Göre Frances nicht mehr allein fertig, so dass sie ihr angedroht hat, sie in England zu lassen, damit sie ihre Ausbildung hier abschließen kann.«
»Nun, das sind ja aufregende Neuigkeiten«, warf Rebecca ein.
»Nicht für mich«, entgegnete Nicholas kopfschüttelnd, während der Lakai ihm seinen breitkrempigen Hut aus weichem Filz reichte. »Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man mit sechzehnjährigen Kindern umgehen muss, die in einem fort ohne Sinn und Verstand reden … und sich trotzdem für ungemein erwachsen halten.«
»Alles hat seine Zeit«, erwiderte Stanmore, während er und seine Frau Nicholas zur Tür begleiteten. »Das gehört alles zum großen Lebensplan dazu. Heirat und Ehe. Kinder. Dass unser Hauptinteresse nicht mehr uns selbst, sondern denen, die wir lieben, gilt. Wie Garrick neulich so treffend im Drury Lane Theatre gesagt hat: Nun ward der Winter unsers Missvergnügens glorreicher Sommer.«
Nicholas war im Begriff, eine frivole Bemerkung über bucklige Könige, die ihre Ehefrau ermorden, zu machen, doch als er Rebecca und Stanmore ansah, blieben ihm die Worte in der Kehle stecken. Aus irgendeinem Grund wollte ihm selbst der Ausdruck ›glücklicher und sorgloser Junggeselle‹ im Moment nicht über die Lippen.
Nicholas beugte sich nach unten und gab Rebecca einen Kuss auf die Wange. »Fröhliche Weihnachten.«
Draußen hatten der Schneefall und der Wind zugenommen. Nicholas drückte sich den Hut auf den Kopf und winkte seinen Freunden von der Straße aus noch einmal zu. Als die Haustür sich schon geschlossen hatte, stand er immer noch da und starrte vor sich hin, um einen Moment über die Ereignisse nachzudenken, die ein derartiges Glück in dieses Haus gebracht hatten. Schließlich riss er sich zusammen und wandte sich seinem Kutscher zu.
»Fahr nach Hause, Jack, damit du ins Warme kommst. Ich geh zu Fuß.«
Ein Windstoß zerrte an den Schößen von Nicholas’ Mantel, und der Kutscher tat, wie ihm geheißen.
Der Baronet schlug den Kragen seines Mantels hoch und machte sich auf den Weg, vorbei an den eleganten Häusern, die den Platz säumten. Obwohl es schon spät am Abend war, war in zahlreichen Fenstern noch Licht zu sehen, denn in dieser Jahreszeit wurden viele Gesellschaften gegeben. Der Wind trieb ein einsames Blatt über die schneebedeckte Straße, das schließlich in einer Wagenspur hängen blieb. Die eisige Luft schnitt Nicholas ins Gesicht und ließ ihn sehnsüchtig an das warme Feuer in der Bibliothek der Stanmores zurückdenken. Immer wieder erblickte er in Gedanken seine beiden in der Eingangshalle stehenden Freunde vor sich.
Es war nicht zu übersehen, wie sehr sich Stanmore zum Positiven verändert hatte. Was für ein gequälter Mensch er doch in all den Jahren gewesen war, nachdem seine erste Frau ihn zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn James verlassen hatte und spurlos verschwunden war. Und jetzt, da er den Jungen wiedergefunden und Rebecca geheiratet hatte, wirkte Stanmore rundum glücklich. Eine bemerkenswerte Veränderung … fast ein Wunder.
Bald darauf kam Nicholas’ Haus am Leicester Square in Sicht, doch er fühlte sich noch viel zu aufgekratzt, um sich schon zur Nachtruhe zu begeben. Da der Schneefall allmählich nachließ, lenkte er seine Schritte in Richtung St. James’s Park.
Seit er vor über zehn Jahren aus den Kolonien zurückgekehrt war, hatte Nicholas Spencer sorgfältig darauf geachtet, dass sein Leben so unkompliziert wie möglich blieb. Er hatte es vermieden, sich zu binden, und war immer bestrebt gewesen, niemandem wehzutun. In seinen Jahren als Soldat hatte er so viel Leid gesehen, so viel Kummer bei den Hinterbliebenen, dass ihn das für alle Zeiten von dem Wunsch nach irgendeiner Art von Bindung kuriert hatte. Dafür war das Leben einfach zu flüchtig, zu vergänglich.
Irgendwann im Laufe der Jahre hatte er entdeckt, dass es viele Frauen gab, die mehr als bereit waren, sich einzig und allein um des gegenseitigen Vergnügens willen mit ihm einzulassen. Um den Augenblick zu genießen, solange man noch Gelegenheit dazu hatte. Das fügte keinem der Beteiligten Leid zu.
Reichtum bedeutete lediglich, dass man genug Geld für gute Kleidung und gute Pferde hatte, sich ab und an harmlose Glücksspiele gönnen und insgeheim ein wenig philanthropisch tätig sein konnte. Es machte ihm nichts aus, dass man in den gehobenen Kreisen der Gesellschaft die Nase über seinen ausschweifenden Lebenswandel rümpfte. Er wusste, dass man ihn für einen Spieler und Frauenhelden hielt, für einen Sportsmann, der es vorzog, die Verpflichtungen, die ihm aus seiner gesellschaftlichen Stellung erwuchsen, nicht zu beachten.
Und Nicholas Spencer stellte den Ruf, den er hatte, in keiner Weise in Abrede. Er war stolz darauf. Er hatte ihn verdient. Er hatte sich große Mühe gegeben, ihn zu erwerben. Er hatte nie irgendjemandem gegenüber irgendwelche Pflichten haben wollen.
Seit wann und warum war er dann eigentlich so unzufrieden?
Er trat durch ein offenes Tor und schlenderte die von Bäumen gesäumten Wege des St. James’s Park entlang. Die Prostituierten und die Galane, die sonst – selbst zu dieser späten Stunde – den Park heimsuchten, schienen wärmere Plätzchen aufgesucht zu haben, wo sie besser vor Wind und Wetter geschützt waren. Er verließ den gepflasterten Hauptweg und ging quer über eine Wiese, wobei der pulvrige Schnee unter seinen Stiefelsohlen knirschte.
Er war in der Tat frei und unabhängig wie ein Adler. Gleichwohl geschah etwas Unerklärliches mit ihm. Warum zum Beispiel hatte er sich veranlasst gesehen, in den letzten sechs Monaten so viel Zeit mit Rebecca und Stanmore zu verbringen? Gewiss, die beiden lagen ihm sehr am Herzen, doch das Zusammensein mit ihnen trug oft nichts dazu bei, seine Stimmung zu heben. Im Gegenteil. Es führte ihm nur immer wieder vor Augen, wie leer und belanglos sein Leben im Vergleich zu dem ihren war.
Offenbar hatte sich allen Widerständen zum Trotz der Wunsch nach Zugehörigkeit, nach Dauerhaftigkeit in Nicholas’ Herz geschlichen. Das war eine merkwürdige Empfindung, wie er sie noch nie verspürt hatte, obwohl er natürlich wusste, dass dieses Verlangen so alt wie die Menschheit war. Nichtsdestotrotz wehrte er sich dagegen. Er war mit seiner jetzigen Lage vollauf zufrieden.
Dachte er zumindest …
»Haben Sie ’nen halben Penny übrig, Sir? Nur ’nen halben Penny für meine Schwester un’ mich?« Aus dem dunklen Schatten der Bäume streckten sich ihm die dürren nackten Ärmchen eines Jungen entgegen. Nicholas blieb stehen, um den Kleinen näher zu betrachten.
»Einen halben Penny, Sir?« Vorsichtig kam die verwahrloste Gestalt, deren Füße in schmutzige Lumpen gehüllt waren, näher. Der Junge reichte Nicholas kaum bis zur Taille. Trotz der Dunkelheit bemerkte der Baronet, dass der Kleine bleich wie der Tod war, und hörte, wie er vor Kälte mit den Zähnen klapperte.
Nicholas schaute an den schmalen Schultern des Kindes vorbei und sah eine zusammengerollte Gestalt reglos unter dem Baum liegen. Die Arme und die Beine des anderen Kinds waren nackt. Strähnen langen dunklen Haars fielen ihm ins Gesicht.
»Ist das deine Schwester?«
Der Junge zupfte Nicholas am Ärmel. »Einen halben Penny, Sir …«
Als der Kleine eine torkelnde Bewegung machte, streckte der Baronet die Hand nach ihm aus und hielt ihn am Arm fest, um ihn zu stützen. Bestürzt bemerkte Nicholas, dass der Körper des Jungen nur von einem dünnen, zerlumpten Hemd bedeckt wurde. Er zog seine Handschuhe aus und nahm seinen Hut ab, um beides dem Jungen zu reichen.
»Einen halben Penny, Sir?«
Erst als Nicholas seinen Mantel ausgezogen hatte und den Jungen darin einhüllte, nahm er wahr, dass das Kind nach Alkohol roch.
»Wenn ihr beide mit mir kommt, bringe ich euch in ein Haus, wo ihr in Sicherheit seid. Dort bekommt ihr warmes Essen und warme Kleidung … und außerdem jeder einen Shilling.«
Der Junge starrte ihn verständnislos an und erwiderte kein Wort.
»Niemand wird dir oder deiner Schwester etwas zu Leide tun, Jungchen. Das verspreche ich dir.«
Nicholas wandte seine Aufmerksamkeit dem auf der Erde liegenden Mädchen zu, das wesentlich kleiner war als der Junge. Als der Baronet dem schlafenden Kind die verfilzten dunklen Haare aus dem Gesicht strich, blickte er in ein Antlitz von engelhafter Unschuld. Wie ihr Bruder hatte sie nichts als dünne Lumpen am Leibe, die kaum ihre Blöße zu verdecken vermochten. Er berührte ihr Gesicht. Es war eiskalt.
Unverzüglich nahm Nicholas das Kind in die Arme, erhob sich und drehte sich dem Bruder zu. Der Junge war verschwunden.
Da ihm das zerbrechliche Bündel aus Haut und Knochen, das er auf dem Arm hatte, jedoch größere Sorgen bereitete, machte er sich auf den Weg zum Angel Court in der Nähe der King Street. Dort gab es ein Haus, wo sich, wie er wusste, gute Menschen um das Kind kümmern würden, während er sich auf die Suche nach dem Bruder machte.
Der Verlust seines Mantels und seines Huts kümmerte ihn nicht weiter. Die konnte der Junge gerne haben. Was Nicholas beunruhigte, war das Geld, das der Kleine in den Taschen finden würde. Es war so viel, dass ein Mann sich vierzehn Tage lang davon betrinken konnte. Für ein Kind, das sich davon Schnaps und Bier kaufte, reichte es aus, um es zu töten.
Das Mädchen wog nicht mehr als ein Kätzchen. Mit finsterer Miene stellte Nicholas fest, dass auch die Kleine nach Alkohol stank. Der übermäßige Alkoholgenuss sowohl der Reichen wie auch der Armen war nach wie vor ein Fluch, der über England lag. Während die Reichen es sich jedoch leisten konnten, für sich und ihre Familien Sorge zu tragen, gaben die Armen ihr Laster frühzeitig an ihre Kinder weiter.
Als Nicholas an die Tür des Hauses am Angel Court klopfte, erschien ein Gesicht am Fenster. Auf den Klang seiner Stimme hin wurde rasch die Haustür geöffnet. Das strahlende Gesicht der alten Frau verdüsterte sich sofort, als sie das Bündel in Nicholas’ Armen sah.
»Ich habe sie im Park gefunden.« Er ging an ihr vorbei ins Haus. »Ich glaube, sie ist bewusstlos, weil sie zu viel getrunken hat … obwohl sicher auch die Kälte ihr Teil dazu beigetragen hat.«
Geschwind machte die alte Frau eine Tür auf und führte ihn in einen großen Raum, an dessen Wänden über ein Dutzend Betten standen, auf die das im Kamin brennende Feuer einen warmen Schein warf. Hier und da lugte eines der Kinder mit großen Augen neugierig unter der Bettdecke hervor.
»In welches, Sadie?«
Die alte Frau nahm einen Handarbeitskorb von einem leeren Bett, und Nicholas legte das Kind sanft auf die saubere Decke.
»Geh Martha holen, Schätzchen«, sagte Sadie zu dem Jungen, der in dem daneben stehenden Bett lag.
Während das Kind aus dem Zimmer eilte, trat Nicholas zurück und sah zu, wie die alte Frau dem Mädchen mit ihren runzligen Händen über das Gesicht und den Hals strich.
Obwohl er sich in diesen Dingen nicht sonderlich gut auskannte, schätzte er, dass die Kleine nicht älter als fünf war. Ihre kleinen, zu Fäusten geballten Hände lagen auf der Decke. Unter ihrem zerlumpten Kleid ragten schmutzige Füße hervor. Nicholas’ Blick wanderte zu dem dunklen Haar, das ihr unschuldiges Gesichtchen einrahmte. Trotz der Dreckkruste sah man, wie bleich ihre Wangen waren.
Während Nicholas sie betrachtete, dachte er fieberhaft nach und schmiedete Pläne. Die Stadt war ein heikler Ort für ein auf sich gestelltes Kind. Vielleicht konnte er die hilf- und obdachlose Kleine nach Solgrave bringen, wenn es ihr ein wenig besser ging. Stanmore hätte sicher nichts dagegen, und Rebecca würde begeistert darauf eingehen. Schließlich hatten sie auch schon Israel Obdach gewährt, der innerhalb von nur sechs Monaten zu einem völlig neuen Jungen geworden war. Auf dem Lande würde die Kleine gut gedeihen. Dort könnte sie auf die Dorfschule in Knebworth gehen. Dort könnte sie wieder ein Kind werden.
Sadie warf ihm einen scharfen Blick zu, der ihn aus seinen Gedanken riss. Er trat näher, und die Frau richtete sich auf.
»Das arme Ding hat bereits das Zeitliche gesegnet, Sir.«
Er starrte auf den Mund der Frau, während der Wunsch in ihm aufstieg, ihr zu widersprechen, ihre Worte anzuzweifeln, doch er riss sich zusammen.
Nachdem er Sadie kurz zugenickt hatte, wandte er sich ab und verließ das Haus.
Ohne auf die Kälte oder die Zeit zu achten, wanderte Nicholas Spencer durch die Straßen. Die Ungerechtigkeit eines solchen Todes schrie zum Himmel. Und um ihn herum gab es unzählige weitere unschuldige Kinder, die hilflos zu Grunde gingen. Was er bisher dagegen unternommen hatte, war eindeutig nicht genug.
Hier und da ein Obdach. Ein Haus, wo sie etwas zu essen und ein warmes Bett bekamen. Alles schön und gut, aber was geschah danach mit diesen Kindern? Inwiefern hatten seine unzulänglichen Akte der Nächstenliebe ihr Leben verändert? Was hatte er getan, um zu verhindern, dass sie betrunken oder missbraucht oder tot auf der Straße endeten?
Es musste noch mehr geben, das er tun konnte. Ein Haus auf dem Lande, wo sie gesund aufwachsen konnten. Eine Schule, wo sie lernen konnten, für sich selbst zu sorgen. Sie brauchten so etwas wie ein ständiges Zuhause.
Plötzlich fand er sich auf dem Berkeley Square wieder. Er starrte zu den dunklen Fenstern im Haus seiner Freunde hoch. Selbst mitten in der Nacht und im Winter strahlte dieses Haus etwas Warmes, Anheimelndes aus.
Nicholas wurde alt und hatte Angst davor. Dieses Eingeständnis schmerzte ihn weniger, als er erwartet hätte. Doch er hatte so lange gegen die Leere und Kälte seines Lebens angekämpft, dass es jetzt eine unglaubliche Erleichterung war, sich sein Elend einzugestehen.
Das unschuldige Gesicht des toten Kindes trat vor sein inneres Auge. Sein Leben war sinnlos und öde geworden, und es gab in der Tat wesentlich mehr, das er tun konnte. Allerdings setzte das einige Veränderungen voraus. Er musste ein neues Leben beginnen, musste ein richtiges Zuhause haben, wo er wahrhaftig Einfluss auf das Schicksal dieser verlorenen Seelen nehmen konnte.
Aber so etwas erforderte eine Ehefrau, und wo in aller Welt würde er die finden?
KapitelZwei
Waterford, Irland, August 1771
Wie ein monströses Lebewesen fraß sich das lodernde Feuer gierig durch die steinigen Felder. Rauch und Asche wirbelten auf und verdunkelten die Sterne, die vor kaum einer Stunde am nächtlichen Himmel aufgegangen waren. An ihre Stelle traten Funken und glühende Asche, die leuchtend in die Höhe schossen und rasch erstarben.
Unzählige mit Knüppeln bewaffnete Männer strömten ins Tal herab, um die Felder in Brand zu stecken. Die Strohdächer von Hütten loderten auf, während Dutzende von Männern, Frauen und Kindern voller Panik in die Dunkelheit rannten. Gegen solch einen Überfall konnte man sich nicht wehren. Es schien keine Fluchtmöglichkeit zu geben.
Unter einer Kuhhaut, die einer der Hütten als Tür diente, kroch ein schreiendes Baby nach draußen in das Inferno.
Auf den steinigen Feldern ringsum zerstörte das Feuer binnen weniger Minuten alles, was dort mit Schweiß und Mühe gesät und angebaut worden war – Gerste, Kartoffeln, Kohl, Weizen –, während die gierigen Flammen gen Himmel züngelten, der von Rauch geschwärzt war.
Nachbarn zerrten eine schreiende Mutter weg, die verzweifelt zu der feurigen Masse zurückblickte, die einmal ihre Hütte gewesen war. Man brachte sie zu dem einzigen Ort, der nicht in Flammen stand, dem sumpfigen Terrain nördlich der Hütten. Jenseits des stinkenden Schlamms und des Sumpfgrases lag ansteigendes Gelände, das Sicherheit versprach.
Ein einzelner Reiter preschte durch die Nacht und hielt auf die Gruppe der Bauern zu, deren Gestalten sich dunkel gegen das lodernde Inferno hinter ihnen abhoben.
Der Ritt über Land war mühselig gewesen, und es war keine Zeit geblieben, um Hilfe zusammenzutrommeln. Der Überfall hier hatte ohne Vorwarnung stattgefunden, ohne rechtliche Grundlage, ohne Rechtfertigung. Dergleichen geschah jetzt überall in Irland. Der Reiter schaute zu dem brennenden Dorf hinüber. Morgen würden diese Scheusale die Mauern der Hütten niederreißen. In einer Woche würden sie Gräben ausheben, um die Felder einzufrieden. Im nächsten Frühjahr würden dort Schafe und Rinder grasen, während die Pächter hier verloren umherirrten, durch ein Land, das eine tragische Veränderung durchmachte.
Die verzweifelten Schreie der Mutter hallten von den Hügeln wider, als diese auf den Reiter zustürzte.
Kurz darauf gab der Reiter seinem Pferd die Sporen und galoppierte auf die brennenden Häuser zu. Das Kind saß mitten zwischen den Hütten auf der Erde, die Hände gen Himmel gereckt, während um es herum glühende Asche niederregnete.
Als der Reiter das Kind erblickte, trieb er sein Pferd wie besessen durch die Feuerhölle. Eine Hütte stürzte mit lautem Krachen ein und übertönte einen Moment lang die Schreie des Kindes. Der Reiter saß ab, während die Marodeure durch den Rauch und die Flammen näher kamen. Nachdem der Retter das Kind auf den Arm genommen hatte, schwang er sich auf sein unruhiges Ross und preschte in die Dunkelheit davon.
Als sie den Hügel erreichten, rannte die Mutter ihnen mit tränenüberströmtem Gesicht entgegen und schloss ihr schreiendes Baby in die Arme.
»Gott segne dich, Egan!«, sagte sie mit erstickter Stimme.
KapitelDrei
Cork, Irland, ein Monat später
Längst war der Flickenteppich ordentlicher, vor kurzem abgeernteter Felder nördlich der Stadt Cork einer wilderen, felsigeren Landschaft gewichen. Die aus dem Kutschenfenster schauende Frau nahm die Umgebung mit dem Blick einer Künstlerin in Augenschein. Diese Gegend war so ganz anders als das durchweg flache Umland ihrer Heimatstadt Brüssel.
Die Landschaft war zweifellos nicht weniger grün als das Tiefland des Küstengebiets im Süden. Die dunkleren Farben zahlreicher Kiefern bildeten einen reizvollen Kontrast zum silbrigen Grün der bereits herbstlich gelb getönten Birken, mit denen die schroffen Hänge zu beiden Seiten des Tals bestanden waren. Wenn die Frau zum azurblauen, von grauen Wolkenfetzen durchzogenen Himmel hochblickte, dachte sie voller Genugtuung daran, dass es kaum Regen gegeben hatte, seit sie von der betriebsamen englischen Hafenstadt Bristol übergesetzt waren.
Die Kutsche war in gemächlichen Tempo den Biegungen des Flusses gefolgt, an dem eine überraschend gute Straße entlangführte. Gelegentlich waren sie an kleinen Gruppen schlichter Hütten vorbeigekommen, aber Alexandra Spencer hatte auch schon etliche prächtige Herrenhäuser zu Gesicht bekommen, die inmitten ausgedehnten Weidelands lagen. Die verstreuten Waldungen ringsum wurden allmählich immer dichter. Mit zufriedenem Lächeln wandte sie sich wieder ihren beiden Reisegefährten zu.
Ihre Tochter redete ohne Punkt und Komma, wie es bei einem sechzehnjährigen Mädchen nicht anders zu erwarten war. Als sie eine kurze Pause machte, um Luft zu holen, schaltete Lady Spencer sich ein.
»Also wirklich, Frances! Man muss mit dem Kopf nach unten von einer Burgmauer hängen … und einen Stein küssen, nur um die zweifelhafte Gabe der Redegewandtheit zu gewinnen? Was für einen Unsinn du doch von dir gibst, Mädchen!«
»Aber das stimmt, Mutter. Man nimmt an, der Stein sei ein Teil des Steins von Scone in Westminster. Insgesamt haben mir auf dem Schiff drei Matrosen erzählt, welche magische Wirkung es hat, wenn man den Stein in Blarney Castle küsst.«
»Nun, mir persönlich steht in keiner Weise der Sinn danach, etwas zu küssen, auf dem ein König gesessen hat … ganz gleich, ob es ein englischer oder sonst einer war.«
»Mutter!«, erwiderte Frances in schockiertem Entzücken.
»Aber was viel heikler ist … wie kommst du eigentlich dazu, dich mit Matrosen zu unterhalten? Wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass eine junge Frau stets darauf achten sollte, nie …«
»Aber Nicholas war doch bei mir.« Die junge Frau wechselte den Platz und setzte sich neben ihren Bruder, um sich bei ihm unterzuhaken. »Im Laderaum fand ein Preisboxkampf statt. Ich bin Nick lediglich nach unten gefolgt, um dabei zuzusehen.«
»Nicholas Edward …!«, fing Alexandra an zu schelten, besann sich aber eines anderen, als ihr Sohn sich von der vorbeiziehenden Landschaft abwandte und sie mit durchdringendem Blick ansah.
Während sich Alexandra Spencer mit der Hand über die Röcke strich, überlegte sie, wie sie ihre Missbilligung am angemessensten zum Ausdruck bringen konnte. Als ihre beiden Kinder jünger gewesen waren, war der zwischen ihnen bestehende Altersunterschied von achtzehn Jahren nicht weiter ins Gewicht gefallen. Doch da Frances jetzt zu einer jungen Frau heranreifte, musste Alexandra einen Weg finden, um Nicholas seine brüderlichen Pflichten klar zu machen.
Sie musterte ihren Sohn, dessen Aufmerksamkeit zum Kutschenfenster zurückwanderte. Als Frances ein kleines Kind gewesen war, hatte Nicholas in Oxford studiert. Einige Jahre später, als Fanny zur Schule gekommen war, hatte Nicholas bei der Einnahme von Quebec mitgekämpft. Und kurz danach war ihr Mann verschieden, so dass Nicholas den Titel und die Besitzungen seines Vaters geerbt hatte. Damals hatte Alexandra beschlossen, auf den Stammsitz ihrer Familie jenseits des Kanals zurückzukehren, um ihrem Sohn und seinen Angelegenheiten nicht im Wege zu sein. Natürlich hatte sie gehofft, dass er die Zeit nutzen würde, um sich ein eigenes Leben aufzubauen und eine Familie zu gründen.
Nun, das war noch nicht geschehen, und Alexandra befürchtete, dass sie und Nicholas zu viele Jahre voneinander getrennt gewesen waren, als dass sie jetzt noch in der Lage gewesen wäre, Einfluss auf ihn auszuüben – zumindest nicht auf direkte, offene Weise.
Frances, die nicht im Geringsten eingeschüchtert klang, fing wieder an zu plappern. »Wie mir erzählt wurde, kann man sich auch auf den Rücken legen und sich zurückbeugen, um den Stein zu küssen, während man an den Beinen von zwei kräftigen Armen festgehalten wird.« Sie machte eine Pause und runzelte die Stirn. »Ich glaube, außer dir, Nick, würde ich allerdings niemandem so weit vertrauen, um mich von ihm festhalten zu lassen.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass du noch größerer Redegewandtheit bedarfst, Fanny«, erwiderte Nicholas gleichmütig. »Du bist in dieser Hinsicht jetzt schon viel zu perfekt.«
Das Mädchen kicherte vergnügt. »Du solltest dir deine Schmeicheleien lieber für deine geliebte Clara aufheben, statt sie an deine Schwester zu verschwenden, weißt du.«
»Meine geliebte Clara?«, entgegnete Nicholas Spencer in scharfem Ton.
Frances warf ihrer Mutter einen fragenden Blick zu. Nachdem diese ihr ermutigend zugenickt hatte, wandte sie sich wieder ihrem Bruder zu.
»Nun, wir sind doch auf dem Wege nach Woodfield House, nicht wahr? Und du hast die Einladung von Sir Thomas Purefoy, Claras Vater, angenommen, vierzehn Tage auf dem Landsitz der Familie in diesem hinreißenden Land zu verbringen, nicht wahr?«
»Frances, ich wünschte, du würdest es unterlassen, das Wort hinreißend zu benutzen …«, warf Lady Spencer ein.
»… Und im letzten Frühjahr hast du diese extrem attraktive junge Frau in London zu nicht weniger als drei gesellschaftlichen Veranstaltungen begleitet, nicht wahr? Soll ich fortfahren?«
»Setz mich nicht unter Druck, Fanny. Ich merke auch ohne deine Hilfe oder die unserer geschätzten Mutter, wie sich die Schlinge immer mehr zusammenzieht.« Er fuhr sich mit dem Finger über die Innenseite seines hohen Hemdkragens. Dann sah er die beiden Frauen nacheinander mit bedeutungsvollem Blick an. »Wir machen diese Reise nicht um meinetwillen, sondern zum Besten von euch beiden. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Erziehung und Ausbildung einer jungen Frau, dass sie außer den verwöhnten Gören, mit denen sie in der Schule Umgang gehabt hat, auch noch andere Mitglieder der Gesellschaft kennen lernt.«
»Lügner!« Frances gab ihm einen Klaps auf den Arm.
Nicholas zuckte die Achseln. »Na schön, wie du willst. Wir sind also meinetwegen hier … weil ich Pferde liebe. Sir Thomas soll ein ganz vorzügliches Gestüt haben …«
»Das ist unglaublich unmanierlich von dir, Nick«, schimpfte Frances und verzog schmollend das hübsche Gesicht. Sie zog den Arm, mit dem sie sich bei ihm untergehakt hatte, zurück und rutschte von ihm weg. »Ich muss sagen, wenn du so lügst, zerstörst du das schöne Bild, das ich von meinem einzigen Bruder habe. Ich werde während unseres ganzen Aufenthalts hier kein Wort mehr mit dir reden.«
Als Alexandra sah, wie zufrieden Nicholas offenbar mit dieser Entwicklung der Dinge war, streckte sie die Hand aus und berührte ihren Sohn am Knie. »Bitte bring das sofort in Ordnung. Wenn sie nicht mehr mit dir redet, bedeutet das, dass sie sich ohne Ende bei mir beklagen wird. Wenn du es nicht schaffst, dich mit dem kleinen Zankteufel auszusöhnen, steige ich an der nächsten Poststation aus und fahre ohne euch zwei nach London zurück.«
Nicholas dachte eine Weile über diese zweite Drohung nach – länger, als seiner Mutter lieb war. Schließlich drehte er sich seiner Schwester zu. Sein Ton verriet Lady Spencer, wie ernst er das, was er sagte, meinte.
»Was Clara und meine diesbezüglichen Absichten betrifft, so habe ich sorgfältig darauf geachtet, dass es zu keinen Missverständnissen kommt. Das Mädchen ist ungefähr halb so alt wie ich.«
»Das stimmt überhaupt nicht!«, berichtigte ihn Fanny, die wieder näher an ihren Bruder heranrutschte. »Clara Purefoy ist letzten Winter achtzehn geworden. Du bist vierunddreißig. Seit du sie kennst, bist du nie doppelt so alt gewesen wie sie.«
»Herrgott noch mal, was soll man denn mit einem Kind von achtzehn anfangen?«
Lady Spencer zog eine Augenbraue hoch. »Den zahlreichen Geschichten nach zu urteilen, die zu mir nach Brüssel dringen, würde ich annehmen, dass du recht geübt darin bist, mit Frauen aller Altersgruppen umzugehen.« Alexandra tätschelte ihrem stirnrunzelnden Sohn das Knie. »Dein Unbehagen, mein Lieber, rührt von dem Gedanken an Ehe und Verantwortung her. Claras Alter ist nur ein Vorwand, und du wirst sehen, dass deine Befürchtungen sich rasch in nichts auflösen.«
»Wirklich, Nick …«, zirpte Frances von der Seite her. »Sie ist alles, was du dir bei einer Ehefrau nur wünschen kannst.«
»Und als einziges Kind bringt Clara ein beträchtliches Vermögen mit in die Ehe.«
»Nicht, dass du das nötig hättest«, warf seine Schwester ein.
»Aber in Anbetracht deines Lebensstils kann es nichts schaden, noch ein bisschen mehr zu haben, mein Lieber.« Lady Spencer wandte den Blick ab und schaute aus dem Kutschenfenster. Im Moment wollte sie ihn nicht allzu sehr unter Druck setzen. »Was ich allerdings rundum entzückend finde, ist, wie sehr die ganze Familie von dir angetan zu sein scheint.«
»Aber Mutter, jeder weiß, wie vorteilhaft es ist, wenn die eigene Tochter jemanden mit einem Titel heiratet. Schließlich ist selbst ein Baronet, dessen Ruf so schlecht wie der von Nick ist …«
»Darum geht es nicht!« Alexandra schnitt ihrer Tochter mit einer ungeduldigen Handbewegung das Wort ab. »Was sie bezaubert hat, ist die warmherzige Persönlichkeit deines Bruders. Seine Bildung. Seine beispielhafte militärische Laufbahn. Seine Ehrenhaftigkeit …«
»Bevor er zwanzig wurde.«
Lady Spencer warf ihrer Tochter einen strengen Blick zu. »Frances Marie, würdest du bitte deine Zunge im Zaum halten.« Lady Spencer strich von neuem ihre Röcke glatt und wandte sich ihrem Sohn zu, den abermals die vorbeiziehende Szenerie in Bann geschlagen hatte. »Wo war ich stehen geblieben?«
»Du hattest gerade deinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, aus der Kutsche auszusteigen«, erwiderte Nicholas mit finsterer Miene, »damit ihr beide nach London zurückfahren könnt.«
Entsetzt beobachteten der Bischof und sein Sekretär, wie mehrere der weiß behemdeten Rebellen auf die Flanken der Pferde einpeitschten, so dass die fahrerlose Kutsche die Landstraße entlangrumpelte. Die Bedienten des Bischofs, die man gezwungen hatte auszusteigen, rannten dem Gefährt hinterher.
»Das wird euch teuer zu stehen kommen, ihr dreckigen Schurken.« Die Stimme des Bischofs zitterte vor Zorn. »Eure Masken und eure verteufelten Leinenhemden werden euch nicht das Geringste nutzen, wenn man euch einen Strick um den Hals legt und euch vor das Antlitz Gottes schickt, damit er über euch richtet. Die Rache ist mein, spricht der Herr.«
Fünf Reiter schauten zu, wie zwanzig Männer zu Fuß die beiden Geistlichen umzingelten. Das Schweigen der Gruppe war entnervend. Bevor der Bischof wieder etwas sagen konnte, erspähte sein Sekretär – ein beleibter junger Mann mit geröteten Wangen – eine kleine Lücke im Ring der Angreifer. Die Gelegenheit beim Schopfe packend, ließ er den Ranzen, den er bisher gegen die Brust gepresst hatte, fallen und rannte los. Eine dicke, mit Papieren voll gestopfte Ledermappe und ein prall gefüllter Geldbeutel kullerten auf die Straße. Niemand machte sich die Mühe, den verängstigten Sekretär festzuhalten.
»Trotz eurer Masken kenne ich jeden Einzelnen von euch«, bluffte der Bischof. »Ich kenne eure Verwandten und die schmutzigen Löcher, in denen ihr lebt.«
Einige der Angreifer ruckten drohend näher, so dass der alte Geistliche gegen einen Baum zurückwich.
»Wenn ihr mich anrührt, ihr Hunde, werde ich Gottes Zorn auf euch herabrufen. Ich bin der Diener des Herrn, und ihr seid die Brut des Teufels. Ihr seid …« Erschrocken keuchte er auf, als von hinten ein Seil um seine Taille geschlungen und er zurückgerissen wurde, so dass er heftig gegen den Baum prallte.
»Das ist dafür, dass Sie die Pächter nördlich von Kinsale gezwungen haben, den Zehnten zu zahlen, obwohl das Unwetter letzten Monat ihre Ernte vernichtet hatte.«
Der Bischof sah angsterfüllt zu dem rechts von ihm stehenden maskierten Mann hin, der diese Worte gesprochen hatte. Im letzten Frühjahr hatte er von einem papistischen Priester gehört, den man in der Nähe von Kildare an einen Baum gefesselt hatte. Der arme Bursche hatte es zwei Tage lang ohne Essen und Trinken aushalten müssen, bis ihn schließlich jemand gefunden und losgebunden hatte. Vor nicht ganz drei Wochen hatte es in der Nähe von Caher Castle einen weiteren Zwischenfall dieser Art gegeben, bei dem das Opfer ein Kurat gewesen war. Daran wollte er lieber gar nicht denken. Natürlich war keiner der Geistlichen getötet, sondern nur schwer misshandelt worden, und beide hatten sich halb zu Tode geängstigt.
Zwei Männer packten die Hände des Bischofs und banden ihm ein Seil um die Handgelenke.
»Das ist für Ihre Weigerung, in Ulster Kinder zu taufen, bloß weil die Familien nicht die höheren Gebühren aufbringen konnten.«
»Das war ich nicht! Ich habe keinen Einfluss auf das, was da oben vor sich …« Abrupt verstummte der Bischof, als ein weiteres Mitglied der Gruppe auf ihn zutrat und ihm ein Seil um den Hals schlang. »Nein! Ich flehe euch an …«
Der Geistliche dachte an die Unterredung zurück, die er vor knapp drei Tagen mit Sir Robert Musgrave, dem Magistrat der Gegend, gehabt hatte. Man hatte ihm versprochen, alle Priester vor solchen Überfällen durch die Whiteboys zu schützen. Im Gegenzug hatte er angeboten, die Landbesitzer um Youghal herum zu unterstützen, die ihre Pächter vom Ackerland vertrieben, damit dieses in Weiden umgewandelt werden konnte. Abschließend hatte man ihm seine persönliche Sicherheit garantiert. Garantiert! Und wo war dieser verdammte Magistrat jetzt?
»Möchten Sie noch ein letztes Gebet sprechen, Eure Exzellenz? Vielleicht um den Herrn um Vergebung zu bitten, weil Sie seinen Namen befleckt und sich schamlos bereichert haben?«
Der Blick des Geistlichen heftete sich auf das Seil, das um seinen Hals baumelte. Die Geistlichen, die bisher überfallen und misshandelt worden waren, waren einfache Gemeindepfarrer gewesen. Er war Bischof. Er konnte nicht umhin, sich zu fragen, ob diese Leute ihn tatsächlich töten würden, um ihre Botschaft laut und deutlich im ganzen Land publik zu machen.
Die Worte, die im nächsten Moment aus ihm herauszusprudeln begannen, waren in der Tat ein Gebet. Ein Gebet, in dem er um Vergebung für genau die Dinge bat, deren man ihn beschuldigte.
Als die Kutsche plötzlich langsamer fuhr, steckte Nicholas den Kopf zum Fenster hinaus. Er hatte zwar gehört, dass Reisende – in diesem Lande wie auch zu Hause – gelegentlich von Straßenräubern überfallen wurden, doch was er da erblickte, war der seltsamste Bandit, den er je zu Gesicht bekommen hatte.
Direkt vor ihnen gabelte sich die Straße und zweigte scharf nach rechts ab. Ein fetter Geistlicher kam, wild mit den Armen fuchtelnd, die Abzweigung entlanggeschnauft und stieß jämmerliche Schreie aus, in die sich zusammenhanglose Worte mischten.
Nicholas rief dem Kutscher zu, Halt zu machen, und stieg aus.
»Whiteboys … Bischof … töten … da … da …!« Der Mann, der vor Angst fast den Verstand verloren zu haben schien, klammerte sich Halt suchend an Nicholas. »Retten Sie mich … helfen Sie … Bischof …!«
Nicholas machte sich von dem Mann los und übergab ihn seinem Kammerdiener, der auf dem Pferd seines Herrn hinter der Kutsche hergeritten war. Als Frances die Tür öffnete, um auszusteigen, gab er ihr mit einer Geste zu verstehen, im Wagen zu bleiben. Er spähte in die Richtung, aus der der Geistliche gekommen war. Der nach Westen ansteigende Abhang war dunkel und dicht bewaldet. Von da, wo Nicholas stand, war nichts zu sehen.
»Für die Damen wäre es am sichersten, wenn wir weiterfahren würden, Sir«, stellte der Kutscher fest. »Die Einheimischen nennen sie Shanavests. Das ist die irische Bezeichnung für Whiteboys. Ein lästiger Haufen … wenn Sie mich fragen.«
Der Geistliche, der gegen die Kutsche gesunken war und sich bemühte, wieder zu Atem zu kommen, richtete sich plötzlich auf. »Aber … aber Sie können ihn nicht einfach … im Stich lassen … Die werden ihn töten.«
»Schon möglich«, erwiderte der Kutscher. »Aber diese Jungs dürften bis an die Zähne bewaffnet sein, Sir. Das sind richtige Rebellen, die immer in ziemlich großer Anzahl auftauchen. Es wäre gefährlich … vor allem natürlich für die Damen … nicht weiterzufahren.«
»Wie viele waren es?«, fragte Nicholas den Pfarrer.
»Fünf Reiter … und etwa zwei Dutzend zu Fuß, würde ich sagen … Ich weiß aber nicht, ob ich alle von ihnen gesehen habe.«
Nicholas nahm dem Kammerdiener die Zügel seines Pferdes ab.
»Kann ich mit dir kommen, Nick?« rief Frances ihm aufgeregt zu.
Als er sich umdrehte, sah er, wie seine Mutter energisch die Kutschentür zumachte, um Fanny am Aussteigen zu hindern. Nicholas wies den Kutscher an, geradenwegs nach Woodfield House zu fahren, während der Kammerdiener hinten auf dem Wagen Platz nahm.
Dann wandte Nicholas sich dem Geistlichen zu. »Rein mit Ihnen.«
Dankesworte murmelnd, riss der Sekretär des Bischofs die Kutschentür auf und sprang mit einer Behändigkeit in den Wagen, die man ihm bei seiner Leibesfülle gar nicht zugetraut hätte.
»Der neue Magistrat, Sir Robert Musgrave, hat eine Prämie auf die Köpfe dieser Jungs ausgesetzt«, sagte der Kutscher in vertraulichem Ton zu Nicholas. »Es heißt, er habe vor, jeden Shanavest, den er schnappt, auf dem alten Buttermarkt in Cork hängen zu lassen. Also, wenn Sie mich fragen, dann ist das die falsche Methode, da die meisten der papistischen Bauern diese Rebellen vergöttern. Aber was weiß ich denn schon? Bin ja nur ein einfacher Kutscher.«
Bevor die Kutsche davonfuhr, steckte Lady Spencer den Kopf zum Fenster heraus. »Es gibt Kämpfe, die man vermeiden sollte, Nicholas. Ich mache mir Sorgen um dich. Es sind einfach zu viele … und wir befinden uns in einem fremden Land.«
»Keine Angst, Mutter. Ich will nur nahe genug an sie heran, um alles genau beobachten zu können.«
»Warum wartest du dann nicht, bis der andere Wagen eintrifft? Dann könnten die Diener dir helfen …«
»Ich komm schon zurecht.« Er bedeutete dem Kutscher loszufahren. »Sieh einfach zu, dass du meine Schwester unter Kontrolle hast.«
Nicholas wartete, bis die Kutsche hinter der Straßenbiegung verschwunden war. Dann saß er auf, zog seinen Degen und gab seinem Pferd die Sporen.
Die Schneide der Messerklinge ließ eine dünne weiße Linie auf der geröteten runzligen Haut am Hals des Mannes zurück.
Der entsetzte Bischof hatte ihnen alles, was ihm nur einfiel, im Austausch gegen sein Leben angeboten – Geld, den Erlass von Kirchengebühren, ein ganzes Jahr lang, Taufen, Eheschließungen, Begräbnisse … alles.
Da sie erledigt hatten, was sie hergeführt hatte, gab der Anführer der Gruppe den Männern mit einem Zeichen zu verstehen, dass sie sich zurückziehen sollten. Den zitternden Geistlichen, der mit fest geschlossenen Augen Gebete und Versprechungen vor sich hinmurmelte, ließ man gefesselt am Baum stehen. Die prächtige Kleidung des Mannes war mit Dreck besudelt. Außer ein paar Kratzern im Gesicht hatte er äußerlich keinen Schaden davongetragen.
»Denken Sie an den heutigen Tag zurück, falls es Ihnen wieder einmal in den Sinn kommen sollte, etwas mit dem Magistrat auszuhandeln«, flüsterte ein junger Riese von einem Mann dem Bischof drohend ins Ohr, während er sein Messer in die Scheide zurücksteckte. »Wir werden Sie immer zu finden wissen.«
Der Anführer sah zu, wie der junge Riese dem Geistlichen in die Seite boxte, bevor er sich davonmachte. Obwohl das Seil den alten Mann daran hinderte, sich vor Schmerz zusammenzukrümmen, spiegelte sich dieser deutlich in seinem Gesicht wider.
Der Beutel mit Münzen wurde geleert. Die zuvor aus der Kutsche des Bischofs geholte Beute wurde in Säcke verteilt und davongetragen. Die Gruppe zerstreute sich so lautlos und unerwartet, wie sie gekommen war. Nur der maskierte Anführer, der auf einem prächtigen Pferd saß, blieb zurück.
Nachdem Nicholas sein Pferd ein Stück weiter unten an einem Birkenast festgebunden hatte, versteckte er sich in einem Kiefernwäldchen, um zu beobachten, was vor sich ging. Nach einer Weile hob der Bischof den Kopf und blickte zu dem einzelnen Reiter hoch.
»Bitte töten Sie mich nicht!«, bettelte der Mann, während Pferd und Reiter langsam auf ihn zukamen. Unverzüglich schlossen sich Nicholas’ Finger fester um den Griff seines Degens. Lautlos bewegte er sich vorwärts. Der Anführer der Rebellen hatte zwar eine Pistole im Gürtel stecken, doch Nicholas hoffte, den Mann überrumpeln zu können, bevor dieser dazu kam, zu ziehen und zu feuern.
»Ich gebe meine Schuld ja zu! Ich biete Ihnen allen weltlichen Besitz, den ich habe … ich …« Als der Reiter rasch ein Messer aus dem Gürtel zog, wurde der alte Mann kreidebleich. »Ich … ich …«
Nicholas stürmte vor, doch kurz bevor er die Straße erreichte, blieb er abrupt stehen, da er sah, dass der Rebell sich nach unten beugte und dem Bischof die Handfesseln durchschnitt.
»Lehren Sie Ihre Leute Barmherzigkeit und Mitleid, Pfaffe. Das sind Tugenden, die ihnen fehlen.«
Die Stimme war heiser und leise, doch irgendetwas in ihrem Ton ließ Nicholas aufmerken. Als der Reiter sein Pferd in seine Richtung lenkte, ging er rasch hinter einem Baum in Deckung und steckte seinen Degen in die Scheide.
Sobald das Pferd den Baum passierte, hinter dem er sich versteckt hatte, sprang Nicholas auf die Straße, packte den Reiter beim Hemd und riss ihn aus dem Sattel. Sie stürzten beide zu Boden. Die Pistole des Rebellen flog in hohem Bogen in das Gebüsch am Rande der Straße.
Der Rebellenanführer rollte sich zur Seite und schnappte sich einen großen Stein, doch Nicholas war schneller. Als der andere Mann den Stein nach ihm warf, hob er die Hand und lenkte das Wurfgeschoss von seinem Kopf ab. Dann machte sein Gegner zu Nicholas’ Enttäuschung kehrt und rannte in Richtung Wald. Ohne auch nur einen Moment nachzudenken, setzte der Engländer ihm nach.
Der Mann war klein, aber extrem schnell und agil. Nicholas’ lange Beine ermöglichten es ihm jedoch, den Rebellen nicht weit von der Straße entfernt einzuholen. Gerade als er im Begriff war, sich von hinten auf ihn zu werfen, wirbelte der Bandit herum und versuchte, ihm in die Weichteile zu treten. Nicholas wich zur Seite aus, so dass der Tritt ihn an der Hüfte traf, und stürzte sich auf den Mann, den er mit einem rechten Haken zu Boden streckte. Dann kniete er sich auf den Maskierten und holte aus, um ihm einen weiteren Schlag zu versetzen. In dem Moment erstarrte er.
Der Hut des Rebellen lag neben ihm auf der Erde, und das Tuch, das sein Gesicht verdeckt hatte, war heruntergerutscht. Voller Verblüffung blickte Nicholas in das Gesicht einer Frau, die ihn mit finsterer Miene anstarrte. Kein Wunder, dass es so leicht gewesen war, sie vom Pferd zu reißen.
Locken schwarzen Haars rahmten ein höchst attraktives Gesicht ein. Schwarze Augen, dunkel wie die Nacht, warfen ihm hasserfüllte Blicke zu. Die eine Seite ihres Munds war bereits dabei, von dem Schlag anzuschwellen. Ohne nachzudenken, langte er nach unten, um die blutige Lippe zu berühren, doch sie schlug seine Hand weg und fauchte ihn auf Gälisch an.
»Ich … Mir fehlen einfach die Worte.«
Die Frau stieß abermals einen längeren gälischen Fluch aus, den Nicholas mit hochgezogener Augenbraue quittierte.
»Wenn ich Sie wäre, würde ich meine Worte ein wenig zügeln, meine kleine Wildkatze.« Er griff in die Manteltasche und holte ein Taschentuch heraus. »Ich bin zwar bereit, Ihnen die Beschimpfungen zu vergeben, die Sie mir an den Kopf werfen, aber müssen Sie auch noch meinen Vater, meine Mutter, meine Frau und mein Pferd beleidigen? Das geht wirklich ein bisschen zu weit.«
Das Blut, das aus ihrem Mund kam, sickerte ihr über die Wange. Als er versuchte, es abzuwischen, fing sie an, wild um sich zu schlagen. Nicholas packte sie bei den Handgelenken, drückte ihre Arme nach oben und hielt sie mit einer Hand fest.
»Gute Güte, ich will Ihnen doch nichts zu Leide tun.«
Als er das Blut mit dem Taschentuch abtupfte, schaute sie ihn unverwandt an. Er sah ihr in die dunklen Augen, unendlich lange, wie es ihm vorkam, denn die Zeit schien still zu stehen. Die Frau war von hinreißender Schönheit, und in ihren Augen loderte ein Feuer, wie er es noch nie gesehen hatte.
Er drückte ihren Körper nach wie vor mit seinem Gewicht in das Farnkraut und die Blätter, die den Boden bedeckten. Sein bewundernder Blick glitt über ihre Brüste, die sich unter dem weißen Kittel hoben und senkten, verweilte auf ihrer heftig pulsierenden Halsschlagader und wanderte schließlich zu ihrer vollen, sinnlichen Unterlippe weiter. Die Verletzung, die er ihr zugefügt hatte, erfüllte ihn mit schmerzlichem Bedauern, doch schon im nächsten Moment zogen ihre magischen Augen ihn wieder in ihren Bann.
»Wer sind Sie?«, fragte er heiser, während er ihr das Taschentuch sanft gegen die Lippe drückte. Er musste gegen den Impuls ankämpfen, seinen Mund auf ihr Gesicht, ihren Hals zu pressen, sich auf sie zu werfen, um herauszufinden, ob sie dasselbe körperliche Verlangen verspürte, das ihn befallen hatte. Die Anziehung war so stark, dass Nicholas sich zwang, sie loszulassen. Abrupt stand er auf und streckte ihr stirnrunzelnd die Hand hin, die sie jedoch nicht ergriff. Daraufhin packte er sie beim Arm und zog sie unsanft hoch. Auch danach hielt er sie weiterhin fest.
»Ich würde Ihnen raten, mir einige Erklärungen zu geben … bevor die Männer des Magistrats eintreffen.« Sie sagte kein Wort, sondern blitzte ihn nur mit ihren dunklen Augen trotzig an. »Ist es bei den Whiteboys Sitte, Frauen für sich kämpfen zu lassen?«
Er war so damit beschäftigt, sich von dem Bann zu befreien, in den sie ihn gezogen hatte, dass er gar nicht bemerkte, wie sie nach dem Messer in ihrem Gürtel griff. Der Stich, den sie ihm versetzte, veranlasste ihn, vor Schreck und Schmerz die Hand wegzureißen. Nicholas warf kurz einen Blick auf die Wunde. Mehr Zeit brauchte die Frau nicht. Bevor er etwas unternehmen konnte, war sie auf und davon.
Als er zum Waldrand gelangte, saß die Frau bereits auf ihrem Pferd, das mit Windeseile davongaloppierte. Nicholas hob die zu seinen Füßen liegende Pistole auf und steckte sie in seinen Gürtel. Dann ging er in den Wald zurück, um auch noch ihren Hut zu holen.
Er zog seinen Mantel aus, dessen Ärmel mit Blut befleckt war. Die Wunde in seinem Unterarm war nicht der Rede wert. Nachdem er sie mit dem Taschentuch, das er immer noch in der Hand hielt, verbunden hatte, zog er seinen Mantel wieder an. Er starrte in die Richtung, in die sie verschwunden war.
»Eine Frau«, murmelte er, während er die Straße entlang zu dem Geistlichen ging, der gerade dabei war, sich von seinen Fesseln zu befreien.
»Sie haben ihn vom Pferd gezogen. Haben Sie sein Gesicht gesehen?«
Der Mann starrte auf den Hut, den Nicholas in der Hand hatte.
»Der Magistrat hat eine große Belohnung auf ihn ausgesetzt, wissen Sie. Vor allem auf ihn!«
»Wer ist er?«
»Der Schurke ist einer ihrer Anführer. Auf seinen Kopf ist die größte Prämie ausgesetzt. Er nennt sich Egan … obwohl das zweifellos ein angenommener Name ist.«
»Zweifellos«, antwortete Nicholas zerstreut, während er den Hut betrachtete.
KapitelVier
»Ich habe ganz entschiedenniemandes Gesicht gut genug gesehen, um den Betreffenden beschreiben zu können.«
Sir Thomas Purefoy runzelte die Stirn und machte sich wieder daran, erregt im hell erleuchteten Blauen Salon von Woodfield House auf und ab zu schreiten. Nicholas’ Mutter und seine Schwester Frances saßen gemütlich auf einem Sofa vor dem Kamin und tranken Tee, während Lady Purefoy und Clara um ihren verletzten Gast herumflatterten wie Schmetterlinge um eine Flamme. Gerade hatte die irische Haushälterin Fey, eine Frau mittleren Alters, die Wunde an seinem Unterarm mit einem sauberen Leinentuch verbunden. Der Stich war nicht sonderlich tief, da der dicke Stoff seiner Kleidung das Messer abgefangen hatte, und Nicholas fand das Gewese, das man um ihn machte, ein wenig übertrieben. Trotzdem ließ er sich widerspruchslos von der rothaarigen Frau verarzten.
Sir Thomas blieb abrupt vor ihm stehen. »Aber Sie sind sicher, dass derjenige, mit dem Sie handgemein geworden sind, der Anführer der Rebellen war, ja? Sie sind sich sicher, dass es Egan war?«
»Nicht im Geringsten. Ich wusste ja vorher gar nichts über diese Leute. Ich gebe nur wieder, was Bischof Russell hinterher gesagt hat.«
»Und der müsste es eigentlich wissen«, murmelte Sir Thomas, um anschließend wieder erregt hin und her zu laufen.
Als Fey ihre Sachen in einen Korb packte, dankte Nicholas ihr und erhob sich.
»Wenn Sie gestatten«, sagte er, indem er sich vor Lady Purefoy verbeugte, »werde ich jetzt auf mein Zimmer gehen und die Kleidung wechseln.«
»Aber natürlich, Sir Nicholas.« Die blauäugige, rundgesichtige Frau machte einen Knicks, um gleich darauf nach der Hand ihrer Tochter zu greifen. »Wie unaufmerksam von mir! Clara, meine Liebe, was hältst du davon, unsern Gast nach oben zu begleiten und ihm sein Zimmer zu zeigen? Vielleicht kannst du ihm dabei auch einen kurzen Abriss der Geschichte von Woodfield House geben. Das Ganze ist wirklich recht interessant, Sir Nicholas.«
Errötend kam die junge blonde Frau der Aufforderung ihrer Mutter nach und führte Nicholas aus dem Zimmer, der ganz bewusst den schelmischen Blick ignorierte, den Fanny ihm zuwarf.
Das nur wenige Stunden von Cork entfernte Woodfield House war ein eindrucksvolles, mit Efeu bewachsenes Gebäude aus Stein, das auf einem hohen, nach Süden gehenden Hügel lag. Das gegenwärtige Herrenhaus bestand, wie Clara Nicholas mitteilte, seit über einhundert Jahren und war auf den Ruinen eines früheren Gebäudes beziehungsweise Schlosses errichtet worden.
»Das Gebäude hat vier Stockwerke …« Die sanfte Stimme der jungen Frau hallte in den Gängen wider, die sie entlangschritten. »… obwohl nur zwei davon von der Familie bewohnt werden. Im Erdgeschoss befinden sich die Vorratsräume, die Küche, die Brauerei sowie die Gesindestube. Die Räume im obersten Stockwerk werden ebenfalls von der Dienerschaft genutzt. Auf dieser Etage liegen mehrere Salons, das Arbeitszimmer meines Vaters, die Bibliothek und ein Saal, den wir manchmal benutzen, wenn wir Empfänge oder Ähnliches geben.«
Als sie am Fuße der Treppe angelangten, legte Nicholas Clara die Hand auf den Ellbogen. Sie errötete noch tiefer und senkte züchtig den Blick, was ihn daran erinnerte, warum sie ihn schon bei ihrer ersten Begegnung in London so fasziniert hatte. Sie war nicht nur schön, sondern auch bescheiden und zurückhaltend – Tugenden, die er bei Frauen immer attraktiv gefunden hatte.
Das war das erste Mal, dass sie seit seiner Ankunft allein waren. Genauer gesagt war es sogar das erste Mal, dass sie seit ihrer Begegnung in London allein waren. Sir Thomas und seine Frau wurden sich seiner Absichten allmählich ein bisschen zu sicher … was Nicholas ein gewisses Unbehagen bereitete.
Sein Blick fiel auf ihre Lippen, und er überlegte, ob er sich die Freiheit nehmen sollte, von den anderen Reizen der jungen Frau zu kosten. Wenn er diesen Dingen mehr Aufmerksamkeit schenkte, würde ihn der zwischen ihnen bestehende Altersunterschied vielleicht nicht mehr ganz so verdrießlich stimmen.
Und dann war da noch eine andere Sache, die er unbedingt vergessen musste, nämlich das Gesicht der Frau, die ihm unterwegs begegnet war und die ihm seither nicht mehr aus dem Kopf ging.
Da außer ihnen niemand im Korridor und auf der Treppe war, streckte Nicholas die Hand aus und drückte Claras Kinn nach oben, bis er ihr unverwandt in die blauen Augen sehen konnte.
»Fürs Erste habe ich genug über das Haus erfahren. Jetzt möchte ich etwas über Sie erfahren, und zwar, ob Sie mich vermisst haben, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.«
»Ich … nun … ich habe … Sie vermisst … Sir Nicholas.«
Als Nicholas sah, wie sie sich mit der Spitze ihrer rosafarbenen Zunge unbewusst über die Lippen fuhr, wusste er, dass dies eine günstige Gelegenheit war, um weiterzumachen. Doch der stechende Schmerz, den er in diesem Moment in seinem Arm verspürte, brachte ihn von dem Gedanken ab. Er ließ ihr Kinn los und schaute die steile Treppe hoch.
»Ich habe mich ebenfalls auf diesen Besuch gefreut«, erwiderte er, indem er sich anschickte, die Treppe hochzugehen.
Ob sie enttäuscht war, vermochte er nicht festzustellen, da sie die ganze Zeit über den Blick auf die an der Wand hängenden Familienporträts richtete.
»Was können Sie mir über diese Rebellengruppe mitteilen, die der Bischof als Whiteboys bezeichnet hat?«
»Ich … tja … nicht viel. Jedenfalls nicht mehr als … als Gerüchte.«
Ihr Gestammel veranlasste ihn, sie scharf anzusehen. Obwohl ihr Gesicht keine Gefühle zeigte, bemerkte Nicholas, dass ihre Finger nervös an den Borten herumzupften, mit denen die Taille ihres Kleides besetzt war.
»Ich habe einige Zeit in der Gesellschaft von Bischof Russell verbracht, während wir versuchten, seine Kutsche und seine Diener einzuholen. Der Mann hatte eine Menge über die Rebellen zu sagen. Er hat mir ausführlich ihre Überfälle auf Geistliche und Landbesitzer geschildert. Er hat sie als Diebe und Mörder bezeichnet, die keine Moral hätten, als Männer, die weder die Autorität des Königs noch die der Kirche anerkennen.«
»Es liegt natürlich ganz in Bischof Russells eigenem Interesse, solche Dinge zu sagen. Doch man könnte auch der Meinung sein, dass die Shanavests bessere Verfechter der Moral sind als die Geistlichkeit, da sie sich für Menschen einsetzen, die kontinuierlich bis zum Weißbluten ausgepresst werden. Aus der Sicht des Bischofs wäre es freilich töricht, wenn er ihnen nicht bei jeder Gelegenheit Schlechtes nachsagen würde.«
»So, wie Sie das ausdrücken, könnte man annehmen, dass Sie dieser Gruppe durchaus freundlich gesinnt sind, Miss Clara.«
Die Borten an ihrem Kleid waren inzwischen völlig zerzupft. »Ich … nein … Sir Nicholas. Ich habe nur eine Ansicht wiedergegeben, die … die viele unserer Diener und Pächter haben. Viele von denen sind papistischen Glaubens.«
Dann sagte sie kein Wort mehr, bis sie zur offenen Tür seines Zimmers gelangten. Nicholas’ Kammerdiener wartete bereits auf ihn.
»Danke für die Führung, Miss Clara. Zu welcher Zeit werde ich unten erwartet?«
Clara schaute nervös den Korridor entlang. »Meine Mutter … nun ja, sie hatte gehofft, Ihnen heute Nachmittag den Rest unserer Familie vorstellen zu können … vor dem Dinner.«
»Ich dachte eigentlich, der Rest Ihrer Familie wohne in England.«
»Stimmt … na ja, zumindest die meisten. Mutter möchte, dass Sie meine ältere Schwester kennen lernen.«
»Sie haben eine ältere Schwester?« Nicholas lächelte. »Und ich dachte, Sie seien ein Einzelkind.«
Sie schüttelte den Kopf. »Allerdings habe ich mich oft wie ein Einzelkind gefühlt. Bisweilen können einem acht Jahre Altersunterschied wie achtzig vorkommen. Jedenfalls ist das bei Jane und mir so.«
Nicholas verdrängte den unbehaglichen Gedanken, wie alt er solch einer jungen Frau wohl vorkommen musste. Er räusperte sich und versuchte, zumindest einen Teil seiner Eitelkeit zu retten. »Werden der Mann und die Kinder Ihrer Schwester sich heute Abend ebenfalls zu uns gesellen?«
»Oh … nein!« Clara schüttelte von neuem den Kopf. »Jane … Jane ist nicht verheiratet.«
Als Nicholas sich kurze Zeit später zum Dinner umzog, dachte er bei sich, dass er zumindest eine ältere Gesprächspartnerin haben würde. Die Begegnung mit Jane Purefoy würde zweifellos der Höhepunkt des Dinners werden.
Der gedämpfte Wortwechsel, der in der Nähe der Tür zwischen ihrem Gastgeber und ihrer Gastgeberin stattfand, erregte sofort Lady Spencers Neugier. Sie beendete ihren Rundgang durch den Raum und blieb vor einem Gemälde stehen, das rechts vom Kamin an der Wand hing.
Nicholas, seine Schwester und Clara saßen auf der anderen Seite des Salons an einem kleinen runden Tisch und spielten Karten. Die drei schienen nichts von der Auseinandersetzung zu bemerken, die sich in der Nähe der Tür abspielte.
»… du solltest sie nicht zwingen herunterzukommen, Thomas. Nicht in diesem Zu …«
»Ich will kein Wort mehr darüber hören. Sie wurde lange vorher über dieses Dinner in Kenntnis gesetzt, verdammt noch mal. Und jetzt schick dein Mädchen nach oben, um sie zu holen. Sofort!«
Alexandra riskierte einen raschen Blick auf das Ehepaar. Offenbar hatte Sir Thomas hier die Hosen an, denn obwohl Catherine Purefoy ziemlich aufgebracht wirkte, nickte sie dem Dienstmädchen zu, das draußen im Gang wartete.
Als Sir Thomas sich umdrehte, wandte Alexandra sich rasch wieder dem Gemälde zu. Sie konnte sich nicht erinnern, dass ihr eigener Mann in all den Jahren ihrer Ehe auch nur ein einziges Mal in solch einem Ton zu ihr gesprochen hatte. Sie blickte zum Tisch hinüber und bemerkte, dass Clara ihre Eltern mit beunruhigtem Gesichtsausdruck beobachtete.
Offenbar steckte hinter der Fassade dieser Familie mehr, als es zunächst den Anschein gehabt hatte. Es war zwar Alexandras größter Wunsch, dass ihr Sohn sich endlich eine Frau suchte und eine Familie gründete, doch jetzt hoffte sie, dass Nicholas nichts überstürzen würde. Es lag auf der Hand, dass man sich erst vergewissern musste, ob Clara auch all die Eigenschaften mitbrachte, die sie zu einer guten Ehefrau machen würden. Schließlich zählten, wie Alexandra fand, Selbstachtung und Charakterfestigkeit wesentlich mehr als Geld. Und obwohl sie und Nicholas den größten Teil der letzten Jahre getrennt verbracht hatten, war sie sich ziemlich sicher, dass er eine Frau brauchte, der es nicht an Selbstbewusstsein mangelte.
Die Türöffnung verdunkelte sich. Alexandras Blick wanderte zu der Gestalt, die in dem Moment den Salon betrat.
Die Frau war völlig schwarz gekleidet.
Sie trug ein elegantes schwarzes Abendkleid, unter dem die Spitzen schwarzer Schuhe hervorlugten. An die langen Ärmel des Kleids schlossen schwarze, mit italienischer Spitze besetzte Handschuhe an. Die Farbe ihres straff zurückgebundenen Haars entsprach der ihrer Kleidung, während ihre großen dunklen Augen einen auffälligen Kontrast zu ihrem perfekten, elfenbeinfarbenen Teint bildeten.
Wobei die Perfektion allerdings von dem unschönen blauen Fleck beeinträchtigt wurde, der seitlich von ihrem geschwollenen Mund prangte.
Außer Sir Thomas schien niemand sonst ihre Ankunft bemerkt zu haben. Alexandra zog überrascht die Augenbraue hoch, als sie sah, wie zwischen Vater und Tochter unverhohlen feindselige Blicke hin und her gingen.
Als am anderen Ende des Raum ein Stuhl zurückgeschoben wurde, wanderte der Blick der jungen Frau in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Unverzüglich trat ein schockierter Ausdruck in ihr Gesicht, und Alexandra bemerkte, wie sie die Hand ausstreckte, um sich an der Tür abzustützen.
Nicholas stand am anderen Ende des Raums neben dem Tisch … und blickte drein, als hätte er gerade ein Gespenst gesehen.
»Komm doch herein, Jane«, sagte Lady Purefoy zögernd. »Sir Nicholas … Lady Spencer … Miss Frances. Darf ich Ihnen meine älteste Tochter vorstellen?«
KapitelFünf
Jane hoffte bloß, dass sie im Moment weniger überrascht aussah als er.
Sie stand stocksteif da und versuchte abzuschätzen, was der Engländer tun würde. Wenn er verriet, dass sie sich schon begegnet waren, war ihr Schicksal besiegelt. Natürlich konnte sie alles abstreiten, doch sie bezweifelte, dass ihr Vater oder Sir Robert, der neue Magistrat, ihr mehr Glauben schenken würden als einem englischen Baronet.
Wie ein Leichentuch lag das Schweigen über dem Zimmer. Jane wandte den Blick ab. Sie war sich in keiner Weise sicher, wie lange sie das noch aushalten konnte. Dann kam die Frau mittleren Alters, die vor der Wand gestanden und eines der Gemälde betrachtet hatte, auf sie zu.
»Miss Jane … oder vielleicht sollte ich eher Miss Purefoy sagen, da Sie ja die älteste Tochter sind.«
Überrascht starrte Jane auf die Hand, die die Frau ihr entgegenstreckte. Die Engländerin schien etwa im gleichen Alter zu sein wie ihre Mutter. Ihre durchdringenden blauen Augen verrieten jedoch eine innere Stärke, die Lady Purefoy fehlte.
»Es reicht völlig, wenn Sie mich Jane nennen, Milady«, erwiderte sie mit ruhiger Stimme, wobei sie die Hand ergriff und einen Knicks andeutete. »Ich lege schon seit langem keinen Wert mehr auf solche Formalitäten.«