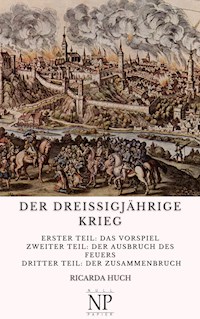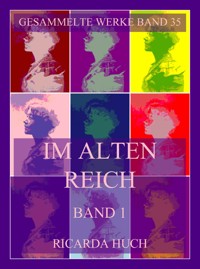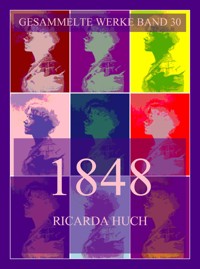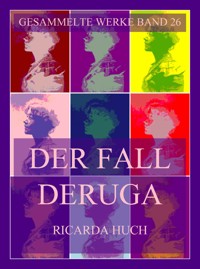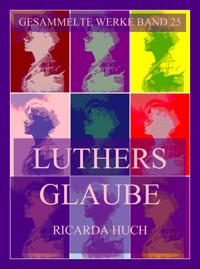9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Man hat den Romantikern mit Recht Willkür, Subjektivität, Individualismus vorgeworfen; mit dem Kampfe gegen die Regel hatten sie ja bereits begonnen. Trotzdem lag zügellose Hingabe an das persönliche Belieben im Kunstbetrieb durchaus nicht in dem ursprünglichen romantischen Programm; aber Phantasie wurde gefordert, und es liegt in der menschlichen Natur, daß die phantasiebegabten Künstler gewöhnlich das Gesetz scheuen, Muster nicht achten wollen und dem Einfall des Augenblicks alles zuliebe tun. Der Sucht, sich und seine Eigenheit und seine Stimmungen auszudrücken, hielt die Ehrfurcht vor überlieferten Typen zu wenig das Gleichgewicht, und so blieb vieles fragmentarisch, anderes verlief im Streben nach Originalität in Abgeschmacktheit und Verzerrung.» Ricarda Huch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 990
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Ricarda Huch
Die Romantik
Blütezeit, Ausbreitung und Verfall
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Man hat den Romantikern mit Recht Willkür, Subjektivität, Individualismus vorgeworfen; mit dem Kampfe gegen die Regel hatten sie ja bereits begonnen. Trotzdem lag zügellose Hingabe an das persönliche Belieben im Kunstbetrieb durchaus nicht in dem ursprünglichen romantischen Programm; aber Phantasie wurde gefordert, und es liegt in der menschlichen Natur, daß die phantasiebegabten Künstler gewöhnlich das Gesetz scheuen, Muster nicht achten wollen und dem Einfall des Augenblicks alles zuliebe tun. Der Sucht, sich und seine Eigenheit und seine Stimmungen auszudrücken, hielt die Ehrfurcht vor überlieferten Typen zu wenig das Gleichgewicht, und so blieb vieles fragmentarisch, anderes verlief im Streben nach Originalität in Abgeschmacktheit und Verzerrung.»
Ricarda Huch
Über Ricarda Huch
Ricarda Huch, geboren in Braunschweig am 18. 7. 1864, gestorben in Schönberg im Taunus am 17. 11. 1947, Studium und Promotion in Zürich. Sie war dort an der Stadtbibliothek tätig, danach Lehrerin an der Höheren Töchterschule in Bremen. 1933 trat sie aus Protest gegen die Gleichschaltung aus der Preußischen Akademie der Künste aus. Sie war Hauptvertreterin der Neuromantik in Lyrik und Prosa, wandte sich in einer späteren Schaffensperiode geschichtlichen Themen zu; ihr Interesse galt vor allem Zeiten des Umbruchs, z.B. dem Dreißigjährigen Krieg. «Die Romantik» (1899, 1902) war ein wichtiger Beitrag zur Wiederentdeckung der romantischen Bewegung und zur Überwindung des Naturalismus.
Inhaltsübersicht
Die Gebrüder Schlegel
Eine Schar junger Männer und Frauen stürmt erobernd über die breite, träge Masse Deutschlands. Sie kommen wie vor Jahrhunderten die blonden germanischen Stämme der Wanderung: abenteuerlich, siegesgewiß, heilig erfüllt von ihrer Sitte und ihrem Leben, mit übermütiger Verachtung die alte, morsche Kultur über den Haufen werfend. Von der scheuen Ehrfurcht vor überlegener Gewalt, die die feine Ausbildung des Römischen Reiches trotz alledem den barbarischen Eroberern einflößte, empfanden freilich die Romantiker nichts. Sie standen den eigenen Vorfahren gegenüber, deren Schwächen sie durch und durch kannten und deren Vorzüge ihnen wenig imponierten; ihre Bewunderung griff in entlegene Vorzeit zurück, wo sie die Eigenart ihres Stammes rein ausgeprägt zu finden glaubten.
Das sonnige Glänzen junger wandernder Sieger liegt blendend über dem kleinen furchtlosen Trupp. Aber am meisten gleichen sie gerade jenen Stämmen der Völkerwanderung, den blühendsten, genialsten, die in der Fremde, wo sie heimisch zu werden gedachten, früh untergingen, die Frucht ihrer Kämpfe Späterkommenden überlassend. Sie verbrauchten ihre Kräfte in der mutwilligen Verschwendung des ersten Sturmes, kindisch und sorglos schwelgten sie in leichten Siegen über schwächliche Gegner, die sie verachteten, verspritzten ihr schäumendes Blut ohne Not, aus Lust des Kämpfens und Ringens, hielten ihren Besitz nicht zu Rate und dauerten nicht aus. Über der freudigen Pracht ihrer Triumphe liegt schwer schattend der frühe, nicht ruhmlose, aber zunächst erfolglose Ausgang und macht sie zu tragischen Erscheinungen.
Derjenige, der als Führer des streitbaren Häufchens angesehen wird, Wilhelm Schlegel, war kein Feldherrngenie, kein Herrscher von Gottes Gnaden, vor dem sich alles niederwirft, unwillkürlich einer elementaren Macht huldigend. Er war ein Mensch von hellem und weitem, aber fast ausschließlich äußerem Bewußtsein, von Umsicht und Klarheit; es war kein Lodern allgewaltiger Leidenschaft um ihn her, aber ein vielfarbiges, reizendes Raketensprühen beweglichen Geistes blitzte aus seinen Augen. Leicht, elegant, freundlich, ritterlich, als immer bereite Waffe in der Hand den anmutig geformten Dolch haarscharfen Witzes, so müssen wir uns sein Bild ausmalen, wie er in guter Stunde war. »Das, was ich am meisten an Dir liebe,« schrieb ihm sein zärtlicher Bruder, »ist am sichtbarsten, wenn Du glücklich bist.« Jung hätte er sterben sollen, in der Fülle des Gelingens; das war die Tragik des eisernen, folgerichtigen Schicksals für ihn, daß er so lange lebte und das Alter erfuhr, das er sein Leben lang mit ahnender Angst gefürchtet hatte. Dies sich Anklammern an die Jugend war nicht etwa Mangel an Fähigkeit oder gutem Willen, die Dinge ernst zu nehmen. Aus dem tändelnden Jüngling wurde sogar, wenn er arbeitete, ein gelehrter Pedant, als welcher er ja auch in der Erinnerung der späteren Geschlechter fortlebte, die für die »übermütigen Götterbuben«, wie Wieland die Brüder Schlegel nannte, kein Verständnis mehr hatten. Jetzt immer noch kennt man ihn hauptsächlich als den gründlichen Forscher, den unermüdlichen Übersetzer, der von sich selbst sagte: »Im Stehn, im Gehn, im Wachen und im Bette, auf Reisen selbst, wie unterm Schutz der Laren, stets dichtend.« Diese eigentümliche Mischung von Anmut, Oberflächlichkeit und Pedanterie beruht auf dem Mangel an Gewicht. Es fehlte ihm an Masse, an dem unbewußten Kern, der die Grundlage des Menschen bildet. Alles läßt sich daraus erklären; in seinen Beziehungen zu den Frauen die Unfähigkeit, große, stetige Leidenschaften zu erregen und zu empfinden. Er suchte und fand viel Neigung der Frauen, liebenswürdig, wie er war, mit dem feuchten Schimmer, der seine glänzenden braunen Augen so anziehend machen konnte; aber nur gaukelndes Schmetterlingsglück, alle Lieblichkeit eines spielenden Jünglingslebens war ihm beschieden, niemals das satte, stolze Genügen einer kraftvollen Natur. Von der einzigen Frau, für die er ein echtes, ernstes Gefühl hatte, soweit er das haben konnte, von Karoline muß man wohl sagen, daß sie ihn niemals wahrhaft geliebt hat. In seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre schrieb ihm sein jüngerer Bruder warnend: »Ich wünschte nicht, daß Du die Zeit Deiner Jugend und das Jugendliche in Deiner Liebe als Dein ganzes Leben ansähest … Warum wolltest Du das Ende der jugendlichen Liebe als das Ende Deiner Herrlichkeit des Lebens überall betrachten? Sie sollte eigentlich nur den Enthusiasmus in Deiner Seele stark und vollkommen gemacht haben, dessen Gegenstand alsdann im männlichen Alter der Wille und die Gedanken Deines eigenen besseren Selbst sein könnte.« – »Das kannst Du, wenn Du willst«, fuhr Friedrich fort; aber der unglückliche Narcissus, der sein besseres Selbst über dem zitternden Spiegelbild der unsteten Wellen, in das er verliebt war, vergaß, hätte das nicht einmal wollen können. Wenn er nicht der junge, blonde, mutwillige Schwärmer sein konnte, wollte er nicht leben. Er war ganz ohne Größe und darum ohne Fähigkeit, das Große ganz zu erkennen, zu lieben, zu wollen. Das ist der Kern all der zarten und liebevollen Ermahnungen, die Friedrich an ihn richtete: wenn er ihn vor Zerstreuung warnt, die der Tod aller Größe sei. – Größe sei nur mit Konzentration aller Kräfte verbunden möglich; wenn er ihn bittet, er möchte sich die Begeisterung nicht schwinden lassen; wenn er fürchtet, es möchte eine gewisse unzufriedene Kälte bei ihm herrschend werden. Wilhelms »uralter Haß gegen die Vernunft« bildete einen beständigen Streitpunkt zwischen den Brüdern, »seine Idiosynkrasie gegen die Vernunft, das Denken«, die es ihm unmöglich machte, wie Friedrich sagte, das Große, z.B. in Schillers Person, zu verstehen. Unter Vernunft begriff nämlich Friedrich das Vermögen der Ideale; er nannte sie einen Grundtrieb, den nach dem Ewigen. Wenn nun auch Wilhelm dichtete:
»Ich wollte dieses Leben
Durch ein unendlich Streben
Zur Ewigkeit erhöh’n«,
so besagt das nichts andres, als daß er geschmackvoll und klug genug war, um zu wissen, was man tun und sein müsse. Grundtriebe aber besaß er gar nicht, das war eben das Ein und Alles, was ihm fehlte. Auch die peinliche, stets verletzte Eitelkeit, zu der er verdammt war, hatte in diesem Mangel ihren Grund. Es ist eigentümlich, wie alle eiteln Menschen den Eindruck einer großen inneren Leere erwecken. In dem dunkeln Gefühl, keinen nährenden Kern im Innern zu haben, hungert es sie beständig nach andern Menschen, an denen sie zehren können. Sie gehören nicht zu den guten Menschen, von denen Salomon in den Sprüchen sagt, daß sie von sich selber gesättigt werden. Eitelkeit ersetzt das Selbstbewußtsein; sie ist wie ein Korsett oder Geradehalter, der einem das Ansehen eines aufrechten, starken Menschen geben soll, eine Art Autosuggestion: wenn der Schwache sich nicht überschätzte, würde er aus Mangel an Selbstvertrauen zusammenbrechen. Diejenige Selbstliebe, die Friedrich meinte, wenn er schrieb: »Wer sich selbst liebt, der ist auf dem Wege, etwas Großes zu werden«, die fehlte Wilhelm. Er war wie ein Schiff ohne Ballast, nur auf einem kleinen, ruhigen Gewässer zu spielen gemacht.
In den Augenblicken, wo er das Herz hatte, ganz ehrlich zu sein, gestand er sich, daß ihm in der Kunst der schönste Kranz versagt bleiben müsse. Dann brandmarkte er, wie Friedrich sagt, seine Kraft, in die innerste Eigentümlichkeit eines großen Geistes einzugehen, unmutig mit dem Namen »Übersetzertalent«. Was für eine reizbare Empfänglichkeit für das Schöne, welches Verständnis für fremdes Genie, was für ein erstaunliches Sprachgefühl und Gedächtnis mit angestrengtem Fleiße zusammenkommen mußten, damit die unsterbliche Shakespeare-Übersetzung entstehen konnte, das kann nie genug hervorgehoben werden. Und dennoch – liest man darin, so empfindet man Shakespeare, so denkt man an ihn, nicht an Wilhelm Schlegel. Des Dichters Persönlichkeit kann man nur in seinen eigenen Werken suchen. Schlegels Gedichte belehren uns in feinster Weise darüber, wie aller gute Geschmack und alles Wissen von dem, was schön und nicht schön ist, die geheimnisvoll wirkende Kraft, die blind das Gute hervorbringt, nicht zu ersetzen vermögen. Wie klar sah er, worauf es ankommt. »Unser Dasein«, sagt er gelegentlich, »ruhet auf dem Unbegreiflichen, und die Poesie, die aus diesen Tiefen hervorgeht, kann dieses nicht rein auflösen wollen. Dasjenige Volk, wofür es sich der Mühe verlohnt, zu dichten, hat hierüber, wie über vieles, die natürliche Gesinnung beibehalten; alles verstehen, d.h. mit dem Verstande begreifen wollen, ist gewiß ein sehr unpopuläres Begehren. Beispiele werden dies einleuchtend machen. Die Bibel, wie sie gegenwärtig in den Händen des Volkes ist, wird nur sehr unvollkommen verstanden, ja vielfältigst mißverstanden, und dennoch ist sie ein äußerst populäres Buch. Von unsern neueren Exegeten zum allgemeinen Verständnisse zugerichtet, würde sie unfehlbar ihre Popularität großenteils einbüßen. Die alten, besonders katholischen Kirchenlieder, voll der kühnsten Allegorie und Mystik, waren und sind höchst populär; die neuen bild- und schwunglosen, vernünftig gemeinten und wasserklaren, die man an ihre Stelle gesetzt hat, sind es ganz und gar nicht. Und warum sind sie es nicht? Weil in ihrer ekeln Einförmigkeit nichts die Aufmerksamkeit weckt, nichts das Gemüt plötzlich trifft und es in die Mitte desjenigen versetzt, was ihm durch förmliche Belehrung nicht zugänglich werden würde. Mit einem Worte, wer für das Volk etwas schreiben will, das über dessen irdische Bedürfnisse hinausgehen soll, darf in der weißen Magie oder in der Kunst der Offenbarung durch Wort und Zeichen nicht unerfahren sein.«
Aber er selbst war kein Magier. Es war nichts, gar nichts Dämonisches in ihm. In seinen Liebesgedichten fehlt der süße Schmelz starker Sinnlichkeit, und nur sein unbestechlicher Geschmack bewahrte ihn davor, anstatt dessen witziger Lüsternheit Raum zu geben, die dagegen in seinen satirischen Scherzgedichten gern hervortritt. Seine Schwester Charlotte traf ganz das Richtige, wenn sie ihn mit Wieland verglich, indem sie sagte, die beste und wirksamste Kritik eines Autors sei ihrer Meinung nach, in eben dem Fache ein besserer Schriftsteller zu sein, und sie traue Wilhelm zu, auf diese Art gegen Wieland zu Felde ziehen zu können. Fast niemals fehlt ihm Grazie, die freilich zu elegant ist, um die Grazie eines Naturkindes zu sein. Nicht die Anmut, die aus Kraft hervorgeht, beseelt seine Gedichte; aber es ist doch etwas Schwebendes in ihnen, wie wenn die Naturtriebe mit der Schwere ihres Müssens nicht auf ihn wirkten. Zarte, im Kopf entstandene Empfindungen hauchen leicht vorüber; man kann wohl unmutig werden über die seifenblasenartige Glätte und Leere dieser angeblichen Leidenschaften; dafür senken sich die Verse auch niemals mit schwüler Schwermut belastend auf das Gemüt, des Dichters Geistesunfreiheit verratend. Man möchte ihm einen Erguß heißen irdischen Blutes in die Adern mehr wünschen, er ist wie eine lose, flatternde Blume, in deren zierlichen Stengel die Säfte der Erde nicht hinaufströmen können.
Nur einmal ist er, wie auch Goethe urteilte, über sich selbst hinausgegangen, in der Zuneigung des Trauerspiels Romeo und Julia, an Karoline gerichtet, die damals endlich seine Frau geworden war. Mag ihm hier auch seine innige Vertrautheit mit der Dichtung zugute gekommen sein, so ist es doch das nicht allein; indem er fein die poetische Weisheit Shakespeares rechtfertigt, die Romeo und Julia gerade deshalb auf der Höhe des Glückes und der Liebe sterben läßt, damit nicht sie – ein weit herzzerreißenderer Untergang – ihre Liebe überleben, mochte er die Gefahr mit dunkler Wehmut ahnen, die in seinem eigenen Wesen und Geschick lag. Kein feindlicher Anblick schreckt Liebe, im Kampfe schwillt ihr Mut, sie schaudert nicht, bei Toten sich zu betten –
Ach, schlimmer drohn ihr lächelnde Gefahren,
Wenn sie des Zufalls Tücken überwand.
Vergänglichkeit muß jede Blüt’ erfahren:
Hat aller Blüten Blüte mehr Bestand?
Die wie durch Zauber fest geschlungen waren,
Löst Glück und Ruh und Zeit mit leiser Hand,
Ach, jedem fremden Widerstand entronnen
Ertränkt sich Lieb’ im Becher eigner Wonnen.
Es liegt eine wahre und keusche Trauer in den Versen. Das gedämpfte Herzklopfen einer furchtsamen Wehmut über die eigene Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit, das ist, was er am wahrsten und tiefsten in sich durchlebte, und überall, wo das anklingt, berührt uns, wenn auch nur ganz leise, der geheimnisvolle Zauber, der aus den Elementen der Natur und des Menschen dringen kann:
Nicht bloß die Blume welkt, das Duftgewebe
Der Frühe reißt, entflieht des Lenzes Prangen,
Nicht bloß erbleichen junge Rosenwangen,
Dem Geist auch droht’s, daß er sich überlebe.
Wie kühn er erst auf freien Flügeln schwebe,
Dumpf g’nügsam bleibt er bald am Boden hangen.
O wißt Ihr für sein grenzenlos Verlangen,
Weis’ oder Dichter, keinen Trank der Hebe?
Die Mängel in Wilhelms Natur schlossen freilich auch große Vorzüge ein. »Frisch und kräftig befaßte er sich nicht mit Psychologie«, schrieb einmal Karoline, was hier als entschiedenes Lob gemeint ist; er zerfaserte nicht das Innere, wie es damals die Darstellungsweise der modernen Schriftsteller wurde, denen es dabei nur selten gelang, eine ganze Erscheinung lebendig vor die Augen zu stellen. »Du bist gewaltig bei Frommanns gelobt worden«, schrieb sie ihm ein andermal. »Du könntest, was Du wolltest, und tätest, was Du könntest, und wärest ein Kleinod von Rechtlichkeit.« Ja, das Kränkliche, Unbestimmte, ins Grenzenlose Ausschweifende der meisten übrigen Romantiker lag nicht in seinem Wesen. Alles, was er schrieb, wenn es auch tiefer und bedeutender hätte sein können, war doch ein Ganzes, abgerundet, hatte Form. Er verfügte über das, was man Mache oder Virtuosität nennt. Eine gewisse Behendigkeit des Handelns und Ausführens machte ihn im praktischen Leben den Gefährten überlegen, die sich zum Teil mit der Unermeßlichkeit ihrer Pläne begnügten. So wurde er der Direktor, Wortführer, Herausgeber, Anordner, Antreiber; so ist er noch jetzt als das Haupt der romantischen Schule bekannt. Als Vorkämpfer des Guten, Neuen und Bekämpfer des Schlechten in der Literatur hat er jedenfalls unter allen das Meiste geleistet, der unermüdliche Rufer im Streit.
Die Reinheit und Schärfe seines Verstandes, seine unfehlbare Empfindung für das Schöne wie für das Häßliche und Lächerliche, sein Mut, seine schneidige Kampflust machen viele seiner kritischen Schriften zu kleinen Kunstwerken. Er selber sagte in späteren Jahren, zwischen Ernst und Ironie, von seinen Leistungen auf diesem Gebiete: »Der Kritiker, aus dessen Schriften man hier eine Auswahl gesammelt findet, stand in seinen jüngeren Jahren in üblem Rufe. Man schilderte ihn wie einen Wüterich, einen Herodes, der an einer Menge unschuldiger Bücher nichts Geringeres als einen bethlehemitischen Kindermord verübt habe. Man hat, wie mich dünkt, dem Manne Unrecht getan. Er hat sein lästiges Amt mit Mäßigung und Schonung verwaltet.« Und wirklich wird man in seinen schärfsten Angriffen fast nie die Höflichkeit des Weltmanns vermissen, der sich selbst zu hoch schätzt, um grob oder plump zu werden. Sein Witz ist zu anmutig, um nicht die Beleidigung durch die spielende Form zu mildern. Und die unerbittliche Schärfe dem Schlechten gegenüber ist besonders nachdrücklich, wenn das Schlechte überschätzt wird und unverdiente Lorbeeren erntet: er suchte sich gern mächtige Gegner, er machte es sich nicht leicht. Was aber seine Angriffslust um so schätzenswerter macht, ist sein ritterliches Einstehen für das Schöne, das ihm nie entging. Er hatte genug Mut und Zutrauen zum eignen Urteil, um verborgene, namenlose Talente zu entdecken, verunglimpfte zu verteidigen; war er doch der erste, der den jungen Tieck ermunterte und anpries, der einzige, der sich des unglücklichen Bürger gegen Schillers allzuharte, verständnislose Kritik annahm. So erfreulich aber auch diese ernste Würdigung eines großen Toten ist, am gelungensten sind doch seine übermütigen Streifzüge ins feindliche Philisterlager. Hier vor allem findet sich die Urbanität und Festivität des Stiles, um die Friedrich seinen Bruder so sehr beneidete, während er »sententiae vibrantes fulminis instar« vermißte.
Eigentümlich ist es, daß, wenn man noch eben diese Vorzüge Wilhelms aufrichtig bewundert, einem doch wieder ein Ausspruch von seiner Schwester Charlotte Ernst in den Sinn kommen kann, die einmal an Novalis über ihre Brüder schrieb: »Wenn sie sich recht strenge selbst prüfen wollten, so würden sie finden, daß nicht allein die reine Liebe zum Guten und Wahren ihre Triebfeder ist, sondern daß etwas Mutwille zugrunde liegt und eine Eitelkeit, ihre brillant witzigen Einfälle nicht unterdrücken zu können.« Diese Eitelkeit ist vielleicht zu allgemein menschlich, um nicht vollkommen entschuldbar zu sein, und doch ist es so: man weiß, es war ihnen ernst; sie sagten ihre Überzeugung, auch wenn es gegen ihren Vorteil war, und trotzdem empfinden wir nicht die Bewunderung und Sympathie, die wir für ein mutvolles und uneigennütziges Betragen haben. Vielleicht hängt es mit dem Gefühl zusammen, als hätten sie nicht so handeln müssen, als sei Absicht dabei gewesen; und man schätzt nun einmal den blinden Trieb zum Guten höher als die löblichste Absicht. Charlottens Tadel bezieht sich auf beide Brüder; Wilhelm allein eigen – sogar im Gegensatze zu Friedrich – ist eine Eigenschaft, die noch ärgerlicher berührt als Mutwille oder Eitelkeit: die Korrektheit, die über sein ganzes Wesen und alle seine Handlungen ausgegossen war. Schon seine äußere Erscheinung war peinlich korrekt, »allerliebst geputzt und gesalbt«, wie Karoline neckend sagte; aber auch das jedenfalls nicht zuviel. Ebensowenig war jemals etwas an seinem Betragen auszusetzen. Ob Karoline ihm einen Korb gab oder seine Hilfe beanspruchte oder sich von ihm scheiden lassen wollte – er war immer gleich höflich, ohne sich wegzuwerfen, gefaßt und entgegenkommend, ohne frivol zu sein; tat, was in seiner Macht stand, um sie zu schonen, ohne zu zögern, noch auch zu überstürzen, sowohl ohne Schwäche als ohne Gewaltsamkeit. Einzig in einer gewissen Schärfe des Wesens verriet sich zuweilen seine Unzufriedenheit. Ebenso im brüderlichen Verhältnis: Friedrich bat ihn nie umsonst um Geld, er war immer hilfsbereit, und zwar ohne seine Gabe durch mehr Vorwürfe und Ermahnungen als nötig waren zu vergällen; obwohl er viel zu verständig war, um verschwenderisch oder auch nur besonders freigebig zu sein, hätte man ihn doch nicht berechnend nennen können. Mustergültig war auch sein Benehmen gegen literarische Feinde und Angreifer: er bediente sich nur ehrlicher Mittel im Kampf, nie war er falsch oder hinterlistig, die Geringeren beachtete er kaum, sondern stürmte neuen Feinden entgegen. Andrerseits atmete auch die erwähnte Ehrenrettung Bürgers vollendete Tadellosigkeit aus. Kurz, man muß immer loben, wie er handelte; und doch ist vielleicht diese einwandfreie Korrektheit gerade das, was ihn der wärmeren Zuneigung am meisten entrückt.
Wie ganz anders Friedrich, an dem seinem Freunde Schleiermacher die »Leichtigkeit, mit der er sich bisweilen einem unrechtlichen Verfahren in seinen Angelegenheiten nähert«, auffiel. »Schlegel ist aber eine hohe, sittliche Natur«, setzte Schleiermacher voll Anerkennung hinzu, und es scheint fast, als ob dem ernsten, unbestechlich rechtlichen Geistlichen diese Mischung von hoher Sittlichkeit und moralischer Nachlässigkeit sehr gefallen habe. Wieviel mehr Liebe und Freundschaft erfuhr der stets inkorrekte Friedrich als sein Bruder! Wenn Wilhelm der Leichte war – zierlich und beweglich, aber ohne Größe – so war Schwere Friedrichs Wesen. Er sei, sagte seine Gattin Dorothea von ihm, was die Orgel unter den Instrumenten, die Orangenblüte unter den Blumen, die Pfirsich unter den Früchten; höchst charakteristische Vergleiche für diesen Menschen von imponierender, aber nur schwer beweglicher Masse, der erfüllt war von Gedanken und Gefühlen, von sinnlichgeistigen Schätzen, die aber, allzu tief in den Grund seines Wesens eingewühlt, nur selten, nach den mächtigsten Erschütterungen, gegen die Oberfläche stiegen. Während man Wilhelm beklagen muß, daß er nicht mehr war, möchte man Friedrich vorwerfen, daß er nicht mehr wurde. Denn die Bestimmung zur Größe war in ihm und hatte keinen andern Feind als seine weibisch-träge Sinnlichkeit. Bewege, tummle dich, schaffe, handle, möchte man ihm immer zurufen, der nicht viel andres tat als lesen, lesen und lesen. Er las so viel, wie Wilhelm schrieb. Unablässig vermehrte er seine Kenntnisse, häufte Ideen auf Ideen, die seinen schwerfälligen Geist belasteten. Es sei keine Gefahr, sagte einmal Dorothea, daß er jemals an Gehalt zu Geisteswerken verarme, allein die Gefahr sei, daß er an seiner Ideenmasse ersticke. In seiner Konstitution lag eine Neigung zum körperlichen und geistigen Fettwerden. Sein großer, runder, priesterlicher Kopf mit den etwas schweren, sinnenden Augen und dem vollen, weichlichen Kinn, das sich zu einem doppelten ausbildete, zeigt einen bedeutenden aber bequemen Menschen. »Die Männlichkeit seiner Gestalt offenbarte sich nicht in der hervorgedrängten Kraft der Muskeln. Vielmehr waren die Umrisse sanft, die Glieder voll und rund, doch war nirgends ein Überfluß. In hellem Lichte bildete die Oberfläche überall breite Massen«, so beschreibt er selbst mit Wohlgefallen seinen behaglichen Körper. Weniges klingt so aus seinem Herzen gekommen wie seine Lobpreisungen des Müßiggangs. »O Müßiggang, Müßiggang, du bist die Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung; dich atmen die Seligen, und selig ist, wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod, einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese blieb.« Das Sprechen und Bilden sei nur Nebensache in allen Künsten und Wissenschaften, das Wesentliche sei das Denken und Dichten, und das sei nur durch Passivität möglich. Je schöner das Klima, desto passiver sei man. Nur die Italiener wissen zu gehen und die Orientalen zu liegen, am zartesten und süßesten habe sich der Geist in Indien gebildet. Das war nicht nur Humor der Übertreibung; er begnügte sich wirklich mit dem Denken und Dichten und verachtete das Bilden und Ausführen, er hat jedenfalls unzählige Male »wie ein nachdenkliches Mädchen in einer gedankenlosen Romanze am Bach« gesessen, »gleich einem Weisen des Orients versunken in heiliges Hinbrüten und ruhiges Anschauen der ewigen Substanzen«. Er erinnert an einen jungen Mann, von dem Steffens in seinen Lebenserinnerungen erzählt, er sei so faul gewesen, daß er ein förmliches Studium darauf verwendet habe, auf welche Weise man am längsten im Stuhle sitzen könne, ohne seine Stellung zu verandern.
Diesem Trägen hatte sein Genius eine beschwerliche Lebensbahn ausgesucht, aber er verstand die weise Absicht, benutzte den Wink nicht. Womöglich ließ er immer andere für sich arbeiten. Und er hatte eine gewisse zutunliche Kindlichkeit an sich, die machte, daß es tätige Menschen natürlich fanden, etwas für ihn zu tun.
Die Jünglingsjahre, die Wilhelm so leicht und geräuschlos abliefen, verbrachte er unter peinvollen Zuckungen und Kämpfen seines Inneren. Er litt unter einem beständigen Mißklang, den er in sich fühlte und dessen letzte Ursache war, daß er kein hinreichendes Gegengewicht besaß für sein ungeheures Denkvermögen, für seine Rezeptivität. Das Vermögen und die Lust, hervorzubringen und zu handeln, worin sein aufgespeicherter Ideenstoff sich hätte verarbeiten können, war Wilhelm allein zugeteilt. So gut wie Friedrich sich seines mächtigen Verstandes bewußt war, wußte er, daß ihm etwas Großes fehlte, welches Etwas er verschieden benannte, sehr häufig aber Liebe, die Seele der Seele. Nicht um Verstand möchte er Gott bitten, sondern um Liebe. Die stets rege, alles durchschauende Kritik seines Verstandes erschwerte ihm das unbefangene Liebhaben, wonach er doch schmachtete. Je nachdem, ob er die reich ausgestattete Seite seines Wesens genoß oder die verkümmerte entbehrte, wechselte ein gerechtfertigtes Gefühl von Überlegenheit mit einem Gefühl von Ohnmacht und Einsamkeit, was ihn scheinbar unvermittelt zwischen den höchsten Höhen und den tiefsten Tiefen auf- und abschwanken ließ. Er lebte in einem beständigen Wechsel von Schwermut und Ausgelassenheit, sagt er in der »Lucinde«. Rührend ist es, wie er zu sein oder auf die Menschen zu wirken wünschte, nämlich so, »daß von meiner Rechtschaffenheit immer mit Achtung, von meiner Liebenswürdigkeit oft und viel mit Wärme geredet würde. Von meinem Geiste braucht gar nicht die Rede zu sein, oder höchstens sollte man mich verständig finden. Jedermann sollte mich gut nennen, wo ich hintrete, sollte sich alles erheitern, jeder sich nach seiner Art an mich schmiegen, und die sich was dünken, mich gnädig anlächeln. Aber längst habe ich bemerkt, welchen Eindruck ich immer mache. Man findet mich interessant und geht mir aus dem Wege. Wo ich hinkomme, flieht die gute Laune, und meine Nähe drückt. Am liebsten besieht man mich aus der Ferne wie eine gefährliche Rarität. Gewiß, manchem flöße ich bitteren Widerwillen ein. Und der Geist? Den meisten heiße ich doch ein Sonderling, das heißt ein Narr mit Geist.«
Wie deutlich sieht man hier, was er war – klug, geistreich, witzig, interessant, bedeutend – und was er nicht war: unbefangen, liebenswürdig, heiter, herzlich. Erstaunlich ist es, mit welcher Schärfe er seine Größe und seinen unersetzlichen Mangel sah: daß er nicht lieben konnte, weder andere noch sich selbst. »Ich weiß, daß ich gar nicht leben kann, wenn ich nicht groß bin, das heißt mit mir zufrieden. Denn mein Verstand ist so, daß wäre alles ihm gleich und Harmonie in mir, so wäre ich’s schon.«
Das Ideal seines Wesens sah er in Hamlet. Nicht, daß er es ausdrücklich sagte; aber seine Auffassung Hamlets ist so persönlich, wie man einen fremden Charakter nur vermittels seines eigenen faßt, weil man mit seiner Seele lebt, oder was dasselbe sagen will, ihm die eigene Seele zum Leben leiht. Der Grund zu Hamlets innerer Zerrüttung, sagt er, liege in ihm selbst, in dem Übermaß seines Verstandes und dem Mangel verhältnismäßiger Kraft der Vernunft. Wäre er weniger groß, so würde er ein Heros sein. Seine Unentschlossenheit rühre daher, daß er eine zahllose Menge von Verhältnissen übersehe. »Durch eine wunderbare Situation wird alle Stärke seiner edeln Natur in den Verstand zusammengedrängt, die tätige Kraft aber ganz vernichtet. Sein Gemüt trennt sich, wie auf der Folterbank nach entgegengesetzten Richtungen auseinandergerissen; es zerfällt und geht unter im Überfluß von müßigem Verstand, der ihn selbst noch peinlicher drückt als alle, die ihm nahen. Es gibt vielleicht keine vollkommenere Darstellung der unauflöslichen Disharmonie, welche der eigentliche Gegenstand der philosophischen Tragödie ist, als ein so grenzenloses Mißverhältnis der denkenden und der tätigen Kraft wie in Hamlets Charakter. Der Totaleindruck dieser Tragödie ist ein Maximum der Verzweiflung. Alle Eindrücke, welche einzeln groß und wichtig scheinen, verschwinden als trivial vor dem, was hier als das letzte, einzige Resultat alles Seins und Denkens erscheint, vor der ewigen kolossalen Dissonanz, welche die Menschheit und das Schicksal unendlich trennt.« Ganz ebenso erschien Friedrich damals seinen Freunden: »Deine urteilende Idee steht mit Deiner genießenden im Mißverhältnis«, schrieb ihm Novalis. Nur daraus, daß er sich eines mit Hamlet fühlte, krank an derselben unheilbaren Disharmonie, läßt sich seine Meinung erklären, die Tragödie könne unter Umständen augenblicklichen Selbstmord veranlassen. Diese Umstände waren eben die seinigen. »Wenn ich auf dem Wege, den ich in Göttingen ging, beständig mit dem Verstande zu genießen, ohne zu handeln, blieb, so hätte er mich in Kurzem zum Selbstmord geführt. Die Liebe zu einem Gegenstande, der Kampf mit Hindernissen und die Freude des erkämpften Gelingens muß unsern eilenden Geist aufhalten; denn sonst wird diesem Kurzsichtigen die Welt bald zu klein.« Selbstmord war denn auch lange Zeit sein täglicher Gedanke, und er wäre, wie er selbst sagt, diesen Entschluß auszuführen wohl fähig gewesen, »wenn er überhaupt zu einem Entschluß hätte kommen können.«
Ich will anführen, wie er selbst den qualvollen Zustand dieser Jahre, wo er »untätig und mit sich uneins« war, schildert:
Eine Liebe ohne Gegenstand brannte in ihm und zerrüttete sein Inneres. Bei dem geringsten Anlaß brachen die Flammen der Leidenschaft aus; aber bald schien diese aus Stolz oder Eigensinn ihren Gegenstand selbst zu verschmähen und wandte sich mit verdoppeltem Grimme zurück in sich und auf ihn, um da am Marke des Herzens zu zehren. Sein Geist war in einer beständigen Gährung; er erwartete in jedem Augenblick, es müsse ihm etwas Außerordentliches begegnen. Nichts würde ihn befremdet haben, am wenigsten sein eigener Untergang. Ohne Geschäft und ohne Zweck trieb er sich umher und unter den Menschen wie einer, der mit Angst etwas sucht, woran sein ganzes Glück hängt. Alles konnte ihn reizen, nichts mochte ihm genügen. – Er konnte mit Besonnenheit schwelgen und sich in den Genuß gleichsam vertiefen. Aber weder hier noch in den mancherlei Liebhabereien und Studien, auf die sich oft sein jugendlicher Enthusiasmus mit einer gefräßigen Wißbegier warf, fand er das hohe Glück, das sein Herz mit Ungestüm forderte. Und so verwilderte er denn immer mehr und mehr aus unbefriedigter Sehnsucht, ward sinnlich aus Verzweiflung am Geistigen, beging unkluge Handlungen aus Trotz gegen das Schicksal und war wirklich mit einer Art von Treuherzigkeit unsittlich.
Ohne Zweifel hätte er sich herausreißen können. »Es ist Trägheit, was uns an peinliche Zustände kettet«, sagt Novalis. Aber träge war er eben; der Elastizität seines Freundes Novalis gegenüber war er wie etwa eine Kuh, vor deren Augen eine Lerche pfeilschnell in die Wolken steigt. Was für goldene Worte wußte er seinem Bruder über den Nutzen eines bürgerlichen Amtes zu sagen: ein vollkommener Querpfeifer erfülle doch sein Wesen, nämlich die Querpfeiferei; wenn er einen guten Pfiff tue, könne er ebenso zufrieden mit sich sein wie Gott, wenn er eine Welt gemacht habe. Durch sein ganzes Leben hindurch zieht sich der Wunsch, ein Amt, einen festen Beruf zu haben, seinem Hange zum bequemen Sichgehenlassen ganz entgegen; und doch wich er gern aus, wenn sich eins bieten wollte. Wenn er seinem Bruder predigte: »Es kommt nur auf dich an, ein großer Mensch zu werden«, oder »Laß doch gar nicht die Gottheit aus deiner Brust aus Trägheit allmählich entweichen«, oder er solle sein Glück für seine Vortrefflichkeit nützen, so ermahnte er damit eigentlich mehr sich selbst als Wilhelm, für den diese Lehren gar nicht paßten und kaum verständlich sein mochten. Klopstock, Schiller, Luther, Fichte, Männer von frischer Tatkraft, waren die Muster, die er aufstellte, die er groß nannte. An Einsicht konnte es ihm bei seinem umfassenden Verstande nicht fehlen; aber er war wie die Jünger, denen Christus zurief: »Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Siehe, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.«
Das Außerordentliche, das er so lange dunkel erwartet hatte, geschah: er lernte Karoline kennen, und die Liebe, die zerrüttend in ihm gebrannt hatte, weil ihr. der Gegenstand fehlte, begrüßte entzückt die endlich Gefundene. Im allgemeinen waren ihm die Frauen zu platt – denn sie wären noch platter als die Männer, sagte er – um sich mit ihnen abzugeben. Daß er auf diejenigen mit dem Geiste herabsah, die seine Sinnlichkeit mächtig anzogen, war stets die Ursache zu quälenden Konflikten, wenn er mit Frauen in Berührung kam. Damals meinte er, er sei reiner Liebe wohl nur zu Männern fähig. Und die Leidenschaft zu einer Frau, die er als Student in Leipzig durchmachte, war allerdings eine dermaßen verzerrte »armselige Raserei«, daß man ihre Geschichte in seinen Briefen nicht ohne Ekel und Mitleiden lesen kann. Karoline ergriff ihn ganz. Da gab es keine Spaltung in seinem Gefühl, wie es keine in ihrem Wesen gab: seine Freundschaft, seine Bewunderung, sein Urteil gehörten ihr wie seine blinde Zuneigung. Aber indem er sich seine schrankenlose Liebe gestand, schwur er sich zugleich Entsagung; denn diese einzig verehrte Frau war die Geliebte Wilhelms, seines heißgeliebten Bruders. Nie erscheint Friedrich liebenswerter als damals, wo er, still und anspruchslos verzichtend, sich dankbar des Glückes freute, der heimlich Geliebten, die zugleich Freundin seines Bruders war, dienen zu können, des Glückes zu lieben überhaupt. Durch Karoline fühlte er sich dem Leben wiedergegeben; in der Liebe, die eine positive Tätigkeit des Gemütes ist, fand er das Gegengewicht gegen den negativen Verstand.
Von dem Zeitpunkt an, wo die Liebe der beiden Brüder, durch das Gefühl für die selbe Frau nicht aufgelöst, sondern erhöht, einen so schönen Triumph feierte, ging sie ihrem Niedergange entgegen. So langsam allerdings, daß das Verhältnis durch eine Reihe von Jahren noch unverändert blieb, ja sogar in vollerer Blüte zu stehen schien. Beide, Wilhelm sowohl als Friedrich, konnten glauben, jetzt dem Höhepunkt des Glückes nahe zu sein. Was er so lange vergebens ersehnt hatte, Freundschaft und Liebe, fand Friedrich reichlich in Berlin, wohin er sich als fünfundzwanzigjähriger junger Mann begab: die Freundschaft Schleiermachers, die Liebe von Dorothea Veit, der Tochter von Moses Mendelssohn. Ein Bild hoher Freundschaft hatte ihm immer vor der Seele geschwebt; er hielt sich für geschaffen, es zu verwirklichen. »Ich bin nun einmal eine unendlich gesellige und in der Freundschaft unersättliche Bestie«, sagte er von sich selbst. Er konnte durchaus nicht allein sein, nichts allein treiben; er brauchte jemanden zum Symphilosophieren, zum Symfaulenzen, kurz zum Symexistieren – eine charakteristische Wortbildung, die er sich erfunden hatte und gern gebrauchte. »Mitteilung, Teilnahme, Arm, an dem du wandelst, das wird dir fehlen, und wird dir fehlen, wie es Keinem fehlt«, schrieb ihm Novalis einmal, als er nach einer anderen Stadt übergesiedelt war, wo er niemanden kannte. Aber der »gute, innige« Schlegel hatte einen Teufel in sich, der ihm die liebsten Freunde mutwillig und bösartig verscheuchte. So sagte er Novalis geradezu ins Gesicht, daß er ihn zuweilen verachte, und begriff kaum, daß der Beleidigte diese Erklärung nicht mit seinem Wahrheitsdrange oder seiner Eigenheit »Dolche zu reden«, wenn es die Gelegenheit mit sich brachte, entschuldigte. Später freilich zog sich der Zwist wieder zu; Friedrichs »Zauberkraft auf menschlichen Geist« war so groß, seine kindliche Offenheit und Umgangslust so versöhnlich, daß seine Freunde ihm nicht leicht etwas nachtrugen. Damals aber führte das Leben ihm Schleiermacher zu, der von allen Männern, die Friedrich nahe traten, ihm die zärtlichste und dauerndste Neigung geschenkt hat.
Mit seinen lebhaften Augen, der Schärfe seines Blickes, die sogar etwas Zurückstoßendes haben konnte, mit seinen streng geschlossenen Lippen, immer überlegt und besonnen, war Schleiermacher ein bestimmter Gegensatz zu dem weichen, behaglich trägen Schlegel. Dieser Verschiedenheit waren sie sich auch wohl bewußt und nannten ihr Verhältnis scherzweise eine Ehe, in der Schleiermacher die Frau war. Mit weiblicher Innigkeit hing der kleine, zarte, etwas verwachsene Jüngling an dem schönen, stattlichen Freunde. Friedrichs Kindlichkeit und Naivität, die Heftigkeit seiner Wünsche, Neigungen und Abneigungen, ja sogar seine Leichtfertigkeit entzückten ihn. Alles, was Schleiermacher fehlte, hatte Friedrich im Übermaß. Ein großes Wort habe Friedrich einmal von ihm gesagt, schreibt Schleiermacher, »nämlich ich müsse aus allen Kräften darauf arbeiten, mich immer frisch und lebendig zu erhalten. Niemand ist dem Verwelken und dem Tode immerfort so nah als ich.« Friedrich war eher in Gefahr des Erstickens oder dem Tode durch Überfütterung nahe. Ihren Verstand bewunderten sie gegenseitig. Und wenn Friedrich durch seine Natur, durch die Wucht seiner Persönlichkeit imponierte, gestand er selbst wiederum Schleiermacher, obwohl er der Jüngere war, eine gewisse Überlegenheit zu, die ihren Grund in seiner Frühreife, Besonnenheit, Zielbewußtheit, seinem tätigen Fleiß, seinem Ernst hatte. Friedrich hatte ein sinnliches, Schleiermacher ein moralisches Übergewicht. Damit hing zusammen, daß Schleiermacher ganz unkünstlerisch war, was aber nicht störend empfunden ward; denn Ethik, Psychologie, Religion, kurz die Wissenschaft war ein so großes Gebiet gemeinsamen Interesses, daß es an Stoff zu endlosem »Symphilosophieren« nicht fehlte.
Die Freundschaftsehe hinderte aber beide Teilnehmer nicht, auch Frauenliebe zu suchen. Während Schleiermacher einen eigentümlich geistig-herzlichen Verkehr mit der berühmten Schönheit Henriette Herz pflegte, stürzte sich Friedrich in zügellose Leidenschaft zu der häßlichen Dorothea. Auch Dorothea ergänzte Schlegel: sie war immer tätig, geschickt zu aller Arbeit, ebenso behende zum Schreiben und Schaffen wie er schwerfällig. Freilich gab es in ihr auch nicht entfernt so viel Gehalt zu verarbeiten. Sie galt für klug und bedeutend; auch dürfte man nicht das Gegenteil von ihr behaupten; aber weder logisch noch tief zu denken war ihre Sache. Daß sie lebhaft, leicht und viel sprach, eine rasche Fassungsgabe besaß, auch gescheit genug war, um nichts Dummes zu sagen, Nichtwissen einzugestehen und, wo es angebracht war, zu schweigen, ließ sie geistvoller erscheinen als sie war. So selbständig sie im Handeln sein konnte, im Denken war sie durchaus abhängig. Gerade das machte sie zu einer bequemen Frau für Friedrich. Während sie alles Praktische für ihn besorgte, soviel wie möglich für ihn arbeitete, ordnete sich ihr Verstand dem seinigen völlig unter, und da ihre weibliche Hingebung keine Grenzen kannte, wurde er der Gott dieser unschönen, aber liebevollen, strebsamen und temperamentvollen Frau, der gegenüber sein Mißtrauen und seine Empfindlichkeit ihn bald verließen. Sich so bedingungslos angebetet zu fühlen, das war es, was ihm immer gefehlt hatte; daß sie ihm das gab, zog ihn hauptsächlich zu ihr hin; bei ihm vertraten allmählich Dankbarkeit, Bequemlichkeit und Gewöhnung die Stelle der Liebe, soweit sie nicht nur Sinnlichkeit war. Es ist begreiflich, daß fast alle Freunde Friedrichs sich von diesem Verhältnis, auf das Dorothea so stolz war, peinlich berührt fühlten. Ja, vielleicht haben diejenigen nicht unrecht, die sie späterhin seinen bösen Dämon genannt haben. Denn mit ihrer blinden Unterwürfigkeit konnte sie nichts als seiner Trägheit Vorschub leisten. Sie hatte jene Affenliebe für ihn, die Müttern als Sünde angerechnet wird; es war nicht sein guter Genius, den sie in ihm erkannte und liebte. Das Temperament seines Wesens, seine gemütliche Kindlichkeit, die olympische Ruhe, die er haben konnte, hätten ihn nach zwei Seiten führen können: zur heiteren Überlegenheit des Weisen und Glücklichen oder zur immer stumpfer werdenden Behäbigkeit eines Haremsweibes. Ohne es zu ahnen, trieb ihn Dorothea den bösen Weg abwärts. Sein durch ihre geistige Unterordnung gelähmter Intellekt trat mehr und mehr in den Dienst seiner stärker anschwellenden materiellen Seite. Sie hätte ihn beflügeln sollen und zog ihn, in der Meinung, sein Wohl zu befördern, mit starkem Gewicht zur Erde.
Wie anders, wie fördernd wirkte Karoline durch die Überlegenheit ihres Geistes auf die Männer ein, die ihr nahestanden, obwohl sie nicht weniger tätig und liebevoll war. Man kann sich eines wehmütigen Lächelns nicht enthalten, wenn man sich erinnert, was für Grundsätze Friedrich in bezug auf Freundschaft und Liebe hatte. Von keiner andern wollte er etwas wissen, als die auf gegenseitiger Anregung zur Sittlichkeit beruhe. Als Karoline das erstemal Wilhelms Antrag zurückgewiesen hatte, tröstete er den betrübten Bruder, indem er ihm riet, seinerseits sie zu verwerfen und sich dadurch über den Verlust hinwegzusetzen: »Deine Liebe zu ihr war nur Mittel zu einem hohen Zweck, den das Mittel zu zerstören droht. Du hast sie nur gebraucht, und mit Recht wirfst Du sie weg, da sie Dir schädlich wird. Oder weißt Du etwa nicht, daß Du in ihr Dein eigenes Ideal der Größe liebtest?« Und über ihr eigenes brüderliches Verhältnis schrieb er an Wilhelm: »Ich sage Dir aber, daß ich es so mit Dir halte, wie Lavater mit Christus, der ihm geradezu erklärt, daß, wenn er ein noch besseres Medium mit Gott findet, er den ersten Platz räumen muß.« Als er Karolinen kennenlernte, entsagte er dem Glück, »aber er beschloß, es zu verdienen und Herr über sich selbst zu werden.«
Jetzt berauschte er sich in dem Genuß, dessen Entbehrung so peinlich an ihm gezehrt hatte. Nun hatte er, was er vor Jahren als das Wünschenswerteste hingestellt: die Liebe zu einem Gegenstande, den Kampf mit Hindernissen und die Freude des erkämpften Gelingens; denn da Dorothea verheiratet war, fehlte es nicht an Widerstand und Schwierigkeiten von allen Seiten. Da die »Wut der Unbefriedigung« gestillt war, wurde er liebenswürdiger, zuversichtlicher, froher. Mutig und stolz sah er ins Leben; niemals vorher hatte er eine so rege und fruchtbare Tätigkeit entfaltet. Bis dahin hatte er mit einer Mühseligkeit gearbeitet, die an einem Menschen, der sich selbst zum Schriftsteller bestimmt, etwas Komisches hat. Das elegante, liebenswürdige Sichausströmen Wilhelms hatte ihm als Ideal vorgeschwebt, wiewohl er sich halb und halb seiner gediegeneren, körnigeren Eigenart nicht ohne Genugtuung bewußt war. Jetzt glaubte er seines Bruders Geschmeidigkeit mit seiner Kraft und Tiefe vereinigt zu haben. Wirklich vollendete er mehrere Aufsätze ästhetischen Inhalts voll neuer Gesichtspunkte, originaler Ideen, weiter Aussichten. Er lud einmal etwas ab von dem großen Haufen angesammelter Entwürfe.
Von langer Dauer war indessen dieser Aufschwung nicht. Nachdem der Kampf vorüber war und das Glück gesichert, sank Friedrich tiefer als vorher in seine Trägheit zurück; eine zunehmende Hypochondrie war die Folge. »Wird er aber schwer über den Dingen«, erzählte Dorothea, »oder die Dinge schwer über ihm, das ist nicht zu entscheiden, aber gewiß ist, daß das Leben ihm sauer wird«; und in komischem inneren Konflikt zwischen praktischer Einsicht und mißverstandenem Idealismus: »Friedrich wird das Dichten immer leichter, dafür aber – soll ich leider sagen? – das eigentliche Arbeiten und alles Geschäft immer schwerer.« An Gründen für seine Untätigkeit fehlte es ihm nie. Nur blitzartig waren die Augenblicke einer so staunenswerten Selbsterkenntnis, die ihn einmal zu Wilhelm sagen ließ: »Wußtest du nicht, daß ich den Mangel an innerer Kraft immer durch Pläne ersetze?« Gewöhnlich schob er alles auf die Ungunst seiner materiellen Lage. Gewiß ist es, daß für jeden Armgeborenen der Kampf ums Dasein desto härter ist, je mehr er einem ideell-geistigen Leben zugetan, und nicht ohne Bitterkeit kann man die äußere Beschränktheit im Leben eines so hochbegabten Menschen mit ansehen. Aber wo blieben in späterer, besserer Zeit die großen Taten, die kommen sollten, wenn nur einmal das Gespenst des Mangels und der Sorge von der Schwelle verscheucht wäre? Muß man nicht Karolinens klaren Blick bewundern, die sagte: »Denn manche gedeihen in der Unterdrückung, dahin gehört Friedrich; es würde nur seine beste Eigentümlichkeit zerstören, wenn er einmal die volle Glorie des Siegers genösse.«
Seit Karoline und Dorothea neben den Brüdern standen, fing das alte, feste Band, durch das sie sich untrennbar vereinigt glaubten, locker zu werden an, und das ist wohl das Traurigste, was sie erleben mußten. Anfänglich war Friedrich, der sechs Jahre jüngere, der unbedingt Aufschauende und Verehrende gewesen, allmählich aber, als der Reichtum und Umfang seines Geistes zur Geltung kam, änderte sich das Verhältnis, und Wilhelm empfand ihn als den Stärkeren, den Tonangebenden. In diesem Verkehr einzig war Eitelkeit ganz ausgeschlossen, wo beide gegenseitiger Anerkennung, ja Bewunderung gewiß waren, sich überhaupt als zwei Hälften eines würdigen Ganzen fühlten. Sie wurden inne, wie sie einander ergänzten, und wurden nicht müde, es einander zu sagen und sich dieser Blutsfreundschaft und Gemeinsamkeit zu freuen. Sie schwelgten in gemeinsamen Entwürfen, und besonders Friedrich war kindlich beseligt, wenn er ihre beiden Namen nebeneinander gedruckt unter ihren brüderlichen Werken lesen konnte. Und diese Einheit und Einigkeit wurde angetastet, nicht durch Feindliches, dessen sie sich hätten erwehren können, sondern durch Frauen, die auch Anteil an ihnen hatten, die ihrem Herzen nahe standen, im Grunde also durch sich selbst. Aber leicht konnten sie von dem Traume ihrer Unüberwindlichkeit im Zusammenwirken nicht lassen. »Ihr seid ein einziges unteilbares Wesen«, schrieb Novalis an Friedrich zu der Zeit, als der Samen der Entzweiung schon gesät war. Mit ängstlicher Besorgnis hielten sie das Kleinod fest, das für sie einen Talisman bedeutete: den Glauben an die innere Notwendigkeit, den Naturzwang ihrer Liebe. Die romantische Schule selbst ist ein Denkmal dieser Liebe. Der gewichtige Friedrich war der Magnet, der die begabten Freunde anzog, Wilhelm, der Rührige, Helle, Wache, wie Karoline ihn nannte, organisierte sie. Hoffnungsvoll stand er am Strande, um auf seligen Inseln ein neues Reich der Poesie zu gründen:
Verbrüderte Gefährten seh ich schweben.
Was schreckte mich, daß ich dahinten bliebe?
Es leuchten milde Sterne, droht kein Wetter.
So leit’, o süße Poesie, mein Leben!
Du Jugend in der Jugend, Lieb’ in Liebe,
Natur in der Natur, Gottheit der Götter!
Karoline
Wenn über einen Verstorbenen das Urteil der Zeitgenossen auseinandergeht, Haß und Liebe wetteifern, sein Bild jedes in seinen Farben auszumalen, dann wünschen wir, alle die widersprechenden Zeugnisse einmal vergessen und anstatt dessen einen Blick in das Antlitz tun und ein Wort aus dem Munde vernehmen zu können, die der Tod ausgelöscht hat, damit wir das Geheimnis der Seele daraus ablesen. Wie war sie denn in Wahrheit, diese Karoline, die der große Schiller Dame Lucifer nannte und die so vielen andern die Einzige, Unvergleichliche war, die unwiderstehlich alle anzog, auf die der warme, kluge Blick ihres liebevollen Auges fiel? Wenn wir sie selber fragen könnten, würde sie gewiß stolz und freimütig und klar über sich Auskunft geben, und vielleicht würde sie mit lieblicher, halb scherzender Wehmut sagen: Seht Ihr es mir denn nicht an, daß mein Herz gut ist?
Sie war nicht eigentlich ein romantischer Charakter mit sonderbaren Mischungen, Dämmerungen, Rätseln, sondern ihr Wesen war die Sicherheit und Ruhe der Harmonie, und es ließe sich auf sie anwenden, was Friedrich Schlegel in seiner »Lucinde« von der kleinen Wilhelmine sagt: »Der stärkste Beweis für ihre innere Vollendung ist ihre heitere Selbstzufriedenheit.«
Sie war die Tochter eines Göttinger Professors Michaelis und, im Jahre 1763 geboren, fast noch ein Kind des ancien régime, aufgeklärt und verständig, in ihrer frühen Jugend sogar ein wenig sentimental. Wie sie in einem Brief an ihre Freundin Luise Gotter ihre Verlobung und Hochzeitsfeier beschreibt, bei welcher Gelegenheit man das junge Paar in bekränzte und mit Versen geschmückte Lauben führte, das mutet wie Klopstock und Wieland an. Aber wenn einmal von Zeit zu Zeit ein heller, starker Naturlaut durchbricht, so spürt man, daß diese Merkmale eines ausgehenden Zeitalters ihr nur angeflogen sind durch Beispiel und Sitte, die auf einen harmonischen Charakter stark zu wirken pflegen. So dichtete ja der junge Goethe seine Anfänge ganz im Geschmacke seiner Zeit und mußte erst von Herder auf revolutionäre Bahnen geführt werden.
Karoline begann ihr Leben als Frau des Bergmedikus Böhmer in Clausthal, eingeengt in Wälder und Berge, zurückgezogen in einen beschränkten Kreis, in dem sie sich niemals heimisch fühlte. Es war nicht, daß sie großartigere Verhältnisse ersehnt hätte; aber ihre starke Natur verlangte unbewußt nach Geschicken, die sie bilden und entwickeln könnten; denn der Genius des Menschen will immer, was ihn fördert, und führt sogar Unglück herbei, wenn der Mensch es braucht und daher Anrecht darauf hat. Sie war nicht dazu angetan, über sich selbst nachzugrübeln und sich durch wirkliche und eingebildete innere Konflikte einen Zeitvertreib zu verschaffen; aber sie fühlte deutlich, daß die Ruhe und Gemächlichkeit ihr nicht gut taten, und leise Angst erwachte in ihr, die »edle Tätigkeit« möchte ganz erlahmen, sie könnte träger und träger werden in ihrer Meeresstille und zuletzt abseits liegen bleiben mit stockenden Kräften. Sie war auch deswegen frei davon, sich der Schwermut hinzugeben, weil die ihr natürliche Weltanschauung war, der Mensch sei bestimmt, zu genießen, mehr als jedes andere Geschöpf, und verfehle seinen Zweck, wenn er es nicht tue. Glücklich zu sein schien ihr, wenn sie es nicht von selbst war, eine Pflicht, und sie versuchte es immer wieder und wieder, wie auch die Umstände es ihr erschweren mochten. Leichtsinn oder Genußsucht war das nicht – wie es sich denn um ein roh materielles Genießen nicht handelte –, vielmehr eine große, seltene Gerechtigkeit: wenn sie unzufrieden war, suchte sie die Schuld niemals anderswo als in sich. Daß die Welt schön sei, voller Gaben und Segen, war ihr unumstößliches Gefühl; wenn ihr Blüte und Frucht nicht zufielen, machte sie es sich zur Aufgabe, an einem Zweiglein oder Blatte froh zu werden. Unter Tränen lächelnd, suchte sie sich heiter zu erhalten zwischen den ernsten, graden, schwarzen und verschneiten Tannen des Harzes, mit denen sie nichts anzufangen wußte, las und las in den Büchern, die die Schwester ihr aus der Göttinger Bibliothek durch die Botenfrau hinüberschickte – Romane, Memoiren, Weltgeschichte, verschollene Philosophie und Lebensweisheit – und stellte sich wohl auch inmitten der drückenden Einsamkeit vor den Spiegel, nickte ihrem betrübten Bilde zu und rief es ermunternd an: Gräme dich nicht allzusehr, Karolinchen!
Ihres Mannes Rechtlichkeit achtete sie, und die blinde Zärtlichkeit, die ihr junges, liebesuchendes Gemüt auf ihn geworfen hatte, hielt sie ängstlich, wie zum Selbstschutz, in ihrem Herzen zusammen. Auch Schwäche mag man es von einem anderen Standpunkte aus nennen, diejenige Schwäche, die ihr eigenstes Wesen ausmachte und zugleich ihre Stärke war, daß sie nämlich ohne Liebe nicht sein konnte. Da er nun einmal ihr Gefährte war, wollte sie nicht wissen und sehen, sondern liebhaben, liebhaben, weil sie ohne das nicht hätte atmen und sein können. Da er aber, wie es scheint, viel weniger Umfang des Wesens hatte, als sie Liebesfülle besaß, überschüttete sie mit allem Überfluß ihres Herzens die Kinder, die sie bekam, so daß man hätte meinen können, die Mutterschaft wäre ihre einzige Bestimmung gewesen.
Überhaupt ist das besonders an ihr zu schätzen, daß sie alle Pflichten, die das Leben mit sich brachte, und alle Gelegenheiten, sich zu betätigen, wenn es auch geringfügige Haushaltsangelegenheiten waren, gründlich ergriff und bei allem, was sie vorhatte, so sehr mit ganzer Seele war, daß man jedesmal hätte meinen können, gerade dies sei für sie die Hauptsache und gerade dafür sei sie geschaffen. Die kleine Auguste freilich war und blieb in Wahrheit die Hauptsache, das seltsame Geschöpfchen, unschön zuerst, aber von immer zunehmendem Liebreiz, wie es bei den Menschen der Fall ist, an deren Schönheit der sich entwickelnde Geist großen Anteil hat, altklug, kindisch, naiv, frühreif, wissensdurstig und vergnügungssüchtig, ein staunenerregendes Durcheinander, mit demselben weichen Gesicht und der blumenhaften Neigung des Kopfes, wie es der Mutter eigentümlich war. Die andern Kinder starben früh, bald nach dem Tode ihres Mannes, mit dem Karoline nur vier Jahre verheiratet war.
So rauh wurde sie aus dem Gefängnis ihrer kindlichen Jugend erlöst, und keinen andern Gebrauch konnte sie zunächst von ihrer Freiheit machen, als daß sie den kleinlichen Kampf mit alltäglichen Familienkümmernissen und überflüssigen Nörgeleien aufnahm; sie kehrte nämlich zu ihrer Familie nach Göttingen zurück. Wie eng und klein die dortigen Verhältnisse auch waren, empfand sie es doch als eine Wonne, frei zu sein und die Flügel weit, so weit sie wollte, ausspannen zu können, und erinnerte sich mit Grauen an die dumpfen Jahre in Clausthal. Jetzt erst gestand sie sich, daß sie sich wie in einen Zwinger eingeschlossen gefühlt hatte. Aber kaum, daß sie es recht inne geworden war, begab sich die Unglückliche freiwillig in neue Sklaverei. Das war eben ihr Fluch – wie vielleicht auch ihr Segen –, daß sie nicht frei sein konnte, daß ihr Herz die Abhängigkeit suchte von etwas Angebetetem. Dieser Hang ihres Herzens konnte, wie sie selbst wohl wußte, sogar für eine Zeitlang ihren hellen, sonst unbestechlichen Geist verblenden, obwohl sie es immer dunkel in sich ahnte, wenn sie auf Irrwegen war.
Der Mann, dem sich ihre Seele nun mit blinder, schrankenloser Hingebung vertraute, scheint ein problematischer Charakter gewesen zu sein. Der starke Instinkt, der sie so sicher machte, fehlte ihm. Er muß sie wohl auf seine Art geliebt haben und war jedenfalls ein Bewunderer ihrer Vorzüge; aber es ist möglich, daß die Stärke ihrer Natur, die er an ihr liebte, ihn zugleich beängstigt hätte; denn er griff nicht zu, um sie festzuhalten, die ihm mit dem ganzen Stolze und der ganzen Freudigkeit ihrer Liebe entgegenkam.
Ob er sich ihr nicht gewachsen fühlte und deshalb den Mut nicht hatte, sie besitzen zu wollen, oder ob er überhaupt unfähig war, zu lieben, und nur als ein schwächlicher Egoist eine Weile mit halbwahren Gefühlen spielte, bange, von sich selbst, seiner Würde und Bequemlichkeit ein Stückchen zu verlieren – kurz, er ließ sich ihre unermüdliche Liebeswilligkeit und Güte gefallen, reizte sie wohl auch gar und blieb dabei doch in einer spröden Zurückhaltung. Mit ihrem vollen Herzen fühlte sie sich fähig, glücklich zu machen, und wollte den, den sie sich erkoren hatte, zu seinem Glücke zwingen. Heiratsanträge, die ihr gemacht wurden, schlug sie um seinetwillen aus.
Damals machte sie die Bekanntschaft des jungen Wilhelm Schlegel, der im Umgange mit Bürger, dem einsamen, vergessenen Greise, seine ersten dichterischen Studien trieb, und es läßt sich denken, daß der regsame, vorurteilsfreie Jüngling eine erquickende Erscheinung für sie war inmitten der dumpfen Herkömmlichkeit oder vorsichtigen Steifheit der Göttinger Honoratioren. Daneben freilich fühlte sie sich ihm gründlich überlegen, und das nicht nur, weil er sechs Jahre jünger als sie war. Für die moderne Richtung in der Literatur mit ihrem, wie man jetzt sagen würde, nervösen, sensitiven Leben hatte sie ohnedies keinen Sinn; der altmodische Gotter, der Mann ihrer Freundin Luise, war für sie, was man nur von einem ordentlichen Dichter verlangen kann. Mit allem Übermut ihrer starken, zuversichtlich das Höchste begehrenden Persönlichkeit wies sie den jungen Schöngeist ab, ja, nicht ohne jene Grausamkeit, die nur Verliebte haben, wenn sie völlig in den geliebten Gegenstand versunken sind.
Man darf sich nun aber nicht vorstellen, sie hätte jemals über einem geliebten Mann wirklich sich und die ganze Welt vergessen. Das brauchte man kaum hervorzuheben und noch weniger zu rühmen. Es möchten leicht mehr Frauen zu finden sein, denen die Liebe alles war: sie unterscheidet das gerade von den meisten, daß sie über ihre Liebe, so groß und hingebend sie auch war, doch die Welt niemals vergaß. Ihr aufmerksamer Geist blieb ihrer blinden, elementarischen Leidenschaft ebenbürtig. Nie verlor sie die denkende Teilnahme an den Menschen und ihrem Tun. Wie klar war aber auch der Spiegel ihres geistigen Auges, mit dem sie die Bilder ihrer Zeitgenossen auffing. Sie konnte auch Vater, Mutter und Geschwister wie Fremde sehen und schildern, nur daß ihr Liebe oder Pietät immer zur Seite standen und wenn nicht ihr Urteil, so doch den Ausdruck ihres Urteils beeinflußten. In ihren Freundschaften mit Frauen war nichts Schwärmerisches und Verstiegenes, vielmehr lag eine gewisse Unerbittlichkeit in der Art, wie sie die Freundin ganz nahm, wie sie war, ohne je zu idealisieren; aber wenn sie auch nicht durch Schmeichelei verwöhnte, so beglückte sie um so mehr durch Verständnis, richtige Schätzung und unwandelbare Anhänglichkeit. Jene echte, geniale Kunst des Idealisierens verstand sie aber doch, daß sie nämlich die Menschen als Ganzes sehen konnte, ihr Wesen der zerstückelnden Zeit entreißend und schöpferisch zusammenfassend. Daher haben ihre Schilderungen von Personen, die wenigen Fälle ausgenommen, wo persönliche Leidenschaft ihren Blick erhitzte, die Milde parteiloser Wahrheit, der man unbedingt Glauben schenkt.
Wie deutlich tritt die Gestalt Therese Forsters aus den kurzen Bemerkungen hervor, die sie in Briefen über sie gemacht hat: der glückzerstörende Geist, der in ihrer ganzen Familie wohnt, ihre Unglücksucht, die sich diejenigen, die sie liebt, durchaus unglücklich vorstellen muß, wie sie überall Bitteres findet, wie unerquicklich sie für die Menschen im allgemeinen ist, wie unendlich viel sie wenigen sein kann, ihr Zug zur Größe, ihre Energie und Kühnheit. Wie fein und gut ist es, daß sie in allem, was an Theresen abstößt, die »konvulsivischen Bewegungen einer großen Seele« erkennt. Wie Karoline war Therese die Tochter eines Göttinger Professors, des angesehenen Philologen Heyne, und wurde, nachdem ihre Beziehungen zu dem jungen Wilhelm von Humboldt gelöst waren, die Frau des Naturforschers Georg Forster. Für keine Frau hatte Karoline jemals ein stärkeres Interesse. Gerade daß diese ringende und unklare Seele von ihrer Harmonie und Güte, die, nach ihrem eigenen Ausdruck, mit solcher Sicherheit am Busen der Natur ruhte und ihr ins Auge sah, so verschieden war, machte sie ihr merkwürdig und anziehend. In ihre tatenlose Einsamkeit kam eine Einladung dieser Freundin, zu ihr nach Mainz überzusiedeln, das sich eben der neuen französischen Republik angeschlossen hatte. Da war das Element, in dem sie atmen konnte: Leben und Handlung! Wie eine Erlösung, wie ein Ruf des Schicksals mußte ihr diese Aufforderung erscheinen, ihr, die sich fähig fühlte, »Wunder zu tun und ein widerstrebendes Schicksal durch ein glühendes, überfülltes, in Schmerz und in Freuden schwelgendes Herz zu bezwingen« und die keine andere Aufgabe vor sich sah als die Erziehung eines kleinen, gutartigen Mädchens, überflüssige gesellige Pflichten und Aufheiterung einer mißvergnügten Familie. Allen Warnungen auch der geliebtesten Menschen zum Trotz zog sie mit ihrem Kinde in die aufgeregte Stadt, in das krampfhafte Treiben eines großen Volkes hinein, wo die wohlmeinenden Freunde ein so leidenschaftliches, liebebedürftiges Geschöpf allerdings für gefährdet halten konnten. Sie indessen pflegte sich auf den Zug ihres Herzens zu verlassen. Mit vollem Bewußtsein tat sie es, es war ihr Stolz und ihre Sicherheit. Sie wußte, daß sie sich irren konnte, nie aber sich selbst verlieren. Sie besaß den glücklichen Instinkt der Nachtwandler, die nicht stürzen, wenn man sie nur ruhig gehen läßt. Auch die Fehltritte, die sie tat, und die Irrwege, die sie wählte, mußten ihr dienen. Um nichts dürfte man sie mehr beneiden als um dies Talent zur Bildung des Lebens, wenn man diesen Ausdruck gebrauchen kann, das einem in jedem Schicksal Zuversicht verleiht, Weil man im Grunde um den letzten Ausgang nicht besorgt ist. »Vielleicht bin ich wirklich schwer zu einer Entscheidung zu bringen«, sagte sie einmal, »allein ich habe sie noch stets gefaßt, ehe es zu spät war, und mich unverrückt an ihr gehalten. Ich sage nicht heute, ich will dies tun, und morgen, ich will ein anderes, und jedesmal so zuversichtlich, als wenn es ewig gelten würde – nein, es malt sich wohl sehr deutlich in meinen Äußerungen, daß ich nicht weiß, was ich tun soll – bis der Moment kommt.« Scharf prägt sich in diesen Worten eine Natur von denen aus, die stets mehr halten, als sie versprechen, die zu klar bewußt sind, um sich selbst belügen zu können, und deren reiner, starker, nicht zu mißdeutender Instinkt sie schließlich, wenn es nötig ist zu handeln, das für sie Angemessene tun läßt.
Es mochte nicht leicht für Karoline sein, zwischen Forster und Therese zu leben, die in entgegengesetzter Weise ihr Interesse in Anspruch nahmen; ihr Verstand erkannte Thereses große Anlagen an, aber ihr Gemüt wurde immer weniger durch sie befriedigt; dagegen mißbilligte ihr Kopf Forster, »den schwächsten aller Menschen«, während ihre weiblich mütterliche Zärtlichkeit ihm vielleicht gerade wegen seiner Unkraft nicht anders als liebevoll begegnen konnte, dessen Intelligenz, Bescheidenheit und großmütige Gesinnung außerdem ihr Herz bewunderte. Das Verhältnis wurde dadurch noch verwickelter, daß gerade um diese Zeit die Ehe sich vollends auflöste, indem Therese, die jetzt behauptete, ihren Mann eigentlich niemals geliebt zu haben, sich gänzlich Huber zuwandte, dem ehemaligen Freunde Schillers und Bräutigam der Schwägerin Körners, Johanna Stock. Forster hörte bis zum Tode nicht auf, seine Frau zu lieben oder, wie Karoline nicht ohne Geringschätzung es beschrieb, »man würde seine Liebe töten können, aber seine Anhänglichkeit nicht«. Er habe nicht die Kraft, sich loszureißen, erzählte sie, lebe von Attentionen und schmachte nach Liebe. Nachdem Therese ihr Haus verlassen hatte, wurde Karoline die Trösterin des Unglücklichen. Kurze Zeit hernach traten furchtbare Ereignisse ein; Mainz wurde von den Deutschen belagert und erobert, Forster entfloh nach Paris und Karoline fiel den Siegern in die Hände.
Die Gefangenen wurden als Geiseln auf eine Festung gebracht und mit ausgesuchter Roheit und Nichtachtung ihrer rechtmäßigen Forderungen behandelt. Karolines zarte Gesundheit und die Angst um ihr Kind, das sie bei sich hatte, machten ihr alle Leiden und Entbehrungen doppelt empfindlich. Was war aber das gegen die Martern, die ihrem zarten und stolzen Herzen zugefügt wurden! Niemand hatte ihr Verweilen in Mainz, ihren Enthusiasmus für die französische Freiheit und ihre Teilnahme für Forster, den Vertreter derselben gebilligt, man hatte ihr im Geiste die rote Mütze der Jakobiner aufgesetzt – und welcher Schlechtigkeit hielt man Jakobiner nicht für fähig? Über die Unglückliche und Wehrlose ergoß sich die Verleumdung: sie sollte die Geliebte des französischen Generals Custine gewesen sein, ihre Freundschaft mit Forster wurde nichtsdestoweniger als Liebesverhältnis aufgefaßt, ihr Schwager Böhmer, der auf seiten Frankreichs war und eine zweideutige Rolle gespielt hatte, wurde für ihren Mann gehalten. Sie konnte nichts tun, als stolz und entrüstet ihre Unschuld beteuern, aber sie tat es mit dem Gefühl, daß der Schein gegen sie war. Denn, wie falsch auch die Anklagen waren, die gegen sie vorgebracht wurden, etwas Verhängnisvolles war geschehen: sie erwartete, Mutter eines Kindes zu werden, ohne mit dem Vater desselben rechtlich verbunden zu sein, ja, was erst das eigentliche Unglück ausmachte, ohne sich ihm innerlich verbunden zu fühlen.
Man hätte nichts gewonnen, wenn man mit Sicherheit ermitteln könnte, wer der Mann war, dem sich die Einsame so unbesonnen und freudlos hingegeben hatte. Daß sie, die Anschmiegsame, von einem Manne, der sie zu fesseln wußte, hingerissen werden und um seinetwillen Vernunft und Vorsicht hintansetzen konnte, ist weniger überraschend, als daß Leidenschaftlichkeit ihre hellen Augen so umflorte, daß sie die Unwürdigkeit des Liebhabers nicht erkannte oder übersah; und vielleicht hätte es doch nicht geschehen können, wenn nicht vorher die Pein, einen Mann zu lieben, der sie niemals ganz an sich zog und doch auch niemals entschieden von sich stieß, sie überreizt und im Herzen krank gemacht hätte.