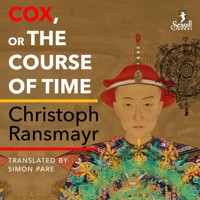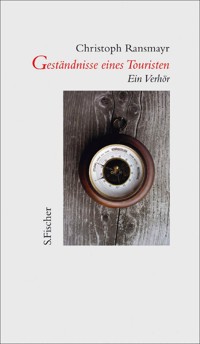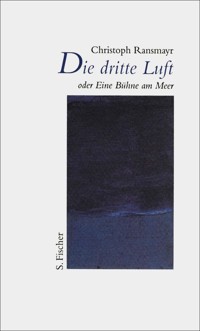9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Christoph Ransmayrs gefeierter erster Roman. Im Zentrum dieses vielschichtigen Abenteuerromans steht das Schicksal einer österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition in den Jahren 1872 bis 1874. Die »Payer-Weyprecht-Expedition« bricht im arktischen Sommer 1872 in das unerforschte Meer nordöstlich des sibirischen Archipels Nowaja Semlja auf. Das Expeditionsschiff wird bald – und für immer – vom Packeis eingeschlossen. Nach einer mehr als einjährigen Drift durch alle Schrecken des Eises und der Finsternis entdeckt die vom Skorbut geplagte Mannschaft eine unter Gletschern begrabene Inselgruppe am Rande der Welt und tauft sie zu Ehren eines fernen Herrschers »Kaiser-Franz-Joseph-Land«. Einer der letzten blinden Flecke ist damit von der Landkarte der Alten Welt getilgt. Parallel zum Drama dieser historischen Expedition erzählt Ransmayr die Geschichte eines jungen, in Wien lebenden Italieners namens Mazzini, der mehr als hundert Jahre später zum besessenen Sammler aller hinterlassenen Zeugnisse und Dokumente der »Payer-Weyprecht-Expedition« wird und schließlich ins Eismeer aufbricht, um als Passagier eines norwegischen Forschungsschiffes die Entdeckung des »Franz-Joseph-Landes« nachzuvollziehen. Aber im Verlauf seiner Recherchen zur polaren Entdeckungsgeschichte gerät Mazzini immer tiefer in die arktische Gegenwart und verschwindet schließlich, ein Schlittenreisender, in den Gletscherlandschaften Spitzbergens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Die Schrecken des Eises und der Finsternis
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Pizzo gewidmet
Vor allem
Was ist bloß aus unseren Abenteuern geworden, die uns über vereiste Pässe, über Dünen und so oft die Highways entlang geführt haben? Durch Mangrovenwälder hat man uns ziehen sehen, durch Grasland, windige Einöden und über die Gletscher, Ozeane und dann auch Wolkenbänke hinweg, zu immer noch entlegeneren, inneren und äußeren Zielen. Wir haben uns nicht damit begnügt, unsere Abenteuer einfach zu bestehen, sondern haben sie zumindest auf Ansichtskarten und in Briefen, vor allem aber in wüst illustrierten Reportagen und Berichten der Öffentlichkeit vorgelegt und so insgeheim die Illusion gefördert, daß selbst das Entlegenste und Entfernteste zugänglich sei wie ein Vergnügungsgelände, ein blinkender Luna-Park; die Illusion, daß die Welt durch die hastige Entwicklung unserer Fortbewegungsmittel kleiner geworden sei und etwa die Reise entlang des Äquators oder zu den Erdpolen nunmehr eine bloße Frage der Finanzierung und Koordination von Abflugzeiten. Aber das ist ein Irrtum! Unsere Fluglinien haben uns schließlich nur die Reisezeiten in einem geradezu absurden Ausmaß verkürzt, nicht aber die Entfernungen, die nach wie vor ungeheuerlich sind. Vergessen wir nicht, daß eine Luftlinie eben nur eine Linie und kein Weg ist und: daß wir, physiognomisch gesehen, Fußgänger und Läufer sind.
1Aus der Welt schaffen
Josef Mazzini reiste oft allein und viel zu Fuß. Im Gehen wurde ihm die Welt nicht kleiner, sondern immer größer, so groß, daß er schließlich in ihr verschwand.
Mazzini, ein zweiunddreißigjähriger Wanderer, ging im arktischen Winter des Jahres 1981 in den Gletscherlandschaften Spitzbergens verloren. Es war ein privater Trauerfall, gewiß. Ein Verschollener, einer mehr, nichts Besonderes. Aber wenn einer verlorengeht, ohne einen greifbaren Rest zu hinterlassen, etwas, das man verbrennen, versenken oder verscharren kann, dann muß er wohl erst in den Geschichten, die man sich nach seinem Verschwinden über ihn zu erzählen beginnt, allmählich und endgültig aus der Welt geschafft werden. Fortgelebt hat in solchen Erzählungen noch keiner.
Mir war die Tatsache oft unheimlich, daß sich der Anfang, auch das Ende jeder Geschichte, die man nur lange genug verfolgt, irgendwann in der Weitläufigkeit der Zeit verliert – aber weil nie alles gesagt werden kann, was zu sagen ist, und weil ein Jahrhundert genügen muß, um ein Schicksal zu erklären, beginne ich am Meer und sage: Es war ein heller, windiger Märztag des Jahres 1872 an der adriatischen Küste. Vielleicht standen auch damals die Möwen wie filigrane Papierdrachen im Wind über den Kais, und durch das Blau des Himmels glitten die weißen Fetzen einer in den Turbulenzen der Jahreszeit zerrissenen Wolkenfront – ich weiß es nicht. Überliefert ist aber, daß an diesem Tag Carl Weyprecht, ein Linienschiffslieutenant der k.u.k. österreichisch-ungarischen Marine, vor dem Hafenamt jener Stadt, die von den Italienern Fiume und von ihren kroatischen Bewohnern Rijeka genannt wird, eine Rede hielt. Er sprach vor Seeleuten und gemischtem Hafenpublikum über die Drohungen des höchsten Nordens.
Ich habe lange an der Vorstellung festgehalten, daß im Verlauf der langen Rede Weyprechts ein plötzlicher Frühlingsregen einsetzte; ein Regen, in dessen besänftigendem Rauschen sich dann ein paar zuhörende Matrosen verlaufen konnten, ohne in den Verdacht zu geraten, sie gingen fort, weil sie sich vor den Bildern, die der Schiffslieutenant beschwor, fürchteten. Weyprecht beschrieb eine ferne Welt, in der eine kalte Sommersonne den Seefahrer monatelang umkreise, ohne jemals unterzugehen; im Herbst aber beginne es zu dunkeln, und schließlich senke sich, wiederum für Monate, die Finsternis der Polarnacht über jene Gegenden, und eine namenlose Kälte. Weyprecht sprach von der großen Verlassenheit eines Schiffes, das, festgefroren im Packeis, durch ein unerforschtes Meer treibe – ausgeliefert der Willkür der Strömungen und den Eispressungen, die tonnenschwere Eisdecken zum Bersten brächten und Eisblock um Eisblock aufeinandertürmten, haushoch! Eine Gewalt, die selbst stahlverstärkte Bäuche von Schonern und Fregatten oftmals zerdrückt habe wie Modelle aus Blattholz. Das Ächzen und Kreischen der zu Eis erstarrten Dünung des Nördlichen Polarmeeres könne in dem Reisenden, der in jene Gegenden vordringe, manchmal die verborgensten Ängste nach oben drängen, und doch müsse er oft jahrelang in dieser Welt verbleiben, eingeschlossen zwischen Mauern aus Packeis und ohne einen anderen Trost als die eigene Kraft.
Aber nun nahm Weyprechts Rede eine überraschende Wende, die alle Schrecken in einem anderen Licht erscheinen ließ und zumindest einige Matrosen so gebannt haben muß, daß sie nachher im Hafenamt bei dem Herrn Schiffslieutenanten vorsprachen:
Das trostlose Einerlei einer arktischen Reise, die tödtende Langeweile der endlosen Nacht, die gräßliche Kälte, das sind eben die nach allen Seiten variirten Schlagworte, mit denen die Civilisation den armen Polarreisenden zu bedauern gewöhnt ist. Aber zu bedauern ist nur jener, der sich der Erinnerung an die Genüsse, die er verlassen hat, nicht erwehren kann, der sich und sein hartes Geschick bejammernd, die Tage zählt, die noch verfließen müssen; ehe die Stunde der Heimkehr schlägt. Ein Solcher thut besser, wenn er ruhig zu Hause bleibt und sich am warmen Ofen den angenehmen Kitzel fremder, in der Einbildung vielleicht übertriebener Leiden verschafft. Für Denjenigen, den das Schaffen und Treiben der Natur interessirt, ist die Kälte nicht so grimmig, daß sie nicht zu ertragen wäre, und die lange Nacht nicht so lange, daß sie nicht einmal zu Ende ginge. Langeweile fühlt aber nur der, welcher sie in sich selbst trägt und der nicht im Stande ist, die Beschäftigung zu finden, welche den Geist davon abhält, sich brütend das eigene Elend selbst zu schaffen.
In der Bremerhavener Werft Teklenborg und Beurmann sei unter seiner Anleitung ein Schiff gebaut worden, schloß Weyprecht seine Rede – die Admiral Tegetthoff, ein dreimastiger Barkschoner, 220 Tonnen groß, ausgestattet mit einer Auxiliardampfmaschine und allem Schutz gegen das Eis. Noch im Juni werde die Admiral Tegetthoff auslaufen, Kurs auf das Nordkap nehmen und von dort immer weiter nach Norden segeln, in das unerforschte Meer nordöstlich des russischen Archipels Nowaja Semlja. Wer von den anwesenden Seeleuten also gesund sei, ohne Angst vor dem Eismeer und bereit, für zweieinhalb Jahre alles Vertraute hinter sich zu lassen, der möge sich im Hafenamt bei ihm melden – zur Teilnahme an der k.u.k. österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition. Er, Weyprecht, werde das Kommando auf der Admiral Tegetthoff führen; zu Lande aber werde sein Gefährte, der Oberlieutenant Julius Payer, befehlen.
Während nun die Dinge an der Adria ihren ermüdenden Lauf nahmen, die Heuer abgemacht und Abschiede vorbereitet wurden, sorgte in Wien ein aristokratisches Polarcomitee, allen voran der ins Abenteuer verliebte Graf Hans Wilczek, für die Finanzierung dieser Expedition, und Oberlieutenant Julius Payer schrieb Briefe nach Südtirol.
Lieber Haller!
Es freut mich, daß ich Dich endlich entdeckt habe und daß Du mir so rasch antwortetest.
Ich beabsichtige eine Reise von zweieinhalbjähriger Dauer nach sehr kalten Gegenden, in welchen es keine Menschen, dafür Eisbären gibt und wo die Sonne mehrere Monate unausgesetzt scheint und dann wieder mehrere Monate gar nicht.
Ich mache nämlich eine Nordpolexpedition.
Ich zahle Dir ohne irgend einen Abzug die Reise von Sankt Leonhard weg bis Bremerhaven, wo wir das Schiff betreten.
Ende Mai würde Dein Dienst beginnen, Du müßtest um diese Zeit in Wien eintreffen.
Zweieinhalb Jahre müßtest Du bei mir bleiben.
Du wirst ganz von mir gekleidet, bewaffnet und verköstigt und erhältst außer besonderen Prämien für besondere Leistungen mindestens 1000 Gulden Papier, davon Du einen Teil schon beim Weggehen ausgezahlt erhalten kannst.
Ich bitte Dich, Haller, sieh Dich noch nach einem zweiten Bergsteiger um – er soll ein anständiger Mensch sein, verträglich, arbeitssam, er darf nie die Lust und Ausdauer verlieren, selbst wenn die Entbehrungen noch so groß sind, er soll ein guter Jäger sein und würde dasselbe wie Du bekommen. Bei der Rückkunft würdest Du auch noch ein feines Lefaucheux-Gewehr (Hinterlader, Büchsflinte) zum Geschenk erhalten.
Also schreibe gleich und suche jedenfalls noch einen zweiten Mann, für den Du garantieren kannst, daß er taugt.
Wir werden Kälte und Gefahren haben, – scheut Dich das? Ich habe bereits zwei solcher Reisen glücklich durchgemacht, und was ich thue, das thust Du auch.
Dein Freund Payer
2Der Verschollene – Angaben zur Person
Josef Mazzini kam als Sohn des aus Wien stammenden Tapezierers Kaspar Mazzini und dessen Frau Lucia, einer Triestiner Miniaturenmalerin, im Triest des Jahres 1948 zur Welt. In den ersten Tagen nach seiner Geburt erreichte ein wochenlanger Streit im Tapeziererhaus seinen Höhepunkt: Es war der deutsche Name Josef, den die Mutter, eine begeisterte Italienerin, vergeblich zu verhindern suchte. Der Tapezierer, der schon damals an den Augen litt und in den Jahren der abnehmenden Sehkraft immer unverträglicher wurde, ließ aber auch hier alle Einwände und Bitten hinter sich. Josef Mazzini wurde in einer Wohnung, die nur durch eine hölzerne Schiebetür von der Werkstätte seines Vaters getrennt war, in den Muttersprachen der Eltern so gründlich erzogen, daß der für eine bessere Zukunft bestimmte Erbe sehr bald begann, nicht nur gegen die väterlichen Absichten, sondern gegen jede Vorschrift zu leben. Er wurde schwierig.
In den frühen Erzählungen der Mutter, einer geborenen Scarpa, war die Welt ein Album, in dem man blätterte. Lucia Mazzini versuchte ihren Sohn stets zu besänftigen. Sie erzählte viel. In den Nachmittagsstunden war die Gegenwart oft nichts als ein Arbeitsgeräusch, das in unregelmäßigen Abständen durch die Schiebetür drang; am Küchentisch aber war die Vergangenheit übermächtig und malerisch. Unter den Scarpas seien viele Seeleute gewesen, hieß es in den Erzählungen, Steuermänner, Kapitäne! Lorenzo etwa, der die Welt siebzehnmal umschifft hatte, als man ihn dann in Port Said erschlug, oder Antonio, der Urgroßonkel, Antonio Scarpa!, der sei mit einer österreichischen Expedition, die in Wahrheit fast nur aus italienischen Matrosen bestanden habe, sogar bis an den Nordpol gesegelt und habe dort ein Gebirge aus Eis und schwarzen Steinen entdeckt, ein strahlendes Land unter einer Sonne, die niemals untergegangen sei. Aber das Schiff, über und über mit Eiskristallen bedeckt, sei festgefroren und Antonio schließlich zu Fuß über ein erstarrtes Meer aus der Wildnis zurückgekehrt. Er habe viel dabei gelitten. Wenn die Mutter von Antonio Scarpas qualvollem Weg durch das Eis erzählte, schlug sie manchmal die Hände über dem Kopf zusammen und machte seltsame Augen. Italien war groß. Italien war überall! Und Lucia, die an ihrem Tapezierer aus Wien keine Freude mehr fand, tröstete sich und ihren Sohn damit. Der Schüler Mazzini wurde mit Helden vertraut. So auch mit dem Schicksal des schönen Generals Umberto Nobile aus dem Avellino, dem die Miniaturenmalerin gewiß manche Träume gewidmet hatte. Nobile hatte im Mai 1926 gemeinsam mit Roald Amundsen, dem Eroberer des Südpols, dem amerikanischen Millionär Lincoln Ellsworth und zwölf anderen Fliegern den Nordpol im Luftschiff von Spitzbergen aus überflogen und war unversehrt und angetan mit einer golddurchwirkten Paradeuniform in Alaska gelandet. Und zwei Jahre später war Lucia, ein weißgekleidetes, fähnchenschwenkendes Mädchen, dabeigewesen!, als man Nobile in Mailand zu einem zweiten Polflug verabschiedet hatte. Was für ein Fest! Auch der Duce war dagewesen. Aber dieser Apriltag war lang geworden und vergangen, ohne daß sich Nobiles Luftschiff Italia in den Mailänder Himmel erhoben hätte. Bis spät in die Nacht war das Schiff vertäut geblieben, und die Menge hatte sich allmählich verlaufen, als dann endlich, mattschimmernd und ungeheuer, die gewaltige Zigarre Italia sachte aus ihren Fesseln glitt und in die Finsternis emporstieg. Lucia hatte damals ausgeharrt bis zu diesem einen, wunderbaren Augenblick, hatte, auf Zehenspitzen stehend, das papierene Fähnchen in die Nacht hinaufgestreckt und sich vor Begeisterung in die weißen Knöchel ihrer Faust gebissen. Aber aus diesem Abenteuer war Lucias Held so verwandelt zurückgekehrt, ein Schiffbrüchiger, daß die Miniaturenmalerin ihn später nur mit Mühe und gegen die öffentliche Meinung in seiner alten Herrlichkeit bewahren konnte. Es war das Unglück, von dem Josef Mazzini im Tapeziererhaus zu hören bekam. Und auch wenn damals der Absturz der Italia schon weit zurücklag, die Toten schon lange tot, die überlebenden Helden beinahe vergessen waren und der Zweite Weltkrieg inzwischen alle Abenteuer in der Arktis und sonstwo als lächerliche Hasardspiele weggewischt hatte – so war es doch das erste Unglück, das Mazzini in seinem Leben betroffen machte und ihn schlimm träumen ließ. Denn in den Erzählungen vom Untergang der Italia-Expedition begann Mazzini zum ersten Mal zu begreifen, daß es so etwas tatsächlich gab: tot sein. Und das erschreckte ihn. Was war das für ein Meer, auf dem sich Helden in Lumpengestalten, Kapitäne in Menschenfresser und Luftschiffe in eisige Fetzen verwandelten?
Ich nehme an, daß Mazzini damals begonnen hat (war er zwölf, war er jünger?), seine ersten, ungefähren Vorstellungen von der Arktis zum Bild einer kalten, gleißenden Welt der Ungeheuerlichkeiten zusammenzufügen; einer Welt, in deren beängstigender Leere einfach alles möglich war und von der man im Tapeziererhaus nur heimlich und ein bißchen altmodisch zu träumen wagte. Es war kein schönes Bild. Aber es war so mächtig, daß Mazzini es aus seiner Kindheit in die Jahre hinein mitnahm.
Der Tapezierer hörte die Geschichten nicht gern, die seine Frau dem Erben erzählte. Er schimpfte Lucias Helden Idioten, Nobile gelegentlich einen Faschisten und ließ aber doch zu, daß eine postkartengroße Fotografie, die den General vor dem Ankermast seines Luftschiffes im spitzbergischen Ny Ålesund zeigte, über Jahre an die Schiebetür zur Werkstätte geheftet blieb. Als man das Bild endlich abnahm, blieb, wie ein Fenster in eine andere Welt, ein helles Rechteck an der Tür zurück, und Josef Mazzini war längst in Wien. Er hatte den schließlich aussichtslosen Streit, der in der Familie um seine Zukunft geführt wurde, mit seinem Abschied von Triest hinter sich gelassen und ließ sich auch im Verlauf von immer selteneren Besuchen nicht mehr dazu bewegen, den geordneten Platz eines Erben wieder einzunehmen. Daß Mazzini nach Wien gegangen war, mochte sogar etwas mit den trotzigen Fluchtphantasien seines Vaters zu tun haben, der an seinen üblen Tagen Triest verflucht und stets davon gesprochen hatte, wieder in seine Heimatstadt zurückzukehren; es mochte auch an einer kleinen, verstaubten Verwandtschaft liegen, die an der Wiener Thahastraße einen Handel mit Obst und Südfrüchten betrieb und den italienischen Neffen in der ersten Zeit nach seiner Ankunft halbherzig unterstützte – gleichwie, Mazzini war in Wien und machte, abgesehen von strapaziösen Reisen, keine Anstalten, wieder zurück nach Triest oder anderswohin zu gehen. Er habe sich, sprach er vermutlich das Deutsch seines Vaters, hier niedergelassen.
Mazzini richtete sich im Haus der Witwe eines Steinmetzmeisters zur Untermiete ein, arbeitete gelegentlich als Fahrer in einer Speditionsfirma, in der ein Freund der Verwandtschaft als Buchhalter saß, besorgte später nebenher fernöstliche Antiquitäten aus Porzellan, Jade und Elfenbein, die mit schwarzem Geld bezahlt wurden, und las viel. Die Steinmetzwitwe versaß ihre Tage an einer klobigen Strickmaschine, bot ihrem Untermieter die seltsamsten wollenen Kleidungsstücke an und betrachtete aus dem Fenster oft stundenlang die unverkauften Grabsteine ihres Gemahls, die immer noch im Hinterhof des Hauses gelagert waren. Auf den Steinen wuchs Moos.
Ich habe Josef Mazzini in der Wohnung der Buchhändlerin Anna Koreth kennengelernt; einer Frau, die mit einer völkerkundlichen Arbeit über einen Samojedenstamm an der sibirischen Eismeerküste in den Kreis der Akademiker getreten war und sich dann in ihrem Laden auf ethnohistorische und Reiseliteratur spezialisiert hatte. In ihrer dunklen, weitläufigen Wohnung an der Wiener Rauhensteingasse gab die Buchhändlerin gelegentlich Abendessen für die bessere Kundschaft. Es waren Abende, an denen viel über Handschriften und seltene Ausgaben gesprochen und billiger Importwein aus Italien getrunken wurde. Man erfuhr in der Rauhensteingasse die unglaublichsten Details über das Zustandekommen verschiedener Werke, über Erscheinungsjahre, Ausstattungen und Einbände, aber fast nichts über die Leute, die solche Bücher lasen. Mazzini – Anna Koreth hatte ihn irgendwann als ihren Josef in den Kreis dieser Abendgesellschaften eingeführt – war eine Ausnahme. Er sprach viel von sich. Er tat es in einem höflichen Deutsch, dem man anmerkte, daß es aus der Emigration kam. So verwendete Mazzini, als er in der Rauhensteingasse noch neu war, Worte wie Lichtspieltheater, sagte behufs, hochherzig, dergestalt oder fernmündlich.
Ich habe sein akzentfreies Vokabular damals als Teil einer pointensüchtigen Konversation mißverstanden – zumal auch die Dinge, von denen er sprach, in Anna Koreths Kreis seltsam und kauzig erschienen. Er entwerfe, sagte Mazzini, gewissermaßen die Vergangenheit neu. Er denke sich Geschichten aus, erfinde Handlungsabläufe und Ereignisse, zeichne sie auf und prüfe am Ende, ob es in der fernen oder jüngsten Vergangenheit jemals wirkliche Vorläufer oder Entsprechungen für die Gestalten seiner Phantasie gegeben habe. Das sei, sagte Mazzini, im Grunde nichts anderes als die Methode der Schreiber von Zukunftsromanen, nur eben mit umgekehrter Zeitrichtung. So habe er den Vorteil, die Wahrheit seiner Erfindungen durch geschichtliche Nachforschungen überprüfen zu können. Es sei ein Spiel mit der Wirklichkeit. Er gehe aber davon aus, daß, was immer er phantasiere, irgendwann schon einmal stattgefunden haben müsse. »Aha«, sagte man in der Rauhensteingasse zu dem Italiener, der sich in einem zu groß gestrickten Pullover am Tisch breitmachte und den Rotwein soff, »aha, sehr nett, kommt uns bekannt vor«, aber eine phantasierte Geschichte, die tatsächlich schon einmal geschehen sei, würde sich doch durch nichts mehr von einer bloßen Nacherzählung unterscheiden; niemand würde eine solche Phantasie zu schätzen wissen und jeder glauben, hier läge ein reiner Tatsachenbericht vor. Das sei ohne Bedeutung, gab Mazzini damals zurück, ihm genüge schon der private, insgeheime Beweis, die Erfindung der Wirklichkeit geschafft zu haben.
Ich nehme an, es war Anna Koreth (sie überragte ihren Josef fast um einen Kopf; um ihren Kopf), die den Erfinder schließlich dazu brachte, die Privatheit und Heimlichkeit seiner Gedankenspiele aufzugeben und seine Geschichten der Öffentlichkeit anzubieten. (Sie erschienen jedenfalls gelegentlich in den wenigen Zeitschriften, die in der Buchhandlung Koreth auflagen und dort zwischen dichten Reihen historischer Werke die Gegenwart repräsentierten.) Mazzini übernahm für die Speditionsfirma weiterhin Fernfahrten zur Aushilfe, versorgte das antiquitätenbedürftige Bürgertum nach wie vor mit Statuetten und schrieb Geschichten, deren Schauplätze auf der Karte meist nur ungefähr zu finden waren. Er ließ Fischkutter in weit entfernten Gewässern versinken, ließ im asiatischen Abseits Steppenbrände ausbrechen oder berichtete als Augenzeuge von Flüchtlingskarawanen und Kämpfen im Irgendwo. Die Grenze zwischen Tatsache und Erfindung verlief dabei stets unsichtbar.
»Dem Unterhaltungsbedürfnis ist ohnedies alles gleich«, sollte Mazzini später in eines jener Eismeertagebücher schreiben, die der Ozeanograph Kjetil Fyrand aus der spitzbergischen Grubenstadt Longyearbyen dann Anna Koreth übersandte, »… es ist wohl immer dieselbe verschämte Ausbruchsbereitschaft, die uns nach Dienstschluß von Dschungelmärschen, Karawanen oder flirrenden Treibeisfeldern träumen läßt. Wohin wir selbst nicht kommen, schicken wir unsere Stellvertreter – Berichterstatter, die uns dann erzählen, wie’s war. Aber so war es meistens nicht. Und ob man uns vom Untergang Pompejis oder einem gegenwärtigen Krieg im Reisfeld berichtet – Abenteuer bleibt Abenteuer. Uns bewegt ja doch nichts mehr. Uns klärt man auch nicht auf. Uns bewegt man nicht, uns unterhält man …«
Je großartiger für Mazzini damals die Vorstellung zu werden schien, seine Hirngespinste tatsächlich in der Wirklichkeit wiederzufinden, desto häufiger verlegte er die Kulissen seiner Erzählungen in unbewohnte, kahle Landschaften und nördliche Einöden. Denn ein erfundenes Drama, das sich in einer leeren Welt vollzog, war schließlich weitaus wahrscheinlicher und denkbarer als etwa ein tropisches Abenteuer, bei dessen Erfindung die Einflüsse einer vielfältigen Natur oder die Rituale einer fremden Kultur zu berücksichtigen waren. So trieb Mazzini die Gestalten seiner Phantasie immer weiter in den Norden hinauf, dorthin schließlich, wo nicht einmal mehr Eskimos lebten – ins Packeis der Hocharktis. Der Erfinder schien damit den Anschluß an die eisstarrenden Bilder seiner Kindheit gefunden zu haben; erst später sollte sich zeigen, daß es auch ein Anschluß ans Ende war. Denn das Vorspiel zu Mazzinis Verschwinden begann, als er unter den antiquarischen Beständen der Buchhandlung Koreth die mehr als hundert Jahre alte Beschreibung einer Eismeerfahrt entdeckte, die so dramatisch, so bizarr und am Ende so unwahrscheinlich war wie sonst nur eine Phantasie: Es war der Bericht Julius Ritter von Payers über die k.u.k. österreichisch-ungarische Nordpolexpedition, erschienen in Wien 1876 beim Hof- und Universitätsbuchhändler Alfred Hölder.
Josef Mazzini war fasziniert. Mehr als zwei Jahre hatte diese Expedition im Packeis zugebracht und an einem strahlenden Augusttag des Jahres 1873 jenseits des 79. Grades nördlicher Breite einen bis dahin unbekannten Archipel im Polarmeer entdeckt – etwa sechzig Inseln aus Urgestein, fast zur Gänze unter einer mächtigen Gletscherdecke begraben, Basaltgebirge, neunzehntausend Quadratkilometer Leblosigkeit. Vier Monate des Jahres ging über diesem Inselreich die Sonne nicht auf, und von Dezember bis Jänner herrschte dort jene völlige Finsternis, in der die Lufttemperatur bis auf siebzig Grad unter die Null der Celsiusskala fiel. Julius Payer und Carl Weyprecht, die Kommandanten der Expedition, hatten dieses entsetzliche Land zu Ehren ihres fernen Herrschers Kaiser-Franz-Joseph-Land getauft und damit einen der letzten weißen Flecken von der Landkarte der Alten Welt getilgt.
Ich kann mir für die Faszination, die dieser Expeditionsbericht in Josef Mazzini auslöste, nur schwer einen anderen Grund als den vorstellen, daß er mit Payers Aufzeichnungen einen Beweis für eines seiner erfundenen Abenteuer in den Händen zu halten glaubte. Gewiß ist aber nur, daß Mazzini damals mit einem geradezu fanatischen Eifer begann, den wirren Verlauf dieser Entdeckungsreise zu rekonstruieren. Er durchwanderte die Archive. (In der Marineabteilung des Österreichischen Kriegsarchivs lag das zerschlissene Logbuch der Admiral Tegetthoff verwahrt, lagen unveröffentlichte Briefe und Journale Weyprechts und Payers, in der Kartensammlung der Nationalbibliothek das Tagebuch des Expeditionsmaschinisten Otto Krisch und die monotonen, sprachlosen Aufzeichnungen des Jägers Johann Haller aus dem Passeiertal …) Es war, als ob jener Sog, der schon Mazzinis frühere Phantasiegestalten in den höchsten Norden verweht hatte, nun auch ihn selbst erfaßt hätte und fortzog. Mazzini rannte einer verjährten Wirklichkeit nach. Für diesen Lauf waren alle Archive zu eng, zu klein. Mazzini reiste ins Eismeer. Mazzini zelebrierte die Chronik der Payer-Weyprecht-Expedition vor den Kulissen der Wirklichkeit – der violette Himmel über den Treibeisfeldern mußte der gleiche sein, unter dem vor mehr als einem Jahrhundert die Mannschaft der Admiral Tegetthoff verzweifelt war. Mazzini wanderte über die Gletscher. Mazzini verschwand.
Nein, ich habe nicht zu seinen Freunden gehört. Ich habe für diesen kleingewachsenen, fast zierlichen Mann, der wohl auch einer Luftspiegelung mit der Kraft eines Fanatikers gefolgt wäre, manchmal sogar jene besondere Feindseligkeit empfunden, mit der man vielleicht nur jemandem gegenübertritt, der einem allzu nahe, allzu ähnlich ist. Ich bin, ohne es zu wollen, in sein Leben hineingeraten – eine flüchtige Bekanntschaft. Tatsächlich aufmerksam wurde ich auf Mazzini erst, nachdem er im Eis verschwunden war. Denn das Rätselhafte und Beklemmende an diesem Verschwinden begann seine Existenz rückwirkend und in einem Ausmaß zu durchdringen, daß allmählich alles, was dieser Mann getan und womit er sich beschäftigt hatte, rätselhaft und beklemmend wurde. Trotzdem war es zunächst nicht viel mehr als ein Gedankenspiel, daß ich die Umstände dieses Verschwindens zu einer Erklärung, irgendeiner Erklärung zusammenzufassen versuchte. Aber aus jedem Hinweis ergab sich eine neue offene Frage, unwillkürlich tat ich so immer noch einen Schritt und den nächsten, setzte biografische Details, Auskünfte und Namen wie in ein Kreuzworträtsel in einen Zusammenhang ein, und Mazzini wurde für mich zum Fall. Ich führte schließlich sogar jene polargeschichtlichen Nachforschungen weiter, die er so unbeirrbar betrieben hatte, vertiefte mich immer mehr in seine Arbeit und vernachlässigte darüber meine eigene. Mazzinis spitzbergische Aufzeichnungen und Tagebücher, die mir Anna Koreth überließ, wurden mir schließlich so vertraut, daß ich auch die verworrensten Passagen daraus mühelos aus dem Gedächtnis zitieren konnte. Ich brachte Sätze und Bilder, auch bedeutungslose Fragmente, nicht mehr aus dem Kopf. Selbst wenn ich es wollte, vergaß ich nun nichts mehr. Haufenwolken, die sich in Schaufenstern spiegelten, wurden zu Gletscherabbrüchen, Schneereste in städtischen Parks zu Treibeisfeldern. Das Nördliche Polarmeer lag vor meinem Fenster. Mazzini mußte es ähnlich ergangen sein. Noch immer ist mir die Erinnerung an jenen Märztag unbequem und lästig, an dem mir auf dem Weg in eine geographische Bibliothek plötzlich bewußt wurde, daß ich längst in die Welt eines anderen hinübergewechselt war; es war die beschämende, lächerliche Entdeckung, daß ich gewissermaßen Mazzinis Platz eingenommen hatte: Ich tat ja seine Arbeit und bewegte mich in seinen Phantasien so zwangsläufig wie eine Brettspielfigur.
An diesem Tag regnete es gleichmäßig und ohne Unterbrechung bis spät in die Nacht. Langgezogene Wasserlachen schlossen sich jedesmal schäumend hinter dem Straßenverkehr, der sie im Rhythmus der Ampelsignale durchzog. Der Regen verwandelte den alten, geschwärzten Schnee in einen glasigen Morast. Es war kalt. Mazzini war tot. Er mußte tot sein.
3Anwesenheitsliste für ein Drama am Ende der Welt
(beiliegend: Auszüge aus den Personalakten der Kommandanten)
Schiffslieutenant Carl Weyprecht aus Michelstadt in Hessen
Expeditionskommandant zu Wasser und Eis, Erster Mann auf der Admiral Tegetthoff
Oberlieutenant Julius Payer aus Teplitz in Böhmen
Expeditionskommandant zu Lande, Kartograph des Kaisers
Schiffslieutenant Gustav Brosch aus Komotau in Böhmen
Erster Offizier (Innerer Dienst), Proviantmeister
Schiffsfähnrich Eduard Orel aus Neutitschein in Mähren
Zweiter Offizier (Pilotage)
Doktor Julius Kepes aus Bari in Ungarn
Expeditionsarzt
Vergessen wir nicht, daß eine Luftlinie eben nur eine Linie und kein Weg ist und: daß wir, physiognomisch gesehen, Fußgänger und Läufer sind.
Linienschiffskapitän Pietro Lusma aus Fiume
Bootsmann
Kapitän Elling Carlsen aus Tromsö in Norwegen
Eismeister und Harpunier
Otto Krisch aus Kremsier in Mähren
Maschinist
Josef Pospischill aus Prerau in Mähren
Heizer
Antonio Vecerina aus Draga bei Fiume
Zimmermann
Johann Orasch aus Graz
Koch
Johann Haller aus dem Passeiertal in Tirol
Erster Jäger, Heiler und Hundetreiber
Alexander Klotz aus dem Passeiertal in Tirol
Zweiter Jäger, Heiler und Hundetreiber
Antonio Scarpa aus Triest
Matrosen
Antonio Zaninovich aus Lesina
Antonio Catarinich aus Lussin
Antonio Lukinovich aus Brazza
Giuseppe Latkovich aus Fianona bei Albona
Pietro Fallesich aus Fiume
Giorgio Stiglich aus Buccari
Vincenzo Palmich aus Volosca bei Fiume
Lorenzo Marola aus Fiume
Francesco Lettis aus Volosca
Giacomo Sussich aus Volosca
Leithund Jubinal aus Nordasien, gekauft in Wien
Schlittenhunde
Gillis, Herkunft unbekannt, gekauft in Wien
Matotschkin, Herkunft unbekannt, gekauft in Wien
Bop, Herkunft unbekannt, gekauft in Wien
Nowaja, Herkunft unbekannt, gekauft in Wien
Semlja, Herkunft unbekannt, gekauft in Wien
Sumbu aus Lappland, gekauft in der Wildnis
Pekel aus Lappland, gekauft in Tromsö
Toroßy aus dem Eismeer, als Sohn Semljas auf der Admiral Tegetthoff geboren
Zwei Katzen aus Tromsö, namenlos
Josef Mazzini aus Triest
Nachfahre
WEYPRECHT, Carl, Linienschiffslieutenant, Polarforscher. Geboren am 8. September 1838 zu Michelstadt im Odenwald im Großherzogtum Hessen-Darmstadt; Sohn wohlhabender Bürger; Gymnasium und Gewerbeschule in Darmstadt. Tritt achtzehnjährig als Provisorischer Cadet in die österreichische Kriegsmarine ein. 1856–59 nautische Ausbildung auf der Segelfregatte Schwarzenberg, der Corvette Erzherzog Friedrich, der Fregatte Donau und dem Dampfer Curtatone; überseeische Fahrten. 1860–61 Offiziersdienst als Effectiver Marinecadet auf der Fregatte Radetzky unter dem Kommando des (späteren) Admirals Wilhelm von Tegetthoff: 1861 Beförderung zum Linienschiffsfähnrich durch Tegetthoff. 1863–65 als Ausbildungsoffizier auf der Brigg Husar. Zeichnet sich 1866 in der Seeschlacht von Lissa an Bord der Panzerfregatte Drache durch besondere Umsicht und Kühnheit aus; wird mit dem Orden der Eisernen Krone Dritter Classe belohnt und 1868, nach einer Fahrt in den Golf von Mexiko, zum Linienschiffslieutenanten befördert. Bis 1871 mehrere Reisen nach dem asiatischen und amerikanischen Kontinent; Kreuzfahrten vor der syrischen und ägyptischen Küste und Vervollständigung der Küstenaufnahme Dalmatiens. Ausgezeichnete Sprachkenntnisse – Italienisch, Ungarisch, Serbokroatisch, Französisch, Englisch und Norwegisch. Unternimmt 1871 gemeinsam mit → Julius Payer und dem Grafen Hans Wilczek auf der Fregatte Isbjörn eine Vorexpedition nach Spitzbergen und Nowaja Semlja zur Erkundung der Witterungs- und Eisverhältnisse in der nördlichen Barents-See; wird 1872, dreiunddreißigjährig, mit dem Seekommando der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition betraut.
Zahlreiche Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Nautik, Meteorologie, des Erdmagnetismus und der Ozeanographie – unter anderem: Die Metamorphosen des Eises, Praktische Anleitung zur Beobachtung der Polarlichter, Die Nordpolexpedition der Zukunft und deren sicheres Ergebniß …
Träger des Ritterkreuzes des Leopoldordens, des Ordens der Eisernen Krone Dritter Classe, des kgl. preußischen Rothen Adlerordens Dritter Classe, des Offizierskreuzes des kgl. italienischen Mauritius- und Lazarusordens, des Silbernen Lorbeerkranzes der Stadt Frankfurt, der Großen Goldenen Medaille des Internationalen Geographischen Kongresses Paris, der Goldenen Stiftermedaille der Londoner Geographischen Gesellschaft etc. etc. vgl. → Payers Dekorationen; Ehrenbürger der Städte Fiume (Rijeka) und Triest.
PAYER, Julius, Ritter von, Oberlieutenant, Kartograph, Alpen- und Polarforscher, Maler, Schriftsteller. Geboren als Sohn eines Ulanenrittmeisters zu Schönau bei Teplitz in Böhmen, am 2. September 1841. Absolvent des Kadetteninstitutes in Lobzowa bei Krakau und der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt; kämpft 1859 als Unterlieutenant des 36. Infanterieregimentes in der Schlacht bei Solferino; wird mit dem Verdienstkreuz mit Kriegsdekoration belohnt und zum Oberlieutenant befördert. Stationierungen in Mainz, Frankfurt, Verona, Venedig, Chioggia und Jägerndorf; lehrt am Kadetteninstitut in Eisenstadt Geschichte und arbeitet später unter Feldmarschall von Fligely für das Militärgeographische Institut. Spektakuläre Hochgebirgstouren zur Erschließung der Südtiroler Alpen und der Hohen Tauern; Kartierung der Monti Lessini, Pasubio-, Glockner- und Venedigergruppe; mehr als dreißig Erstbesteigungen in der Brenta-, Adamello- und Presanellagruppe. 1865–68 systematische Erforschung und trigonometrische Aufnahme aller Teile der weitverzweigten Ortlergruppe; sechzig Gipfelbesteigungen. 1869/70 Teilnahme an der Zweiten Deutschen Nordpolarexpedition nach Grönland als Geograph, Orograph und Glaziologe; Entdeckung des Tyroler-Fjordes und Franz Joseph Fjordes auf einem sechshundert Kilometer langen Fußmarsch entlang der grönländischen Ostküste. 1871 gemeinsam mit → Carl Weyprecht und Graf Hans Wilczek Vorstoß in die Barents-See bis 78°48' nördlicher Breite; ergänzende Kartierung Spitzbergens. Übernimmt 1872, dreißigjährig, das Commando zu Lande der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition.
Zahlreiche Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Kartographie, Geographie und des arktischen Abenteuers – unter anderem: Die Adamello-Presanella-Alpen, Die Bocca di Brenta, Die Ortler-Alpen, Die österreichische Vorexpedition zur Untersuchung des Nowaja Semlja Meeres, Über Kälte, Das Innere Grönlands, Die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition von 1872–74 etc.
Träger des Ordens der Eisernen Krone Dritter Classe, der Goldenen Medaillen der Geographischen Gesellschaften von London und Paris; Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaften von Wien, Berlin, Rom, Budapest, Dresden, Hamburg, Bremen, Hannover, München, Frankfurt a.M. und Genf; Ehrenmitglied der Meteorologischen Gesellschaft zu Algier, des Nautischen Vereins zu Hamburg und des Vereins für Erdkunde in Preßburg; Ehrenmitglied des französischen, englischen und italienischen Alpenvereins; Ritter der französischen Ehrenlegion, des kgl. preußischen Rothen Adlerordens Dritter Classe, des kgl. schwedischen Nordsternordens, des kgl. italienischen Mauritius- und Lazarusordens, des Ordens der italienischen Krone, des kgl. portugiesischen Turm- und Schwertordens und des großherzoglich-sächsischen Ordens vom Weißen Falken; Dr. phil. h.c. der Universität Prag; Ehrenbürger der Städte Brünn, Fiume und Teplitz; genießt den Ruf, der beste außerhalb des Polarkreises geborene Hundeschlittenführer seiner Zeit zu sein.
4Chronik der Abschiede oder die Wirklichkeit ist teilbar
Im Jahre 1868, während der Aufnahme der Ortler-Alpen, drang einst ein Zeitungsblatt mit der Nachricht von der deutschen Vorexpedition Koldeweys bis zu meinem im Gebirge entlegenen Zelte. Ich hielt den Hirten und Jägern, die meine Begleitung ausmachten, Abends beim Feuer einen Vortrag über den Nordpol, von Staunen erfüllt, wie es Menschen geben könne, die weit mehr als Andere befähigt seien, die Schrecken der Kälte und Finsterniß zu ertragen. Damals hatte ich noch keine Ahnung, daß ich schon ein Jahr später selbst Theilnehmer einer Nordpol-Expedition sein würde, und ebensowenig konnte Haller, damals einer meiner Jäger, voraussetzen, daß er mich auf meiner dritten Reise begleiten würde. Julius Payer
Wo begann der Abschied? Und wann? Es gab so viele Schauplätze – den Bahnsteig des Wiener Westbahnhofes, das Schleusentor von Geestemünde, den Hafen der norwegischen Stadt Tromsö; und ein Jahrhundert später war es der Airport und wieder ein Landesteg.
Fünf Matrosen der Admiral Tegetthoff ließen Familien zurück; haben sie beim Abschied die Versprechungen wiederholt, die man ihnen gemacht hat? Länder werden wir entdecken. Haben sie vom großen Leben nach der Rückkehr gesprochen und von der Heuer, die besser war als auf anderen Schiffen? Eintausendzweihundert Gulden in Silber, Ausrüstung und freie Kost für zweieinhalb Jahre, vielleicht auch drei, vielleicht – aber nein, es wird gewiß nichts geschehen – für immer. Die zurückblieben, konnten nicht viel mehr wissen, als daß es dort, wo die Söhne, die Brüder, die Väter hingingen, ganz anders war und kalt, daß noch niemand dort gewesen war und daß es lange dauern würde; länger als sonst.
Am Fronleichnamstag des Jahres 1872, es war Donnerstag, der 31. Mai, setzte sich die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition samt ihren Schlittenhunden zum erstenmal geschlossen in Bewegung. Man bestieg den Zug nach Bremerhaven, der, eingehüllt in eine Rauchwolke, die nicht überliefert ist, den Wiener Westbahnhof um 18 Uhr 30 verließ. Es war kein großer Abschied. Zwei Tage lang zog die Landschaft an den Abteilfenstern vorüber, rollte dorthin zurück, wo man herkam. Mährisch-Trübau, Budweis, Prag, Dresden, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Bremen – in den Stationen, die man passierte, entboten manchmal Delegationen ihre besten Wünsche, erhoben sich Hände, aber kein Jubel.
Jeder fühlt, ohne es auszusprechen, daß er einer ernsten Zeit entgegengeht; Jedem steht auch frei, heute noch zu hoffen, was er wünscht; denn vor Keinem eröffnet sich ein Blick in die Zukunft. Ein Gefühl aber belebt Alle, das Bewußtsein, daß wir, in einem Kampf für wissenschaftliche Ziele, der Ehre unseres Vaterlandes dienen, und daß man unsern Schritten daheim mit regster Antheilnahme folgt. Julius Payer
Die Matrosen in ihren neuen Kleidern, an den Abteilfenstern stehend oder in die Sitze zurückgelehnt, eine Branntweinflasche zwischen den Knien; die Jäger Haller und Klotz, beide noch in der Tracht des Passeiertals – bestickte Lodenjoppen, breitkrempige Hüte und knielange Hirschlederhosen (Payer wollte seine Jäger zur Abfahrt in ihren Trachten sehen) – was konnten für diese Männer Wissenschaft und Vaterlandsehre gegen eintausendzweihundert Gulden in Silber bedeuten? Eintausendzweihundert Gulden in Silber, dazu Prämien und ein neues Land! Noch sitzen sie im Zug und machen sich in den Dialekten vier verschiedener Sprachen miteinander vertraut; das Italienische wird die Schiffssprache sein. Aber sie fahren auf einen Tag zu, an dem dieser zähe Tiroler Alexander Klotz in den Schnee des Franz-Joseph-Landes sinken wird; seine Pelze in Fetzen, ausgezehrt und mit erfrorenen Füßen wird er in ein langes Schluchzen ausbrechen und keinem Zuspruch und keinem Trost mehr zugänglich sein. Und an einem anderen Tag wird man Otto Krisch, den neunundzwanzigjährigen Maschinisten, in einem von Antonio Vecerina gezimmerten Sarg übers Eis unter die Klippen des neuen Landes tragen und ihn zwischen Basaltsäulen mit Steinen zudecken. Unbeschreibliche Einsamkeit liegt über diesen Schneegebirgen …, wird Julius Payer in sein Tagebuch schreiben, Wenn das Strandeis nicht durch Ebbe und Fluth ächzend und klingend gehoben wird, der Wind nicht seufzend über die Steinfugen dahinstreicht, so liegt die Stille des Todes über der geisterbleichen Landschaft. Wir hören von dem feierlichen Schweigen des Waldes, einer Wüste, selbst einer in Nacht gehüllten Stadt. Aber welch ein Schweigen liegt über einem solchen Lande und seinen kalten Gletschergebirgen, die in unerforschlichen duftigen Fernen sich verlieren, und deren Dasein ein Geheimniß zu bleiben scheint für alle Zeiten … So stirbt man am Nordpol, allein und wie ein Irrlicht verlöschend, ein einfältiger Matrose als Klageweib, und draußen harrt des Dahingegangenen ein Grab aus Eis und Steinen …
Aber in den Gesprächen im Zug ist es nur eine ernste, weiße Ferne, die ihnen entgegenkommt; und wenn sie auf ihrer Fahrt durchs Eismeer eine Insel entdecken sollten, dann würde es gewiß ein schönes Land sein, still und sanft.
Seine Thäler dachten wir uns damals mit Weiden geschmückt und von Renthieren belebt, welche im ungestörten Genuß ihrer Freistätte weilen, fern von allen Feinden. Julius Payer
Die Welt vor den Abteilfenstern wird allmählich fremder. Aber sie bleibt grün. Hopfenfelder, Pappelalleen, Weiden, strohgedeckte Backsteinhäuser. Hier beginnt ein Sommer.
Am 2. Juni traf die Expeditionsmannschaft in Bremerhaven ein und zog noch am Abend desselben Tages über die Kais von Geestemünde. Und dann, fast ehrfürchtig die einen, beklommen die anderen, standen sie vor der Admiral Tegetthoff: Was für ein Schiff! Und wie neu alles war. Keine Algen und Muscheln an den Planken, keine Salzkrusten; es roch nach Firnis, Teer und frischem Holz. Unterhalb der Wasserlinie mit Eisenplatten beschlagen, ausgestattet mit einer hundert Pferdestärken leistenden Auxiliardampfmaschine der Fabrik Stabilimento Tecnico Triestino, würde dieser Barkschoner auch bei Windstille durchs Treibeis ziehen; die Lebensmittel, geliefert von der Hamburger Proviantfirma Richers und von dem Lübecker Fleischkonservenfabrikanten Carstens, würden für tausend Tage reichen und einhundertdreißig Tonnen Kohle für eintausendzweihundert Stunden Fahrt unter Dampf, eintausendzweihundert Stunden Unabhängigkeit vom Wind in den Segeln. Aber wie weit würde der Weg durchs Polarmeer sein und wie groß ein Eisberg? Die Admiral Tegetthoff war 32 Meter lang und 7,3 Meter breit. Was waren drei Mastbäume und hundert Pferdestärken gegen Schollen, so groß, daß man Paläste auf ihnen hätte errichten können? Es war eng auf dem Schiff, eng die Kajüten der Offiziere, bedrückend die Kojen der Matrosen im Mannschaftsraum. Eine gravierte arabische Floskel schmückte die Offiziersmesse: In Niz Beguzared – Auch das wird vorübergehen.
Über den letzten Vorkehrungen verstreichen zehn Tage. Im Hafenamt wird eine Verzichtserklärung hinterlegt: Die k.u.k. Nordpolexpedition wolle für den Fall ihres Schiffbruchs keinerlei Rettungs- und Suchexpeditionen bemühen. Man käme entweder aus eigener Kraft oder niemals mehr zurück. Das Dokument trägt die Unterschriften der Offiziere, allen voran die in eleganter Kurrentschraffierung nach rechts fallende Signatur Carl Weyprechts und den vor so viel Ernst fast jungenhaft anmutenden Schriftzug Julius Payers. An eine Zeichnung der Matrosen kann ich mich nicht erinnern. Es hätten da auch Kreuze stehen müssen. Nicht alle konnten lesen und schreiben.
Am frühen Morgen des 13. Juni 1872, es ist sommerlich warm, zieht die Admiral Tegetthoff im Schlepptau eines städtischen Dampfers durch die Schleusen von Geestemünde und dann die Weser hinab. Noch einmal Bäume und Weiden. Dann läßt Weyprecht die Segel setzen. Vor ihnen öffnet sich das Meer. Die Tiroler Jäger sehen zum erstenmal das Meer.
Unbeirrt sahen wir alle Reize der Schöpfung sich verjüngen und erlöschen, mehr und mehr sank das Land hinter uns; Abends war die deutsche Küste unsern Blicken entschwunden … Frohsinn belebt die Mannschaft; Abends trägt ein leichter Wind die heiteren Gesänge der Italiener fort oder es erweckt der gleichmäßige Rhythmus des Ludro der Dalmatiner die Erinnerung an ihre sonnige Heimat, welche sie bald mit einem Gegensatz vertauschen sollen, der selbst ihrer Phantasie noch ein Geheimniß ist. Julius Payer
Vor Helgoland singt keiner mehr. Die Admiral Tegetthoff entgeht den Untiefen des Küstenwassers nur knapp. Schweres Wetter zieht auf. Sturzseen, Regen, Kälte; nein, das ist noch keine Kälte. Tiroler Haller bedeutend seekrank, schreibt der Maschinist Krisch in sein Tagebuch. So geht es zwei Wochen. Dann ragen die Felsen Norwegens aus den Wellen; blaugrau wie die Dünung. Der Wind wird schwächer.
Nach einer ziemlich stürmischen Fahrt ankerten wir am 2. Juli 1872 vor Tromsö, wo sich der Harpunier Elling Carlsen einschiffte, ein Mann von sechzig Jahren und besonderer Eismeerpraxis, der sich durch die Umsegelung Spitzbergens einen geachteten Namen gemacht hatte. Gustav Brosch
Stürmisches Wetter hatte uns einige Zeit bei den Lofodden aufgehalten, so daß wir erst am 3. Juli in Tromsö anlangten. Julius Payer
Am 4ten July um 11 Uhr Nachts in Tromsö angekommen. Feuer ausgelöscht und im Tromsö-Sund geankert. Otto Krisch