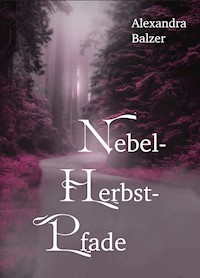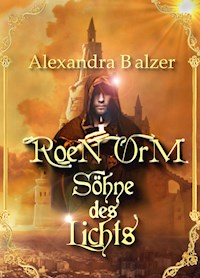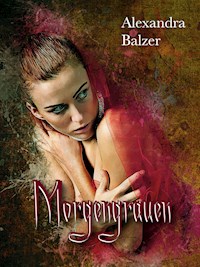2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Ein König kann nicht allein regieren. Erweckt die Diener, die seinen Thron stützen. Die Sklaven, die zu seinen Füßen liegen. Die Wächter, die sein Reich bewahren.“ Einmal mehr müssen Maondnys Helden sich anstrengen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Wächter von Zoi’rons Reich gilt es zu erwecken. Dabei stoßen sie auf zahlreiche Hindernisse – und kämpfen gegen die gefährlichste aller Seelenplagen: Zweifel. Ca. 53.000 Wörter Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieser Roman ca. 265 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
„Ein König kann nicht allein regieren.
Erweckt die Diener, die seinen Thron stützen.
Die Sklaven, die zu seinen Füßen liegen.
Die Wächter, die sein Reich bewahren.“
Einmal mehr müssen Maondnys Helden sich anstrengen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Wächter von Zoi’rons Reich gilt es zu erwecken. Dabei stoßen sie auf zahlreiche Hindernisse – und kämpfen gegen die gefährlichste aller Seelenplagen: Zweifel.
Ca. 53.000 Wörter
Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieser Roman ca. 265 Seiten
von
Alexandra Balzer
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Epilog
Glossar
Kapitel 1
„Der Tod ist keine wirklich ernste Angelegenheit. Man muss ihn respektieren, aber es lohnt sich nicht, ihn so sehr zu fürchten, dass man vergisst zu leben. Alles in allem ist der Tod einfach nur der Zeitpunkt, an dem zufällig das Leben endet und damit ist es nicht einmal eine Angelegenheit. Gleichgültig, ob nun ernst oder nicht.“
Zitat aus einem umstrittenem philosophischen Werk, Verfasser und Datum unbekannt
eißt du, welcher Tag heute ist?“ Anthanael baute sich vor ihm auf. Sayid blieb mit verschränkten Armen stehen. Wollte er keine Gewalt anwenden, gab es keine Möglichkeit, sich an seinem Bruder vorbeizuschieben, also musste er sich wohl oder übel mit ihm auseinandersetzen. Ob er das nun wollte oder nicht.
Gestern Abend hatten sie ihre einsame Insel verlassen, wo sie nach ihren letzten Abenteuern erneut eine längere Zeit Erholung genießen durften. Maondny hatte sie in jenem Haus mitten in der Wildnis einquartiert, in dem Illoziz zuvor Anthanael und Sayid untergebracht hatte – ganz am Anfang, als er noch bemüht gewesen war, sie durch Folter zu zerbrechen. Das Haus hatte einst reichen Leuten gehört. Wem genau, und warum es leer gestanden hatte, wusste Sayid nicht. Illoziz hatte sich mit Freude und Begeisterung darauf gestürzt, es für ihre Zwecke zu möblieren und derart fein herzurichten, als sollten sie den Rest ihres Lebens dort verbringen. Er hatte wirklich Spaß an solchen Detailarbeiten, das spürte man. Von den Teppichen, deren Farben und Muster feinsinnig mit der jeweiligen Tapete des Raumes abgestimmt waren – die wiederum exakt zu Haar- oder Augenfarbe des Bewohners passten, je nachdem, was heller war; zu den Kristallleuchtern in jedem Zimmer, die sich mit einem Klatschen in die Hände und dem jeweils passenden Stimmkommando magisch ein- und ausschalten ließen bis hin zu den Silberlöffeln, in die er ihre Namen eingraviert hatte, damit jeder genau wusste, welcher zu wem gehörte. In Maondnys Zimmer variierten die Farben von Wand- und Bodenschmuck sogar, je nachdem, ob sie sich in Trance befand und ihre Augen golden oder blau leuchteten. Es gab zudem zahllose magische Spielereien, die der Unterhaltung oder der Erleichterung des Alltags dienten, wie zum Beispiel Trinkbecher, die sich auf Zuruf magisch mit dem Getränk auffüllten, das man gerne haben wollte.
Warum sie hier waren und wie lange sie bleiben würden, hatte Maondny nicht verraten. Dass es mehr als zwei Tage dauern sollte, zweifelte Sayid allerdings an. Er vermutete vielmehr, dass ihr Aufenthalt mit seinem bevorstehenden Anfall von Tod zusammenhing. Seit Nakoio, der gefallene Gott der Lügen und Diebe, ihm das stärkste Glücksamulett der Welt gebracht hatte, lief er wenigstens nicht mehr Gefahr, bei jedem winzigen Fehltritt tödlich zu verunglücken. Aufgrund des zugehörigen Fluchs wurde er nun einmal im Monat in der ersten Neumondnacht mit dem Tod belästigt. Heute Nacht war es soweit, zum ersten Mal, seit er das Amulett trug. Sayid war durchaus gespannt, welche Sterbeart der Fluch für ihn arrangieren würde. Vermutlich würde es recht spektakulär werden … Eigentlich hätte er das lieber auf der gemütlichen Insel hinter sich gebracht, doch zweifellos hatte Maondny einen Grund dafür, warum sie sich dagegen entschieden hatte. Das war das Einzige, worauf man bei ihr vertrauen konnte – sie wusste, was sie tat. Vielleicht nicht immer warum, aber kein Wesen, ob sterblich oder göttlich, durchdachte seine Handlungen mehr als sie.
Bei Anthanael konnte man hingegen darauf vertrauen, dass er stur bei einem einmal gefassten Entschluss blieb.
„Könntest du mich bitte vorbeilassen, Bruder?“, fragte Sayid höflich.
„Du musst im Haus bleiben“, erwiderte Anthanael und starrte ihn finster an. Spitzohren machten sich einfach zu viele Sorgen!
„Anthanael, ich will so weit weg wie möglich von euch sein, wenn die Sonne untergangen ist. Ich weiß nicht genau, wann ich meine Verabredung mit dem Tod habe und wie schlimm es wird, kann sich höchstens Maondny ausmalen. Dieses Artefakt hat wahre Wunder vollbracht, um mich trotz Todes- und Unglücksfluch am Leben zu erhalten. Wenn es sich gleich gegen mich wendet, könnte es schlimm genug werden, um euch alle mit hineinzuziehen. Vielleicht reißt die Erde auf und verschlingt mich, oder ein Schwarm wilder Greife fällt über mich her. Ich werde hinterher wieder auferstehen. Ihr nicht.“
„Wenn du in glühender Lava untergehst, kann dein Körper sich nicht regenerieren. Dann stehst auch du nicht wieder auf“, entgegnete Anthanael scharf. „Bleibst du bei uns, können wir dir helfen.“
„Sollte es Lava sein, kann Illoziz meine verflüssigten Überreste raussieben und wieder zusammensetzen. Es ist mir ernst, du musst mich gehen lassen!“
„Er hat recht.“ Maondnys süße Klein-Mädchen-Stimme ließ sie beide herumfahren; sie hatte sich unbemerkt angeschlichen.
„Wären wir auf der Insel verblieben, hätte der Fluch mit zweiundsechzigprozentiger Wahrscheinlichkeit ein schweres Seebeben erzeugt, auf das eine tödliche Flutwelle gefolgt wäre, die die gesamte Insel vernichtet hätte. Lass ihn ziehen, Anthanael. Er befindet sich an jenem einen Ort im Nordernreich, wo der Fluch es am schwersten hat, eine Naturkatastrophe zu entfesseln. Die Kontinentalplatten sind stabil, die geographische Lage erschwert die Manifestation von Stürmen. Trotzdem ist die Gefahr für uns im Moment in Sayids Nähe zu groß. Illoziz wird aus der Ferne auf ihn aufpassen und seinen Körper zurückbringen, wenn es geschafft ist.“
Anthanael senkte den Kopf. Als er wieder aufblickte, verriet sein ewig junges Elfengesicht nichts über die Gefühle in seinem Inneren. Er legte Sayid eine Hand auf die Schulter, schaute ihm ernst in die Augen, bevor er zur Seite schritt und den Weg zur Haustür frei gab.
Draußen warteten die anderen Gefährten auf ihn, was Sayid vor Überraschung stocken ließ. Yllanya, Hojin und Khun standen Spalier, um ihn zu verabschieden. Dabei war das nichts weiter als ein kurzes bisschen Sterben …
„Spar dir den Atem. Für dich ist es eine Kleinigkeit, du bist daran gewöhnt“, sagte Yllanya und umarmte ihn. „Für uns ist es jedes Mal grauenhaft. Diesmal wissen wir es wenigstens vorher, trotzdem macht es das nicht leichter. Wir wissen schließlich auch, dass du leiden wirst.“ Sie küsste ihn links und rechts auf die Wangen und umarmte ihn ein weiteres Mal, heftig genug, dass seine Rippen krachten.
„Ich bin besorgt, Liebes“, murmelte Sayid, sobald sie ihn zu Atem kommen ließ. „Seit wann bist du derart gefühlsbetont? Hojin, was hast du mit ihr angestellt?“
Ihr jüngstes Gruppenmitglied lächelte bloß scheu und errötete ein wenig, was bei seiner goldbraunen Haut kaum auffiel. Hojin begnügte sich damit, ihm die Hand zu drücken und dabei verlegen zu Boden zu starren. Er suchte vermutlich dort nach Worten, die zur Situation passen könnten.
„Ich habe das bizarre Empfinden, auf dem Weg zu meiner eigenen Bestattung zu sein. Was ich irgendwie ja auch bin. Hoffentlich wird an dem Tag, an dem ich tatsächlich zum letzten Mal die Augen schließe, eine etwas fröhlichere Stimmung herrschen. Alles wird gut, Freunde, ich schwöre es.“ Beklommen wollte er sich abwenden – und wurde von Khun umgerissen. Der riesige Magierhund leckte ihm frenetisch das Gesicht ab. Protest war sinnlos, Widerstand noch viel mehr. Er lachte und strampelte und versuchte, Khun von sich fernzuhalten, der erst aufhörte, als Maondny ihn glucksend zu sich rief. Sayid setzte sich auf und wischte sich den Hundesabber von den Wangen. In diesem Moment senkte sich ein gewaltiger Schatten über sie. Die Erde bebte leicht, als Ca’urté landete. Der Greif, Sayids unfreiwilliger Seelengefährte, neigte sein weißfiedriges Haupt und berührte ihn behutsam mit dem Schnabel, wodurch er eine Flut von Gedanken und Empfindungen sandte. Gute Wünsche, dass er einen raschen und schmerzlosen Tod gewährt bekommen sollte.
„Wir sehen uns morgen wieder“, entgegnete Sayid aufgewühlt. „Such dir eine sichere Stelle, wo du dich niederlegen kannst.“ Sein Tod bedeutete jedes Mal auch für den Greif Verderben. Ca’urté war dazu verdammt, mit ihm gemeinsam zu sterben und erst wieder zu erwachen, wenn Sayids Herz von Neuem zu schlagen begann.
„Mach dir keine Sorgen um mich“, dachte Ca’urté. „Für mich ist es nicht viel anders als zu schlafen. Du bist derjenige, der den Schmerz des Sterbens zu ertragen hat.“
„Ohne mich müsstest du nicht ungewollt für vierundzwanzig Stunden oder länger dasitzen und auf deinen eigenen Körper starren, bis deine Seele zurückkehren darf.“
„Ohne dich läge ich weiterhin gefangen in meinem Käfig, was sehr, sehr viel schlimmer als eine kurzfristige Trennung von Körper und Seele ist. Ich denke, ich könnte mich an diese Anfälle von Tod gewöhnen.“
Sayid unterdrückte ein Schmunzeln. Der arme Greif befand sich bereits zu lange in ihrer Gesellschaft, eindeutig. Er begann, die Grundbegriffe des Zynismus’ zu meistern, was für seine Art nicht richtig sein konnte. Mit einem letzten herzlichen Klaps auf Ca’urtés Flanke verabschiedete er sich. Die Sonne würde in einer halben Stunde hinter dem Horizont verschwinden, es war dringend Zeit zu gehen.
Die friedvollen Tage auf der Insel hatten ihnen allen gut getan. Der Greif war ruhiger und gelassener, nicht mehr so getrieben von Unzufriedenheit wie zuvor. Das würde sich gewiss rasch wieder ändern, denn die Ursache lag im wilden Umherreisen durch das Land. Heute hier, morgen dort, stets in Lebensgefahr, immer unter Anspannung und auf der Hut vor mächtigen Feinden, von denen die meisten halbgöttliche Macht besaßen. Ca’urté hatte eine kurze, glückliche Kindheit mit seiner Familie verbracht, bevor diese von einem Pashatva abgeschlachtet und er in einen Käfig gesteckt wurde. Er war es nicht gewohnt, auf Reisen zu sein, abends nicht zu wissen, was ihn am folgenden Tag erwarten würde. Für sich selbst verantwortlich zu sein, Ungewissheit ertragen zu müssen – Freiheit war leicht zu ersehnen und schwierig zu leben.
In ihrem Seelenbund besaß der Greif keinen vollkommen gleichberechtigten Rang. Er entschied nicht darüber, wohin sie gingen, wann sie aßen, kämpften oder schliefen. Von vielen Aktivitäten war er ausgeschlossen, da er zu groß oder zu schwer war. Nicht einmal mit seiner Magie konnte er triumphieren, da Illoziz ihn an Macht um ein Vielfaches übertraf. Die meiste Zeit über war Ca’urté nichts als ein Reittier ohne eigenen Willen, auch wenn Sayid ihn ermunterte, so oft wie möglich loszufliegen und die Landschaft zu erkunden oder zu jagen. Es half wenig, was ihm vom Herzen leid tat. Der Greif war ein stolzes, intelligentes Geschöpf. Er hatte es nicht verdient, minderwertig zu sein und es war nicht sein Verschulden, dass er zu wenig von der Welt wusste. Dass er vermutlich niemals von einem Greifenschwarm aufgenommen werden würde, sollte der Seelenbund eines Tages enden, weil er einfach zu stark auf Menschen und Magier geprägt war.
Die ruhigen, ereignislosen Tage auf der Insel waren kostbar gewesen. Sobald die Todessache erledigt war, würden sie sich wohl sofort auf den Weg machen müssen, um das vierte Zeichen des Zorns zu initiieren. Sayid kratzte sich unwillkürlich im Nacken. Drei Runen trugen er und seine Gefährten in Nacken und Rücken eingebrannt. Magische Zeichen. Sie wusste alle, dass Maondny ihnen die volle Wahrheit über diese Runen und das Erweckungsritual als solches vorenthielt. Einen Gott in die Sphären der Sterblichen zu rufen war keine Kleinigkeit und was daraus am Ende werden sollte, konnte wohl nur ihre kleine Schicksalsgöttin selbst überblicken. Irgendetwas stellten diese Runen mit ihnen an. Sie verstärkten ihre Magie und beeinflussten ihre Körper. Vor kurzem erst hatte Anthanael einen Wasserfall gefrieren lassen – etwas, wofür man wohl offenkundig eher sechs oder noch mehr mächtige Elfen benötigt hätte.
Sayid selbst besaß extrem geschärfte Sinne. Die rieten ihm gerade, sofort stehen zu bleiben, darum blickte er sich aufmerksam um. Er war mittlerweile etwa drei Meilen vom Haus entfernt, wobei er sich instinktiv in Richtung untergehende Sonne orientiert hatte. Hier gab es glücklicherweise keinen Wald, der spontan entflammen oder Baumstämme auf ihn stürzen lassen könnte. Nichts als karges Grasland weit und breit. Maondny hatte ihn gewarnt, dass sein diesmaliges Ableben eine Verkettung von mindestens drei, eher noch mehr unglaublichen Zufällen beinhalten und sich gegen jede Wahrscheinlichkeit und Logik sperren würde. Das Quinaua-Amulett könnte ihn eigentlich mit so viel Glück und subtilen Schicksalsfügungen überschütten, dass er sich vor Zufriedenheit kaum noch retten konnte. Entsprechend würde das Ergebnis ausfallen, sobald sich drei magische Flüche auf einmal gegen ihn wandten. Maondny hatte nicht voraussehen können, welche der zahllosen möglichen Szenarien eintreffen würde. Lediglich, dass es schmerzhaft, langwierig und irrwitzig sein musste. Sayid hatte bereits überlegt, vorher Selbstmord zu begehen, um dem Schlimmsten zu entkommen. Andererseits war er neugierig, wie spektakulär es tatsächlich werden konnte.
In der Hoffnung, dass er jetzt wirklich weit genug entfernt war, um die anderen nicht durch Fluchausläufer zu gefährden, setzte er sich im kniehohen Gras nieder und wartete. Gewiss, er freute sich nicht auf Leid und Schmerzen. Doch er war bereits häufig genug gestorben, wie schlimm konnte es also schon werden?
Eine Weile saß er still und schaute der Sonne beim Untergang zu. Ob es losging, sobald es dunkel war? Er wusste es nicht. Die Dämmerung legte sich wie ein warmer Mantel über die Welt, dämpfte Licht und Geräusche. Es war leicht bewölkt, regnen würde es wohl nicht. Sayid hörte und spürte, wie sich ihm eine Schlange näherte. Normalerweise würde ihn ein solches Reptil nicht attackieren, solange er es nicht in irgendeiner Weise bedrohte, doch heute Nacht konnte er sich auf das Gegenteil verlassen. Um nichts unnötig hinauszuzögern, hielt er brav still. Ein Schlangenbiss war unspektakulär … Außerdem gab es kein ihm bekanntes unmagisches Tier, dessen Gift für ihn gefährlich werden könnte. Andererseits sagte niemand, dass dieses Exemplar nicht über Magie verfügte, oder? Warum sonst sollte der Fluch es herbeigelockt haben?
Die Schlange zischelte kaum hörbar, verharrte abwartend hinter ihm. Sayid schielte nach ihr, ohne den Kopf zu drehen. Ein hübsches Reptil war das. Etwa eineinhalb Schritt lang und blau-schwarz gemustert.
Der Angriff erfolgte blitzschnell: Die Schlange zuckte vor, vergrub ihre nadelspitzen Fänge in Sayids linkem Unterarm und schlängelte danach hastig davon.
Brennender Schmerz steigerte sich innerhalb eines Wimpernschlags zur unerträglichen Qual. Er atmete konzentriert durch die Nase ein, durch den Mund aus. Spürte, wie sein Unterarm auf Kürbisgröße anschwoll. Na ja, ein kleiner Kürbis bestimmt … Das Pochen darin war gnadenlose Folter, doch er hatte bereits Schlimmeres ertragen. Sein Herzschlag vervielfachte sich, kalter Schweiß brach aus sämtlichen Poren. Erst kam die Lähmung. Als diese sich löste, zwangen Muskelkrämpfe ihn, sich stöhnend zusammenzukrümmen.
Dann verebbte der Schmerz langsam. Der Arm schwoll wieder ab. Sayids Körper hatte das Gift erfolgreich niedergekämpft. Er öffnete und schloss mehrfach die Faust, spannte die Armmuskeln an. Es gelang ihm ohne Widerstand, lediglich die Bissspuren der Schlangenzähne brannten noch ein wenig. Ein gewöhnlicher Mensch wäre sicherlich inzwischen gestorben. War der Fluch zu dumm, um zu erkennen, dass er von so etwas nicht hinweggerafft werden konnte?
„Keineswegs“, erklang Maondnys heiteres Stimmchen in seinem Bewusstsein. „Das Amulett wurde mit der stärksten, intelligentesten und anpassungsfähigsten Magie belegt, die möglich ist. Harvalyar, Gott des Wissens, und sein Zwillingsbruder Curulayar, Gott der Schmiedekunst, haben sich für dieses Werk zusammengetan. Sie hatten sehr, sehr viel Freude bei der Arbeit …“
„Wäre das nicht eher eine Aufgabe für Nakoio gewesen? Schon allein wegen des Fluches?“, fragte Sayid, während er die trügerisch friedfertige Umgebung beobachtete. Nakoio, Gott der Diebe und Lügen. Ja, ihm wäre ein solch betrügerisches Artefakt zuzutrauen.
„Der Gute ist mit Worten ein begnadeter Künstler, als Handwerker hingegen nicht zu gebrauchen. Darum nein, er hätte dieses Wunder der Magie nicht erschaffen können. Die Zwillingsgötter haben damit leider auch nicht erreicht, was sie geplant hatten, aber das ist eine andere Geschichte und führt jetzt zu weit. Egal! Der Schlangenbiss konnte dich selbstverständlich kaum für eine volle Minute ärgern. Einen gewissen Effekt hatte er dennoch, nicht wahr?“
„Es hat weh getan, wenn du das meinst“, knurrte Sayid. „Ein bisschen geschwitzt habe ich dabei durchaus.“
„Exakt. Der köstliche Duft eines leidenden Geschöpfs hat sich zielsicher in den Nasen der nächsten Angreifer verfangen. Sie sind bereits im Anflug.“
Richtig – das Rauschen in seinen Ohren stammte nicht vom Wind allein. Sayid blickte in die Höhe und staunte nicht schlecht: Norbalt-Eulen! Ein ganzer Schwarm dieser riesigen Raubvögel, die Tag und Nacht auf die Jagd gehen konnten und normalerweise in den Mittel- und Hochgebirgen zu Hause waren statt hier in den Grasebenen. Sie jagten in intelligenter Gemeinschaftsarbeit und konnten sogar wilde Büffel in den Gebirgstälern erlegen. Sayid kannte sie noch aus seiner frühen Kindheit und wusste, wie gefährlich ihm dieser Schwarm werden konnte. Kurz wägte er ab – Kampf, Flucht, stillhalten? Von Vögeln zerlegt zu werden, die sich meist nicht mit Gnadenstößen aufhielten, würde seine Selbstbeherrschung überfordern und ihn zwingen, sich zu wehren. Diese seltenen und wunderschönen Tiere töten, bloß weil der Fluch sie hergelockt hatte … Nein. Entschlossen sprang er auf und raste im Zickzack los, in der Hoffnung, dass er unterwegs stürzen und sich das Genick brechen würde. Im ausdauernden, raumgreifenden Schritt rannte er über die Ebene, die keinerlei Versteckmöglichkeiten bot. Die Eulen stießen schrille Rufe aus, enttäuscht, weil die sicher geglaubte Beute stark und wendig vor ihnen fliehen konnte. Zwei Mal stürzten sie sich auf ihn herab. Sayid musste sich flach zu Boden werfen, um Klauen und Schnäbeln zu entgehen. Beim dritten Mal erwischte ihn eines der Biester am Rücken, zerriss sein Hemd und hinterließ eine brennende Wunde. Sayid schrie vor Schmerz und Wut, sprang in die Höhe und versetzte der überraschten Rieseneule einen Fausthieb, der sie fast zum Absturz brachte. Eilig duckte er sich unter den Attacken des restlichen Schwarms. Ein schriller Schrei, und die Eulen schraubten sich in die Höhe. Sie warteten, bis der angeschlagene Gefährte aufgeschlossen hatte, dann jagten sie davon, wohl auf der Suche nach weniger wehrhafter Beute. Sayid atmete tief durch. Er fühlte, wie Blut über seinen Rücken rann. Die Wunde musste großflächig und tief sein, das Brennen war zu einem dumpfen Pochen verebbt. Ein Zeichen, dass die Hautnerven zerstört worden waren. Die nächsten Raubtiere, die von dem Blutgeruch angelockt werden würden, wetzten garantiert bereits Klauen und Reißzähne. Wenn das in diesem Tempo weiterging, war er morgen früh immer noch nicht tot.
„Vielleicht stürze ich mich doch lieber in mein Kampfmesser?“, murmelte er halblaut vor sich hin. Er hatte unbewaffnet losmarschieren wollen, sich aber ohne das vertraute Gewicht nackt gefühlt.
„Selbstverständlich kannst du gerne Selbstmord verüben, dann geht das Spiel allerdings morgen Nacht weiter. Der Fluch erlaubt keinen Freitod, du musst von fremder Hand, beziehungsweise Klaue, oder durch eine Naturkatastrophe sterben.“ Maondny amüsierte sich mal wieder, das liebliche Kind, er konnte es an ihrer Stimme hören.
„Zählt es auch, wenn ich Illoziz darum bitte, mich zu erlösen?“
„Durchaus. Der freut sich bloß über die unterhaltsame Vorstellung und sieht jetzt noch keinen Grund, diese vorzeitig zu beenden …“
Entnervt seufzend lief Sayid weiter. Wenn er in Bewegung blieb, würde das nächste Unglück sicherlich schneller auf ihn aufmerksam werden. Also, abgesehen von der Raubkatze, die er bereits auf seiner Fährte herumschleichen hörte. Sie war groß, ein Einzelgänger, noch etwa fünfzig Schritt entfernt. Er hielt kurz inne, um intensiv zu lauschen. Da! In etwa dreihundert Schritt Entfernung kam ein weiteres großes Raubtier heran. Es fauchte leise und beschleunigte seinen Schritt. Sayid hätte nicht gedacht, dass sich überhaupt zwei größere Katzen im gleichen Revier und dazu in dieser Landschaft aufhalten würden, aber vermutlich waren sie ebenfalls Opfer des Fluches. Der hätte dafür allerdings Tage oder sogar Wochen im Voraus wissen müssen, dass Maondny sie hierherbringen wollte, damit die Raubtiere genug Zeit hatten, sich aus ihren üblichen Revieren in diese Gegend zu verirren. Besser, man dachte nicht zu intensiv über die innewohnende Logik nach, sonst riskierte man schlimme Kopfschmerzen …
Sayid setzte sich auf die Erde, entschlossen abzuwarten, welches der Tiere ihn zuerst erreichte. Vielleicht gehörten sie sogar zusammen und jagten ihn von zwei Seiten, um ihre Chancen zu erhöhen? Ein Biss in die Kehle würde ihn schnell erledigen und selbst wenn er noch leben sollte, sobald sie ihn aufzufressen begannen, würde er nicht lange bei Bewusstsein bleiben. Es gab schlechtere Wege zu sterben.
Leider umkreisten ihn die Raubkatzen unschlüssig. Anscheinend gehörten sie doch nicht zusammen und behinderten sich gegenseitig. Ungefähr eine halbe Stunde verging, in der hauptsächlich Langeweile sein Leben bedrohte, abgesehen von diversen Insektenstichen und -bissen, die Sayid ignorierte. Normalerweise kam ihm kein Insekt zu nah!
„Nun macht schon!“, schrie er schließlich entnervt. Nicht einmal auf wilde Bestien konnte man heutzutage noch vertrauen. Jetzt liefen die auch noch davon … Oder nein, sie wichen lediglich zurück. Warum? Etwas rauschte über ihm. Das klang zu laut für einen weiteren Schwarm Vögel. Sayid verkniff es sich, hochzuschauen. Ein seltsames Geräusch, es wurde lauter. Beinahe, als würde ein schweres Geschoss vom Himmel fallen … Es ging nicht anders, er musste den Kopf heben – und ruckartig ausweichen, als er erkannte, was dort zielgenau auf ihn herabfiel: Eine Schildkröte.
Eine SCHILDKRÖTE!
Eine riesige Landschildkröte, die wirklich nichts am Himmel zu suchen hatte. Das schwere Tier streifte ihn an Kopf und Schultern, bevor es zu Boden krachte, wo der Panzer brach. Taumelnd kam Sayid auf die Beine, benommen von dem Schlag, den er erhalten hatte. Blut strömte munter aus mehreren Verletzungen und vereinte sich mit dem aus der Klauenwunde am Rücken. Verdammt! Wäre er einfach sitzen geblieben, hätte er es bereits hinter sich. Die arme Schildkröte, die ihm fast bis zum Oberschenkel reichte, hätte ihn zu Tode gequetscht. Ein schneller, schmerzarmer Tod.
Vogelschreie warnten ihn, dass er sich zu nah an der Beute befand. Die Norbalt-Eulen waren zurück. Offenkundig hatten sie sich die Schildkröte geschnappt, mehrere hundert Schritt in den Himmel gehoben und fallen gelassen, um den Panzer zu knacken. Hastig floh Sayid, um dem Schwarm nicht im Weg zu stehen, der sich nun über das bedauernswerte Opfer hermachte. Ziellos rannte er durch das Gras und wartete auf den knochenbrechenden Sturz, der ganz bestimmt noch auf ihn lauerte, um ihn für weitere Raubtierattacken zu verkrüppeln. Sein Kopf dröhnte, die Schildkröte hatte ihn heftig erwischt. Fliegende Schildkröten … In diesem Moment stolperte er endlich, überschlug sich und landete bäuchlings auf etwas Hartem. Hart und – lebendig? Was er für einen niedrigen Felsen gehalten hatte, bewegte sich plötzlich. War das Ding etwa von einem Elementargeist belebt? Nein, es schien ein Tier zu sein, das schnaufte und schnaubte und sich grollend aufrichtete. Ganz schön groß war es, mit einem tief sitzenden Kopf, der von zwei Hörnern direkt über dem Maul herabgedrückt wurde. Es wirkte verwirrt, konnte offenbar nichts mit dem Gewicht auf seinem Rücken anfangen. Sicherlich roch es auch das Blut, das Sayid immer noch verlor – obwohl, einen nennenswerten Geruchssinn konnte das Biest mit diesen Nasenhörnern nicht besitzen. Dafür Schlagkraft, mit den Hörnern ließen sich garantiert junge Bäume entwurzeln. Er hatte noch nie von einem solchen Tier gehört. Irgendetwas sagte ihm, dass er bei einem Kampf den Kürzeren ziehen würde. Durchaus das, wonach ihm gerade der Sinn stand. Sayid versuchte sich zu bewegen, um vom Rücken dieses lebendigen Felsens herab zu gelangen. Es ging nicht – er hatte sich an irgendetwas verhakt und sein in Flammen stehender Rücken nahm ihm die Idee mit dem Bewegen extrem übel. Das Horntier stampfte ruhelos mit den Vorderbeinen. Es witterte die Raubkatzen, die mittlerweile bis auf wenige Schritt herangekommen waren und vermutlich auch nicht wussten, was sie da vor sich hatten. Dazu die schrillen Rufe der Norbalt-Eulen, die sich über ihr Festmahl hermachten … Und das Menschlein auf seinem Rücken, das da nicht hingehörte … Übergangslos rannte das Tier los, schnaubend und grollend und in einem überraschend hohen Tempo, das man einem wandelnden Felsbrocken nicht hätte zutrauen mögen. Sayid wurde umhergeschleudert. Augenblicklich wurde ihm übel, seine Kopfwunde war heftiger als gedacht. Da er es nicht schaffte, sich loszureißen, klammerte er sich an der rauen Haut fest, so gut es ging. Eine der Raubkatzen geriet dem Horntier vor die Beine. Es holte mit seinem schweren Kopf aus und rammte die unglückliche Katze beiseite – sie flog durch die Luft und blieb benommen liegen. Der graue Gigant hingegen rannte weiter. Zielgerade auf ein Wäldchen zu.
„Hey, keine Bäume!“, schrie Sayid und bewegte sich ruckartig. Sein Hemd zerriss, er kam frei. Das Horntier bremste unvermittelt und Sayid flog nun ebenfalls durch die Luft. Ihm blieb Zeit für einen kurzen Fluch, schützend zog er den Kopf ein, bevor er in einem Tümpel landete. Dort blieb er einen Moment hocken, um seinem Körper Zeit zu geben, die Schmerzen zu bemerken, die in sämtlichen Winkeln und Ecken aufflammten. Das Horntier kam langsam auf ihn zu und starrte ihn aus seltsam winzigen Augen an.
„Na los“, murmelte Sayid. „Mach mich nieder. Bring mich um. Ich weiß, dass du es draufhast!“ Er bespritzte es mit Wasser, um es anzufeuern. Das Tier schnaufte. Sayid fand einen Stein, den er dem Biest an den Kopf warf.
„Du sollst mich umbringen, Dicker! Das ist deine Aufgabe. Der Fluch will es. Leg los, es ist unhöflich, Todgeweihte warten zu lassen!“
Statt einer Antwort begann das Tier in aller Gemütsruhe zu saufen, bevor es sich umdrehte und in langsamem Zockelschritt davonlief.
Frustriert hieb Sayid auf die Wasseroberfläche. Das konnte doch jetzt echt nicht wahr sein! So viele Schwierigkeiten hatte er noch nie beim Sterben gehabt! Und seine Stiefel waren voller Wasser, was er absolut nicht ausstehen konnte.
Dreisprachig fluchend raffte er sich hoch und humpelte ans Ufer. Dabei schleuderte er einige Blutegel von sich, die sich an ihm festsaugen wollten und verjagte ein marderähnliches Tier, das sowieso zu klein war, um ihn umzubringen.
„Hast du nichts Besseres auf Lager, Amulett?“, knurrte er und schüttelte den Anhänger um seinen Hals. Erschöpft lehnte er sich gegen einen Baumstamm. Bis jetzt war er reichlich gequält, gebissen und durchgerüttelt worden. Hoffentlich ging das nicht in diesem Stil weiter. Jetzt aber erst einmal fort von diesem Wäldchen, in dem sicherlich tausende unschuldiger Geschöpfe hausten, die er nicht unnötig in Gefahr bringen wollte.
Er konnte seine Beine nicht bewegen.
Verwirrt blickte er nach unten. Der Boden sah fest aus, dennoch steckte er mittendrin und versank ziemlich rasch. Treibsand? Moor? Sayid kannte sich mit solchen Dingen nicht aus.
„Ich hasse es zu ertrinken!“, zischte er und klammerte sich am Baumstamm fest. Sicherlich war das der einzige Fleck Treibsand in dreihundert Meilen Umkreis. So ein Unfug! Er würde freikommen, aber zweifellos seine schönen Stiefel verlieren. Hoffentlich war Illoziz gut aufgelegt, der konnte sie ihm zurückholen.
„Sayid … Schau nur, Schwester. Das ist Sayid.“
„Schwach. Nutzlos. Der letzte Drachenreiter.“
Verdutzt hielt Sayid in seinem Kampf gegen das Versinken inne und blickte sich um. Woher kamen die beiden feindseligen weiblichen Stimmen?
„Deine Schwäche lähmt die Gruppe“, zischte die erste Stimme. „Du vergiftest den Greif. Schwach. Nutzlos. Sie wären besser ohne dich dran.“
Die Stimmen waren körperlos und steckten in seinem Kopf. Na großartig! Entweder hatte er gerade spontan den Verstand verloren, oder er hatte es geschafft, auf zwei Leptahs gleichzeitig zu stoßen. Was, soweit er wusste, absolut unüblich war. Anscheinend hatte der Unglücksfluch sich langsam warm gelaufen …
„Drei Flüche liegen auf ihm und er ist immer noch zu dumm zu sterben. Sieh ihn dir an, Schwester, was für jämmerliches, nutzloses …“
„Haltet die Klappe!“, rief Sayid. „Ich bin mit Ertrinken beschäftigt. Haut ab und sucht euch ein besseres Opfer. Oder vielmehr ein schlechteres. In Ordnung?“ Leptahs konfrontierten ihre Opfer mit deren eigenen Schwächen, Ängsten und Unzulänglichkeiten, bis diese innerlich zerbrachen. Danach stahlen sie ihre Seelen und ließen die Glücklosen sterbend zurück. Sayid brauchte seine Seele, sonst würde er morgen nicht wie geplant auferstehen. Statt sich gegen das Versinken zu stemmen, versuchte er nun stattdessen, noch rascher unterzugehen. Wenn er ertrank, bevor sie ihn zermürbt hatten, bekamen sie seine Seele nicht.
„Du kannst nicht gegen zwei von uns standhalten, Sayid.“ Die Leptahs lachten schrill in seinem Kopf, was sengende Schmerzen zur Folge hatte. Schwach, er fühlte sich schwach …
„Du bist schwach. Was hast du schon getan, außer die anderen aufzuhalten? Ein göttliches Artefakt reicht nicht aus, um dich am beständigen Sterben zu hindern. Du bist eine Last, eine Plage. Jeder muss Rücksicht nehmen, weil du dich kaum auf zwei Beinen halten kannst, ohne zu sterben. Ein Dieb bist du, ein wertloses Nichts. Dein Bruder verachtet dich, dein Seelengefährte leidet, weil du ihn mit in den Abgrund zerrst. Du bist …“
„Hab ich euch schon mal von meiner Begegnung mit Davinia erzählt? Der Königin von Halderrath? Nein? Das war so: Ich wollte in diesem eigentlich völlig bedeutungslosen Provinznest …“
„Hör auf zu plappern!“, zischte die erste Leptah. „Du erzählst nichts als Lügen, wir kennen sie alle.“
„… nach etwas Essbarem suchen, genau. Konnte nicht wissen, dass es ein kleines Königreich für sich war. Ich suchte mir das prächtigste Gebäude, was in dieser Ansammlung schäbiger Holzhütten gar nicht so einfach war und …“
„Lügen, nichts als Lügengeschichten!“
„Stimmt nicht, hab ich genau so erlebt!“, rief Sayid mit der hysterischen Fröhlichkeit der Verzweiflung. „Da stand ein Wächter vor der Tür, worüber ich mich bereits gewaltig wunderte.“
Die Leptahs begannen in seinem Kopf zu schreien, bis er stöhnend und halb ohnmächtig in sich zusammensackte, soweit ihm das möglich war – er war bereits bis zur Brust im Morast eingesunken. Sie zischelten erneut ihr Gedankengift von seiner Wertlosigkeit, doch er konzentrierte sich, wild entschlossen, an seiner Seele festzuhalten.
„Hab ihn niedergeschlagen“, brabbelte er mit geschlossenen Lidern. „Drinnen war die Königin. Eine hagere Vettel, die Mord und Vergewaltigung schrie. Als ob ich die je angerührt hätte … Ich sagte, ich wolle was zu essen haben und sie … sie …“ Das Geflüstere der Leptahs wurde triumphierend. Sayid rollte mit den Augen und presste sein Gesicht in den Schlamm. Ertrinken! Jetzt!
„Tu das nicht!“, kreischten die Leptahs. Da sie ihn nicht berühren konnten, stand es nicht in ihrer Macht, ihn aufzuhalten. Hoffentlich wurde das nicht als Selbstmord gewertet, Sayid hatte keine Lust, diese Tortur morgen Nacht noch einmal durchzustehen.
„So, Mädels, ihr habt genug gespielt.“ Die vertraute Stimme des Schadensdämons klang gedämpft an Sayids Ohr. Illoziz! Irgendetwas stellte er an, um die Leptahs zu vertreiben. Sofort verschwand der immense Druck in Sayids Kopf.
„Hey, bist du noch bei mir?“ Er wurde gepackt und aus dem Morast gezogen. „Selbstmord gilt nicht. Auch wenn ich es gut verstehen kann. Widerliche Mistdinger, diese Leptahs.“
Sayid blinzelte, als Dämonenklauen ihm den Schlamm aus den Augen wischten. Illoziz hockte in seiner wahren Gestalt neben ihm. Eine fürchterliche Erscheinung, bestens geeignet, sämtliche potentiellen Angreifer in zehn Meilen Umkreis abzuschrecken.
„Du kannst dich gerne weiter amüsieren, mein Freund, wenn du möchtest. Oder ich bringe dich jetzt um. Maondny meint, der Fluch hätte sich zur Genüge ausgetobt, es wäre problemlos, wenn ich nun Hand anlege.“
„Hör auf zu plappern“, knurrte Sayid. Illoziz grinste ihn freundlich an, enthüllte dabei seine Doppelreihen nadelspitzer Dämonenzähne. Einen Moment später brach Sayids Genick wie ein trockener Zweig. Er war tot. Endlich! Seine Seele löste sich von dem schwer gebeutelten Körper. Wie er wieder aussah, seine Kleidung ruiniert, die Stiefel waren im Treibsand verloren …
„Hallo Sayid. Wird auch langsam Zeit, dass du es auf die andere Seite geschafft hast.“
Verwirrt wandte er sich der Stimme zu und erstarrte. Nakoio!
Kapitel 2
„Vergrabe sie nicht zu tief, die Seelenpein, die du vergessen willst. Sobald sie anfängt dich zu vergiften, musst du sie aus den Tiefen deiner Seele bergen.“
Zitat aus „Das Komplott“, kriminalistisches Theaterstück von Yubeck Haradstochter; uraufgeführt 297 vor dem Krieg
allo Sayid“, wiederholte Nakoio höflich und neigte den Kopf zum Gruß.