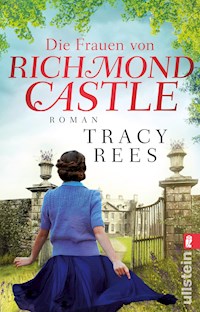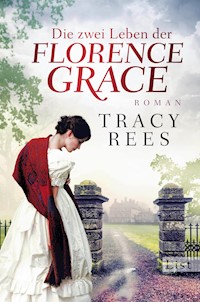8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
"Atmosphärisch und elegant geschrieben. Die Sonnenschwestern ist eine berührende Geschichte mit vielen liebevollen, historischen Details." Lucinda Riley London, 2006: Noras ist fast 40 und hat doch keine Ahnung, wer sie ist. Warum weiß sie so gut wie nichts über ihre Familiengeschichte? Spontan kündigt sie Job und Wohnung, lässt alles hinter sich und reist nach Tenby, einem kleinen Ort im Süden von Wales, um sich auf die Spuren ihrer Familie zu begeben. Tenby, 1956: Jedes Jahr verbringt Chloe ihre Ferien im Süden von Wales. An ihrer Seite ist stets ihr Sandkastenfreund LLew, ein kluger Junge aus armen Verhältnissen, der heimlich in Chloe verliebt ist. Doch ein dramatischer Vorfall bringt die beiden auseinander. Sie sehen sich nie wieder, vergessen können sie sich nicht. 50 Jahre später findet Nora in dem idyllischen Ort nicht nur ihren eigenen Frieden, sondern auch eine altes Familiengeheimnis, das nun endlich gelöst werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Sonnenschwestern
Die Autorin
Tracy Rees studierte in Cambridge und hat acht Jahre in einem Sachbuchverlag gearbeitet. Ihr Debütroman "Die Reise der Amy Snow" wurde aus über tausend Einsendungen in einem Schreibwettbewerb als Gewinner ausgewählt. Sie lebt in South Wales, England.
Das Buch
Kurz vor ihrem 40. Geburtstag bricht Noras Leben zusammen. Im Büro ist es ihr völlig unmöglich weiterzuarbeiten. Einem inneren Impuls folgend, kündigt sie spontan. Es folgen einsame Tage in ihrer Wohnung, in denen sie zu nichts in der Lage ist. Nicht einmal dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben, ihrer Mutter, kann sie sich anvertrauen, weil sie selbst nicht versteht, was mit ihr passiert. Vor ihrem inneren Auge sieht sie immer wieder einen Strand. Es ist der Strand von Tenby, dem walisischen Ferienort, in dem sie schon seit ihrer Kindheit nicht mehr war. Erst als sie sich entschließt, auf unbestimmte Zeit dorthin zu reisen, berichtet sie ihrer Mutter davon. Unerwartet hat ihre Mutter wenig Verständnis für die Krise ihrer Tochter, obwohl sie sonst eine liebevolle Mutter ist. Als sie aber das Wort »Tenby« hört, wendet sie sich abrupt ab. Was ist in Tenby geschehen, dass Noras Mutter so abweisend reagiert?
Tracy Rees
Die Sonnenschwestern
Roman
Aus dem Englischen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Das englische Original erschien 2017 unter dem Titel The Hourglass bei Quercus Ltd., London.
List ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbH
© by Tracy Rees© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Alle Rechte vorbehaltenAus dem Englischen von Elfriede PeschelUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotiv: Arcangel / © Ildiko Neer,gettyimages / © Ulrike Schmitt-Hartmann,Arcangel / © Tony Watson, FinePic ©, MünchenAutorenfoto: © Ludwig Esser - All Rights ReservedE-Book powered by pepyrus.com
ISBN: 978–3-8437-1826-4
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
PROLOG
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE UND NORA
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
CHLOE
NORA
EPILOG
Danksagungen
Walisische Begriffe im Text
Rezept
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
PROLOG
Für meine wunderbaren Eltern – und dieser Roman ist auch für die Familie.
PROLOG
Manchmal muss man um das bitten, was man sich wünscht.
Die alte Frau stand zur Zeit der tiefsten Nachtwache von ihrem Bett auf. Diese Formulierung hatte ihr immer gefallen – die Zeit der Nachtwache –, weil sie nahelegte, dass jemand wachte. Sie gab ihr das Gefühl, als würde irgendwo jemand die verstreichenden Stunden und Minuten ihres Lebens bezeugen und Anteil daran nehmen. Mühsam schlüpfte sie in ihren Morgenmantel. Er war gelb und flauschig und sie fühlte sich darin wie ein frisch geschlüpftes Küken, obwohl sie sich doch am ganz anderen Ende des Lebensbogens befand. Pantoffeln waren unwichtig. Sie konnte nicht schlafen und der Zeitpunkt war gekommen.
Sie schnippte ihr Haar aus dem Kragen und zog es mit einer Handbewegung, die ihr seit vielen Jahren eigen war, über ihre linke Schulter. Dann holte sie tief Luft und drückte sich die Hände an die Wangen. Diese waren weich wie Papiertaschentücher und hatten ihre pralle Elastizität schon lange eingebüßt. Umso mehr ein Grund, ihre Forderung vorzubringen. Die Vorstellung, etwas einzufordern, gefiel ihr nicht, aber eine Bitte war zu schwach und hier ging es um etwas Wichtiges. Da es für sie ganz und gar ungewohnt war, etwas für sich selbst zu erbitten, war sie sich nicht sicher, wie es sich anfühlen, wie es ankommen würde. Aber ihr Entschluss stand fest. Sie lag jetzt schon zu viele Nächte lang wach. Nun denn.
Durch das indigoblaue Dunkel trat sie zum Fenster, zog die Vorhänge zurück und hatte den glitzernden Himmel vor sich. Trotz ihrer Bangigkeit musste sie lächeln. Wie Brotkrumen lagen die Sterne über der Schwärze verstreut, und sie zu sehen war Balsam für ihre Seele. Dunkel und leer erstreckten sich die Felder in alle Richtungen. Jedenfalls wirkten sie leer, aber sie wusste, dass da draußen Füchse umherschlichen, Eulen jagten, Mäuse huschten.
Sie kniete nieder – das tat weh – und legte mit gefalteten Händen ihre Unterarme auf dem Fensterbrett ab. Auch die Stille war indigoblau.
»Lieber Gott«, begann sie und ihre Stimme war weich, zaghaft, ganz wie immer.
»Lieber Gott«, setzte sie erneut an mit einer Stimme, die nur ganz seltenen Anlässen vorbehalten war. Vor langer Zeit hatte sie sich ihrer bedient, wenn der Lehrer einem der Kinder zu Unrecht vorwarf, Unfug getrieben zu haben. Aber auch, als die Jungs ins Lausbubenalter kamen und es nötig wurde, ihnen ein entschiedenes »Nein« entgegenzuhalten. Und es war auch die Stimme, mit der sie mit dem Arzt sprach.
»Wie immer danke ich dir, Herr, für alle Segnungen, die ich erfahren habe. Du hast mir ein langes Leben mit viel Gutem darin vergönnt, und ich bin dafür dankbar gewesen, das weißt du. Aber Herr, ich ertrage diese Situation nicht länger, ich möchte, dass es ein Ende damit hat.«
Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als sie in die unergründliche Nacht hinausblickte und sich dabei als schwaches Abbild im Fenster gespiegelt sah, eine gleichermaßen vertraute und fremde Überlagerung von älterer Frau und jungem Mädchen.
»Es schmerzt einfach zu sehr, Herr. Nie habe ich dich meinetwegen um etwas gebeten, immer nur für die Familie. Aber es gibt für alles ein erstes Mal, heißt es, und dieses Gebet ist für mich selbst. Das will ich gar nicht beschönigen. Es ist nur für mich. Ich will aufrichtig sein: Ich kann mir nicht vorstellen, warum du mich nicht erhören solltest. Wir wissen beide, dass ich nicht mehr sehr lange hier sein werde. Und so denke ich, du solltest es tun, und vertraue darauf, dass du es tun wirst, und ich … ich werde mich nicht mit weniger zufriedengeben, Gott. Genug jetzt. In deiner unendlichen Güte und Allmacht kannst du dies geschehen lassen. Irgendwie.«
Sie zögerte. Aber manchmal muss man das aussprechen, was man sich wünscht.
»Bitte, lieber Gott, bring mir, bevor ich gehe, meine Mädchen nach Hause zurück. Das ist alles, was ich mir jetzt noch wünsche. Bring meine Mädchen nach Hause. Amen.«
Die Tränen liefen hemmungslos. Ihre Worte schwebten in die dunklen Ecken und setzten sich dort ab wie Staub und durchdrangen bebend die Scheiben und trieben über die tintenschwarzen Ebenen des Nachthimmels. Alles war still und reglos. Sollte Gott sie gehört haben, schickte er ihr kein Zeichen.
Doch als sie sich schwer auf der Fensterbank abstützte, um wieder auf die Füße zu kommen, tat sie dies in der Gewissheit, ihr Anliegen vorgebracht zu haben. Sie hatte das Gefühl, sich klar und deutlich ausgedrückt zu haben.
NORA
Dezember
Nachdem Nora eine Weile in Therapie gewesen war, zeichneten sich Veränderungen ab. Nur traten diese Veränderungen nicht in der erwarteten Weise ein. Vor ihrer ersten Sitzung an einem scheußlichen Abend im Juni hatte sie eine Liste mit all den Punkten erstellt, für die sie sich eine Verbesserung erhoffte. Da sie bisher noch nie therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hatte, wollte sie nicht unvorbereitet sein.
Eine Weile lief das Leben in den alten Bahnen weiter, mit dem einzigen Unterschied, dass sie einmal in der Woche zum Belsize Park fuhr, um Jennifer zu treffen. Aber nach etwa drei Monaten wurden die Albträume immer hartnäckiger, ihre Angst verstärkte sich und die Beziehung zu ihrer Mutter wurde immer problematischer. Außerdem trennte sie sich von ihrem Lebensgefährten Simon, und das nur wenige Monate vor ihrem vierzigsten Geburtstag. Nichts davon hatte auf ihrer Liste gestanden.
Und jetzt, an einem frostigen Dezemberabend, stand sie in Jennifers cremefarbenem Wartezimmer am Fenster und starrte in die klare Dunkelheit einer ruhigen Straße in North London. Im Winterwind geisterten ein paar verblasste Blätter vorbei und schwebten durch den Lichtkegel einer Straßenlampe. Nora machte es nichts aus, warten zu müssen. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie sie Jennifer ihren letzten Entschluss erklären sollte.
»Ich habe heute gekündigt!«, platzte es vierzig Minuten später aus ihr heraus. Jennifer hatte angemerkt, dass sie das häufig tat – etwas wirklich Wichtiges so lange für sich zu behalten, bis sie schon fast am Ende der Sitzung angelangt waren und keine Zeit mehr blieb, angemessen darüber zu sprechen. Für gewöhnlich erkannte Nora gar nicht, wie bedeutsam es war, bis Jennifer darauf ansprang wie eine Archäologin, die ein offenbar ganz normales Steinfragment untersuchte und es zur Pfeilspitze erklärte. Aber dass dies wichtig war, wusste selbst Nora.
Gern hätte sie diese Enthüllung noch eine weitere Woche zurückgehalten, aber wenn sie es schon Jennifer nicht sagen konnte, die darin geübt war, mit menschlichen Launen umzugehen, wie sollte sie es dann ihren Mitarbeitern im Büro erklären? Wie sollte sie es Simon erzählen (der noch immer Kontakt zu ihr hielt, obwohl sie mit ihm Schluss gemacht hatte) und – oh Gott – wie ihrer Mutter?
»Verstehe. Möchten Sie mir dazu vielleicht noch etwas mehr sagen?«, hakte Jennifer nach, ohne jegliches Anzeichen einer Beunruhigung, die sie, dessen war Nora sich sicher, gewiss empfand. Jennifer hatte einen kastanienbraunen Haarschopf und schöne sahnige Haut. Vermutlich war sie höchstens zehn Jahre älter als Nora, schien ihr aber um Äonen voraus zu sein. Weise? Mütterlich?
»Äh, na gut, ich habe es nach der Mittagspause gesagt«, erwiderte Nora und verzog dabei das Gesicht. Das war eindeutig nicht das, worauf Jennifer abzielte. »Olivia war völlig überrascht, reagierte aber sehr freundlich. Ich weiß auch nicht, warum ich es getan habe. Ähm … ich habe einen Strand gesehen.«
»Einen Strand?«
Nora seufzte. Das zu erklären war unmöglich, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, total übergeschnappt zu sein. Vermutlich war sie das ja. Man schmiss schließlich nicht einfach seine Arbeit hin, nur weil man zum Strand wollte! »Ja. Vor meinem geistigen Auge. Ich weiß, das hört sich verrückt an. Ich … ich weiß nicht, warum ich es getan habe«, wiederholte sie. Wie sollte sie das jemals erklären? Es war doch sicherlich nur eine müßige Tagträumerei gewesen … sie jedoch wollte unbedingt eine Vision darin erkennen. Es hatte sich beinahe atemberaubend bedeutsam angefühlt. Es kam so überraschend, war kristallklar und unwiderstehlich und versetzte sie in eine ihr fremde und heitere Stimmung. Hoffnung, vielleicht. Aber jetzt würde sie zu allem anderen auch noch bald ohne Arbeit dastehen. Jennifer hatte ihr erklärt, dass sich, wenn jemand eine Therapie begann, die Dinge manchmal erst verschlimmerten, bevor eine Besserung erkennbar wurde. Das war kein Scherz gewesen!
»Wir haben nur noch ein paar Minuten, Nora …«, setzte Jennifer an. Aus unerfindlichen Gründen dauerte eine Therapiestunde fünfzig Minuten. Sie hatte nicht auf ihre Armbanduhr geschaut und die einzige Uhr im Raum befand sich über ihrem Kopf, doch Jennifer schien ein natürliches Zeitempfinden zu haben. »Ich bleibe aber gern noch etwas länger, wenn Sie dieser Entscheidung noch ein wenig mehr auf den Grund gehen möchten.«
»Wirklich?« Jennifer überzog nie. Vielleicht war ihr Schock größer, als sie es sich anmerken ließ. »Danke.«
»Warum erzählen Sie mir nicht ganz genau, was heute vorgefallen ist, so, als würde es jetzt in diesem Moment passieren?«
Nora nickte. Sie schloss die Augen, wie Jennifer es ihr beigebracht hatte, und versetzte sich zurück in das, was sie von diesem Tag noch erinnerte. Als wäre sie wieder in der Arbeit: Mittagspause. Der Rest ihrer Abteilung war hinausgegangen, sie aß wie gewöhnlich an ihrem Schreibtisch. Aus dem Augenwinkel konnte sie den grau-metallischen Glanz des Aktenschranks, den weißen Schimmer des Computermonitors und den schwarzen Hefter erkennen, der ordentlich hinter der Tastatur stand.
»Es ist Mittagszeit«, begann sie. »Ich bin im Büro. Ich sage mir, dass ich mich glücklich schätzen kann, weil es zwei Fenster hat. Allerdings sehe ich durch das eine Fenster nur den Flur. Das andere geht auf den überdachten Innenhof. Was bitte bringt ein Indoor-Innenhof? Aber wenigstens gibt es dort was Grünes – ein paar Farne, die über irgendwelche Steine wachsen … Erinnern Sie sich noch, dass Sie letzte Woche sagten -«
»Konzentrieren Sie sich, Nora«, murmelte Jennifer. »Sie sind im Büro …«
»Oh ja. Ich beschließe also, mir unten in dem Innenhof die Beine zu vertreten. Ich gehe zu den Farnen und berühre sie und … sie sind aus Plastik. Ich fühle mich betrogen. Also hole ich mir einen Kit-Kat-Riegel aus dem Automaten und kehre in mein Büro zurück. Ich denke mir, kein Wunder, dass ich nie vom Schreibtisch aufblicke – ich mache am besten einfach mit meiner Arbeit weiter. Aber als ich wieder Platz nehme, sehe ich nur noch diesen Strand vor mir …«
Und sie konnte ihn noch immer sehen. Er hatte sie den Rest des Tages nie wirklich losgelassen. Ein kühler Streifen Strand, goldener Sand, der im blassen, klaren Licht die Farbe von Austern annahm – kilometerweites Wandern unter einem silbrigen Himmel …
»Ich meine, ich kann ihn sehen, so deutlich, als wäre es das, was ich sehe, wenn ich aus meinem Fenster blicke! Und er ist wunderschön … Es ist Winter, aber der Himmel strahlt, es weht ein Lüftchen … und ich bin von dieser Sehnsucht erfüllt … Es geht nicht nur um die Schönheit, es geht um das Gefühl, das sie in mir auslöst. Ein Gefühl von Freiheit und von etwas … Realem. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dort zu sein. Und nicht einfach, weil ich irgendwo sein möchte, wo es schön ist, obwohl auch das zutrifft. Es fühlt sich an …« Nora stieß wieder einen Seufzer aus und schüttelte den Kopf. »Es fühlt sich an, als wäre es mir bestimmt, dort zu sein, als würde mich der Strand rufen. Mich sogar herbeizitieren. Als läge dort der Schlüssel zu einem großen Geheimnis – obwohl ich nicht mal wusste, dass es ein Geheimnis gab! Dann kommt Nick vom Mittagessen zurück. Er ist mein Assistent«, ergänzte Nora und öffnete ein Auge, für den Fall, dass Jennifer es vergessen hatte. Aber das hatte sie natürlich nicht und gab Nora einfach ein Zeichen fortzufahren.
»Er platzt durch die Tür – die Bürotüren sind übrigens hässlich, sie haben so einen grässlichen Grünton … Ich meine, wer hat diese Lackfarbe gesehen und sich gesagt: ›Genau, die nehmen wir‹? Jedenfalls platzt Nick herein und ich sehe ihn an, ich meine, ich sehe ihn wirklich an. Seine Haare sind zerzaust, was mich darauf schließen lässt, dass es draußen windig sein muss, was ich sonst gar nicht gewusst hätte, da ich mich ja in diesem hermetisch abgeschlossenen Gebäude befinde. Ich bin nie im Freien. Ich bin entweder im Büro oder im Fitnessstudio oder in der U-Bahn oder in der Wohnung … Er hat seine abgewetzte alte Umhängetasche dabei. Die ist immer vollgestopft mit diesen schwarzen Moleskine-Notizbüchern, weil er sich an einem großen britischen Roman versucht. Und da wird mir klar, dass in meiner Tasche absolut nichts ist, woran meine Leidenschaft hängt. Nur meine Geldbörse sowie Telefon und Make-up – Unverzichtbares. Dann macht Nick sich wieder an die Arbeit, aber ich sehe noch immer den Strand, der lautstark nach mir verlangt. Also gehe ich den Flur entlang und klopfe an Olivias abscheuliche grüne Tür und sage ihr, dass ich kündige. Oh, natürlich halte ich die einmonatige Kündigungsfrist ein, ich will sie ja nicht hängen lassen. Aber danach …«
Nora öffnete die Augen. Jennifer nickte bedächtig. »Ihr Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben macht sich jetzt sehr deutlich bemerkbar«, meinte sie schließlich. »Wie es scheint, können Sie nun nicht mehr davor davonlaufen.«
»Kein Weglaufen, kein Verstecken mehr.« Nora lachte nervös. »Ich habe Simon verlassen und ich habe meinen Job aufgegeben und weiß nicht, was ich jetzt tun werde.« Und nur Gott wusste, was ihre Mutter dazu sagen würde – aus vielen Gründen. Aber Nora konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass Jasmine der Dreh- und Angelpunkt all dessen war, auch wenn diese Vermutung überhaupt keinen Sinn ergab. Fest stand jedenfalls, dass ihre Mutter ihr niemals zu dieser Vorgehensweise geraten hätte und dieser Strand der letzte Ort wäre, dem ihre Sehnsucht galt, doch das Gefühl hielt sich hartnäckig, so irrational und beunruhigend es auch war.
Jennifer sah sie noch immer nachdenklich an. »Und wie fühlen Sie sich, seit Sie gekündigt haben?«
Sie tauschten ein schiefes Lächeln. Seit jenem ersten Tag im Juni teilten sie einen kleinen Scherz über das Klischee, dass Therapeuten immer fragen: »Und welches Gefühl löst das in Ihnen aus?« Jennifer war mit ihr einer Meinung, dass dies eine fürchterliche Frage war – manchmal jedoch unvermeidlich nützlich.
»Fassungslos! Ich meine, ich ohne meinen Job … was ist das? Außerdem fühle ich mich wie ein kleines Kind, das die Schule schwänzt. Ich habe Angst, jemand findet es heraus und schreit mich zusammen.«
»Jemand?«
»Ein Verantwortlicher. Ein Lehrer oder so.«
»Aber da sind keine Lehrer, Nora. Sie sind kein Kind und Ihre Entscheidungen gehören Ihnen. Die einzige Person, der Sie in dieser Situation Rechenschaft schuldig sind, ist Ihre Chefin Olivia, und der haben Sie es bereits gesagt.«
»Also gut, dann meine Mutter.«
»Und welche Reaktion erwarten Sie von ihr?«
Und sofort verschlug es Nora die Sprache. Irgendwelche Vorhersagen ihre Mutter betreffend waren in letzter Zeit unmöglich geworden. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate hatten sie sich immer weiter entfremdet. Niemals hätte Nora eine solche Entwicklung für möglich gehalten, so nah, wie sie sich immer gestanden hatten, aber sie wusste noch sehr genau, dass es ihr letztes Jahr an Weihnachten zum ersten Mal aufgefallen war. Bereits mehrmals hatte sie ihre Mutter gefragt, was los war, aber Jasmine hatte den Spieß immer umgedreht und ihr vorgehalten, übersensibel zu sein. Und zur selben Zeit hatten auch Noras eigene Probleme begonnen.
Dann warf Jennifer einen Blick auf ihre Uhr. »Wir müssen jetzt aufhören, Nora, aber vielleicht ist das etwas, worüber Sie bis zum nächsten Mal nachdenken können. Doch noch eine kurze Zwischenfrage: Haben Sie den Strand erkannt? Existiert er nur in Ihrer Einbildung oder kennen Sie ihn?«
Nora lachte freudlos. »Oh, ich kenne ihn. Danke, Jennifer.«
Sie nahm ihre Sachen und brach auf, kehrte zurück auf die dunkle Straße, die, wie alle Straßen, zu Starbucks führte. Jetzt brauchte sie wirklich einen Latte macchiato. Oh ja, sie wusste genau, wo dieser Strand lag. Aber davon ihrer Mutter zu erzählen, widerstrebte ihr noch mehr als alles andere.
CHLOE
Juli 1953
»Freude hat eine Farbe! Und die ist hellblau, wie dieser Sommerhimmel!«, rief Chloe und drehte sich im Kreis, das Gesicht der Sonne zugewandt, die Handflächen ausgestreckt.
Ihr neuer Faltenrock – mintgrün und grau kariert – hob sich von ihren Beinen und drehte sich mit ihr. Er war nicht wirklich neu, es war der abgelegte von Margaret Matthews (die jetzt siebzehn und nach Swansea gegangen war), aber für sie war er neu und so ziemlich das erwachsenste Kleidungsstück, das sie besaß. Ihre Mutter meinte, sie solle ihn für gute Gelegenheiten aufheben, aber Chloe konnte sich keinen besseren Anlass als diesen vorstellen, den Anfang ihres jährlichen Sommerurlaubs in Tenby.
Tenby! Schon der Name erfüllte sie mit einem Hochgefühl. Er schmeckte nach Abenteuer, endlosen sonnigen Tagen an den Stränden, nach Romantik und verborgenen Schätzen … Sie würde ihre glamouröse Tante Susan wiedersehen und ihren Onkel Harry – wie sie ihn jetzt nannten. Würde ihre Cousins Megan und Richard treffen, die sechzehn und achtzehn waren. Allein deren Alter hatte eine Strahlkraft, in deren Glanz sich Chloe noch sonnte, wenn sie schon wieder auf dem Nachhauseweg war. Sie würde Mr Walters in der Eisdiele besuchen und Mrs Isaacs im Zeitungsladen. Sie würde ins Fountains Café und ins Kino gehen und die Höhlen und den Musikpavillon aufsuchen. Und vor allem, oh ja!, vor allem würde sie Llew wiedersehen.
»Chloe Samuels! Hör sofort mit diesem Herumgewirbel auf!« Die einschüchternde Stimme von Tante Bran beendete abrupt ihre Pirouetten. »Da wird ja selbst der Katze ganz schwindelig! Komm her und setzt dich jetzt brav hin. Was würde deine Mama sagen?«
Chloe verkniff sich die Bemerkung, dass es gar keine Katze gab, denn sie warteten an der Bushaltestelle von Carmarthen. Aber die bloße Erwähnung ihrer Mutter reichte, um ihre Freude in Heimweh zu verwandeln. Und das noch bevor sie das County verlassen hatte! Ihre Eltern hatten sie in Nant-Aur in den Bus gesetzt, um dreißig Kilometer weiter von Tante Branwen abgeholt zu werden, die dafür Sorge trug, dass sie in den Bus nach Tenby stieg. Oh Mam, Dad, fragte sie sich, wie soll ich es ohne euch drei ganze Wochen lang aushalten?
Chloe und Tante Bran versanken nebeneinander in Schweigen. Tante Bran war befriedigt, dass sie, indem sie Chloes Mutter ins Spiel brachte, ihrer dreizehnjährigen Nichte wirkungsvoll den Wind aus den Segeln genommen hatte. In Wahrheit jedoch teilte Gwennan die Aufregung wegen Chloes Urlaub. Wäre sie hier gewesen, hätte sie auch Pirouetten gedreht. Sie hatte den Koffer ihrer Tochter gepackt und so sorgfältig Seidenpapier zwischen die abgetragenen Pullover, Röcke und Blusen gelegt, als wären sie aus feinster Pariser Seide. Es gab nichts, was Gwennan nicht für das Glück ihres erstgeborenen Kindes und ihrer einzigen Tochter tun würde, aber sie und ihr Ehemann Daf hatten nur wenig zu geben. Also mussten sie sich damit arrangieren, sich jeden Sommer für drei Wochen von Chloe zu trennen, damit sie sich in Tenby herrlich amüsieren konnte.
Der rote Bus nach Tenby kam in einer Staubwolke und mit knirschenden Rädern zum Stehen. Chloes Tante schwang den abgewetzten braunen Koffer (wieder etwas von Margaret Matthews Abgelegtes) über die Stufen und gab Chloe einen knappen, spitzen Kuss auf die Wange. Sie trat zurück, als der Bus sich in Bewegung setzte, und trottete dann davon, ohne zu winken oder ihm hinterherzuschauen.
Die drei Schwestern könnten unterschiedlicher nicht sein, überlegte Chloe, als sie ihrer davonstapfenden Tante nachblickte. Branwen, die Älteste, hatte nie geheiratet und lebte allein in ihrem kleinen Cottage in der Blue Street. Diese Situation hätte zu jeder Menge Spaß und Abenteuer führen können, wäre Tante Bran nicht eine Person gewesen, die mit einem steifen Besen jede Art von Spaß und Abenteuer verjagte. Die blasse und unschöne Tante Bran mit Augenbrauen, die überall dort sprossen, wo sie gar nicht hingehörten, war, wie sich mit Gewissheit sagen ließ, nicht die Lieblingstante von Chloe.
Dann kam Susan, das »mittlere Kind«, eine Bezeichnung, die alles Mögliche andeuten sollte, wenn Chloe die Nachbarn darüber tuscheln hörte. Sie war groß, ziemlich glamourös und hätte fast die Universität besucht! Tatsächlich hatte Chloe bis vor vier Jahren nicht mal gewusst, dass sie eine Tante Susan hatte – während des Kriegs, als Chloe noch klein war, hatte es einen Familienzwist gegeben. Aber 1950 hatte Tante Susan die »Unstimmigkeiten ausgebügelt«. Sie schrieb an Gwennan, die weichherzigere ihrer Schwestern, dass eine neue Dekade angebrochen sei und sie die Vergangenheit ruhen lassen sollten. Sie schrieb, dass sie sich nun in Tenby niedergelassen habe, und falls Gwennan Chloe auf Besuch schicken möchte, würde man sich ihrer sehr gern annehmen.
Gwennan, die jüngste der Schwestern, war Chloes Mutter … Ach, nicht schon wieder. Chloe liebte ihre Mutter so sehr, außerdem hatte ihr Urlaub gerade erst begonnen, sodass sie nicht an sie denken konnte, ohne gleich zu weinen. Am schlimmsten wäre es, wie sie wusste, am heutigen Abend, wenn sie ihre erste Nacht auf dem Feldbett zu Füßen von Cousine Megans Bett verbrachte. Da würde sie sich an den besorgten Ausdruck ihrer Mutter erinnern, als diese immer und immer wieder überprüft hatte, ob Chloe auch alles dabeihatte, was sie benötigte. So viel Liebe … Eine Trennung, und sei es auch nur für einen Urlaub, machte eine derartige Liebe zu einem doppelschneidigen Schwert.
Aber morgen würde sie vom Gekreisch der Möwen und mit dem Versprechen auf lange, sonnige Tage voller Freiheit aufwachen. Die Zeit würde verstreichen und Chloe würde glücklich sein und Fortsetzungsbriefe nach Hause schreiben, die sie einmal in der Woche zur Post brachte, und das Heimweh, das hiraeth, würde nachlassen. Das Muster, dem ihre Tage folgten, kannte sie inzwischen gut, denn dies waren ihre vierten Sommerferien beim anderen Zweig der Familie, dem »vornehmen« Zweig.
Und dies würden ihre bisher besten Ferien werden, denn nun war sie dreizehn! Und das bedeutete – ihr Magen flatterte ganz aufgeregt beim Gedanken daran -, dass sie, Chloe Samuels, in diesem Jahr zum allerersten Mal am Teenager-Sommerball von Tenby teilnehmen durfte! Wie ließ sich so viel Aufregung aushalten und überleben?
Sie zwang sich, still zu sitzen, und kramte in ihrer Manteltasche nach einem Bonbon.
Genieß es, cariad! Genieße jede Minute! Die Erinnerung an Gwennans freundliche, liebe Stimme ließ Chloe ihre Mutter noch heftiger vermissen, weshalb sie stattdessen an Llew dachte.
Chloe hatte Llew in ihrem ersten Tenby-Sommer vor langen drei Jahren kennengelernt, und er war ihr bester Freund auf der ganzen Welt. Natürlich erzählte sie das nicht Bethan Hill, die ihre beste Freundin in Nant-Aur war. Sie wollte niemandes Gefühle verletzen. ABER …
Llew war etwas Besonderes. Er war zwei Jahre jünger als Chloe, genauso alt wie ihr Bruder Clark. Wäre er jemand anderes gewesen, hätte Chloe ihn als Kind bezeichnet. Aber er hatte eine »alte Seele«, wie Tante Susan meinte, was nicht unbedingt als Kompliment gedacht war. Doch Chloe gab ihr recht, sie konnte es in seinen grün-braun-gelben Augen sehen, und wenn er sprach, hatte sie das Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, der älter und nicht jünger war als sie. Außerdem war er genauso groß wie sie und jeder wusste, dass Jungs langsamer wuchsen als Mädchen. Aber Chloe wiederum war nie groß gewesen – darin kam sie nach ihrer Mutter. Und sie war in ständiger Sorge, am Ende auch genauso untersetzt zu sein wie sie. Doch noch gab es dafür keine Anzeichen. Chloe war so schlank wie ein Gänseblümchenstängel.
Llew machte sich viele Gedanken und las Gedichte. Chloe neckte ihn deswegen, aber insgeheim war sie beeindruckt. Er würde später als Erwachsener einmal ein bekannter Fotograf werden und Fotos von sämtlichen Berühmtheiten machen – Schauspielern und Schauspielerinnen, Schriftstellern und Tänzern und Erfindern. Nie sah man ihn ohne seine Box Brownie um seinen dünnen Hals. Ohne jede Scheu quatschte er Fischer, Urlauber, Seenotretter oder Platzanweiserinnen im Kino an und bat sie, dies oder das oder jenes zu tun, alles, wovon er sich ein interessantes Foto versprach. Selbst als Red Sam, der Hummerfischer, ihn anbrüllte und davonjagte, blieb Llew unverdrossen. Red Sam machte Chloe Angst mit seinen Händen und Füßen, die so groß waren wie Ambosse, und der Gesichtsfarbe eines Trinkers, der er seinen Namen verdankte, und dem Bart so dicht wie ein Brombeergestrüpp, aber Llew tänzelte über die Felsen davon und lachte ihn aus.
Red Sam war jedoch eine dramatische Ausnahme. Weitaus öfter schienen sich die Leute geschmeichelt zu fühlen oder sich wenigstens zu amüsieren, und Llew bekam sein Foto. Gelegentlich verfluchten sie ihn und meinten, er werde als Erwachsener ein Nichtsnutz werden wie sein alter Herr. Chloe hätte es niemals ertragen, derart zurückgewiesen zu werden, aber Llew zuckte nur die Schultern.
»Eines Tages wird es ihnen leidtun«, lautete seine lakonische Antwort darauf. »Sie werden mich anflehen, ein Foto von ihnen zu machen, aber sie werden es sich nicht leisten können.«
Eines Tages würde Llew auch Chloe fotografieren, versprach er ihr, denn sie würde schön sein. Das kam ihm ganz nüchtern über die Lippen und klang nicht anders als die Feststellung, dass ein Marienkäfer Punkte oder ein Schmetterling Flügel hat, aber Chloe freute sich unbändig. Denn außer ihrer Mutter war er der Erste, der dies sagte, und sie wollte unbedingt schön sein, denn dann würden die Männer sich in sie verlieben, wenn sie erwachsen war, und sie würde ein märchenhaftes Leben führen … Chloe war fest entschlossen, ein märchenhaftes Leben zu haben.
In Nant-Aur konnte man sich allerdings nur schwer vorstellen, wie dies Wirklichkeit werden sollte. Nicht, dass Chloe ihr Zuhause nicht geliebt hätte, das tat sie. Sie verehrte ihre Eltern, ertrug ihre Brüder besser, als sie sich anmerken ließ (dass sie die beiden liebte, würde sie allerdings niemals zugeben) und konnte sich nicht vorstellen, sich jemals daran zu gewöhnen, beim Aufwachen nicht die um den Hügel wabernden Nebel zu sehen.
Aber Nant-Aur war ein Dorf. Sie kannte jeden Einzelnen, und sollte etwas Großes in ihr schlummern, so würde es dort keiner wahrnehmen, abgesehen vielleicht von ihrer Mam. Für alle anderen war sie einfach »das Samuels-Mädchen«, viel zu flatterhaft, aber dennoch ein hübsches Ding, sofern sie noch etwas fülliger wurde.
Was die Männer betraf … Abgesehen von ihren Brüdern gab es im Dorf gerade mal zwölf Jungs etwa in ihrem Alter. Selbst wenn sie ihnen zubilligte, dass sich ihr Aussehen und ihre Manieren beim Heranwachsen verbesserten, konnte Chloe sich nicht vorstellen, sich auch nur in einen Einzigen von ihnen zu verlieben. Sie waren allesamt Einfaltspinsel, dumm wie Brot. Wohingegen Chloe sich wünschte … nun, in Wahrheit wusste sie nicht, was sie sich wünschte, und das lag mit an Nant-Aur. Abgesehen von der Klavierlehrerin und der Küsterin, die beide alte Jungfern waren (ein Wort, bei dem es Chloe schauderte), waren alle Frauen Mütter und Ehefrauen. Sie besorgten den Haushalt, wuschen die Wäsche. Sie standen nicht für ein breites Spektrum an Möglichkeiten, aus denen Chloe hätte wählen können.
Die Kinder im Bus stimmten begeistert ein Lied an und rissen sie damit aus ihren Grübeleien.
»Oneby, Twoby, Threeby, Fourby, Fiveby, Sixby, Sevenby, Eightby, Nineby, TENBY!«, brüllten sie und wurden mit jedem Zählen lauter, bevor sie in schallendes Gelächter ausbrachen und sich nicht mehr einkriegten.
Ein paar der Alten quittierten dies mit missbilligenden Lauten, andere lächelten nachsichtig. Chloe zog ihre Brauen hoch, wie Megan das vielleicht getan hätte. In früheren Jahren hatte sie immer mitgemacht, aber jetzt war sie ein Tenby-Teenager! Jetzt brauchte sie nicht mehr kindisch zu sein wie die Kleinen.
Es war ja nicht so, dass sie nicht heiraten und Kinder kriegen wollte, es sollte nur nicht so sein, wie das in Nant-Aur üblich war. Sie wollte sich nicht an sechs Tagen in der Woche in eine alte Schürze wickeln und an den Sonntagen im geflickten Kleid in die Kirche gehen, und danach nach Hause eilen, um einen großen Braten mit sämtlichen Beilagen zuzubereiten, während der Rest der Familie vor dem Kamin schnarchte. Sie wollte … auch noch etwas anderes.
Nur in Tenby blitzten alternative Wege auf, wie man sich das Leben einrichten konnte. Tante Susan zum Beispiel hatte einen Ehemann und Kinder, aber sie trug schöne Kleider aus ihrer Zeit in London. Sie traf sich häufig mit Freundinnen zum Mittagessen und brachte viel Zeit damit zu, aufs Meer hinaus zu schauen, sich mit der Zigarettenspitze an die Zähne zu klopfen und ihre Nägel in einem umwerfenden Rot wie dem der Stechpalmenbeere zu lackieren. Chloe glaubte, auch sie könnte glücklich sein, wenn sie Nagellack und hübsche Dinge zum Anziehen hätte und Zeit, um sich mit Freundinnen zu amüsieren. Nichts davon besaß ihre eigene Mutter, aber Gwennan war immer glücklich, allerdings konnte Chloe sich nicht erklären, warum. Der einzige Mensch, mit dem sie über solche Dinge sprechen konnte, war Llew, und er meinte, dass es so viele verschiedene Wege gäbe, glücklich zu sein, wie es Menschen auf der Welt oder Kieselsteine am Strand gab.
»Woher willst du das wissen?«, hatte sie ihn gefragt und dabei herausfordernd angesehen. »Du bist gerade mal zehn!«
Aber ob er nun richtig- oder falschlag, Chloe gefiel der Gedanke, ihren eigenen Weg zum Glücklichsein zu finden. Sie wollte nicht so sein wie ihre Mutter und auch nicht ganz so wie Tante Susan und ganz gewiss nicht wie Tante Bran! Also würde sie sich einen neuen Weg bahnen müssen. Nur eins wusste sie mit Sicherheit: Sollte irgendwo in dem kleinen, gewöhnlichen Leben von Chloe Samuels etwas Märchenhaftes zu finden sein, dann wäre Tenby der richtige Ort dafür.
NORA
Die Angst war so schlimm wie eh und je. Zum Glück war Samstag und sie brauchte nicht zur Arbeit. Bis jetzt bestand die große Leistung des heutigen Tages für Nora darin, dass sie aus dem Bett aufgestanden war und sich eine Tasse Tee gekocht und in einen Sessel vor ihrem Schlafzimmerfenster gesetzt hatte. Sich anzuziehen hatte sie noch nicht geschafft, aber dank der voll aufgedrehten Heizung, einer Fleecedecke und einem Paar violetter Bettsocken war ihr warm. Und dennoch zitterte sie. Jennifer hatte ihr für solche Fälle den Rat gegeben, »es auszusitzen«, »in es hinein zu atmen« und »es mit Neugier und Mitgefühl zu betrachten«. Achtsamkeit. Nora versuchte es. Nicht so sehr, weil sie daran glaubte, sondern weil sie sich so elend fühlte – so überaus elend -, dass sie jede Technik, jede Perspektive ausprobieren wollte, die eines Tages diese kalte graue Lähmung verscheuchen würde. Wenn ihre Arbeitskollegen sie jetzt sehen könnten, würden sie es nicht glauben.
Nora war – jedenfalls für weitere vier Wochen – die Büroleiterin der Historischen Fakultät an der School of Humanities der University of Greater London. Sie leitete ein Team von neun Administratoren (kleiner Scherz der Fakultät: Warum eine Person für einen Job einstellen, wenn drei es halb so gut schaffen?) und sorgte dafür, dass der Arbeitsalltag der von ihr unterstützten acht Akademiker wie am Schnürchen lief. Den Sumpf der Arbeitsabläufe an der Universität mit all dem Papierkram und den Protokollen hatte sie immer als Dschungel gesehen und sich selbst darin als mächtige Forscherin, die sich mit der Machete ihren Weg bahnte. Wegen der Unerschrockenheit, mit der sie ihre Aufgabenlisten abarbeitete, an denen schwächere Sterbliche verzagt wären, pflegte Simon sie das Erfolg-o-Meter zu nennen. Von einem Mann nicht gerade ein sexy Kompliment.
Aber es stimmte schon, Nora war eine unübertreffliche Fachkraft. Alles an ihr saß immer perfekt. Was den Kopf einziehen bedeutete, wusste sie gar nicht. Aber seit etwa einem Jahr plagten sie verschwommene, unspezifische Ängste. Plötzlich wachte sie nachts weinend aus Albträumen auf, ohne sich später daran erinnern zu können, manchmal auch aus erotischen Träumen, so klar und aufdringlich und so sehr im Widerspruch zu ihrem Leben im Wachzustand, dass sie diese sogar noch beunruhigender fand.
Die Aussicht, die ihre Zweizimmerwohnung auf die Hofseite bot, bestand aus einem Gewirr von Dächern und Häuserkanten, ein paar Abflussrohren und einer rissigen Regenrinne, aus der wie aus einem dekonstruktivistischen Hängekorb üppig das Unkraut spross. Nora saß da und stierte vor sich hin, während zwischen ihren Händen der Becher kalt wurde.
Wie sollte sie es den anderen am Montag in der Arbeit beibringen? Neun Jahre hatte sie dort zugebracht; sie »gehörte zum Inventar«, wie Dr. Menna Brantham (Gender und Narrativität 1765–1857) oft betonte. (Sie meinte es als Kompliment.) Sie war nicht ansatzweise darauf vorbereitet, auf die mit Sicherheit folgenden Fragen Antworten zu geben. Wie etwa: Warum?
Vielleicht hatte Simon recht. Vielleicht tickte sie wirklich aus. Sie hatte einem momentanen Impuls nachgegeben, hervorgerufen durch den Kontrast jenes Strandbildes und dieser grün angestrichenen Türen und des verdammten Plastikfarns. Eine spontane vehemente Ablehnung all dessen, was für ihr Leben stand. Aber das konnte sie doch wohl kaum ihren Kollegen erzählen.
Ihr Kopf sagte ihr immer wieder, dass sie einen katastrophalen Fehler gemacht hatte, schließlich könnte ihr Job wirklich schlimmer sein. Aber ein rebellischer, uneingestandener Teil von Nora flüsterte ihr ein: Er könnte aber auch sehr viel besser sein.
Was würde sie tun, wenn sie aufhörte? Jeden Tag genauso wie diesen verbringen, sich vor einem unsichtbaren Raubtier totstellen, vor dem Leben zurückweichen? Würde sie tatsächlich verrückt werden? Diese Möglichkeit hatte Nora bisher nie auf dem Schirm gehabt. Sie war klug. Pragmatisch. Engagiert. »Eine sehr patente junge Frau«, hatte Dr. Wendham Windsor (Politik und Soziologie des 20. Jahrhunderts) sie einmal gelobt.
Ihr Becher war jetzt eiskalt. Nora stellte ihn auf dem Fensterbrett ab und die Dachlandschaft vor ihren Augen verwandelte sich in den Strand. Langgezogen und makellos, mit einem Funkeln wie Champagner, gesäumt von Schaum und ins Flutlicht der Wintersonne getaucht. Nora stöhnte. Musste sie nun auch noch Halluzinationen auf die Liste ihrer Probleme setzen? Es war nur ein Ort in Wales, den sie als Kind ein einziges Mal besucht hatte.
Nora und Jasmine hatten bei Grandma gewohnt, die vorgeschlagen hatte, einen Ausflug nach Tenby zu machen. Jasmine wollte natürlich nicht mitkommen, also fuhr Gran allein mit Nora. Nora hatte an diesen Tag seit sicher zwanzig Jahren nicht mehr gedacht – bis gestern im Büro der Strand aus dem Nichts vor ihrem geistigen Auge aufgeblitzt war.
Und warum genau dieser Strand? Tenby verfügte über zwei oder drei wunderbare Strände, wenn Nora das noch richtig in Erinnerung hatte. Erst gegen Ende des Tages hatten sie einen kurzen Abstecher zum South Beach unternommen. Als Gran sie fragte, ob sie hinuntergehen und einen Spaziergang machen wolle, hatte Nora den Kopf geschüttelt – sie war müde. Also kehrten sie zum Auto zurück. Es war ein hübscher Ort gewesen, eine glücklichere Zeit, aber es hatte sich dort nichts Bemerkenswertes ereignet. Er hatte für sie keine besondere Bedeutung. Es war lächerlich. Man konnte doch nicht von einem Strand heimgesucht werden. Aber das Seltsamste daran war, dass ihre Angst jedes Mal nachließ, wenn sie diesen Strand sah.
Das Schlimmste an einem Nervenzusammenbruch, oder was immer das war, worunter sie litt, war das Gefühl, von allem entrückt zu sein. Gestern Abend hatte sie auf ihrem Nachhauseweg Glen, den Obdachlosen, vor der U-Bahnstation getroffen. Er hielt eine Leine, an der jedoch kein Hund befestigt war. Als er Nora sah, packte er sie am Arm.
»Haben Sie ihn gesehen?«, fragte er mit großen forschenden Augen.
»Wen gesehen?«, hakte Nora nach. »Ihren Hund?«
Er sah sie fragend an. »Nein, ich habe keinen Hund. Mich selbst. Ich kann mich selbst nicht finden. Haben Sie ihn gesehen?«
Nora hatte ihm im nahegelegenen Café einen Kaffee und ein Stück Kuchen gekauft und sich eine Weile zu ihm gesetzt. Sie fühlte sich genauso, als würden all die Dinge, die einmal »Nora« ausgemacht hatten, aus den Fugen geraten und davonschweben. Das war beängstigend und machte einsam.
In letzter Zeit konnte schon die kleinste Kleinigkeit sie erschüttern. Wie etwa die Aussicht auf den heutigen Abend: Sie musste zum Abendessen zu ihrer Mutter. Nun, sie musste natürlich nicht – Jennifer zog sie ständig wegen einer Wortwahl wie dieser auf. Ihre Mutter hatte schlicht eine Einladung ausgesprochen und Nora stand es frei, sie anzunehmen oder abzulehnen, wie Jennifer betonte. Also hatte Nora sich dafür entschieden, die – eindringlich vorgebrachte – Einladung anzunehmen, in der Hoffnung, dass es diesmal so sein würde, wie es früher einmal war.
Es kostete sie Kraft, sich aufzuraffen und zu duschen, anzuziehen und die Haare zu föhnen. Aber ihre Mutter bekäme einen Anfall, wenn Nora bei ihr auftauchen würde, als wäre sie gerade erst aus dem Bett gekrochen. Also musste es getan werden.
»Okay, okay«, führte Nora ihren imaginären Dialog mit Jennifer fort. Es musste nicht getan werden. Sondern sie entschied sich dafür, sich präsentabel herzurichten, um sich selbst Kummer zu ersparen. Vermutlich hatte es auch sein Gutes: Ungewaschen den ganzen Tag in einem Sessel zu sitzen, war nicht gerade aufbauend.
Als sie ihre Wohnung verließ, sah Nora zwar blass, aber sonst beinahe normal aus in schwarzer Jeans, violetter Bluse und flachen Schuhen. Sie wählte Kristallohrringe und ein Armband. Glänzend rahmte das braune Haar im Rachel-Schnitt, wie er in den Neunzigern populär war, ihr herzförmiges Gesicht. Nora war immer ein Fan von Friends gewesen. Mit etwas Mascara betonte sie ihre großen grauen Augen und besprühte sich mit La Vie Est Belle. Sie stellte die Parfümflasche zurück neben das alte Stundenglas ihrer Mutter mit seinem Mahagonigestell und dem Sand in Entenei-Blau. Als Kind hatte sie gern mit diesem hübschen Gegenstand gespielt. Jetzt stand er vernachlässigt zwischen dem Krimskrams, das Glas trüb von einer Staubschicht. Schuldbewusst wischte Nora es rasch mit ihrem Ärmel ab.
Als sie rosa Rosen kaufte – die Lieblingsblumen ihrer Mutter –, fühlte sie sich gleich besser. Im Bus überfiel sie dann allerdings der Drang, bis zur Endstation in Richmond sitzen zu bleiben, aber das hatte wohl nichts zu bedeuten, oder? Schließlich konnte man nicht immer in der Stimmung sein, seine Mutter zu besuchen. Nur dass Nora sich früher stets darauf gefreut hatte.
Ihr Dad Steve hatte sich aus dem Staub gemacht, als sie noch klein war – an Noras erstem Geburtstag, um genau zu sein. Jasmine hatte nie wieder geheiratet. Sie blieben in selbst gewählter Zweisamkeit unter sich. Zwischen uns passt kein Blatt Papier, wie Jasmine immer betonte, wenn man sie dafür bewunderte, dass sie so gut zurechtkam.
»Zwischen uns passt kein Blatt Papier«, meinte sie dann lächelnd und schüttelte den Kopf. »Uns geht’s wunderbar, nicht wahr, Nora?« Und das stimmte auch. Selbst als Nora zur Universität ging und dann mit ihrem ersten Freund zusammenzog, blieben sie weiterhin beste Freundinnen. Bis letztes Jahr war die eine der anderen die liebste Gesellschaft und sie waren sich so nah, wie man sich nur sein konnte.
Warum sich das geändert hatte, wusste Nora nicht. Es war nichts Dramatisches passiert. Lag es an Nora? Lag es an Jasmine? Oder war es völlig natürlich und unvermeidlich? Vielleicht konnte niemand auf Dauer seiner Mutter so nah sein. Es war noch immer okay zwischen ihnen, sie redeten noch miteinander und so, aber … Zwischen ihnen lag permanente Anspannung, Verärgerung. Die banalsten Gespräche bargen Landminen des Missverständnisses. Vielleicht waren sie einander zu nah.
Auf dem Oberdeck des Busses nach Petersham redete sie sich gut zu. Diese Affirmationen beruhten nicht auf einer Empfehlung von Jennifer; Nora war in einem der Selbsthilferatgeber darauf gestoßen, die sie im Lauf der letzten Monate angehäuft hatte. Sie beruhigten sie ein wenig.
Alle meine Beziehungen sind harmonisch und befriedigend. Ich bin eine zuversichtliche, kompetente Erwachsene. Ich bin frei, eigene Entscheidungen zu treffen.
Jasmines Haus war ein winziges Cottage aus dem achtzehnten Jahrhundert am Ende einer Straße, die nun zu einer modernen Wohnsiedlung führte. Nora zögerte unweigerlich an der Türschwelle. Natürlich würde sie ihrer Mutter die Neuigkeiten erzählen. So hatten Nora und Jasmine das immer gehalten. Wenn Nora aus der Schule kam, erzählte sie ihrer Mutter jedes Mal in allen Einzelheiten bei heißer Schokolade und Jacobs Crackers, wie ihr Tag verlaufen war. Wenn Jasmine von der Arbeit nach Hause kam, erzählte sie Nora bei einem Glas Wein, wie ihr Tag in der Arbeit ausgesehen hatte. Nora wünschte sich, dass es zwischen ihnen wieder genauso wurde. Sie hatte aus keinem erkennbaren Grund gekündigt und nun erst mal keinen Job. Es sollte doch wohl noch immer möglich sein, das ihrer Mutter mitzuteilen, oder?
Alle meine Beziehungen sind aufrichtig und ehrlich. Ich bin eine starke, unabhängige Erwachsene.
Die Tür flog auf und Nora fuhr zusammen. »Willst du den ganzen Abend hier stehen bleiben und Selbstgespräche führen?«, fragte ihre Mutter. »Ich habe dich vom oberen Fenster aus beobachtet. Man könnte meinen, du willst gar nicht reinkommen!«
»Natürlich will ich reinkommen!« Nora errötete und drückte ihrer Mutter, deren Augen vor Freude strahlten, die Blumen in die Hand.
Jasmine hatte lange dunkle Haare, und das schon immer, so weit Nora zurückdenken konnte. Natürlich half Jasmine, die in den Siebzigern war, jetzt bei der Farbe nach, die ihr zu ihren auffallend blauen Augen und dem elfenhaften Körperbau noch immer gut stand und außerdem gut gemacht war. Ihre Haut war seidig und sie hatte eine zierliche Figur – was Nora ärgerte, die üppig gebaut und fast einen Meter achtzig groß war und sich neben ihr riesig fühlte. Offensichtlich kam sie nach ihrem Vater.
»Dank dir, meine Liebe, die sind wunderschön. Du bist ein Schatz. Jetzt komm aber rein. Was hast du denn mit deiner Bluse angestellt?« Sie strich nicht gerade sanft über Noras Ärmel.
Nora blickte auf den Staubstreifen, den das Stundenglas zurückgelassen hatte. »Das ist nur Staub.«
»Ganz ehrlich, meine Liebe, es würde nicht schaden, wenn du dir hin und wieder mal eine Putzfrau leisten würdest. Oh! Ich glaube, die Suppe kocht. Die darf aber nicht kochen!«
Sie humpelte davon und Nora folgte ihrer Mutter in die Küche. Diese war klein und wirkte warm, mit Eichenschränken und Terracottafliesen auf dem Boden. Der süße Duft von Pastinaken waberte wie eine Wolke durch den Raum. An den Türrahmen gelehnt verfolgte Nora, wie Jasmine die Flamme am Kochfeld kleiner drehte und die Suppe umrührte. Sie war wie immer elegant angezogen, schwarze Seidenhose und cremefarbene Chiffonbluse. Jasmine gab nichts auf Schürzen. Einen kurzen Moment lang sah sie aus wie immer. Nur wenn sie umherlief, sah man ihr das Alter an – die steifen Gelenke und seltsamen Bewegungen beim Bücken und Strecken. Nora gab sich der Illusion hin, sie sei noch ein Kind und ihre Mutter in den Vierzigern und sie könnten einander bei Pastinakensuppe das Herz ausschütten.
»Sandy wird mit uns zu Abend essen«, verkündete Jasmine, während Nora einen Krug mit Wasser füllte und die Rosenstängel beschnitt.
Das war ein Dämpfer für Nora. Es war schon in den besten Zeiten schwer genug geworden, mit Jasmine ins Gespräch zu kommen. Wenn sie zudem Gesellschaft hatte, dürfte es unmöglich sein. »Oh.«
»Was ist denn? Du magst Sandy doch.«
Nora mochte sie. Auch sie war eine ständig umherziehende Siebzigjährige, die jedes Mal, wenn Jasmine auf einem ihrer immer häufiger werdenden Ausflüge nach Thailand oder Kanada oder Malawi außer Landes war, auf das Cottage aufpasste. Bedeutete dies etwa, dass ihre Mutter schon wieder wegfuhr?
»Wirst du Weihnachten denn hier sein, Mum?«, platzte es aus ihr heraus. Sie würde doch wohl nicht über Weihnachten verschwinden, jetzt, da Nora Simon verlassen hatte?
Jasmine drehte sich am Herd zu ihr um und sah sie mit gerunzelter Stirn an. »Natürlich werde ich da sein!«, erklärte sie in einem höchst ungeduldigen Ton. »Nun werde bloß nicht albern, Nora.«
»Ich habe doch nur gefragt!«
»Derart sinnlose Fragen kannst du dir sparen! Oh, da kommt Sandy. Lass sie doch bitte rein.« Jasmine bückte sich mühsam, um die Tür des Backofens zu öffnen, dem der appetitanregende Duft von Knoblauchbrot entwich. Mit ihren riesigen Topfhandschuhen sah sie aus wie ein Kind in den Schuhen des Vaters. Hin- und hergerissen zwischen Liebe und Enttäuschung biss Nora sich auf die Lippe und ging dann zur Tür, als sie Sandys Gehstock auf dem Kies knirschen hörte.
Je weiter der Abend voranschritt, umso entspannter wurde Nora. Vielleicht war es sogar gut, dass Sandy hier war. Sie brauchte ihrer Mutter ja die letzten Entwicklungen nicht unbedingt heute zu erzählen. Das konnte warten.
»Nora geht noch immer zu dieser Therapeutin«, bemerkte Jasmine bei der Zitronenbaisertorte. »Mir lässt das keine Ruhe. Dieses ständige Graben in der Vergangenheit und die Geldverschwendung. Das haben wir damals nicht gemacht, stimmt’s?«
»Du darfst nicht vergessen, Jasmine«, wandte Sandy ein, »die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage stehen junge Leute unter großem Druck. Entschuldige, Nora, ich möchte nicht besserwisserisch klingen. Ich weiß, dass du ziemlich erwachsen bist. Allerdings kommen mir in letzter Zeit alle, die unter sechzig sind, jung vor.«
Nora lachte. Sandy war drahtig und zäh. Ihr dichtes graues Haar war zum Pferdeschwanz zusammengebunden und sie trug wie üblich Jeans und ein Poloshirt. Sie war lebhaft und an Menschen interessiert. Sie war eine gute Reklame für die Siebzig-plus.
»Das sagen alle«, erwiderte Jasmine mit finsterer Miene. »Man braucht ja nur das Frühstücksfernsehen einzuschalten. Da wird über Lärmbelästigung und Zeitdruck und Schikane in den sozialen Medien gestöhnt … Alles muss richtig aufgeblasen werden …«
Anstatt vor Sandy einen Streit vom Zaun zu brechen, entschuldigte Nora sich und ging nach oben. Jasmine hatte sich immer damit gebrüstet, unvoreingenommen und aufgeschlossen zu sein. Wieso, verdammt, hatte sie sich derart verändert? Im Badezimmer flackerten Teelichte auf dem Fensterbrett und der Boiler summte. Das weckte bei Nora nostalgische Gefühle. Sie vermisste das Leben hier, als sie jung und voller Optimismus war und am Fluss entlanglief, um den Schulbus zu erwischen. Und Herrgott noch mal, sie vermisste ihre Mutter! Und doch begriff sie nicht, wie man jemanden vermissen konnte, der in diesem Moment unten saß. Vor allem nicht, nachdem derjenige sie während der vergangenen zwei Stunden so wütend gemacht hatte. Sie vermisste die Mutter, die sie einmal gewesen war. Und das, was ihre Beziehung ausgemacht hatte.
Auf dem Treppenabsatz sah sie, dass die Dachbodenleiter heruntergezogen war – Jasmine hatte erwähnt, dass die jährliche Exhumierung der Weihnachtsdekoration anstand. Plötzlich packte Nora das Verlangen, die alten Fotoalben ihrer Mutter durchzublättern. Als Nora klein und ihrer schönen, abenteuerlustigen Mutter in Ehrfurcht ergeben war, hatte sie Stunden damit zugebracht, sie sich anzusehen. An vielen Winterabenden hatte Jasmine sich mit Nora hingesetzt und die Seiten umgeblättert und dabei die Geschichten zu den Bildern erzählt.
Nora hatte verzaubert zugehört und war sich dabei sicher gewesen, dass jede Frau so sein wollte wie ihre Mutter. Jetzt aber, nachdem ihre Mutter sich so verändert hatte, fragte Nora sich, wie das Leben für Jasmine tatsächlich ausgesehen hatte – hinter den strahlenden Bildern.
»Mum«, rief sie, »ich komme gleich wieder, ich muss nur meine alten Bücher durchsehen.«
»Okay!«, rief ihre Mutter zurück. »Soll ich dir für später noch ein Stück Torte abschneiden?«
»Ja, bitte.«
»Wirklich? Ich dachte, du wolltest abnehmen?«
»Warum hast du es mir dann angeboten?«, brummelte Nora, verdrehte die Augen und verweigerte die Antwort.
Rasch erklomm sie die Leiter zum Dachboden und schaltete das Licht an. In der Mitte stapelten sich Schachteln mit Weihnachtsdekoration, aus denen Lametta hing. Nora griff nach der Taschenlampe, die neben der Dachbodenluke ihren Platz hatte, und strahlte die verschiedenen Objekte an: Noras Schulzeugnisse und -projekte, Koffer, die Gitarre, auf der niemand spielen konnte …
Sie entdeckte die verzierte Truhe mit den Fotoalben und öffnete sie. Es gab kein Geheimnis zu lüften, sie wusste, dass sie keinen geheimen Brief oder eine bisher nicht entdeckte Aufschrift auf der Rückseite eines der Fotos entdecken würde, weil sie diese Alben von vorn bis hinten in- und auswendig kannte. Sie wollte einfach nur wieder mal einen Blick darauf werfen. Sie zog das oberste Album heraus und schlug es aufs Geratewohl auf. Nora musste lächeln. Diese Fotos hatte sie seit Jahren nicht mehr angeschaut … Als Erstes war da Jasmines Phase als Go-go-Girl. In den Sechzigerjahren hatte sie in London als Model gearbeitet und die Fotos zeigten sie mit dramatisch schwarz umrandeten Augen, Miniröcken und klobigen kniehohen Stiefeln, das lange dunkle Haar hochtoupiert.
Darauf folgte die Hippiezeit in den Siebzigern: fließende gebatikte Röcke und gehäkelte Ponchos, das Haar offen und länger denn je. Das war die Phase, die Nora hervorgebracht hatte.
Danach kam das, was für Nora immer die Melanie-Griffith-Phase ihrer Mutter in den Achtzigern gewesen war, nachdem Steve sie verlassen hatte. Rechnungen mussten bezahlt und ein Kind versorgt werden, und so machte Jasmine eine Ausbildung als Rechtsassistentin und wurde Anwältin und war als alleinerziehende Mutter erfolgreich in einem harten Umfeld, in dem Frauen damals noch eine Minderheit darstellten. Aber sollte sie diese weitere, ihr aufgedrängte Veränderung ihres Lebensstils bedauert haben, so ließ sie sich das nie anmerken. Die Fotos aus dieser Zeit zeigten sie mit Frisuren wie aus dem Denver-Clan, mit blauem Lidschatten und dem Goldschmuck einer Powerfrau.
Go-go-Jasmine hatte Nora nie gekannt und von Hippie-Jasmine waren ihr nur vage Erinnerungen wie aus einer anderen Welt geblieben: die Berührung weicher Stoffe, der Duft von Räucherstäbchen. Es war die »berufstätige Mutter« Jasmine, an die Nora sich erinnerte und von der sie geprägt worden war.
Aber bei Jasmine war eine Karrierefrau sexy, faszinierend und dynamisch, und Nora kam nicht umhin, einen Vergleich mit ihr im entsprechenden Alter anzustellen. Eine sehr patente junge Frau. Das Erfolg-o-Meter. Teil des Inventars. Das waren keine Komplimente, die ein Mädchen zum Strahlen brachten. Nora hatte Jennifer einmal beschrieben, dass sie das Leben ihrer Mutter als eine Anhäufung großer, bunter Bauklötze empfand, wohingegen für Nora nur die engen, staubigen Räume dazwischen übrig blieben. Sie fühlte sich wie das Negativ einer Fotografie, wie die farblosen, verschmierten Flecken, die Jasmine Banquists bemerkenswertes Leben übrig ließ.
Sie blätterte noch eine Weile, klappte dann die Alben zu und stellte alles zurück. Sie wappnete sich für die Rückkehr an den Esstisch. Und verdammt noch mal, sie würde noch ein Stück Torte verspeisen.
CHLOE
Als der Bus am Lager der Fahrenden nahe Kilgetty vorbeifuhr, wusste Chloe, dass sie sich tatsächlich ihrem Ziel näherte. Das war ihre spezielle Landmarke. Eine Ansammlung von Roma-Wohnwagen stand auf einem Flecken Gemeindeland. Offene Feuer flackerten, darüber hingen Kessel und Töpfe. Pferde bewegten sich und Hunde streiften durch die kleine Gemeinschaft, Frauen hängten Wäsche auf die Leinen und das kreischende Lachen der spielenden Kinder übertönte den Motorenlärm des Busses und gelangte an Chloes Ohr. Jeden Sommer winkte Chloe ihnen fasziniert zu. Sie wurde gar nicht wahrgenommen. Aber von diesem Punkt an versprachen die gewundenen Straßen und hohen Hecken nur noch eins: Tenby.
Als das Lager hinter ihnen verschwand, setzten die Kinder wieder zu ihrem Gesang an: »Oneby, Twoby …«
Chloe hörte zu und fühlte sich überlegen, bis die Begeisterung sie übermannte. »Eightby, Nineby, TENBY!«, brüllte sie. Sie waren fast dort!
Nachdem die Straße zu einer letzten Biegung nach rechts ausgeholt hatte und man kurz das türkisfarbene Meer aufblitzen sah, ging es endlich abwärts, vorbei an der grauen Eisenbahnbrücke. Dann zockelte der Bus mühsam zu den Five Arches hoch, wo die zauberhafte Fahrt ein Ende fand. Aber da hüpfte Chloe schon vor Ungeduld auf ihrem Sitz.
»Zappelsuse«, brummelte eine alte Frau, die neben ihr saß, und bedachte sie mit einem finsteren Blick.
Und dort, neben dem Zaun, stand Tante Susan wie ein Farbfoto aus einem ihrer Modemagazine. Chloe winkte aufgeregt und traf dabei den Hut des Herrn vor ihr, sodass dieser ihm über die Augen rutschte.
»Oh, tut mir leid! Mae’n ddrwg gen i«, stieß sie hervor, ohne auf die missbilligenden Laute der alten Dame zu achten. Als sie sich aus ihrem Sitz schob, warf sie einen besorgten Blick auf den Schorf auf ihren Knien – sie war letzte Woche beim Himmel-und-Hölle-Spiel hingefallen. Dabei wollte sie für Tenby immer elegant sein, aber Schorf auf den Knien war nicht gerade das angesagteste Sommeraccessoire.
Sie drängelte sich aus dem Bus, hinaus an die salzige Seeluft, die so rein wie Glockenklang war. Möwen kreischten, ein warmes Lüftchen wehte und Chloe war wieder einmal verzaubert.
»Ich bin hier«, schrie sie, ließ den Koffer fallen und öffnete weit die Arme.
Tante Susan lächelte und kam vorsichtig auf ihren hochhackigen Schuhen auf sie zu. Sie trug ein hellblaues Kleid mit rundem Kragen und eng sitzendem Bleistiftrock, dessen schmaler weißer Gürtel die schlanke Taille ihrer femininen Figur betonte. In Nant-Aur würde keine Frau ihre Formen derart zur Schau stellen. Das Schönste jedoch waren die Schuhe und der dazu passende kleine Hut, der auf ihrem perfekt gewellten braunen Haar thronte. Beide waren weiß mit dunkelrosa Streublümchen. Sofort war Chloes Sehnsucht geweckt, auch solche Schuhe zu haben. (Sie trug ihre braunen Schultreter, die zwar nicht hübsch, aber von ihrem Vater auf Hochglanz poliert worden waren.)
»Chloe, Liebes, herzlich willkommen«, sagte Tante Susan und bückte sich, um ihrer Nichte einen Kuss auf den Scheitel zu hauchen. »Was für ein hübscher Rock.«
In eine Parfümwolke gehüllt, musste Chloe erst mal Luft holen, bevor sie antworten konnte. »Danke! Der ist neu. Neu für mich, meine ich, nicht neu gekauft. Du hast fantastische Schuhe! Ich würde alles geben für solche Schuhe.«
»Wenn du älter bist, werden Absätze bei dir Wunder bewirken. Du brauchst die Höhe. Aber du bist so ein hübsches Mädchen. Und wie geht es deiner Mutter?«
»Mam geht es sehr gut, danke, Tante Susan, und sie lässt liebe Grüße an dich und Onkel Heinrich ausrichten.«
»Oh, er heißt jetzt Harry, du erinnerst dich doch, meine Liebe? Und wie geht es Branwen?«
Chloe zögerte. Das war kniffelig, denn Branwen weigerte sich, anzuerkennen, dass die Feindseligkeiten mit Susan beigelegt waren. Der Krieg war vorbei, aber Branwen hegte und pflegte ihren Groll. »Hm, es geht ihr gut. Sie ist … wie sie ist«, schloss sie und bediente sich dabei einer Phrase, die oft von den Nachbarn gebraucht wurde. Dazu nickte sie weise, wie sie das die Erwachsenen hatte tun sehen. »Und wie geht es Megan und Richard?«
»Megan ist ganz junge Dame. Die wird schnell erwachsen. Sie ist mit ihren Freundinnen ausgegangen, aber du wirst sie zum Tee sehen. Richard ist mit Lernen beschäftigt. Buchhaltung, weißt du. Er hofft, in einem der Hotels Arbeit zu finden.«
Chloe verzog das Gesicht bei dem Gedanken, den Sommer in Tenby mit Buchhaltung zuzubringen. Und sie fand es gemein von Megan, nicht auf sie gewartet zu haben, sie musste doch gewusst haben, wie gern Chloe mitgekommen wäre. Megans Freundinnen waren lustig und spritzig wie Brause.
Als sie aufbrachen, reckte Chloe ihren Hals, weil sie sich am Anblick der Five Arches nicht sattsehen konnte. Dieser Rest der alten Stadtmauer hob sich burgartig und massig vor dem hellen Blau des Himmels ab, aus den Mauerfugen quollen rosa Blüten. Jedes Mal hatte sie das Gefühl, in einem Märchenbuch gelandet zu sein: Prinzessin Chloe von Goldstrom … Offenbar war sie dem noch immer nicht entwachsen.
Das Meer konnte man von hier nicht sehen, aber sie konnte es riechen und auch hören in den Schreien der Möwen, die auf silberweißen Schwingen wie Propellerflügel vorbeisegelten. Ihre kreischend vorgetragenen Geschichten von Plünderungen und aufregenden Abenteuern auf den Wellen amüsierten sie – Llew nannte sie Piraten der Lüfte.
Sie kamen am Bowlingfeld vorbei und liefen durch Wohnstraßen, bis sie Kite Hill Nummer zwölf erreichten. Es war ein hübsches mittelgroßes Haus mit einer Spitzbogenveranda, umrandet von filigranem Holz.
Mochte Megan sie auch vergessen haben, Llew erwartete sie. Er saß auf der Türschwelle. Also würde es heute Nachmittag doch Abenteuer geben!
Chloe hatte Llew während ihres ersten Ferienaufenthalts bei Tante Susan kennengelernt – weshalb Llew und Tenby für sie immer untrennbar verbunden waren. Eines Abends war sie ganz wörtlich über ihn gestolpert. Sie hatte die Teenager von Tenby beim Sommerball ausspioniert, Megan war natürlich dort, zusammen mit Alma und Evie und Christine. Chloe hoffte, von ihnen hineingeschmuggelt zu werden, aber sie hatten es nicht angeboten.
Gerade mal drei Jahre zu jung dafür – frustriert hatte sie gegen die Mauer des Fountains Café getreten. Megan und ihre Freundinnen hatten nur noch von diesem Ball gesprochen, bis Chloe das Gefühl hatte, dass das Leben für jeden, der nicht daran teilnehmen durfte, absolut sinnlos und trist war. Sie hatte die Ankunft der Jungs mit ihren glatt nach hinten gekämmten Haaren und der Mädchen in ihren neuen Kleidern mit den weiten Röcken beobachtet, in sämtlichen Regenbogenfarben waren sie über den Weg von der Esplanade herbeigeströmt. Als alle drinnen und nur noch Chloe draußen war, trottete sie davon und steuerte die Dünen an, begleitet von den Klängen Nat King Coles und der Andrews Sisters. Und dabei stolperte sie über etwas, das sie für einen Ast hielt, sich aber als ausgestreckter Knöchel entpuppte. Und landete mit dem Gesicht voran der Länge nach im Sand.
»Pass auf!«, murmelte eine verträumte Stimme.
»Du hast mir ein Bein gestellt!«,, entrüstete sie sich, setzte sich auf und spuckte Sand.
Wie sich herausstellte, gehörte der Knöchel zu einem sehr schmalen Jungen, der auf dem Bauch lag und etwas in Händen hielt, was sie anfangs für ein Fernglas hielt.
»Ach, jetzt ist sie weg«, sagte er. »Egal. Ist mit dir alles in Ordnung?« Er setzte sich auf, drehte sich um und sah sie an. »Oh, du bist hübsch«, ergänzte er. »Hast du was dagegen, wenn ich ein Foto von dir mache?«
Da erkannte Chloe, dass es eine Kamera und kein Fernglas war, womit er auf sie zeigte.
»Aber doch nicht so!«, sagte sie verärgert und fing an, sich den Sand aus dem Gesicht zu wischen und ihre Haare zu ordnen.
»Nein, nicht! Ich will dich genau so – das wird ein großartiges Foto, vertrau mir!« Und schon klickte der Auslöser.