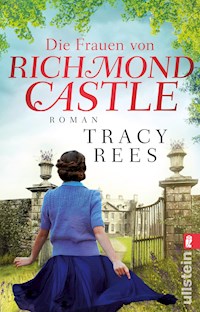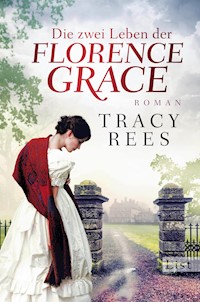
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der emotionsgeladene neue Roman der Bestsellerautorin von "Amy Snow" Die Waise Florrie Buckley wächst wild und glücklich bei ihrer Großmutter in den weiten Mooren von Cornwall auf. Kurz vor dem Tod offenbart die alte Frau das Geheimnis ihrer wahren Herkunft: Florrie ist Teil der reichen Grace-Familie. Mit dem Umzug zu ihrer unbekannten Familie nach London, verändert sich ihr ganzes Leben. Fortan ist sie für alle nur noch Florence Grace. Doch in der großen Stadt bei der fremden Familie fühlt sie sich nicht willkommen. Als ihr vermeintlicher Cousin Turlington auf der Bildfläche erscheint, findet sie in ihm endlich einen Freund. Über die Jahre entwickeln sich zwischen den beiden leidenschaftliche Gefühle. Aber der charismatische Turlington hat dunkle Geheimnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Kurz vor dem Tod ihrer geliebten Großmutter erfährt Florrie, wer sie wirklich ist. Sie gehört einer reichen, berüchtigten Londoner Familie an. Fortan lebt Florrie bei den Graces. In der großen Stadt wird aus dem wilden Mädchen die junge Florence Grace. Der elegante Lebensstil beeindruckt sie, doch zuhause fühlt sie sich hier nicht. Nur ihr Cousin Turlington scheint sich ernsthaft für sie zu interessieren. Aber Turlington ist nicht der, der er zu sein scheint. Was ist sein Geheimnis?
Die Autorin
Tracy Rees studierte in Cambridge und hat acht Jahre in einem Sachbuchverlag gearbeitet. Ihr Roman »Die Reise der Amy Snow« feierte sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland große Verkaufserfolge und gewann den 1. Platz des Lovelybooks Leserpreis 2016 in der Kategorie historische Romane. Tracy Rees lebt in South Wales, England.
TRACY REES
Die zwei Leben der
FLORENCE GRACE
Roman
Aus dem Englischenvon Elfriede Peschel
List
Die englische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Florence Grace bei Quercus Publishing, London.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-1507-2
© 2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotiv: gettyimages / © Justin Paget; gettyimages / © Niall Benvie; Arcangel / © Malgorzata Maj
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für meine wunderbaren Eltern, wie immer mit all meiner Liebe, und für all die Alten Rillas und Laceys, die mir mein Leben verzaubert haben
KAPITEL EINS
Dieses verdammte Pony war wieder durchgegangen. Mit Sicherheit gab es in West Wivel Hundred kein Geschöpf, das hinterhältiger und widerspenstiger war. Wir hatten uns gerade mal eine halbe Stunde im Moor befunden, da blitzte vor uns eine Taube auf – ein dummes, erschrockenes Geschöpf vor einem anderen. Das Pony stürzte und verschwand unter mir, so dass ich der Länge nach im Schlamm landete. Von dort sah ich dann zu, wie sein haariges weißes Hinterteil in der Ferne verschwand.
»Feigling!«, schrie ich. »Das war doch nur eine Taube!«
Vom Meer her war plötzlich Nebel aufgestiegen. Auf Bergspitzen und in Senken, auf Pfad und Fels, gesundem Boden und dampfendem, stinkendem Sumpf lag derselbe milchige Schleier, in dem alles verschwamm. Man musste schon sehr unerschrocken oder töricht sein, um da noch weiterzugehen. Ich hielt mich selbst für keins von beidem, aber ich konnte es mir nicht erlauben, Zeit im Nebel zu vergeuden. Der konnte gleich wieder weg sein oder sich tagelang einnisten, und ich war ohnehin schon zu spät dran. Einen ganzen Tag, um ehrlich zu sein.
Ich hätte nicht mal mehr sagen können, warum ich die Nacht in Truro verbracht hatte. In letzter Zeit schien das Leben sich in eine tyrannische Abfolge irrationaler Impulse verwandelt zu haben, denen zu folgen ich genötigt war – und einer sich daraus ergebenden Reihe anstrengender Fragen, auf die ich keine Antworten hatte. War es das, was das Frausein ausmachte? Wenn ja, dann wollte ich doch darum bitten, diese Ehre für mich noch ein paar Jahre hinauszuzögern.
Ich hatte keinen Zweifel daran, dass ich den Weg nach Hause finden würde – die Moorlandschaft war meine Heimat auf eine Weise, die keiner verstehen konnte –, der Nebel jedoch war ein verdammtes Ärgernis, klamm und kalt und kriechend. Stephen würde sicherlich sagen, er hätte mich ja gewarnt. Abscheuliches Pony. Sollte es doch an einem Felsen abrutschen und sich den Hals brechen oder in einen Sumpf stolpern und im dicken schwarzen Schlamm ertrinken, diese flatterhafte Kreatur.
Wütend trottete ich dahin, dreizehn Jahre alt und sehr wohl wissend, dass ich im Unrecht war. Mir wäre es völlig gleichgültig gewesen, wie lange der Nebel mich hier draußen im Schlamm und bei den Moorgeistern festhielt, hätte ich nicht gewusst, dass Nan in Sorge war. Der gestrige Abend war der erste, den wir getrennt voneinander verbracht hatten, seit Da gestorben war.
Tags zuvor war ich mit Stephen und Hesta nach Truro gegangen, weil sich dort eine aufregende Gelegenheit bot – jedenfalls schien es uns so, jung und unerfahren, wie wir waren. Diese Gelegenheit hatte sich über eine denkbar unwahrscheinliche Quelle ergeben: meine alte Schulfeindin Trudy Penny.
Ausgerechnet sie hatte mir eine Nachricht geschickt! Ich glaube nicht, dass irgendein Bewohner unseres kleinen Weilers jemals zuvor einen Brief bekommen hatte. Er war auf weißem Papier verfasst und steckte in einem Umschlag mit wächsernem Siegel. Folgendes war zu lesen:
Florrie,
am kommenden fünften September feiern mein Onkel und meine Tante Mr und Mrs Beresford aus Truro ein Fest anlässlich der Verlobung ihres Sohnes. Aufgrund einiger Veränderungen im Haushalt sind sie knapp an Personal – ein schlechter Zeitpunkt, meint meine Tante, die beinahe den Verstand darüber verliert. Helfende Hände werden gebraucht, und da dachte ich mir, dass Du und Deine Freunde sich vielleicht ein wenig Geld verdienen möchten. Sie bezahlen jedem von Euch Sixpence für den Tag. Ihr würdet die Haushälterin in ihrem Haus in der Lemon Street unterstützen. Solltest Du Interesse daran haben, lass es mich bitte bis Ende der Woche wissen, dann werde ich ihnen sagen, dass Ihr kommt.
Mit freundlichen Grüßen
Trudy
Ich wusste auf Anhieb, dass ich hingehen würde. Und das war keine meiner »Vorahnungen« – keine besondere Intuition hatte mich darauf vorbereitet –, es war einfach nur mein unbedingter Wunsch. Bis allerdings die Realität mit mir gleichzog, dauerte es etwas. Hesta und Stephen waren ihrem Gemüt nach nämlich alles andere als abenteuerlustig und bedurften großer Überredungskunst: Ich ließ mehrmals das Wort »Sixpence« fallen. Und Nan zu überzeugen, die außer mir nichts mehr auf der Welt hatte, erwies sich als noch schwieriger. Wieder sagte ich »Sixpence«. Geduldig argumentierte ich jede Sorge und jeden Zweifel weg, aber es genügt festzustellen, dass ich sie alle meinem Willen beugte. Wenn Starrköpfigkeit in einer Familie weitervererbt wird, dann wurde ich doppelt bedacht.
Ich ging davon aus, dass es sich dabei um ein vereinzeltes Abenteuer handelte. Hätte ich gewusst, was dieses edle Fest in Truro erahnen ließ, wäre ich womöglich ferngeblieben. Aber geändert hätte das letztendlich auch nichts.
Und so machten Hesta und ich uns auf dem Pony von Stephens Vater auf den Weg nach Truro, Stephen lief neben uns her. Ich hatte bereits ein paar Städte gesehen – ich war in Lostwithiel und Fowey gewesen –, aber mit solcher Eleganz und einem solchen Reichtum hatte ich nicht gerechnet. So etwas wie der Lemon Street in Truro war ich bisher noch nie begegnet. Sie war gepflastert und breit und es gab keinen Schmutz. Pferde und Karren und sogar Kutschen rumpelten auf und ab. Vornehme Leute spazierten entlang, lächelten einander zu und sagten »Guten Tag«. Es war ein angenehmer sonniger Spätsommernachmittag, als hätte sich sogar das Wetter in anmutiger Absicht angepasst.
Die Häuser waren aus grauem Stein und standen so dicht nebeneinander, als klebten sie zusammen. Kein Sturm würde sie wegwehen können. Ihre Bewohner müssten sich niemals besorgt fragen, ob das Dach bei heftigem Regen dichthielt. Wir verharrten zu dritt mitten auf der Straße und glotzten, bis uns eine Kutsche beinahe umgefahren hätte. Stephen zog uns auf das Trottoir, etwas, das wir vorher noch nie gesehen hatten, und wir fanden uns vor einem prächtigen Haus wieder. Es zu betreten kam uns unglaublich wagemutig vor.
»Ist Trudy Penny sich da auch ganz sicher?«, wollte Hesta wissen. »Spielt sie dir nicht etwa einen bösen Streich? Vielleicht wirft man uns ja gleich wieder raus und wir sind heute Abend wieder daheim in Braggenstones.«
»Also wir können nicht den ganzen Tag hier stehen bleiben«, sagte ich, löste meine Arme aus denen meiner Freunde, stieg die Stufen hinauf und griff nach dem Löwenkopftürklopfer. Natürlich hätten wir zum Hintereingang gehen sollen, aber was wussten wir schon – wir hatten keine Erfahrung mit Häusern, die so groß waren, dass sie zwei Eingänge benötigten.
Man führte uns in die Küche und sagte uns, was zu tun war. Alle waren recht freundlich, und ich glaube, die Haushälterin war derart aufgeregt, dass sie in uns nicht so sehr schmutzige, unerfahrene Kinder vom Land, sondern eher rettende Engel sah.
Die folgenden Stunden jagte ein Befehl den anderen, und es blieb nichts anderes übrig, als darauf zu reagieren. Wäre dies mein Leben und ich Bedienstete in einem solchen Haus gewesen, hätte ich es wohl nicht ertragen, diesen endlosen Anweisungen nachzukommen. Aber als Ausnahme, weil alles so neu und lebendig und anders war, flitzte ich mit strahlenden Augen und endloser Energie hin und her und verdiente mir damit mehr als nur ein paar Worte des Lobs. Von Zeit zu Zeit erhaschte ich einen Blick auf Hesta. Ihr prächtiges weißblondes Haar war im Nacken zusammengebunden und der Ausdruck ihres winzigen Gesichts war resigniert und elend. Aber sie bekam schließlich auch zu Hause genügend Befehle. Stephen sah ich nur einmal kurz und er machte einen verwirrten Eindruck.
Aber ich war glücklich. Es war eine neue Herausforderung, und ich kam damit gut zurecht. Ich half und bewirkte etwas. Ich war davon ausgegangen, dass ich mich einsam fühlen oder Heimweh haben würde, weil ich so weit weg von allem war, das ich kannte, aber es gefiel mir, eine neue Florrie zu sein, eine Florrie, die Neues anpacken und aufblühen konnte. Und als die Haushälterin ihren Kopf durch die Tür steckte, um zu verkünden, dass die Gäste eintrudelten, ging ein erregtes Murmeln durch die Bediensteten.
Plötzlich tauchten alle ihre Hände in einen Wassereimer, um sich die geröteten Wangen abzukühlen und die vom Schweiß feuchten Haarsträhnen unter Kappen und Tücher zu schieben. Schürzen wurden abgelegt und Röcke glattgestrichen. Dann durften sich immer zwei bis drei gleichzeitig in »die Nische« schleichen, einen versteckten Platz, von wo aus man zusehen konnte, wie die vornehmen Leute zum Ball eintrafen.
»Komm, Florrie, jetzt sind wir dran«, sagte nach einer Weile eins der Küchenmädchen.
»Ich?« Ich war ganz aus dem Häuschen. Ich war davon ausgegangen, dass eine solche Gefälligkeit nur den regulären Bediensteten des Hauses zuteilwurde. Ich folgte Vera durch einen Korridor und dann über eine kleine Treppenflucht zu einer Seitentüre des großen Esszimmers. Dieses verfügte über eine Art Vorraum, vom Zimmer durch einen schweren, dicken Vorhang aus pflaumenfarbenem Samt abgetrennt, worin auf einem ausladenden Tisch eine zusätzliche Schüssel mit Punsch, Kristallgläser, Porzellanteller und anderes bereitstand, was für die Gäste rasch würde ausgetauscht werden müssen. Wir quetschten uns in dieses Versteck und steckten unsere Nasen durch den Vorhang, hinter dem eine Welt aus Farbe und Licht lag.
Wie gebannt beobachtete ich die sich verneigenden Herren, die funkelnden Damen. Meine Augen weideten sich an Kleidern in Rosa, Pfirsich und Elfenbein. So etwas hatte ich noch nie gesehen, selbst die hübschen pastellfarbenen Kleider meiner Lehrerin waren im Vergleich dazu schlicht. Wie gern hätte ich sie angefasst und ihren schimmernden Glanz in mich aufgenommen. Und das Geschmeide! Für das, was ich da sah, hatte ich keine Namen. Dunkelgrün, blutrot und klar wie das Sonnenlicht auf Tautropfen – es sah aus, als käme es aus einer anderen Welt, keiner mir bekannten Welt.
Und diese Leute zu beobachten! Das verzauberte mich noch weitaus mehr als das andere Spektakel. Ich entdeckte die hinter der glatten Maske der Höflichkeit verborgene Verachtung, das boshafte Funkeln in den Augen der sittsamen jungen Damen, die Überheblichkeit der Herren mit ihren Schnurrbärten – ich hätte die ganze Nacht zusehen können. Als die Kapelle loslegte, war ich im siebten Himmel. Wie man hier knickste und von einem Partner zum nächsten wirbelte, war nichts im Vergleich zu den Tänzen auf dem Land, die ich ein paar Mal in Boconnoc besucht hatte, wo rotgesichtige Menschen schwerfällig herumstampften.
Und die Musik! Ich traute meinen Ohren kaum. In meinem bisherigen Leben war Musik für mich das Gefiedel von Rod Plover gewesen oder manchmal auch die fröhlichen Stimmen meiner Nachbarn, wenn sie im Chor Volkslieder anstimmten. Aber in meinem Kopf hatte ich manchmal etwas gehört, das ich nicht beschreiben konnte – ein klimperndes An- und Abschwellen von Tönen, ganze Musikpassagen, die sich tanzend bewegten wie der Wind … Ich hatte diese Erfahrung Hesta öfter als einmal zu beschreiben versucht, aber sie hatte immer nur verwundert ihr kleines Gesicht verzogen.
»Was kann das sein, Hesta?«
»Das ist nur wieder eine Spinnerei von dir. Du bist seltsam, Florrie Buckley, so gern ich dich auch mag.«
Aber ich wusste, dass es wichtig war, genauso wie ich viele andere Dinge wusste, die ich nicht erklären und auch nicht beweisen konnte. Und in jener Nacht, eingezwängt in der Nische neben der Punschschüssel, hörte ich »meine« Musik zum ersten Mal im wirklichen Leben.
»Was ist das?«, fragte ich Vera und zupfte an ihrem Ärmel und deutete.
»Nun, das ist ein Piano, Kind«, sagte sie.
»Pi-ah-no«, hauchte ich erstaunt, als hätte sie »Elysium« oder »Olymp« gesagt.
Vera schien etwas in meinem Gesicht gelesen zu haben, denn sie tätschelte meinen Arm und sagte: »Bleib noch ein wenig.« Gleich darauf wurde sie durch ein anderes Mädchen abgelöst, das sich neben mich zwängte und mir beim Zusehen heftig ins Ohr atmete.
Ich versuchte, mir das, was ich sah, für immer einzuprägen, da ich mir nicht vorstellen konnte, es jemals wiederzusehen. Während meine Blicke über die Menge wanderten, fielen sie auf einen jungen Mann und ich spürte dabei ein leichtes Ziehen im Herzen, wieder ein Moment unheimlichen Wiedererkennens …
Als Erstes bemerkte ich sein freundliches Lächeln. Ja, er sah gut aus, seine Locken erinnerten an gelben Ginster, seine klaren braunen Augen an die Teiche im Moor und sein hübsches Gesicht war noch das eines Knaben, das aber schon den Mann in sich trug. Das zog mich an, denn ich selbst fühlte mich damals auch so dazwischen, doch das sonnige Lächeln auf seinem Gesicht legte nahe, dass er weitaus würdevoller damit umzugehen verstand als ich. Sein geduldiger Ausdruck, die Art und Weise, wie er jeden ansah, als würde ihn wirklich interessieren, was sie zu sagen hatten, beeindruckte mich in einem Raum voller Masken und Formalitäten. Während ich ihn beobachtete, stellten zahlreiche stolze Mamas und Papas ihm ihre jungen Töchter vor. Schließlich nahm er eine an der Hand und führte sie auf die Tanzfläche.
Ich unterdrückte ein Kichern. Ein derart ungelenkes Mädchen hatte ich noch nie gesehen! Und mein Held, der sich zwar einigermaßen graziös bewegte, war als Partner nicht geschickt genug, um das ausgleichen zu können. Gemeinsam stolperten sie sich mutig durch einen langsamen Walzer, rempelten verkniffen dreinblickende Paare an und brachten sie ins Straucheln. Auf der Tanzfläche waren sie eine Gefahrenquelle. Als der Walzer zu Ende war und zu einer flotten Polka aufgespielt wurde, hätten sie sich eigentlich zurückziehen müssen, aber mit dem Selbstvertrauen eines Paars junger Kälber preschten sie ausgelassen hüpfend und springend los. Ich hielt mir kurz die Augen zu, nahm meine Hand aber rechtzeitig herunter, um zu sehen, wie sie das Gleichgewicht verloren. Und es geschah das Unvermeidliche: Die junge Lady stolperte über ihre Röcke und stürzte zu Boden, stieß gegen drei Stühle, auf denen weitere besonnene junge Damen hockten – und brachte auch diese zu Fall.
Ich wollte schon in lautes Gelächter ausbrechen, als meine Gefährtin in der Nische ihr zu Hilfe eilte. Ich erinnerte mich daran, dass ich schließlich zum Arbeiten hier war, und jagte ihr hinterher. Der Vater des Mädchens war sofort an ihrer Seite und warf, während er seiner Tochter auf die Beine half, dem jungen Mann einen wütenden Blick zu.
»Komm her, hilf mir«, forderte er das andere Dienstmädchen auf. »Nimm sie am Arm. So, Fanny, stütz dich auf uns. Wir bringen dich an einen ruhigen Ort.«
Das kleine Grüppchen humpelte davon und ließ mich ohne Aufgabe in diesem funkelnden Raum voller Menschen zurück, die mir so gar nicht ähnlich waren. Einer jedoch fiel mir auf, der genau das tat, wonach es mich verlangt hatte, und sich vor Lachen kugelte. Auch er war ein junger Mann, der in der hintersten Ecke des Raums saß. Es schüttelte ihn vor boshafter Schadenfreude. Ich grinste, wandte mich dann aber ab.
»Ist mit Ihnen alles in Ordnung, Sir?«, fragte ich den goldenen jungen Mann, da es sonst keiner getan hatte. Alle schienen ihn für diese Katastrophe verantwortlich zu machen.
»Also wirklich, junger Sanderson!«, murmelte mehr als einer der korpulenten Gentlemen, und zahlreiche Damen tadelten: »Sie müssen besser achtgeben, Sanderson!« Das war nicht gerecht.
Er sah mich überrascht an, aber bevor er antworten konnte, brachte eine furchteinflößende Frau mit dunklen Haaren ihn weg. Seine Mutter? Ich konnte keine Ähnlichkeit feststellen, aber sie verhielt sich ihm gegenüber höchst besitzergreifend. Da ich von niemandem wahrgenommen wurde, nutzte ich die Gelegenheit, schlüpfte zurück hinter den Vorhang und widmete mich wieder meiner Abendunterhaltung.
Ein oder zwei Tänze später überlegte ich gerade, in die Küche zurückzukehren, erspähte dann jedoch den glücklosen Sanderson, der allein in der Nähe meines Alkovens stand. Einer verrückten Eingebung folgend, zog ich den Vorhang beiseite und machte zischend auf mich aufmerksam. Erstaunt wandte er sich mir zu, und ich gab ihm winkend zu verstehen, dass er zu mir kommen solle. Nachdem er sich rasch umgeblickt hatte, huschte er hinter den Vorhang und ich ließ ihn wieder fallen, so dass er uns verbarg.
»Hallo.« Ich grinste ihn an, höchst zufrieden mit meiner Eroberung. Als ich sechs Jahre alt war, hatte Stephen in einem Hühnerstall um meine Hand angehalten. Das hier war besser.
»Hallo«, sagte er schrecklich höflich. Er war älter, als ich ihn aus der Ferne eingeschätzt hatte, fast erwachsen. Wäre mir das bewusst gewesen, hätte ich ihn niemals ansprechen dürfen.
»Ich hab gesehen, wie Ihre junge Lady hingefallen ist«, bemerkte ich. Vielleicht nicht besonders taktvoll von mir.
Er wurde rot wie ein Bauernjunge. »Sie ist nicht meine junge Lady, sie ist eine Freundin der Familie. Ich fürchte, ich bin nicht der Geschickteste im Polka-Tanzen.«
»Papperlapapp. Das war sie. Sie war fürchterlich. Sie haben das gut gemacht, sonst hätte sie sich ja gar nicht so lange auf den Beinen gehalten. Warum schieben alle Ihnen das in die Schuhe? Warum sogar Sie selbst?«
»Weil es sich so gehört. Als Gentleman gibt man nicht zu, dass Damen, äh, etwaige Mängel haben.«
»Tatsächlich?« Das verblüffte mich. »Das ist doch dumm, oder? Natürlich haben junge Damen Mängel. Sie sind Menschen wie alle anderen auch. Ich habe Mängel. Haufenweise sogar.«
Er sah mich gleichermaßen amüsiert und verdutzt an. »Oh, ich bin mir sicher, dass du keine hast.«
»O doch, die hab ich! Haufenweise!« Ich schwieg, als mir klarwurde, dass dies wohl keine besonders eindrucksvolle Vorstellung war. »Aber es gibt auch haufenweise Dinge, die ich gut kann.«
»Dessen bin ich mir sicher. Welche wären das?«
»Etwa Lesen. Ich kann sehr gut lesen. Und ich kann schreiben. Und ich kann aus Wildpflanzen Arzneien herstellen und Rezepte und Zaubertränke.« Die letzte Behauptung stimmte nicht ganz, aber ich wollte diesen freundlichen, gut riechenden jungen Mann beeindrucken.
»Zaubertränke! Du liebe Güte. Wie klug.« Er wirkte ein wenig nervös, lächelte aber wieder auf seine gutmütige Art.
»Möchten Sie vielleicht ein wenig Punsch, Sir?«, bedrängte ich ihn, weil ich alles in meiner Macht Stehende tun wollte, um ihn vom Gehen abzuhalten. Ich deutete auf die Bowlenschüssel auf dem Tisch und schöpfte ihm ein Glas voll, bevor er mir antworten konnte.
»Danke.« Er nahm es und linste durch den Vorhang. »Donnerwetter, das ist wirklich ein ganz brillantes Versteck.«
»Das ist es. Doch ich sollte wieder an die Arbeit. Man hat mir erlaubt, von hier aus zuzusehen, aber sicherlich nicht so lange.«
»Du arbeitest für die Beresfords?«
»O nein, Sir, ich bin aus Braggenstones.«
»Bragg…?«
»Das werden Sie nicht kennen. Es liegt im Nirgendwo. Ich helf hier nur für den einen Abend aus. Aber so was habe ich noch nie gesehen.«
»Und gefällt es dir?«
»Sehr, Sir. Leben Sie in Truro?«
»Ich lebe in London. Ich bin mit meiner Tante und meinem Bruder hier und vertrete die Familie.«
»Welcher ist Ihr Bruder, Sir?«
Sein Lächeln wurde breiter und er winkte mich an seine Seite, damit ich zusammen mit ihm nach draußen spähen konnte. Ich konnte die Wärme seines erlesen gekleideten Körpers neben meinem spüren und genoss das Gefühl der Kameradschaft mit jemandem, der meinem Verständnis nach zwei Fuß hoch über der Erde wandeln müsste.
»Dort drüben, bei der Punschschüssel.«
Es war der boshaft lachende junge Mann, den ich vorhin erspäht hatte.
»Der sieht Ihnen gar nicht ähnlich!«, rief ich aus. Es stimmte. Der Bruder war ein seltsamer Vogel. Er hatte weder die aufrechte Haltung noch den gleichmütigen Ausdruck der anderen Herren, sondern saß mit finsterer Miene zusammengesunken da wie ein Troll. Die Leute machten einen weiten Bogen um ihn. Glattes seidiges Haar, so dunkel, wie das seines Bruders hell war, fiel ihm halb ins Gesicht, und seine Haut war bleich.
»Jünger oder älter als Sie?«, fragte ich und vermutete jünger.
»Zwei Jahre älter. Er ist der Erbe und ich bin die Versicherung«, sagte er lachend.
Ich verstand ihn nicht. »Ich hab noch keinen so unglücklichen Jungen gesehen«, bemerkte ich.
»Oh, Turlington ist nicht unglücklich. Er ist verärgert. Normalerweise tut er, worauf er Lust hat, und er wollte nicht hierherkommen. Mein Großvater hat ihn erpresst, deshalb schmollt er.«
Ich betrachtete ihn mit erneutem Interesse. Auch mir gefiel es zu tun, worauf ich Lust hatte. »Ich mag Ihren Namen. Er passt zu Ihnen.«
»Warum sagen Sie das?«
»Sanderson. Sand. Sie sind so golden wie Sand.«
Er errötete ein wenig. »Schön. Danke. Du bist die Erste, die das je gesagt hat. Normalerweise fragen alle: Warum haben du und dein Bruder so außergewöhnliche Namen?«
»Und, warum denn? Entschuldigen Sie, ich muss das einfach fragen, nachdem Sie es gesagt haben.«
»Es hat damit zu tun, dass meine Familie so unglaublich stolz ist, dass für eine Ehe nur Frauen aus anderen guten Familien in Frage kommen. Und um auch den Namen dieser Familien zu bewahren, geben sie uns Jungs deren Nachnamen als Taufnamen.«
Offenbar hatte ich ihn verwundert angeblickt, denn er führte dies weiter aus.
»Der Name meiner Mutter war Isabella Sanderson. Ich war ihr erstgeborener Sohn, also wurde ich Sanderson getauft. Turlingtons Mutter hieß Belle Turlington. Auf diese Weise brüstet meine Familie sich mit ihren ausgezeichneten Verbindungen.«
»Das ist aber komisch. Und warum haben Sie und Turlington nicht dieselbe Mutter, wenn Sie doch Brüder sind?«
»Eine gute Frage. Die Graces sind eine komplizierte Familie. Weißt du –«
Aber ich erfuhr es nicht, denn in diesem Moment rauschte seine wütende Tante vorbei. »Haben Sie Sanderson gesehen?«, fragte sie den Herrn, der neben ihr stand. »Wo ist der Junge nur hin? Bei seiner Tolpatschigkeit und Turlingtons haarsträubenden Manieren weiß ich nicht, was aus den Graces werden soll.«
Er schnitt eine Grimasse. »Ich gehe lieber. Ich darf nicht hier drin entdeckt werden. Aber dürfte ich dich noch um deinen Namen bitten?«
Ich hätte auch nicht gewollt, von dieser Hexe entdeckt zu werden. Ich knickste. »Florrie Buckley, Abkürzung für Florence, Sir.«
»Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen, Miss Florence.«
Es gefiel mir, Florence genannt zu werden. Das hörte sich nach einem völlig anderen Mädchen an als Florrie Buckley aus Braggenstones.
»Ich danke dir, das war eine willkommene Abwechslung«, sagte Sanderson und verschwand zurück in die Welt, aus der er gekommen war.
Als ich in die Küche zurückkam, herrschte dort große Aufregung, deren Mittelpunkt Hesta war. Sie war gestürzt und mit dem Kopf auf dem Steinboden aufgeschlagen, war blutüberströmt und ohnmächtig. Man hatte sich um sie gekümmert, doch der Arzt hatte befunden, sie könne nicht weiterarbeiten. Man hatte Mr Beresford hinzugezogen. Er stand, die Hände auf seinen Knien, gebückt vor Hesta, die schlaff in einem Stuhl am Feuer hing. Er bot an, uns drei in seiner Privatkutsche nach Hause zu schicken oder uns über Nacht zu beherbergen.
»Hesta! Geht es dir gut?«, rief ich und eilte an ihre Seite. Ihr süßes Gesicht war bleich und ihre blauen Augen wirkten diffus.
»Ich werd schon wieder, Florrie.« Tapfer ergriff sie meine Hand. »Ich fühle mich nur ein wenig seltsam und würde gern zu Hause in meinem eigenen Bett schlafen.«
»Natürlich, meine Liebe, natürlich«, beruhigte ich sie, obwohl mein Herz schwer wurde. »Das ist sehr nett von Ihnen, Sir, danke«, ergänzte ich an Mr Beresford gewandt.
»Das ist doch selbstverständlich, Kind. Ich mache mir Vorwürfe, dass es zu so einem Unfall kam, nachdem ihr den langen Weg auf euch genommen habt, um uns zu helfen.« Ich fand ihn überaus freundlich und wunderte mich, wie er mit der schrecklichen Trudy Penny verwandt sein konnte. »Ihr wart zu dritt, wenn ich das richtig verstanden habe? Ein junger Mann?«
»Jawohl, Sir, Stephen Trevian.«
Mr Beresford nickte. »Bitte holen Sie sofort Stephen Trevian, Mrs Chambers. Ich schicke diese drei Kinder zurück ins Moorland. Wallace, fahren Sie die Kutsche vor. Und nun, meine jungen Damen, muss ich mich wieder meinen Gästen widmen, aber ich wünsche euch eine gute Reise. Und für dich rasche Erholung, mein armes Kind.« Er verschwand und ich hielt Hestas Hand und murmelte tröstliche Worte, bis Stephen besorgt eintraf.
»Ich habe selbst genug Probleme«, murmelte Mrs Chambers. »Der Abend ist noch lang und ich bräuchte eure Hilfe. Aber ihr müsst wohl alle gehen, nehme ich an?«
»Ja«, erwiderte Stephen sofort. »Wir haben versprochen, zusammenzubleiben. Wir können Hesta nicht allein in der Kutsche zurückfahren lassen, außerdem geht es ihr nicht gut.« Er stellte sich beschützend über Hesta, so stocksteif und ernst und selbstgewiss, dass Mrs Chambers resignierte.
Aber ich hatte einen Hoffnungsschimmer erspäht. Hesta sah bereits ein wenig rosiger aus. Und Stephen war so treu und zuverlässig, wie man sich einen Freund nur wünschen konnte …
»Ich würde bleiben, Ma’am«, tastete ich mich vor, »nur dass ich nachts nicht allein übers Moor zurück nach Hause gehen kann. Meine Großmutter würde mir das Fell über die Ohren ziehen, so viel steht fest.«
Meine Hoffnung spiegelte sich in ihrem Gesicht. »Wenn du dazu bereit wärst, Kind, könntest du über Nacht bleiben. Du könntest dir ein Zimmer mit Sarah teilen, da gibt es ein freies Bett. Und du könntest am Morgen beim Aufräumen helfen, und ich zahle dir noch mal Sixpence zu den bereits versprochenen dazu. Du bist eine gute Arbeiterin und flink dazu.«
»Nein, Florrie!«, widersprach Stephen sofort. »Was würde Nan sagen? Sie würde mir die Hölle heißmachen, wenn ich dich hier allein zurücklasse. Wir müssen gemeinsam los.«
»Aber, Stephen, wie soll dann das Pony wieder nach Hause kommen?«
»Es kann neben der Kutsche herlaufen, denke ich.«
»Niemals würde es mit Mr Beresfords edlen Pferden mithalten. Nein, ich werde bleiben und hier aushelfen und weitere Sixpence für Nan verdienen. Ich bin ja nicht allein«, ich zeigte mit meiner Hand in die volle Küche, »und ich hab eine sichere Bleibe. Am Morgen, wenn ich alles nach Mrs Chambers’ Wünschen erledigt hab, werd ich zurückreiten.«
»O Kind«, sagte sie sehnsüchtig. »Wenn das möglich wäre!«
»Sie kann nicht«, sagte Stephen.
»Ich will aber«, sagte ich.
»Florrie, nein«, sagte nun auch Hesta. Sie tutete immer ins gleiche Horn wie Stephen. »Das hier ist nicht daheim. Du weißt nicht, was passieren wird. Ohne uns kannst du nicht hierbleiben. Nan wäre außer sich! Fahr in der Kutsche mit uns mit.«
Ein Junge steckte seinen Kopf durch die Tür. »Die Kutsche ist bereit«, rief er.
»Nein«, entschied ich. »Wir haben gesagt, dass wir das machen, und ich möchte es zu Ende führen. Du kannst nicht helfen, Hesta, du bist verletzt und zu Hause besser aufgehoben. Und du, Stephen, musst natürlich mit ihr mitkommen, sie braucht jemanden. Aber mir geht es gut und mir gefällt es hier und ich möchte die Sixpence verdienen. Ich werd morgen vor dem Mittagessen wieder in Braggenstones sein, keine Sorge. Und jetzt los mit euch beiden. Alles Gute, Hesta, meine Liebe.«
Ich umarmte sie, als sie wankend aufstand. Stephens Blick zeigte mir, dass er damit nicht einverstanden war. Es lag in seiner Natur, sich um Leute zu kümmern, und indem wir uns aufteilten, brachte ich ihn in eine sehr unangenehme Lage – er konnte nicht für uns beide sorgen. Aber Mrs Chambers drängte mich zur Eile und teilte mich zum Geschirrspülen ein. Ich warf einen Blick über meine Schulter und sah, wie meine Freunde sich langsam entfernten, Hesta auf Stephen gestützt, der sie mit seinem Arm an der Schulter festhielt. Dann wandte ich mich der schmutzigen Abwaschlauge zu.
Insgeheim hoffte ich, das seltsame Brüderpaar wiederzusehen, aber am Ende verlief der Abend ruhig. Ich spülte das Geschirr ab, ich schälte Gemüse. Ich rannte hin und her und legte dabei bestimmt tausend Meilen zurück, schleppte Tabletts und stapelweise Geschirr und ganze Wäschetürme für die Übernachtungsgäste. Um drei Uhr morgens ließ ich mich in das freie Bett in Sarahs winziger Dachkammer fallen, so müde, dass ich nicht einschlafen konnte.
»Ich hab heute Abend diese dunkelhaarige Mrs Grace gesehen. Sie sieht furchterregend aus«, sagte ich in der Hoffnung auf ein Gespräch.
»Oho, aber erst ihr Neffe mit den goldenen Locken!«, murmelte Sarah sofort. »Was für ein gutaussehender Gentleman. Aber ich sag dir, trotz seines hübschen Gesichts würde ich nicht mit ihm gehen. Er ist ein Grace, weißt du, und das bedeutet Ärger. Na ja, er mag ja nett sein, aber der Rest von ihnen? Nur Ärger.«
»Wirklich? Wieso das?«, hakte ich nach, gähnend, als würde ich nicht darauf brennen, mehr zu erfahren. Aber Sarah schlief bereits, flach auf dem Rücken, und sagte kein einziges Wort mehr.
Ich lag auf dieser fremden Matratze, jeder Muskel tat mir weh und in meinem Kopf drehte sich alles. Mein Körper bitzelte wie Apfelmost. Noch nie hatte ich mich derart wach gefühlt, wie ein zum Sprung bereites Tier, und zugleich so müde, müde, müde …
Um halb sechs Uhr morgens stand Sarah auf, genau eine Minute bevor eine laute Glocke durch den Dachboden dröhnte. Sie hatte ihr Kleid schon fast angezogen, bevor es mir gelang, mich aufzusetzen, geschweige denn, irgendwelche Fragen zu stellen. Umziehen brauchte ich mich nicht, denn ich hatte in meinem Kleid geschlafen, aber ich musste mich waschen und kämmen, bevor ich mich meinen vorübergehenden Dienstherren präsentierte.
Ich kam meinen Pflichten nach – wenn auch nur halb so flink wie am Abend zuvor. Für die Gäste wurde bereits ein üppiges Frühstück zubereitet, obwohl sich zu so früher Stunde noch keiner von ihnen zeigte.
Als alles fertig war und es eine Pause gab, bevor die Gäste herunterkamen, hatte Mrs Chambers Mitleid mit mir. »Du hast gut gearbeitet, vor allem wenn man bedenkt, dass du das noch nie gemacht hast«, lobte sie. »Wir schaffen das jetzt. Geh nach Hause, Kind, du siehst zum Umfallen müde aus und hast noch einen weiten Weg vor dir.«
Und ich war inzwischen auch bereit aufzubrechen. Ich bedankte mich bei ihr – und bedankte mich noch mal, als sie mir keinen Shilling, sondern einen Florin in die Hand drückte. Ich konnte es kaum erwarten, Nan diesen zu überreichen. Damit könnte ich ihrem Genörgel wegen der in Truro verbrachten Nacht sicherlich ein Ende bereiten.
Ein Diener führte mich in den Stall.
Ich zäumte gerade das Pony von Stephens Vater auf, als ich im Stroh etwas rascheln hörte, das viel größer sein musste als eine Maus. Ich fuhr herum und sah einen jungen Mann, der sich mit Stroh im Haar aufsetzte und verwirrt umsah.
Ich zuckte zusammen, erholte mich aber rasch wieder. »Guten Morgen«, sagte ich spitz, während ich den Sattelgurt glattstrich.
Er runzelte die Stirn und kratzte sich am Kopf. »Guten Morgen. Ist das … Bin ich hier im Stall?«
Ich schnaubte und richtete meinen Blick betont auf die Boxen voller Stroh, die Pferde und die dampfenden Pferdeäpfel. »Was soll’s denn sonst sein?«
Er verdrehte die Augen. »Ich meine, was mache ich hier?«
Ich zuckte die Achseln und griff nach den Zügeln. »Woher soll ich das wissen?«
»Zu viel Champagner«, stöhnte er, kam auf die Beine und nahm seine Umgebung in sich auf. Da erkannte ich ihn. Turlington Grace. Bruder des entzückenden Sanderson.
»Ich kenn Sie!«, rief ich. »Ich weiß jedenfalls, wer Sie sind. Ich bin gestern Abend Ihrem Bruder Sanderson begegnet. Ich bin Florrie Buckley. Florence.«
Er sah mich aus schmalen Augenschlitzen an. »Ah! Du bist die, von der er mir erzählt hat. Ich wünschte, ich wäre gestern Abend von einem hübschen Mädchen entführt worden. Aber mein größtes Abenteuer bestand darin, zu viel zu trinken. Und am Ende hier zu landen.«
»Hört sich für mich nicht gerade nach Abenteuer an. Und sind Sie nicht noch zu jung, um zu trinken? Sie sehen nicht viel älter aus als ich.«
»Wie alt bist du denn?«
»Dreizehn.«
Mit Gewittermiene meinte er: »Ich bin fast zwanzig! Jeder hält mich für jünger, aber das bin ich nicht. Ich bin ein erwachsener Mann, um Himmels willen.«
»Wenn Sie das sagen. Also, ich muss jetzt los. Grüßen Sie Ihren hübschen Bruder von mir.«
»Wohin gehst du?«
»Nach Hause.«
»Und wo ist zu Hause? Truro?«
»Nein. Ich wohne in Braggenstones. Ein winziger Ort auf der anderen Seite des Moors. Ist ein langer Weg von hier.«
»Und du wirst ganz allein dorthin reiten?«
»’türlich. Das mach ich immer«, log ich.
»Hast du denn gar keine Angst? Ich hörte, dass die Moore voller rastloser Geister und abscheulicher Sümpfe sind.«
»Ja, das sind sie auch, aber machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich bin kein Stadtmädchen.«
Er kam zu mir und starrte mich an. »Das sehe ich«, sagte er und ich spürte, dass es als Kompliment gedacht war. Ich konnte den Alkohol riechen, den er ausdünstete.
Turlington Grace hatte braune Augen, dunkler als die seines Bruders, so dunkel wie Torf aus dem Moor, fruchtbar und gefährlich. Ich konnte tausend widerstreitende Gedanken darin sehen. Ich fragte mich, wie sein Leben aussah, was er für eine Geschichte hatte, und war mir plötzlich der Nähe seines Körpers nur allzu bewusst. Selbst als ich dichtgedrängt neben seinem Bruder in der Nische gestanden hatte, fühlte sich das nicht so an. Gestern Abend hatte Turlington derart eingefallen und gekrümmt ausgesehen, dass es mich nun überraschte, feststellen zu müssen, dass er größer war als ich, viel größer, und dabei nannte mich in Braggenstones jeder eine junge Birke. Er war schlaksig, wo sein Bruder kompakt war. Plötzlich tat er mir leid, aber ich wusste nicht, warum. Der Augenblick zog sich in die Länge und zwischen uns lag bedeutungsschweres Schweigen.
Traurig. Bemitleidenswert. Braucht einen Freund. Diese Worte kamen mir ungebeten in den Sinn.
»Turlington Grace«, murmelte ich, weil ich wenigstens irgendetwas sagen wollte.
»Grace«, bestätigte er bitter, was ich seltsam fand. Aber dann machte er etwas noch viel Seltsameres. Er neigte seinen Kopf und lehnte seine Stirn an meine, so dass wir mindestens eine Minute lang Stirn an Stirn standen. Schließlich stupste uns das Pony ungeduldig mit dem Kopf an und wir strauchelten. Ich kippte gegen ihn und er fing mich in seinen Armen auf, erwies sich als kräftiger, als er aussah. Plötzlich wünschte ich mir, ich würde kein Kleid tragen, in dem ich gearbeitet und geschlafen hatte. Er brachte mich ganz sanft wieder zurück in die Vertikale, wofür ich ihm dankbar war, denn meine Beine versagten mir in diesem Moment ihren Dienst. Seine Nasenflügel waren ein wenig geweitet, wie mir auffiel, und seine Augen recht reizvoll. Er hatte noch immer Stroh in seinen dunklen Haaren, und ich griff nach oben und zupfte es heraus.
»Ich geh jetzt lieber«, sagte ich und wünschte mir, er würde mich zurückhalten, aber er wich sofort zurück. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, ergänzte ich, denn er wirkte verloren und einsam. Das war eine merkwürdige Wahrnehmung für ein dreizehnjähriges Mädchen angesichts eines erwachsenen Mannes. Aber schließlich war meine Seele hundert Jahre alt, wie man mir sagte.
Er nickte. »Mir geht es gut. Danke, junge Hexe aus dem Moor. Und wird es dir denn auch gut gehen, da draußen bei den Geistern und Ghulen? Kann ich dir meine Hilfe anbieten? Ich oder mein Bruder?«
Ich stellte mir die beiden vor, wie sie mich in ihren feinen Anzügen, jeder mit einem Champagnerglas in der Hand, übers Moor begleiteten, und musste kichern. »Nein, besten Dank, Turlington. Und hören Sie auf, so viel zu trinken. Es kann nicht gut sein für Sie, wenn Sie nicht mehr wissen, warum Sie in einem Stall aufwachen.«
Ich führte das Pony ins Freie, sprang auf und ritt unter Hufgeklapper die Lemon Street entlang. Bald schon hatte ich mich verirrt – ich fand meinen Weg viel besser, wenn Bäume und Sterne und Flüsse und nicht Straßen und Häuser und Menschenmengen mir zur Orientierung dienten. Außerdem war ich abgelenkt durch meine Begegnungen mit zwei so unterschiedlichen wunderbaren jungen Männern. Schon komisch, dass Sanderson auch damals schon Sir für mich war – ein junger Gentleman –, Turlington jedoch war immer Turlington.
Kaum war ich eine halbe Stunde im Moor, flog die Taube auf, das Pony ging durch, und da war ich nun. Lief zu Fuß durch den Nebel nach Hause. Es war ein hundsgemeiner Nebel, ich konnte kaum meine Hand sehen. Aber ich war mein ganzes Leben lang durch dieses Moor gewandert. Es war mein Zufluchtsort bei jeder Drangsal oder Tragödie gewesen. Ich fühlte mich ihm auf eine Weise verbunden, die ich weder Nan noch sonst jemandem, den ich kannte, befriedigend erklären konnte. Nur die Alte Rilla – unsere weise Frau und Heilerin aus dem Dorf – verstand es. Sie sagte, das Moor sei das Zuhause meiner Seele: der Ort, an dem ich mich nie verloren fühlen würde. Wenn ich nichts sehen konnte, vertraute ich einfach meinen anderen Sinnen – ich konnte das Stampfen und Quatschen meiner Stiefel spüren, die Büschel oder die Glätte auf meinem Weg, und ich wusste, auf welcher Art von Boden ich mich befand. Ich konnte das Plätschern der Wasserläufe hören und wusste, in welche Richtung sie flossen. Konnte die Bäume auf den Hängen riechen und von den Hügelkuppen aus das Meer. Meine Sinne waren unfehlbare Führer, zusammen mit den Geistern, von denen Turlington gesprochen hatte.
Es war allgemein bekannt, dass Sumpfgeister sich an diesem einsamen Ort wohl fühlten. Man hielt sie für Unzufriedene, die ihren Spaß daran hatten, Menschen anzulocken, zu quälen und ihnen sonstigen Schaden zuzufügen. Und es stimmte auch, dass immer wieder Leute im Moor umkamen. Die Leute aus Lostwithiel und Boconnoc schworen, es sei ein teuflischer Ort. Selbst die Bewohner von Bodmin mieden es, und die kannten sich aus mit trostloser Moorlandschaft.
Aber für mich waren diese Geister immer nur Freunde. Ich spürte sie um mich und es käme mir niemals in den Sinn, sie zu fürchten, genauso wenig wie ich meine Nachbarn in Braggenstones fürchtete. Sie gehörten zum Moor und irgendwie gehörte auch ich zum Moor, und das verband uns.
Während meiner Wanderung an diesem Tag dachte ich lange und intensiv über die beiden Grace-Jungen nach. Es fühlte sich alles so bedeutsam an – nach Truro zu gehen, einen guten Eindruck bei der Haushälterin zu machen, die beiden merkwürdigen Brüder zu treffen. Ich war mir sicher, dass es nicht das Ende der Geschichte wäre, auch wenn mir mein gesunder Menschenverstand das Gegenteil sagte. Denn was erwartete ich? Dass der himmlische Sanderson sich an den ausgefallenen Dorfnamen erinnerte, den er nur einmal vernommen hatte, und auf einem weißen Pferd übers Moor galoppiert käme, um Ansprüche auf mich zu erheben? Das war natürlich unmöglich, aber in meiner Phantasie suchte ich verzweifelt nach Wegen, es möglich werden zu lassen. Vielleicht käme ja auch der rebellische Turlington im Sturmgebraus herbeigeeilt und packte mich an der Hand und warf mich ins Heidekraut? Obwohl ich angesichts solch lustvoller Überlegungen errötete, wusste ich doch, dass auch dies nicht eintreffen würde.
Für mich stand fest, dass ich mich in mindestens einen von ihnen verliebt hatte, sie aber mit Sicherheit nie wiedersehen würde, weshalb mein Leben ärmer und grauer wurde. Es war eine Qual. Am liebsten wäre ich auf direktem Weg zur Alten Rilla gegangen und hätte ihr alles erzählt, denn sie konnte mir immer helfen, etwas zu verstehen, half mir stets, die größeren Zusammenhänge zu erkennen. Aber ich wusste, dass ich heute keinesfalls zu ihr gehen konnte. Je näher ich meinem Zuhause kam, desto stärker wurde mein Gefühl, dass Nan in Sorge war, also nahm ich schließlich doch die Beine in die Hand und beeilte mich.
War diese Fähigkeit, so genau zu spüren, was andere empfanden, ein Segen oder ein Fluch? Ich war mir diesbezüglich nie sicher. Aus der Ferne gelang es mir nicht immer, und manchmal erreichte es mich auch nur in kleinen, kaum zu begreifenden Blitzen. Aber an diesem Tag spürte ich alles, was Nan während der vergangenen Nacht durchgemacht hatte, nachdem Stephen und Hesta ohne mich nach Braggenstones zurückgekehrt waren und sie Stephen eine Ohrfeige dafür gab, dass er mich zurückgelassen hatte.
Ich wusste, dass das dumme Pony inzwischen nach Braggenstones hineingetrabt war, mit schleifendem Zügel, die Beine vom weißen Schlamm so dick wie Tonsäulen. Ich wusste, dass Nan noch in diesem Moment den Gedanken zu verdrängen suchte, ich könnte gestürzt sein und mir an einem Stein den Kopf aufgeschlagen haben. Ich wusste, dass ihr leicht ums Herz werden würde, wenn sie mich am Horizont auftauchen sah. Also durfte ich nicht säumen, nicht einmal, um die Alte Rilla zu besuchen. Nein, ich durfte Nan nicht länger mit ihrer Angst allein lassen.
Endlich erklomm ich den letzten Kamm oberhalb von Braggenstones. Inzwischen war es später Nachmittag. Die Sonne brach strahlend und dreist hervor und machte sich lustig über meine Reise, lustig über das weite Moor, das hinter mir lag und noch im Nebel waberte und wogte. Es war, als wären es zwei verschiedene Welten, und ich auf der Schwelle zwischen den beiden. Truro lag hinter mir und Braggenstones, vertraut und verlässlich und sicher, lag vor mir. Ich hielt kurz inne und schloss meine Augen, spürte die Sonne auf meinem Gesicht, während mir der feuchte Nebel noch kalt am Rücken klebte. Dann trat ich hinaus in den Sonnenschein.
KAPITEL ZWEI
Nan war wütend. Sie überschüttete mich mit so vielen Aufgaben, dass es zwei Tage dauerte, bis ich endlich die Alte Rilla aufsuchen konnte. Während ich schmollend meine Arbeit erledigte, ging ich immer wieder die Ereignisse jener Nacht in Truro durch und hinterfragte die seltsamen Gefühle, die sie in mir hervorgerufen hatten. Außerdem bedachte ich mein Leben vor dieser Nacht. Die beiden Welten waren so grundverschieden und es war unmöglich, sich eine Verbindung zwischen diesen beiden vorzustellen, doch meine Gefühle sagten mir, dass es sie gab.
Mein Leben begann in Nans kleinem Cottage in einer dunklen Nacht. Es gab ein Unwetter. Meine Mutter hatte unter dem Beistand von Donner und Blitz und heulendem Wind im Cottage in den Wehen gelegen – doch ohne Arzt. Die Tür wurde vom Sturm aufgerissen, hing wie ein taumelnder Trunkenbold nur noch an einer Angel und schlug und schlug gegen die Steinwand, als wolle sie auf sich aufmerksam machen. Der Tod naht, schien sie zu sagen. Macht euch bereit, macht euch bereit. Der Tod kommt.
Und tatsächlich starb meine Mutter in jener Nacht, aber sie hielt mich noch eine halbe Stunde in ihren Armen, stillte mich und gab mir meinen Namen, bevor sie verschied. Und so begriff ich schon vom ersten Tag an, dass Tod und Leben miteinander verbunden sind. Die wenigsten von uns tragen dieses Wissen so tief in sich.
Mein Vater war zum Arbeiten in St. Ives, denn es war Sardinensaison. In diesem Jahr war sie kurz, nur vier oder fünf Wochen, jedoch lange genug, dass er bei seiner Rückkehr seine Frau nicht mehr antraf und an ihrer Statt eine kleine Tochter vorfand. Nan war es, die um meine Mutter trauerte und sich in diesen ersten Stunden um mich kümmerte, nachdem das Unwetter sie mitgenommen hatte. Natürlich war es nicht wirklich das Unwetter, sondern ich war eine Steißgeburt und die Wehen zogen sich endlos in die Länge, aber ich bleibe hartnäckig dabei, es so zu sehen. Es war Mittsommer. Das Unwetter braute sich zusammen, als hätte ein Dämon es ausgeheckt, brauste dann übers Moor, zerstörte zwei Häuser und richtete Schaden an weiteren an, und jagte wieder davon und nahm meine Mutter mit sich. Ich stelle mir gern vor, dass ihr Geist, auf der Zacke eines Blitzes reitend, von dieser gewaltigen steifen Brise davongetragen wurde. Und ich sage mir, dass sie immer bei mir ist, wenn der Wind weht. Stephen meinte, das sei Blasphemie, aber warum sollte ich mir den Geist meiner Mutter nicht in Freiheit vorstellen? Mir gibt es keinen Trost, sie eingezwängt in einem Sarg zu sehen, eingegraben in der Erde.
In der üblichen Abfolge kleiner Wunder, die so alltäglich sind, dass wir leicht vergessen, sie als Wunder anzuerkennen, wuchs ich vom Baby zum Mädchen heran. Ich vergötterte meinen Vater. Als Baby streckte ich die Arme nach ihm aus, sobald ich seine Stimme hörte, wie Nan mir erzählte, und sobald ich herumtapsen konnte, lief ich ihm überallhin hinterher. Für mich war er ein Löwe mit seinen langen rotblonden Locken und dem Bart. Er hob mich auf seine Schultern, auf denen ich so königlich ritt wie eine indische Fürstin auf einem Elefanten. Leider sah ich ihn viel zu wenig und meine Erinnerungen an ihn sind spärlich, denn er verbrachte lange Stunden und Tage bei der Arbeit – harter Arbeit auf dem Land und in den Minen und manchmal auch auf See. Aber wenn wir zusammen waren, war die Welt ein einziger Gesang. Ihm war die Gabe zu tiefer Liebe eigen. So hatte er meine Mutter geliebt, so liebte er jetzt mich.
Wir lebten in einer geschlossenen Gemeinschaft, klein und abgeschieden, eine bäuerliche Gesellschaft in einem freundlichen Tal, einem weichen grünen Band in einer ansonsten unerbittlichen, dem Wetter ausgesetzten, gefährlichen, schlammigen Moorlandschaft. Elf Cottages reihten sich wie aufgerichtete Steine entlang des Talbodens. Es gab gepflegte kleine Gärten und wir nutzten diese winzige Insel aus sanftem Grün zu unserem Vorteil. Reich wurde hier keiner von uns, aber wir konnten wenigstens erzeugen, was wir zum Leben brauchten. Wir mussten nie hungern, nicht wirklich. Wir bauten Gemüse und Gerste an. Gelegentlich hatte die eine oder andere Familie eine Kuh, und das bedeutete dann Milch für uns alle. Und manchmal scharrten auch ein paar Hühner auf dem Hof. Wir verkauften unsere Ware auf dem Markt – Gemüse, Obst und sogar Blumen, die wir zu Sträußen banden, um die Städter zu erfreuen. In einem guten Jahr genossen wir es, so einfach und abgeschieden zu leben, unabhängig und frei. In einem schlechten Jahr knirschten wir mit den Zähnen und weinten bittere Tränen.
Hoch oben im Moor hielt Heron’s Watch Wache über uns – ein altes verlassenes Bauernhaus, das mich auf seltsame Weise anzog. Oft ging ich große Umwege, nur um auf seinem zugewachsenen Gelände zu verweilen und durch die Fenster in seine dunklen Räume zu spähen. Das war eine weitere seltsame Neigung von mir.
Nan konnte sich noch an die Zeit erinnern, als Heron’s Watch bewohnt gewesen war. Damals gingen Männer und Frauen aus Braggenstones dort hinauf, um für ein paar Münzen oder Lebensmittel, die es in unserem Weiler nicht gab, wie Käse oder Rindfleisch, Arbeiten zu verrichten. Es war ein lebensspendender Strom gewesen, der durch unser Dorf lief. Aber die Familie war ausgestorben und der Hof war an die Verwandtschaft in Falmouth gegangen, die sich jedoch nicht darum kümmerte. Das Land wurde Stück für Stück an einheimische Grundbesitzer verkauft, bis nur noch das Haus übrig war, das am Rande des Moors hockte und für all die Dinge stand, die die Leute vergaßen, und eine Lebensweise, die es so nicht mehr gab.
Als ich klein war, waren Da und Nan und ich beste Freunde. Nan war so klein und verhutzelt, wie er groß und raumgreifend war. Mochte sie ruhig verhutzelt sein – schließlich hatte sie bereits zwei Söhne verloren, einer war vom Baum gefallen, der andere im Meer ertrunken. Die Beschäftigungen, denen die armen Männer aus Cornwall nachgehen konnten, waren allesamt riskant, aber Geld musste verdient, Familien mussten versorgt werden. Nan pflegte zu sagen, dass es ihr jedes Mal das Herz brach, wenn sie meinen Da während der Sardinensaison zur Küste und während der meisten anderen Tage zu den Minen aufbrechen sah, aber es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihm zum Abschied zuzuwinken und ihn bei seiner Rückkehr willkommen zu heißen, als wüsste sie nichts von den Gefahren, denen er ausgesetzt war, als wäre das Leben etwas, das beherrschbar wäre.
Sie trug ihr eisengraues Haar zu einem Zopf geflochten, der ihr fast bis zur Taille reichte. Als Baby zupfte ich daran, als junges Mädchen kämmte ich sie, aber für das Flechten waren meine kleinen Hände zu ungeschickt. Gebannt sah ich zu, wenn Nan dies selbst machte.
Ich nannte sie Nan, weil sie meine Oma war. Aber alle anderen nannten sie ebenfalls Nan, denn so hieß sie. Mir gefiel diese doppelte Bedeutung. Und ich fand es schön, dass ich noch einen zusätzlichen Anspruch auf sie hatte.
Was meine Mutter betraf, so erzählte man mir, dass sie aus Launceston stammte und meinen Vater auf einem großen Tanzfest des West Wivel Hundred kennengelernt habe. Man berichtete mir von ihrer Anmut und dem schelmischen Funkeln in ihren Augen, als sie sich unter einem Sommermond im Kreis drehte. Wie hätte mein Vater diesem Zauber widerstehen können? Sie habe weiches dunkles Haar, dunkelbraune Augen und eine blasse Haut gehabt und ein verträumter Schimmer wie Morgennebel habe auf ihr gelegen. Sie habe wie eine Lerche gesungen und sei freundlich und gutherzig gewesen.
Ich war ein zielstrebiges Kind mit braunen Haaren, die sich aber nicht recht entscheiden konnten, denn es befanden sich auch dicke Strähnen in Honiggelb und glänzendem Kupfer darin. Nan pflegte zu sagen, ich hätte Cornwall-Haare. Ich hatte die dunklen Augen meiner Mutter und war zu groß gewachsen.
In Braggenstones hatte ich zwei enge Freunde: Hesta Pendarne und Stephen Trevian. Wie ich stammten sie aus Familien, die schon ein Jahrhundert lang in den Minen gearbeitet und noch viel länger das Land bestellt hatten. Stephen hatte Haare wie feuchtes Stroh. Er war stämmig und schielte ein wenig. Er war ernsthaft und manchmal ein wenig schwerfällig, und Hesta und ich hatten Spaß daran, ihn aufzuziehen. Hesta war halb so groß wie ich, eine kleine weißhaarige Fee mit blauen Augen und der Gabe, immer lachen zu können. Wir waren nicht die einzigen Kinder in unserem Weiler, aber wir drei waren etwa im gleichen Alter, mit nur acht Monaten Unterschied zwischen uns.
Wir waren sechs Jahre alt, als Stephen eines Tages zu mir kam und mich an der Hand in den Hühnerstall führte und sagte: »Ich will mit dir reden, Florrie.« Bis heute weiß ich nicht, was da in ihn gefahren war.
»Ich hab nachgedacht«, begann er kurzerhand. »Ich finde, wenn wir erwachsen sind, sollten wir heiraten. Was meinst du?«
Was konnte ein Mädchen zu so einer Werbung schon sagen? Ich verspürte nicht den Wunsch zu heiraten, aber die Menschen taten es offenbar. »Na gut«, sagte ich. »Danke, Stephen.«
»Fein. Mein Da sagt, ich soll den Ponystall ausmisten. Willst du mir helfen?« Und mit diesem romantischen Stelldichein zur Feier unserer Vereinigung kletterten wir aus dem Hühnerstall. Im Lichte meiner Begegnung mit den beiden jungen Männern in Truro kam mir diese Erinnerung wieder in den Sinn, und ich lächelte ein wenig verächtlich.
Ich hatte also zwei enge Freunde. Ich hatte einen Vater und eine Großmutter, die mich beide liebten. Ich hatte ein Dach über meinem Kopf, und das Dach leckte nur selten. Ich hatte fast jeden Tag frische Nahrung direkt aus der Erde, auf der die Regentropfen glitzerten. Seit jungen Jahren verfügte ich über die Freiheit, das Moorland zu erforschen, wo ich über die Geister gebot, die alle anderen fürchteten. Ich fand, mehr konnte sich ein Mädchen nicht wünschen.
Ich war also … etwas Besonderes. Das sagte meine Großmutter mir von Anfang an. Sie sagte es so oft, dass ich erst drei Jahre alt werden musste, um zu begreifen, dass mein Name Florence war – Florence Elizabeth Buckley – und nicht Nans Besonderes Mädchen. Aber vielleicht war ich das auch. Ich hatte kein Geld und stach durch nichts hervor, war keine Schönheit, auf deren Namen Männer Schiffe taufen würden (doch Stephen erklärte unsere Kindheit hindurch steif und fest, dass er mich heiraten würde, komme, was da wolle). Die Dinge, die mich besonders machten, waren die, die mir einfach so in den Schoß fielen.
Wie etwa, dass ich mich nie im Moor verirrte. Und manchmal von Dingen wusste, bevor sie sich ereigneten. Häufig konnte ich verstehen, was die Menschen dachten und fühlten, manchmal sogar, bevor es ihnen selbst klar war. Manchmal wusste ich auch Fakten wie: Du hasst deine Mutter oder Du bist viel gereist, bevor sie ihren Mund aufmachten. Einmal war es: Du liebst deine hübsche graue Katze. Und da fragte ich dann, wie es der grauen Katze ginge, bevor sie überhaupt erwähnt worden war, was zu einem misstrauischen Blick der fraglichen Dame und zu einem vorwurfsvoll verzogenen Gesicht von Nan führte. Ich lernte dann, das, was ich wusste, für mich zu behalten, weil es die Leute durcheinanderbrachte, aber nichtsdestotrotz wusste ich es.
Nan war sehr stolz auf mich, was ihr arg zusetzte, denn Stolz war eine Sünde. Aber sie nannte mich ihren größten Trost, ihren Leitstern und ihr Besonderes Mädchen, wenn wir allein waren und sie sich sicher war, dass kein anderer es hören konnte. Ich fragte mich, ob Sanderson oder Turlington mich für etwas Besonderes hielten.
Als ich sieben war, ein großes Mädchen mit wirren Haaren und Augen, die oft auf den Horizont gerichtet waren, teilte mein Vater mir mit, dass er es sehr begrüßen würde, wenn ich in Tremorney, einem kleinen, drei Meilen weit entfernten Dorf, am Unterricht teilnehmen würde. Er war ein armer Mann mit großen Träumen, und diese Träume streckten Fühler nach mir aus, die mich sanft umfingen. Er besaß nichts, aber er wollte, dass ich das Beste von allem bekam. Ich habe geistige Großzügigkeit immer mehr bewundert als jede andere.
Mein Unterricht folgte keinem Plan, sondern setzte sich querbeet aus allem zusammen, was die Interessen unserer Lehrerin berührte. Diese war eine junge Frau von gerade mal achtzehn Jahren. Sie hieß Lacey Spencer und kam aus Penzance. Die Verbindung zu Tremorney kam über eine Tante, bei der sie von frühester Kindheit an regelmäßig auf Besuch gewesen war. Als sie älter wurde und ihr das Ausmaß der Armut und Unwissenheit in unserer Gegend bewusst wurde, wollte sie hier eine Schule aufbauen. Wie sie einen solchen Plan in die Tat umsetzen sollte, wusste sie nicht recht, doch ihre Absichten waren gut. Und den Segen dazu bekam sie von ihren Eltern, einem freundlichen Paar aus dem Bürgerstand, das seine Tochter vergötterte und genug Geld hatte, um sie zu verwöhnen. Die Kosten waren gering, weil sie im Wohnzimmer ihrer Tante unterrichtete.
Lacey Spencer war schlank und hatte federnde braune Locken. Jeden Tag kleidete sie sich in einer anderen Farbe – Zitronengelb, Lila, Pfirsich, Türkis, Apfelgrün: Es war, als würde man einen Regenbogen ansehen. Als ich ihr das erste Mal begegnete, dachte ich: Tageslicht. Gelächter. Entschlossen. Jung, wie ich war, wusste ich nicht zu schätzen, was für ein bemerkenswertes Unterfangen diese Schule war, aber selbst mir war klar, dass Lacey Spencer wichtig für mich werden würde.
In dieser Schule war es auch, dass ich die bereits erwähnte Trudy Penny kennenlernte. Trudy mit ihren rosa Seidenbändern und Ballettschuhen und ihren in Truro lebenden Cousins. Trudy war zwei Jahre älter, ein Mädel aus Tremorney, deren Eltern es sich hätten leisten können, sie auf eine richtige Schule zu schicken, aber keinen Sinn darin sahen.
Sie war ein gemeines kleines Ding, diese Trudy, und ihre ständigen Quälereien verletzten meine Gefühle mehr, als ich mir je anmerken ließ. Sie behauptete, ich würde stinken wie ein Schwein. Da wir kein Schwein hatten – wir hätten uns gar keines leisten können –, bezweifelte ich, dass es stimmte, aber die übertrieben gerümpfte Nase, wann immer sie in meiner Nähe saß, führte dazu, dass ich mir um meine Reinlichkeit Sorgen machte. Mich sauber zu halten war schwer, da ich nur ein Kleid besaß, in dem ich wanderte, den Garten versorgte und ausritt (sofern Stephens Vater es mir erlaubte). Und obwohl ich Trudy nicht ausstehen konnte, betrachtete ich doch gern ihre Bänder und ihre saubere rosige Haut.
Und deshalb bemühte ich mich auch wochenlang, ihre Freundschaft zu gewinnen. In Tagträumen malte ich mir aus, dass sie über den Schmutz hinwegsah und erkannte, dass ich etwas Besonderes war, und mich zu sich nach Hause einlud und mir ihre Bücher und Spielsachen zeigte und mich bat, ihr meine verwunschenen Plätze im Moor zu zeigen. Ich brachte ihr Geschenke mit – ein paar Erdbeeren im Sommer, eine Habichtfeder, einen außergewöhnlichen Stein mit einem hübschen grünen Muster. Die Verachtung, mit der sie mich strafte, wenn ich ihr diese bescheidenen Dinge anbot, war grenzenlos.
»Was willst du denn damit?«, spottete sie und warf die Feder aus dem Fenster auf die Straße, wo sie zu Boden schwebte und unter den Hufen des Gastwirtspferdes zermalmt wurde. »Einen Stein?«, höhnte sie, hielt dabei ihren Kopf schief und ergänzte dann in vorgeblicher Heiterkeit: »Du hast mir einen … Stein gegeben. Wohl weil’s nicht genug Steine in Cornwall gibt und ich keinen fände, wenn du mir keinen mitbrächtest?«, und warf das Objekt ihrer Beleidigung nicht gerade freundlich zurück. Die Erdbeeren jedoch aß sie.
Miss Spencers »Schule« war eine merkwürdige Sache. Neun Kinder, meist arm und schmutzig, saßen zusammengepfercht im Wohnzimmer ihrer Tante, das zur Hauptstraße von Tremorney hinausging. Wir hockten auf riesigen, mit Rosshaar gepolsterten Sesseln mit steifen Rückenlehnen und lauschten Geschichten von Rittern und griechischen Göttern und lernten, was Miss Spencer von Geographie und Mathematik wusste. Der Unterricht fand montags, mittwochs und donnerstags mitten am Tag statt und dauerte fünf Stunden einschließlich einer Pause, in der es Hammelbrühe, Tee und Kuchen gab. Ich glaube, Letzteres sorgte dafür, dass die meisten fast immer zum Unterricht erschienen.
Die Hausaufgaben waren vollkommen freiwillig, was der Tatsache geschuldet war, dass die meisten Schüler noch einen weiten Heimweg hatten und arbeiten mussten, wenn sie nach Hause kamen, und darüber hinaus auch noch am nächsten Tag vor Sonnenaufgang. Ich weiß nicht, welchen Nutzen die anderen Kinder aus dieser Schule zogen – abgesehen von gutem frischen Fleisch dreimal in der Woche –, aber ich weiß, was es für mich bedeutete.
Noch bevor ich mit Lacey Spencers Sammelsurium an Lehrstoff in Berührung kam, hatte ich gewusst, dass es Welten außerhalb von Cornwall gab, jenseits vom Gemüseanbau und dem ewigen Flicken des immer selben Kleids, jenseits von allem, was ich je gekannt hatte. Ich konnte sie spüren, wenn ich unterwegs war, was oft geschah. (»Füße mit einem Eigenleben«, pflegte Nan verwundert und verzweifelt zu sagen.) Dann lehrte Miss Spencer mich lesen, und plötzlich befanden sich diese Welten zwischen meinen Händen, in Worten festgehalten. Am besten gefielen mir die griechischen Mythen: diese alten Geschichten vom Chaos und von der Schöpfung, von den Titanen und Zentauren, von Göttern und Sterblichen und den kapriziösen Lebensmustern. Ich lächelte über das ungeheuerliche Verhalten der Götter und ihre listenreichen Finten, mit denen sie sich gegenseitig austricksten. Mir war klar, dass es sie womöglich nicht gab, aber dennoch pries ich sie für alle Fälle, wann immer ich daran dachte.
Meine Gebete waren vergeblich. Eines Tages, als ich die Schule seit fast einem Jahr besuchte – ich war acht Jahre alt –, las ich der Klasse aus Erzählungen nach Shakespeare von Charles und Mary Lamb vor. Dies geschah stockend, denn obwohl ich eine schnelle Leserin war, wenn es nur das Buch und mich gab, übertrug diese Fähigkeit sich nicht automatisch auf das laute Vorlesen. Ich weiß noch genau, dass es Der Sturm war. Mich überkam dabei plötzlich eine Kälte, so nasskalt und erschütternd, dass ich das Buch fallen ließ. Charlie Mendow kicherte. Trudy Penny machte eine hochnäsige Bemerkung. Miss Spencer kam zu mir geeilt und erkundigte sich, ob ich unwohl war. Ich konnte nicht sprechen. Ich starrte aus dem Fenster, hinaus auf die Straße und die normale Welt, und wusste mit völliger Gewissheit, dass der Tod wieder über uns gekommen war, um jemanden zu holen, den ich liebte. Ich sah den Geist meines Vaters vor mir aufblitzen, so rot und hell und grell wie sein Bart, völlig frei und frohlockend. Ich entzog Miss Spencer meine Hand und rannte nach Hause, jagte durch Tremorney wie ein Dieb auf der Flucht. Auf dem ganzen Weg hielt ich nur einmal an, obwohl mein stoßweise gehender Atem wie eine rostige Türangel quietschte.
Als ich Braggenstones erreichte, sah ich den Minenverwalter vor unserem Cottage und wusste, dass es stimmte.