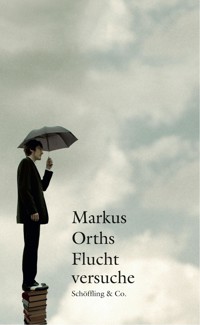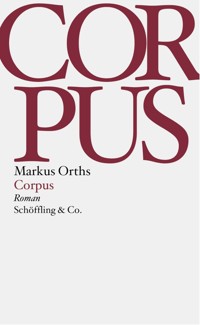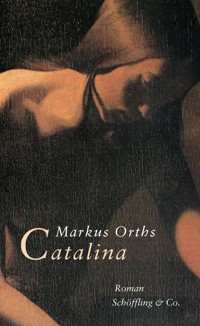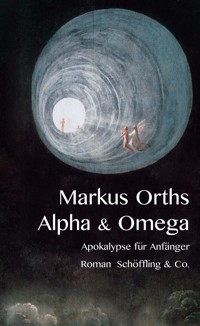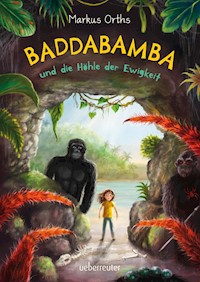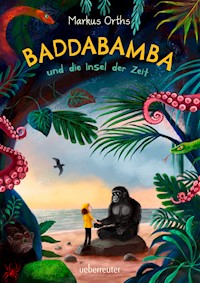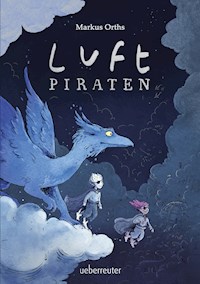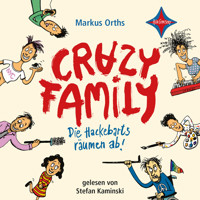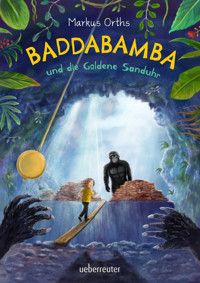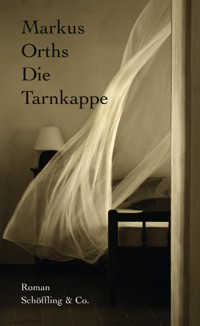
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unsichtbar sein. Sehen können, ohne selber gesehen zu werden. Dinge tun, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen: Jeder hat sich das schon einmal gewünscht. Simon Bloch, Mitte vierzig, erhält eine solche Chance. Seinen Lebenstraum - Filmkomponist zu werden - hat er längst beerdigt und sich eingenistet in alltäglicher Routine. Da gelangt er vollkommen unerwartet in den Besitz einer seltsamen Kappe. Als er sie aufsetzt, verschwindet er vor seinen eigenen Augen und spürt »ein Knistern, etwas, was tief in ihm geschah und zugleich auf der Oberfläche, ganz so, als kehre sich alles Verborgene nach außen und alles Äußere nach innen«. Blochs Leben gerät aus den Fugen. Zunächst versetzen ihn die neuen Möglichkeiten in einen Rausch. Doch bald werden seine Fragen dringlicher: Wer hat ihm die Tarnkappe zugespielt? Wie funktioniert sie überhaupt? Und: Was macht sie mit ihm? Um das herauszufinden, muss Simon Bloch Dinge tun, die er niemals für möglich gehalten hätte. Markus Orths verleiht einem faszinierenden literarischen Motiv seinen eigenen mitreißenden Sound. Ein Schwindel erregender, wilder Trip ins Nichts: hinein in das, was wir nicht sehen können - oder nicht sehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Titel
Markus Orths
Die Tarnkappe
Roman
Schöffling & Co.
Der Tod probiert schon mal deine Kleider an.Max Sessner›Ich weiß durchaus nicht, was ich tue! Ich weiß durchaus nicht, was ich tun soll!‹– Du hast recht, aber zweifle nicht daran: du wirst getan!Friedrich Nietzsche
Die Tarnkappe
1
Und dann das: Gerade erst hatte er sich hingesetzt und die Beine aufs Höckerchen geschoben, die Platte aufgelegt und den Kopfhörer in die Hand genommen, bereit, das Leben und den Alltag zu vergessen und vor allem diese seltsame Begegnung am Morgen, und dann das: die Klingel, kurz, einmal, zweimal, die Klingel, dreimal. Simon setzte den Kopfhörer auf: Sacco und Vanzetti, seit längerem mal wieder, die Vertonung des Freiheitsstatuengedichts, das große Morricone-Lied. Aber Simon bekam das Klingeln nicht aus dem Kopf, dieses Klingeln, jetzt, an seinem freien Samstagnachmittag, den er seit jeher für die Filmmusik reserviert hatte. Kurz versuchte er sich einzureden, dass es ein Nachbar sein könnte, mit einer simplen Frage nach Zucker oder Zwiebeln, doch als Joan Baez von den Müden, Armen und Heimatlosen sang, wusste Simon, dass er sich etwas vormachte, er wusste, dass er nur aus einem einzigen Grund die Sacco-und-Vanzetti-Platte hervorgekramt hatte, die Begegnung am Morgen, an der Straßenbahnhaltestelle: dieser bettelnde Mann mit Kopftuch und Strohhut. Und wenn das tatsächlich Gregor gewesen war? Und wenn Gregor ihn, Simon, erkannt hatte? Und wenn der Ausruf des Manns, sein letztes Ha!, ein Zeichen für dieses Erkennen gewesen war? Dann könnte Gregor an der Haltestelle auf Simons Rückkehr gewartet haben, um ihm heimlich zu folgen und herauszufinden, wo er wohnte, ja, dann würde Gregor jetzt draußen stehen und klingeln.
Simon setzte sich aufrecht hin und ließ den Kopf kreisen, um eine Verspannung zu lösen. Aber auch in der Pause zum nächsten Stück, noch unterm Kopfhörer, drang es schwach an seine Ohren, das Klingeln. Simon saß dort und wartete auf das Ende der Platte, auf ihr letztes Leiern, auf das Summen, mit dem der Nadelarm zurückschwebt. Here’s to you Nicola and Bart / Rest forever here in our hearts / The last and final moment is yours / That agony is your triumph. Simon konnte den Reigen nicht genießen, die endlose Wiederholung dieser Zeilen, das Insistierende der Musik, die sich nicht entwickelte, sondern in fortwährendem Kreisen um sich selbst den Moment zementierte, in dem Sacco und Vanzetti feststeckten, das Warten auf die Hinrichtung, er konnte den Reigen nicht genießen, weil er wusste, dass die Musik doch noch enden würde, enden musste, so, wie Saccos und Vanzettis Leben enden würde, enden musste. Der elektrische Stuhl. Wie man sich fühlt, wenn man zu ihm hingeführt wird, in Erwartung dessen, was unausweichlich geschieht? Wenn man weiß, dass der Tod kurz bevorsteht, ein paar Minuten, eine Minute, wenige Sekunden, jetzt, sofort, hier? Wenn ich sehenden Auges zum Abgrund geführt werde in der Gewissheit, es stößt mich einer hinab? Die Allgegenwart des Todes, die überall lauernde Möglichkeit des Endes, ist nur aus einem einzigen Grund zu ertragen: weil man nicht weiß, wann es soweit ist. Simon lüpfte den Kopfhörer. Es klingelte jetzt ohne Pause, ein Sturmklingeln, das nicht eher enden würde, ahnte Simon, bis er die Tür öffnete. Doch er wehrte sich dagegen, trat ans Fenster und schaute nach unten. An der Haustür: niemand. Also musste Gregor vor der Wohnung stehen, hier oben, der Kerl klopfte nicht, er trommelte nicht gegen die Tür, er beschränkte sich aufs Endlosklingeln. Wenn ich ihn reinlasse, dachte Simon, kommen wir auf die verdammte Vergangenheit zu sprechen, und das will ich nicht. Simon verfluchte den Altbau, in dem er wohnte, weil es in der Tür keinen Spion gab, durch den er hätte spähen können, um zu sehen, wer wirklich dort stand, aber wer, dachte Simon, sollte das sein, wenn nicht Gregor? Es gibt keine andere Möglichkeit. Wer sonst besäße die Frechheit, ein solches Endlosklingeln zu zelebrieren? Keine Unterbrechung, kein Absetzen, keine Pause. Der wird nicht aufhören, dachte Simon und wusste, dass er dem Kampf nicht gewachsen war, sein Widerstand bröckelte, er hatte keine Lust, sich zu verschanzen und die Ohren zu verstopfen oder sich mit Kopfhörer in die Badewanne zu legen. Am Ende, ganz am Ende von allem würde er nicht darum herumkommen, Gregor zu öffnen. Also könnte er es auch sofort tun. Zwanzig Minuten klingelt der jetzt schon, dachte Simon in der Küche, ein Glas kalte Cola in der Hand, ich will endlich, dass es aufhört. Mit einem Ruck stürzte er das Glas hinunter und aus der Küche in den Flur, und ohne weitere Überlegung riss er die Tür auf.
Draußen stand niemand. Kein Gregor, kein anderer Mensch, alles leer. Die Klingel? Runtergedrückt von unsichtbarer Hand. Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Simon kniff die Augen zusammen und stöhnte auf: In der Ritze des Klingelknopfs steckte ein winziger, abgebrochener Streichholzsplitter, der die Klingel gedrückt hielt. Und Simon sah die feixenden Nachbarsjungen förmlich vor sich, die ihm diesen Streich gespielt hatten. Trotzdem musste er lächeln. Immerhin kein Gregor. Simon versuchte, den Streichholzsplitter aus der Ritze zu ziehen, es gelang ihm nicht, der Splitter war viel zu kurz, außerdem zitterten seine Finger noch vor Aufregung. Er ließ die Wohnungstür offen, ging ins Badezimmer, fand erst nach längerem Suchen eine Pinzette, kehrte zurück und zupfte den Streichholzsplitter heraus. Endlich Ruhe. Simon schnaufte. Aber sein eigenes Schnaufen war nicht das einzige Schnaufen, das er hörte. Es schnaufte auch von der Treppe her. Als Simon ans Geländer trat, sah er nicht etwa Gregor Strack, mit Kopftuch und Strohhut, sondern die alte, asthmatische Frau Kubelik von gegenüber, die sich mit drei Plastiktüten die Treppe hinaufmühte.
»Warten Sie, ich helf Ihnen!«, rief Simon, lief die Stufen nach unten und nahm Frau Kubelik die Taschen ab.
»Das ist aber nett«, sagte Frau Kubelik.
Gemeinsam stiegen sie hoch. Frau Kubelik öffnete die Tür zu ihrer Wohnung.
»Soll ich Ihnen die Tüten reintragen?«, fragte Simon.
»Ja, danke, gern!«, sagte Frau Kubelik.
Simon folgte ihr in die Wohnung und stellte die Tüten auf den Küchentisch.
»Möchten Sie ein Bonbon, junger Mann?«
Simon verneinte.
»Ob sie wohl so freundlich wären, mein Küchenfenster aufzumachen?«, fragte Frau Kubelik. »Das klemmt immer so.«
»Sicher«, sagte Simon, öffnete das Küchenfenster, und es rutschte ihm beinah aus der Hand, da von draußen ein kräftiger Windstoß in die Küche wehte und durch die Küche in den Flur und durch den Flur ins Treppenhaus, und dann hörte Simon einen Knall. Er ahnte, dass seine eigene Wohnungstür durch die Zugluft ins Schloss gefallen war, verließ die Kubelik-Wohnung, fand die Ahnung bestätigt, stand vor seiner Tür, barfuß, wie er nun bemerkte, auf der rauen Matte, leicht fröstelnd, in Hemd und Hose, ohne Schlüssel.
Und jetzt? Es wäre ein Leichtes, in die Kubelik-Wohnung zurückzukehren und den Schlüsseldienst zu rufen. Aber Simon zögerte. Er stand dort. Etwas ging in ihm vor. Etwas weitete sich. Er schloss kurz die Augen. Und ging nicht zurück in die Kubelik-Wohnung. Er rief nicht den Schlüsseldienst an. Nein. Er tat ganz was anderes.
Er klingelte.
Er klingelte an seiner eigenen Tür.
Er klingelte, obwohl er mit vollkommener Sicherheit wusste, dass sich niemand in seiner Wohnung befinden konnte. Trotzdem klingelte er. Und weil er so selbstverständlich klingelte, war er auch nicht wirklich überrascht, als die Tür aufging, der Mann mit Kopftuch und Strohhut sein Gesicht in den Rahmen schob und sagte: »Hast dich ausgesperrt, Simon?«
»Gregor?«, flüsterte Simon.
»Na, komm halt rein, Mensch!«
2
An diesem Samstagmorgen war Simon Bloch wie üblich um halb sieben vom Zirpen seines Tennisballweckers wach geworden, einem Relikt aus Studententagen, gelb, rund und borstig. Simon hatte sich das Ding zu einer Zeit gekauft, als er das Aufstehen noch abgrundtief verabscheute und jeden Morgen mit gutturalem Grunzen begrüßte, denn der Tennisballwecker war eigens für Morgenmuffel konzipiert: Wenn er ansprang, ballerte man ihn gegen die Wand, und durch die Wucht des Aufpralls schaltete er sich ab, um noch dreimal, viermal durch die Wohnung zu hoppeln und sich nach fünf Minuten erneut zu aktivieren, was den Schlafenden dazu zwang, das Bett zu verlassen, um das Biest endgültig zum Schweigen zu bringen. Aber seit er den Vertrag bei Brönner & Co. unterschrieben hatte, um fortan ein geregeltes Leben zu führen, verzichtete er darauf, den Wecker gegen die Wand zu werfen, hatte ihn zunächst noch auf die Oberfläche des Nachttischs oder an die Bettkante geschlagen, später getippt, dann nur noch getupft, und seit einigen Jahren stand Simon beim ersten Ertönen des Zirpens sofort auf und schaltete das Gerät einfach aus, er bewegte sich ohne zu murren zur Kaffeemaschine, in die er am Abend zuvor schon den Filter gesteckt, Kaffeepulver und Wasser eingefüllt hatte, sodass er jetzt nur noch den Knopf zu drücken brauchte, ehe er ins Bad ging. Danach schlich er jeden Morgen, ganz leise, da er wusste, dass seine Nachbarn noch schliefen, die Treppe hinab, fischte die Zeitung aus dem Rohr, stieg wieder nach oben, legte die Zeitung auf den Küchentisch, schmierte zwei Brote, eins mit Leberwurst, eins mit Marmelade, trank zum Leberwurstbrot ein Glas Orangensaft und zum Marmeladenbrot den herben, ungesüßten Kaffee, und währenddessen rührte er die Zeitung, die vor ihm lag, nicht an, sondern schaute auf den Tisch oder auf die schläfrig an der Wand tickende Uhr. Um sieben stellte er den Teller in die Spülmaschine, putzte sich die Zähne, zog Jackett und Schuhe an, und um zehn nach sieben griff er zur Zeitung.
Eigentlich hasste er Zeitungen. Sie stanken nach Druckerschwärze und fühlten sich klebrig an, außerdem waren sie viel zu groß. Er hasste es, mit aufgeschlagener Zeitung irgendwo zu sitzen, hasste den Kampf, den das umständliche Aufblättern mit sich brachte, hasste es, seine Arme beim Lesen wie ein Priester ausgebreitet halten zu müssen, aber er hätte nie auf die Zeitung verzichten können, ohne sich der Welt entrückt zu fühlen. Es muss doch gelingen, hatte Simon schon vor Jahren gedacht, dieses Zeitungsungetüm zu zähmen. Und so hatte er ein Ritual ersonnen, das ihn inzwischen mit tiefer Befriedigung erfüllte. Jeden Morgen legte er die großen Zeitungsbögen rittlings über die Stuhllehne, sodass zu beiden Seiten je eine Hälfte herabbaumelte: wie die Flügel erlegter Engel. Er nahm den Mantelbogen und faltete ihn zusammen, ohne Eile, die Prozedur bereitete ihm stilles Vergnügen, einen Zeitungsbändiger nannte er sich, einen Zeitungsdompteur, er knickte den Bogen fünfmal, falzte jeden Knick geschmeidig, bis der Bogen auf Taschenbuchgröße zusammengeschnurrt war und Simon ihn in seine linke Jacketttasche stecken konnte. Dasselbe geschah mit den übrigen Bögen. Dann klopfte Simon noch einmal auf den dicken Packen Papier vor seinem Herzen, verließ die Wohnung und machte sich auf den Weg. Er freute sich auf die Fahrt, die vor ihm lag. Denn jetzt, in der Straßenbahn, suchte er sich stets den vorderen Platz hinterm Fahrer, zog den ersten Bogen seiner gefalteten Zeitung hervor, entblätterte und las ihn, ehe er den Bogen wieder sorgsam zusammenfaltete, in die rechte Jacketttasche wandern ließ und zum nächsten griff. Beim Lesen legte Simon das Kinn auf die Brust und sah aus wie ein erstarrter Stier mit gesenktem Kopf, kurz vorm Stoß ins rote Tuch. So zerlas er Bogen für Bogen seiner Zeitung, und seit einiger Zeit war er dazu übergegangen, die gefalteten Bögen nicht, wie anfangs, der Reihe nach aus der Tasche zu ziehen, sondern wahllos, sodass er nie wusste, welchen Teil der Zeitung er zu fassen bekam, ob Politik, Wirtschaft, Feuilleton oder Sport: Das war das einzige Überraschungsmoment in seinem Leben. Er las auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt, in der Kaffee- und Mittagspause. So wusste er, was um ihn herum geschah, und am nächsten Tag würde eine neue Ausgabe erscheinen, ewiger Fortgang, die Zeitungen kannten nur eine Richtung, Simon folgte ihnen begierig, er hasste das Zurückblicken, und daher warf er, zu Hause angekommen, den Packen zerlesener Bögen sofort in die Tonne fürs Altpapier. Dann zog er die Schuhe aus, setzte sich in den Sessel und tat erst mal eine Viertelstunde lang nichts, ehe ihm dieses Nichts zu nahe kam, weshalb er aufstand und all die Dinge verrichtete, die eben zu verrichten waren.
Jetzt aber, an diesem Samstagmorgen, war alles anders gewesen. Auch samstags musste Simon zur Arbeit. Bis vierzehn Uhr. Beim Falten der Zeitung verzichtete er auf sämtliche Sonderbeilagen– Reise, Immobilien, Anzeigen–, weil seine Jacketttasche für eine komplette Wochenendausgabe zu klein gewesen wäre. Auch an diesem Samstag verließ er das Haus und wartete auf die Straßenbahn. Da sah er, wohl hundert Meter neben der Haltestelle, einen Mann auf dem Boden sitzen. Simon blickte zur elektronischen Anzeigetafel. Die Straßenbahn käme in zwei Minuten. Simon schüttelte sich kurz, gab sich einen Ruck und ging auf den Bettelnden zu. Er wusste, zwei Minuten, das würde reichen, um hinzugehen, Geld in den Hut zu werfen und umzukehren. In der Straßenbahn würde er den Mann wieder vergessen, spätestens nachdem er den zweiten Bogen seiner Zeitung gelesen hatte, und es war wichtig für Simon, die bettelnden Männer und Frauen zu vergessen, denen er Geld gab. Er durfte nicht allzu lange über sie nachdenken, sonst breitete sich eine Traurigkeit in ihm aus, die ihn für Stunden aus dem Konzept bringen konnte.
Schon nach wenigen Schritten sah Simon, dass etwas nicht stimmte. Der Mann besaß zwei Hüte. Einen hatte er umgedreht vor sich hingestellt, den anderen trug er auf dem Kopf, tief in die Stirn gedrückt, ein alter Strohhut, und darunter ein Kopftuch. Es umrahmte sein Gesicht und schien unverrückbar festgeknotet, bedeckte Ohren und Wangen, sogar sein Kinn. Zu sehen blieben nur noch Augen, Nase, Mund. Als wolle er etwas verbergen, dachte Simon. Vielleicht eine Brandnarbe, eine Entstellung, eine Hautkrankheit. Jetzt stand Simon dicht vorm Bettelnden. Der Mann trug ein rosa Hemd mit Löchern, eine enge kurze Radlerhose, dazu graue Wollsocken und Birkenstocksandalen. Der zweite Hut war mit ein paar müden Cent-Stücken gefüllt. Simon wollte schon wie üblich zwei Euro in den Hut werfen, doch da bemerkte Simon die Hosenklammer, eine neongelbe Hosenklammer mit Klettverschluss, die nicht im mindesten ihren Zweck erfüllte: In Kombination mit der kurzen Radlerhose wirkte sie entsetzlich fehl am Platz und auf so traurige Weise lächerlich, dass Simon, um dem aufkommenden Gefühl bodenloser Tristheit etwas entgegenzusetzen, einen Geldschein aus der Brieftasche zog, einen Zehn-Euro-Schein, sich zum Mann hinunterbeugte und den Schein in den Hut fallen ließ, wobei er bemerkte, dass die Hände des Manns keineswegs, wie es sich für einen Bettelnden gehört hätte, dreckig, stumpf, rissig und rau waren, sondern vielmehr zart und geradezu manikürt. Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass der Mann mit keiner Regung auf Simons Großzügigkeit reagierte, ließen Simon innehalten. Nicht mal ein Danke, dachte er und ärgerte sich zu sehr, um ohne Bemerkung zu gehen.
»Sie könnten sich wenigstens bedanken!«, sagte Simon.
»Danke«, murmelte der Mann, ohne aufzublicken.
»Oder mich anschauen«, sagte Simon und wünschte sich sofort, diesen Satz nie gesagt zu haben, denn als der Mann vor ihm den Kopf hob und ihn anblinzelte, zuckte Simon zusammen, als hätten seine Augen sich an etwas verbrannt, er wandte sofort den Blick ab, wünschte einen guten Tag und eilte zurück zur Haltestelle, hörte in seinem Rücken ein Ha!, drehte sich noch mal um, der Mann war aufgesprungen, starrte Simon hinterher, mit ausgestrecktem Zeigefinger, doch Simon kam zur selben Sekunde bei der Haltestelle an wie die Straßenbahn, sprang hinein, ging nach vorn und setzte sich auf den Platz hinterm Fahrer, blickte aus dem Fenster, merkte, wie er zitterte, ließ Bogen um Bogen seiner Zeitung aus der linken in die rechte Jacketttasche wandern, las zwar, was geschrieben stand, aber das war nichts weiter als der verzweifelte Versuch, während der Fahrt den Gedanken an Gregor Strack unter Verschluss zu halten. Er hatte Gregor seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Woher hätte er wissen sollen, wie Gregor jetzt aussah? Es konnte nur eine flüchtige Ähnlichkeit sein, eine Ähnlichkeitsahnung. Simon zählte seine Atemzüge. Das wirkte immer wie ein kaltes Tuch gegen überbordende Gefühle. So auch jetzt, und als die Straßenbahn ihr Ziel erreicht hatte, stürzte sich Simon in die Arbeit, in seine nie enden wollende Akten-, Brief- und E-Mail-Arbeit, er dachte, jetzt, heute, mit Schwung, jetzt muss ich doch endlich mal fertig werden, vielleicht gelingt es mir heute. Einmal nur fertig werden, das war Simons Traum, einmal nur seinen Schreibtisch leergefegt zurücklassen, doch so sehr er sich beeilte, immer kam noch die zweite Post mit einem neuen Stapel Briefe oder der Bürobote mit einem Aktenberg, oder es trafen neue Beschwerde-E-Mails ein, die bearbeitet werden mussten, ich werde es nie schaffen, fertig zu werden, dachte Simon, das ist mein Los, das ist das Los der Menschen, dass wir es niemals schaffen, fertig zu werden.
3
Simon schob sich an Gregor vorbei in seine Wohnung. Gregor roch gut. Geradezu parfümiert. Überhaupt nicht so, wie ein bettelnder Mensch riechen musste, der womöglich in einem Wohnheim für Männer schlief. Im Gegenteil. Er roch nach Vanille, nach Flieder, nach was weiß ich, wonach der riecht, dachte Simon plötzlich, der riecht zu gut, Mensch, warum ist das so? Gregor schien merkwürdig nervös zu sein. Er schloss sofort die Tür.
»Wo ist der Schlüssel?«, fragte er Simon.
»Auf dem Schränkchen.«
Gregor steckte ihn ins Schlüsselloch, drehte zweimal um und legte ihn zurück. Verdammt, dachte Simon, was passiert hier? Gregor hat mich reingelassen, ermich, in meine Wohnung! Sofort spürte Simon einen Funken dieser Wut, seiner– wie er sie nannte– alten Lebenswut, die er längst erkaltet glaubte, und die Wut zielte auf Gregors Unverschämtheit, auf sein Eindringen, seine Aufdringlichkeit. Simon wusste, er würde diese alte Wut brauchen, um dem, was folgte, gewachsen zu sein, er musste ein Stück des Erloschenen wieder anfachen, um Gregor Paroli bieten zu können. Und wie zum Teufel war der Kerl überhaupt hier reingekommen? Er wollte ihn fragen, aber Gregor war schon ins Wohnzimmer gegangen. Simon folgte ihm und sah sofort den Koffer. Er sprang ihm geradezu ins Auge, ein schwarzer, nagelneuer Aktenkoffer, den er am Morgen nicht bei Gregor gesehen hatte, jetzt aber lag der Koffer wie ein fremdes Wesen, das nirgends dazugehörte, auf dem Wohnzimmertisch. Gregor setzte sich.
»Wie bist du reingekommen?«, fragte Simon.
»Wir müssen reden. Hast du was zu trinken?«
»Ich… Was willst du?«
»Wasser.«
Simon ging in die Küche. Er drehte den Hahn auf, hielt ein Wasserglas darunter und nahm noch ein zweites Glas, wobei er sich fragte, weshalb zwei? Wenn er jetzt mit zwei Wassergläsern zu Gregor zurückginge, sähe das aus wie eine Einladung zum Plaudern, so, als hätte er nichts dagegen, dass Gregor jetzt hier bei ihm saß und mit ihm reden wollte, doch Simon musste sich eingestehen, dass er tatsächlich nichts dagegen hatte, denn in ihm war eine ungeahnte Neugier erwacht, auf alles, was gerade geschah, und seltsamerweise auch auf alles, was in den Jahren geschehen war, in denen sie sich nicht gesehen hatten.
Gregor nahm Simon das Glas aus der Hand. »Und? Filmkomponist?«, fragte er und deutete mit dem Glas auf das Plakat von Bandolero.
Und es geschah, was Simon insgeheim befürchtet hatte, ein Wechsel der Vorzeichen, die Verlagerung des Geschehens, denn obwohl er sich fest vorgenommen hatte, nichts von sich selbst preiszugeben, obwohl er Gregor fragen wollte, wie er reingekommen war und was es mit dem Koffer auf sich hatte und weshalb er so verstört wirkte und wieso er in dieser komischen Aufmachung herumlief, geschah das Gegenteil. Es war Gregor, der fragte, und Simon leistete keinen Widerstand, hörte sich plötzlich selber reden, ihm war, als hätte ein Stück in Es-Dur gespielt werden sollen, und nun ertönte ein Stück in h-Moll. Simon hatte seit dem Tod seiner Frau nicht mehr so viel geredet. Die Freizeit verbrachte er am liebsten mit sich selbst, seinen Platten und seinem Klavier, und im Büro gab es kaum Veranlassung zu reden, im Gegenteil, man hatte ihn eingestellt, weil er so gut zuhören konnte, als Blitzableiter für wütende Anrufe, und weil er über eine gewisse Kunst der Formulierung verfügte, die ihm half, den erhitzten Beschwerdebriefschreibern etwas von ihrer Wut zu nehmen. Jetzt aber brach es, je länger er redete, umso sprudelnder hervor. Simon erzählte von seiner Leidenschaft, von Filmmusik und Filmkomponisten, die er runterbeten konnte wie nichts, erzählte von seinem Musikstudium und davon, wie er geschuftet hatte, ein Besessener. Als Student hatte er sich eine Kordelanlage gebaut, mit der er seine kleinen Hände spreizen wollte, damit ihm gelänge, was allen wahren Virtuosen gelang, nämlich eine Spanne auf dem Klavier zu überbrücken, die eine plumpe Oktave deutlich übertraf, und dann war ihm im Eifer des Gefechts die Sehne des kleinen Fingers gerissen, es blieb ein irreparabler Schaden zurück, der Finger hatte an Beweglichkeit eingebüßt und sein blinder Ehrgeiz ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit diesem verkrüppelten Finger würde er die Prüfungen nicht meistern können: Weder Bach noch Beethoven noch Schostakowitsch lassen sich ohne kleinen Finger spielen. Da erzählte ihm ein Kommilitone, dass Robert Schumann ein ähnliches Missgeschick widerfahren war. Der hatte, zur Stärkung des schwachen Ringfingers, ein Gerät erfunden, das er unaufhörlich erprobte, bis er sich eine Sehnenscheidenentzündung zuzog, durch die der Finger unbrauchbar wurde, zum Glück für die Musikgeschichte, denn wäre dies nicht geschehen, hätte Schumann vielleicht seine konzertante Karriere forciert und sich nicht zu dem grandiosen Komponisten entwickelt, der er letztendlich geworden war. Simon schöpfte neuen Mut. Vielleicht, dachte er, würde auch er ein Schumann werden, ein Robert Schumann der Filmmusik, vielleicht war der Sehnenriss ein Zeichen. Simon kehrte der Hochschule den Rücken und jobbte in einer Eckkneipe, spielte dort Klavier, ein bisschen Jazz, ein bisschen Improvisation, aber vor allen Dingen Filmmusik, alles Stücke, die man auch ohne kleinen Finger hinbekam. Der Wirt ein Filmfreak, und die Wände der Kneipe übersät mit Plakaten, nebenan lag das verratzte Kommunale Kino, und die Kneipe gehörte dazu. Simon durfte sich austoben, er spielte Tiomkin, Steiner, Waxman, Korngold, die Großen eben, vor allem seinen geliebten Victor Young, der ein unerschöpfliches Talent für Melodien besaß, auch Jerry Goldsmith, den Vielschreiber. Simon hörte sich selber zu, wie er über Filmmusik zu dozieren begann und vom oft zitierten obersten Credo sprach, gute Filmmusik zeichne sich dadurch aus, dass man sie nicht höre, sie müsse sich wie selbstverständlich in den Film einfügen, dürfe nie stören oder die Überhand gewinnen, müsse die Bilder begleiten, ohne in den Mittelpunkt zu treten. Lediglich der Urvater der Filmmusik, Max Steiner, hatte dieser Regel kalauernd entgegengehalten: Wozu braucht man eine Musik, wenn man sie nicht hört? Es kommt natürlich auf den Film an, war Simons Antwort: Ennio Morricones Musik steht über den Bildern, sie ist elementar, Alexandre Desplats Musik zu Syriana dagegen schmiegt sich an die Bilder wie eine Haut, und erst ohne Film merkt man, wie wunderbar sie ist.
Abends und nachts spielte Simon im Walfisch. Sein Künstlername: Schneider. Und weil Filmmusiknoten damals noch nicht so einfach zu bekommen waren, spielte Simon viel nach Gehör, wenn auch die Melodie oft anders klang als im Film, wenn auch Newman, Salter, Friedhofer und Grusin sich gewehrt hätten gegen seine freie Interpretation ihrer Musik, Simon war das egal, er spielte so, wie er es für richtig hielt. Immer öfter schoben sich eigene Melodien in das, was Simon spielte, und irgendwann ging er dazu über, in der Kneipe zu improvisieren, zu komponieren: Beim Spielen beobachtete er die Leute und wandelte das, was er sah, in Musik, er vertonte das Lachen der Menschen, das Quatschen, das bellende Bestellen, Simon fasste immer für einige Zeit einen bestimmten Tisch ins Auge und reagierte auf das, was er sah, komponierte im Augenblick und für den Augenblick eine unerhörte Filmmusik des Alltags, das bierselige Gebrabbel, das Raunen, der Rauch, der wie ein sich stetig erneuerndes Netz in der Luft hing und das Leben lähmte, der Nebel, der den Menschen aus den Mündern kroch und alles verklebte, was sonst noch aus ihnen hätte kommen können, das Aufstehen und Zur-Toilette-Gehen, Blicke, verliebte, zornige, freudige, seine Musik fügte sich unhörbar und unmerklich in den Film ein, der sich vor ihm abspielte. Er war zufrieden, auch wenn das Geld nur leidlich reichte. Die Melodien, die ihm in der Nacht einfielen, schrieb er am nächsten Tag auf, er tat alles für seine Karriere als Komponist, kratzte sein Geld zusammen und mietete ein Studio, spielte die Stücke ein, indem er mittels Synthesizer ein Orchester imitierte, schickte seine Demobänder überallhin, doch ohne Erfolg.
Irgendwann, Simon war etwa dreißig Jahre alt, kam es zum totalen Bruch. Das geschah, als er in der Kneipe versuchte, ein Pärchen zu vertonen, das am Tisch unmittelbar vor ihm saß. Dieses Pärchen verkörperte nicht mehr und nicht weniger als die ödeste Mittelmäßigkeit. Der Mann