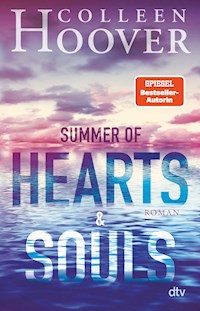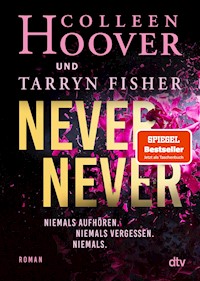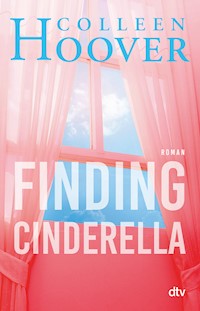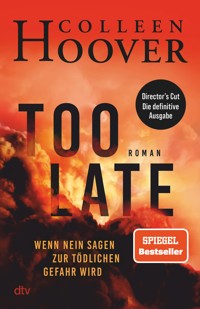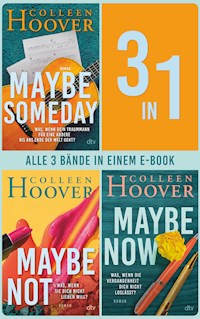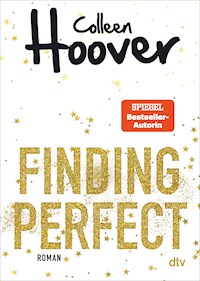12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Meisterwerk der Bestsellerautorin Ein intensiver Roman über versteckte Gefühle, dunkle Familiengeheimnisse und über das, was passiert, wenn du deiner großen Liebe begegnest – diese aber für dich unerreichbar ist. Stell dir vor, du triffst den Mann deiner Träume – und dann findest du heraus, dass er der eine ist, in den du dich nicht verlieben solltest … Beim Shoppen in der Stadt lernt die siebzehnjährige Merit den überaus attraktiven Sagan kennen und verliebt sich so heftig in ihn, dass sie ihren sonstigen Schutzpanzer fallen und sich schon bei der ersten Begegnung von ihm küssen lässt. Ein fataler Fehler – denn leider stellt sich heraus, dass Sagan für Merit absolut off limits ist, weil er ihrer an versteckten Geheimnissen ohnehin reichen Familie näher steht, als sie ahnte. Damit nicht genug: Anstatt ihr aus dem Weg zu gehen, bereichert Sagan in der folgenden Zeit das vielköpfige Elternhaus von Merit mit seiner täglichen Anwesenheit. Das aber führt das ohnehin schon chaotische Familienleben völlig ad absurdum – und stürzt Merit in eine tiefe persönliche Krise. »Ehrlich, komisch und herzzerreißend in einem! Ich konnte den Roman nicht aus der Hand legen.« Anna Todd
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Colleen Hoover
Die tausend Teilemeines Herzens
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katarina Ganslandt
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Cale Hoover
Weil ich deine Mutter bin und dich liebe, habe ich manchmal das überwältigende Bedürfnis, dich in Luftpolsterfolie zu packen, um dich vor der Welt zu beschützen. Manchmal denke ich aber auch, ich müsste vielleicht die Welt in Luftpolsterfolie packen, um sie vor dir zu schützen. Weil du sie eines Tages nämlich garantiert aus den Angeln heben wirst.
Ich kann’s kaum erwarten.
1.
Ich besitze eine beeindruckende Sammlung von Pokalen, die ich alle nicht gewonnen habe.
Die meisten stammen von Flohmärkten oder aus Trödelläden. Zwei hat mein Vater mir zu meinem siebzehnten Geburtstag geschenkt. Nur ein einziger ist gestohlen.
Den gestohlenen mag ich wahrscheinlich von allen am allerwenigsten. Ich habe ihn an dem Tag, an dem Drew Waldrup mit mir Schluss gemacht hat, aus seinem Zimmer mitgenommen. Wir waren damals zwei Monate zusammen, und ich hatte ihm zum allerersten Mal erlaubt, mich unter dem T-Shirt anzufassen. Als ich gerade gedacht habe, wie wahnsinnig toll sich das anfühlt, hat er auf mich runtergeschaut und gesagt: »Ich glaube, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, Merit.«
Während ich es schön fand, dass er mich streichelt, hatte er die ganze Zeit daran gedacht, dass er mich nie mehr anfassen will. Ohne eine Miene zu verziehen, bin ich unter ihm hervorgerutscht und aufgestanden. Nachdem ich mein T-Shirt wieder zurechtgezupft hatte, bin ich zum Regal gegangen und habe mir den allergrößten Pokal genommen, der darauf stand. Drew hat nie ein Wort darüber verloren. Ich finde aber auch, dass es so nur gerecht war. Dafür, dass er mit der Hand auf meinen Brüsten mit mir Schluss gemacht hat, habe ich mir ja wohl mindestens einen Pokal verdient.
Diese geklaute Football-Trophäe war der Beginn meiner Sammlung. Seitdem kaufe ich mir jedes Mal, wenn in meinem Leben irgendwas Beschissenes passiert, einen Pokal dazu.
Fahrprüfung nicht bestanden? Erster Platz im Kugelstoßen.
Keiner lädt mich zum Schulball ein? Erster Platz beim Theaterfestival/Kategorie Einakter.
Mein Vater macht seiner Geliebten einen Heiratsantrag? Little League Baseball Champions.
Drew Waldrups Pokal habe ich vor zwei Jahren gestohlen. Mittlerweile ist meine Sammlung auf zwölf Stück angewachsen, obwohl viel öfter als nur zwölfmal beschissene Sachen passiert sind, seit er mit mir Schluss gemacht hat. Dass es trotzdem nicht mehr sind, liegt daran, dass es merkwürdigerweise ziemlich schwierig ist, Pokale zu finden, die keiner mehr haben will. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade im örtlichen Antiquitätenladen vor einem Pokal stehe, auf den ich schon seit sechs Monaten ein Auge werfe. Er ist fast einen halben Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1972, wo er bei einer Miss-Wahl namens »Boots and Beauties« in Dallas der siebtplatzierten Teilnehmerin verliehen wurde.
Dass der Schönheitswettbewerb einen so selten dämlichen Namen hatte, finde ich gut, aber noch besser gefällt mir die vergoldete Figur auf der Spitze des Pokals: eine Frau im Prinzessinnenkleid mit Krönchen und Cowboystiefeln mit Sporen. Alles an diesem Pokal ist absurd. Vor allem die fünfundachtzig Dollar, die auf dem Preisschild stehen. Aber ich spare auf dieses Ding, seit ich es das allererste Mal gesehen habe, und jetzt endlich habe ich genug Geld zusammen, um es mir zu kaufen.
Ich habe den Pokal gerade mit beiden Händen vom Regal genommen und will damit zur Kasse, als ich auf der Galerie im ersten Stock einen Typen bemerke, der mich beobachtet. Das Kinn auf die Hand gestützt, lehnt er lässig am Geländer und sieht aus, als würde er schon eine ganze Weile so dastehen. Als ich zu ihm hochschaue, lächelt er und ich lächle zurück – was extrem untypisch für mich ist. Ich flirte nie und wüsste auch gar nicht, wie ich reagieren sollte, falls jemand mit mir flirten sollte. Aber er hat ein echt nettes Lächeln, und außerdem steht er ja nicht neben mir, sondern oben auf der Galerie, wodurch sich die Peinlichkeit in Grenzen hält.
»Was machst du hier?«, ruft er zu mir runter.
Ich schaue hinter mich, ob da noch jemand ist, den er meinen könnte. Vielleicht galt sein Lächeln ja gar nicht mir. Aber abgesehen von einer Mutter mit ihrem kleinen Sohn ist der Laden leer. Außerdem sehen die beiden in eine andere Richtung, also meint er wohl wirklich mich.
Als ich wieder zu ihm hochgucke, lächelt er immer noch. »Ich kaufe einen Pokal!«
Sein Lächeln ist wirklich nett, aber er steht zu weit weg, um zu beurteilen, ob mir auch der Rest von ihm gefällt. Seine lockere Selbstsicherheit finde ich jedenfalls schon mal ziemlich anziehend. Die dunklen Haare hängen ihm ein bisschen zottelig ums Gesicht, aber das stört mich nicht. Ich weiß ja selbst nicht, wann ich meine zum letzten Mal gebürstet habe. Gestern nach dem Aufstehen, glaube ich. Er trägt einen grauen Kapuzenpulli, dessen Ärmel er bis zu den Ellbogen hochgeschoben hat, und der Arm, auf den er sein Kinn stützt, ist mit Tattoos übersät, die ich von hier unten aus nicht erkennen kann. Irgendwie wirkt er ein bisschen zu jung und zu tätowiert, um mitten in der Woche vormittags in einem Antiquitätenladen herumzustöbern, andererseits könnte man so was auch von mir behaupten. Ich müsste eigentlich in der Schule sein.
Weil das Ganze allmählich doch ein bisschen peinlich wird, drehe ich mich weg und schlendere die Regalreihen entlang, werde dabei aber das Gefühl nicht los, dass er mich weiter beobachtet. Ich riskiere einen unauffälligen Blick und tatsächlich steht er immer noch am Geländer und guckt runter.
Arbeitet er vielleicht hier? Das könnte sein, würde allerdings nicht erklären, warum er mich die ganze Zeit anschaut. Komisch. Falls das seine Vorstellung von Flirten ist, hat er sehr seltsame Vorstellungen. Wobei ich zugeben muss, dass ich alles Seltsame grundsätzlich erst mal interessant finde. Während ich also so tue, als würde ich nicht weiter über ihn nachdenken, mache ich in Wirklichkeit nichts anderes als das. Sein Blick lastet schwer auf mir. Natürlich haben Blicke kein Gewicht, aber es reicht zu wissen, dass er mich anschaut, um meine Beine bleischwer werden zu lassen. Selbst mein Magen fühlt sich schwerer an als sonst.
Ich habe mir schon alles im Laden angeschaut, will aber noch nicht gehen. Dieses Spiel macht mir zu viel Spaß.
Dazu muss ich vielleicht erwähnen, dass ich in einer echt kleinen Stadt wohne, mit einer ebenso kleinen Highschool. Und wenn ich »klein« sage, klingt sogar das fast noch zu groß. Bei uns hat jeder Jahrgang nur so um die zwanzig Schüler. Nicht jede Klasse, jeder Jahrgang.
In meinem gesamten Abschlussjahrgang sind wir insgesamt nur zweiundzwanzig. Zwölf Schülerinnen und zehn Schüler. Acht von diesen zehn Jungs kenne ich schon seit der Grundschule. Das schränkt das Feld der Kandidaten, die als Objekte der Begierde infrage kommen könnten, natürlich ziemlich ein. Es ist schwierig, jemanden aufregend zu finden, mit dem man seit dem fünften Lebensjahr fast jeden Tag seines Lebens verbracht hat.
Aber dieser Typ da oben auf der Galerie, der mich beobachtet, ist ein vollkommen Fremder, und das bedeutet, dass ich ihn automatisch jetzt schon interessanter finde als sämtliche Jungs meiner Schule zusammen.
Ich bleibe in einem Gang stehen, den er von seinem Platz aus perfekt einsehen kann, und betrachte ein altes Blechschild im Regal. Es ist aus weißer Emaille, auf der groß das Wort STÄNDER zu lesen ist, ein Pfeil zeigt nach rechts. Direkt daneben steht eine zerkratzte Werbetafel, die vermutlich aus einer Kfz-Werkstatt stammt: Kolbenschmiermittel. Ich muss lachen. Keine Ahnung, ob da jemand eine besonders schmutzige Fantasie hatte oder ob die beiden Schilder zufällig nebeneinanderstehen. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich sie kaufen und eine Sammlung zweideutiger Schilder starten. Aber meine Pokal-Leidenschaft ist schon kostspielig genug.
Der kleine Junge steht jetzt ein paar Schritte neben mir. Ich schätze, er ist etwa im Alter meines kleinen Bruders, also vier oder fünf. Obwohl ich gehört habe, wie seine Mutter ihn bestimmt schon zehnmal ermahnt hat, bloß nichts anzufassen, greift er zielsicher nach einem Schwein aus Glas im Regal vor uns. Wieso werden Kinder eigentlich immer wie magnetisch von Sachen angezogen, die total zerbrechlich sind? Mit leuchtenden Augen dreht er das Schwein hin und her, und ich muss zugeben, dass ich es ganz schön cool finde, dass seine Neugier größer ist als die Bereitschaft, seiner Mutter zu gehorchen.
»Mom?«, fragt er. »Krieg ich das?«
Seine Mutter, die ein paar Meter weiter vor einer Kiste hockt und in alten Zeitschriften blättert, dreht sich nicht mal zu ihm um. Sie sagt einfach nur: »Nein.«
Die Miene des Jungen verdüstert sich, aber er gehorcht. In dem Moment, in dem er das Schwein wieder zurückstellen will, rutscht es ihm aus den kleinen Händen und zersplittert zu seinen Füßen.
»Nicht bewegen!«, rufe ich und bin bei ihm, ehe seine Mutter reagieren kann. Ich bücke mich und beginne die scharfkantigen Stücke aufzusammeln.
Seine Mutter kommt angerannt, packt ihn und stellt ihn ein paar Meter vom Gefahrenbereich entfernt wieder ab. »Ich habe dir doch gesagt, dass du nichts anfassen sollst, Nate!«, schimpft sie.
Der kleine Junge starrt auf den Scherbenhaufen, als wäre gerade sein bester Freund gestorben. Seine Mutter presst sich entnervt die Hand an die Stirn, seufzt und kommt dann zu mir, um beim Aufsammeln der Splitter zu helfen.
»Das war gar nicht seine Schuld, sondern meine«, sage ich.
Die Frau schaut zu ihrem kleinen Sohn, der mich anguckt, als hätte er Angst, das Ganze könnte irgendeine Art Test sein. Ich zwinkere ihm zu, bevor ich mich wieder zu ihr drehe. »Ich habe ihn nicht bemerkt und bin in ihn reingelaufen. Da ist es ihm runtergefallen.«
Die Frau sieht überrascht und vielleicht sogar auch ein bisschen beschämt aus, weil sie sofort angenommen hatte, ihr Sohn wäre schuld. »Oh«, sagt sie, hilft mir aber trotzdem, die größeren Scherben aufzuheben. In dem Moment taucht der Ladenbesitzer von irgendwoher mit einer Kehrschaufel und einem Besen auf. »Das mach ich schon«, brummt er, zeigt aber auf ein Schild an der Wand. WERWAREBESCHÄDIGT, MUSSSIEBEZAHLEN.
»Dann gehen wir jetzt lieber.« Die Frau greift nach der Hand ihres Sohns und zieht ihn zum Ausgang. Der kleine Junge wirft mir über die Schulter noch mal einen Blick zu, und sein niedliches Lächeln allein ist es schon wert, dass ich die Schuld auf mich genommen habe.
»Wie viel hätte das Schwein denn gekostet?«, frage ich den Verkäufer.
»Neunundvierzig. Wenn du mir dreißig gibst, ist es okay.«
Ich seufze. Plötzlich bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das Lächeln des kleinen Jungen dreißig Dollar wert war. Schweren Herzens stelle ich den Miss-Wahl-Pokal wieder ins Regal zurück und nehme stattdessen einen anderen, der wesentlich kleiner und unspektakulärer ist. Erst als ich für das Schwein und meinen ersten Platz beim Bowling bezahlt habe, fällt mir der Typ wieder ein, der mich von der Galerie aus beobachtet hat. Bevor ich rausgehe, werfe ich einen Blick nach oben, aber er ist nicht mehr da. Und aus irgendeinem Grund fühlen sich meine Schritte auf einmal noch schwerer an.
Ich überquere die Straße zum Park in der Mitte des Courthouse Square und gehe auf einen der Picknicktische zu, die neben dem Brunnen in den Beton eingelassen sind. Obwohl ich schon mein ganzes Leben in Hopkins County lebe, bin ich selten hier. Dabei ist das eigentlich ein sehr cooler Platz, vor allem seit am Zebrastreifen Verkehrsschilder stehen, auf denen ein Mann mit Aktentasche und absurd hoch in die Luft gerecktem Bein abgebildet ist, der wie der Typ mit dem albernen Gang aus dem Monty-Python-Sketch aussieht. Vor ein paar Jahren hat die Stadtverwaltung außerdem neue Toiletten aufstellen lassen, die von außen wie zwei riesige Spiegelwürfel aussehen. Das Glas ist aber nur einseitig verspiegelt, sodass man rausschauen kann, wenn man innen auf dem Klo sitzt. Es ist ganz schön seltsam, zu pinkeln und die Autos an sich vorbeifahren zu sehen. Aber ich mag nun mal alles, was seltsam ist, weshalb ich wahrscheinlich eine der wenigen Bürgerinnen dieser Stadt bin, die auf ihre komischen öffentlichen Toiletten stolz ist.
»Für wen ist der Pokal?«
Wo wir gerade von seltsamen Sachen sprechen …
Der Typ aus dem Laden steht plötzlich auch auf dem Platz, und aus der Nähe betrachtet, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass er mir gefällt. Das Auffälligste an ihm sind seine unglaublich blau strahlenden Augen, die einen starken Kontrast zu seiner gebräunten Haut und den schwarzen Haaren bilden. Ich starre ihn einen Moment lang stumm an, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich schon jemals jemanden mit so schwarzen Haaren und so blauen Augen gesehen habe. Das ist irgendwie ein bisschen irritierend. Für mich jedenfalls.
Er lächelt mich genauso offen und freundlich an wie vorhin im Laden. Schaut er womöglich immer so? Hoffentlich nicht. Ich fände es schöner, wenn er nur bei mir so lächeln würde, weil er vielleicht gar nicht anders kann. Als er mit einer Kopfbewegung auf die Tüte in meiner Hand zeigt, erinnere ich mich, dass er mir eine Frage gestellt hat.
»Ach so, ja. Der ist für meine Sammlung.«
Er zieht eine Augenbraue hoch. Ich weiß nicht, ob er mich lustig findet oder seltsam, aber mir ist beides recht. »Du sammelst Pokale, die du nicht gewonnen hast?«
Ich nicke und er lacht, aber es ist ein lautloses Lachen, fast so, als würde er es lieber für sich behalten wollen. Dann schiebt er die Hände hinten in die Taschen seiner Jeans. »Warum bist du nicht in der Schule?«
Ist es so offensichtlich, dass ich noch auf der Highschool bin? »Die Sonne scheint.« Ich stelle die Tüte auf den Picknicktisch und ziehe meine Schuhe aus. »Ich hatte keine Lust, im dunklen Klassenzimmer zu hocken.« Barfuß gehe ich zum Brunnen, der eigentlich gar keiner ist, sondern nur ein in einen gefliesten Kreis eingelassener großer roter Stern. Zwischen seinen Zacken sind Düsen angebracht, aus denen in unregelmäßigen Abständen Wasser in die Mitte des Sterns spritzt. Ich stelle meinen rechten Fuß auf eine der Düsen und warte.
Im Sommer toben hier immer Massen von Kindern, aber jetzt, Ende Oktober, ist es dafür zu kalt. Mir macht es nichts aus, nasse Füße zu bekommen. Es kitzelt schön, wenn das Wasser die Fußsohle trifft, und ist gleichzeitig eine kostenlose Fußmassage.
Der Typ beobachtet mich schweigend, aber allmählich gewöhne ich mich an ihn. Es ist ein bisschen so, als wäre er eine Art persönlicher hübscher Schatten. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass er auch die Schuhe auszieht und einen Fuß auf eine der Düsen stellt.
Als ich verstohlen einen Blick auf seine Arme werfe, fällt mir auf, dass komischerweise nur sein linker Arm tätowiert ist, der rechte gar nicht. Auch die Tattoos selbst sind komisch, weil es so viele sind und weil sie völlig zusammenhanglos wirken. Auf dem Handgelenk ist ein Toaster, aus dem gerade eine Scheibe Brot fliegt. Neben dem Ellbogen eine Sicherheitsnadel. Und quer über dem Unterarm der Spruch »Du bist der Nächste, Doktor«. Während mein Blick über seinen Arm wandert, schaut er auf seine Füße. Als ich ihn gerade nach seinem Namen fragen will, trifft der Wasserstrahl meine Fußsohle, ich springe kreischend nach hinten, und wir sehen beide zu, wie die Fontäne ins Zentrum des Sterns spritzt.
Seine Düse ist die nächste, aber er lässt den Fuß stehen und betrachtet ihn nachdenklich, bis das Wasser wieder abebbt und aus der Düse gegenüber sprudelt. Erst danach hebt er den Blick, doch jetzt lächelt er nicht mehr. Im Gegenteil, sein Gesichtsausdruck ist auf einmal so ernst, dass es mir einen Stich versetzt. Und dann sagt er etwas, das ich wie ein Schwamm in mich aufsauge.
»Wir könnten beide gerade an tausend anderen Orten sein und ausgerechnet hier treffen wir uns.« In seiner Stimme schwingt ein leichtes Lachen mit, aber seine Miene ist vor allem eins: verwundert. Kopfschüttelnd geht er einen Schritt auf mich zu und streicht mir eine Strähne aus dem Gesicht, die sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst hat. Die Geste kommt vollkommen unerwartet und fühlt sich seltsam vertraut an, wie alles, was hier gerade zwischen uns passiert, aber das ist mehr als okay für mich. Von mir aus könnte er das gleich noch mal machen, aber er lässt den Arm wieder sinken und sieht mich nur an.
Ich kann mich nicht erinnern, schon jemals in meinem Leben von jemandem so angesehen worden zu sein. So, als … als fände er mich total faszinierend, obwohl wir uns überhaupt nicht kennen. Diese Faszination würde natürlich verfliegen, sobald wir uns unterhalten würden. Wahrscheinlich würde er mich langweilig finden oder ich würde feststellen, dass er ein Vollidiot ist, und wir wären beide froh, wieder getrennter Wege gehen zu können. Meine Begegnungen mit Jungs laufen meistens nach diesem Schema ab. Aber dadurch, dass ich rein gar nichts über ihn weiß, kann ich mir vorstellen, er wäre perfekt. Intelligent, aufmerksam, nett und witzig, am besten auch noch künstlerisch begabt, alles Eigenschaften, die ein Traumtyp für mich haben muss. Es reicht mir völlig, mir einfach nur vorzustellen, er wäre genau so, wie ich ihn mir wünsche.
Er macht noch einen Schritt auf mich zu, und auf einmal – als hätte ich plötzlich nicht nur meins, sondern auch noch sein Herz in mir – verdoppeln sich die Schläge in meiner Brust. Sein Blick wandert zu meinem Mund, und im nächsten Moment bin ich mir ganz sicher, dass er mich gleich küssen wird. Ich hoffe es sogar, was seltsam ist, weil wir ja erst ein paar Sätze gewechselt haben. Vielleicht möchte ich geküsst werden, solange ich mir vorstellen kann, dass er perfekt ist, weil der Kuss dann auch perfekt wäre.
Er streicht federleicht mit den Fingern an meinem Handgelenk aufwärts, und es ist, als würde er mir mit dieser Berührung alle Luft aus den Lungen pressen. Heiße Schauer jagen meinen Arm hinauf. Jetzt liegt seine Hand in meinem Nacken, und es ist mir ein Rätsel, wie ich es schaffe, immer noch aufrecht zu stehen, obwohl meine Beine unter mir einzuknicken drohen. Unwillkürlich neige ich den Kopf zurück, als sein Mund sich meinem nähert. Kurz davor stoppt er und lächelt. Dann flüstert er: »Begrabe mich.«
Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es klingt verdammt gut. Genauso gut, wie es sich anfühlt, als er im nächsten Moment ganz sanft seine Lippen auf meine legt. Und ich hatte recht: Der Kuss ist perfekt. So perfekt wie die Küsse in den alten Filmen, wenn der männliche Hauptdarsteller der Frau, die er liebt, die Hand auf den Rücken legt, um sie an sich zu ziehen, und sie sich unter dem sanften Druck seiner Lippen nach hinten biegt wie ein großes C. Ganz genau so.
Er zieht mich an sich, und als er hauchzart mit der Zunge über meine Lippen fährt, bin ich wie die Frauen in den alten Filmen erst mal zu überwältigt, um irgendetwas zu tun. Aber dann überkommt mich das Verlangen, ihn noch viel intensiver zu spüren, und ich öffne die Lippen und erwidere den Kuss. Er schmeckt nach Pfefferminzeis, und auch das ist perfekt, weil das, was hier gerade passiert, auf der Skala aller tollen Dinge schon jetzt ganz weit oben rangiert, direkt neben Nachtisch. Wenn es nicht so schön wäre, würde ich darüber lachen, dass dieser wildfremde Junge mich küsst, als hätte er sich genau das schon sein ganzes Leben lang gewünscht. Wieso tut er das? Es ist absurd.
Aber er nimmt mein Gesicht in beide Hände und küsst mich, als hätten wir von heute an bis in alle Ewigkeit nichts anderes mehr zu tun. Er hat es nicht eilig, und dass wir hier mitten auf dem größten Platz des Ortes stehen und schon zweimal angehupt wurden, ist ihm anscheinend auch völlig egal.
Die Arme um seinen Nacken geschlungen, beschließe ich, dass ich mich einfach küssen lasse, solange er will, weil ich heute sowieso nichts anderes vorhabe. Und selbst wenn, wäre mir das auch egal.
Genau in dem Moment, als er in meine Haare greift, platscht Wasser über meine Füße. Ich quietsche, und er lacht an meinen Lippen, hört aber nicht auf, mich zu küssen. Bald sind wir beide pitschnass, aber das kümmert uns nicht. Das macht diesen Kuss nur noch absurder.
Dann klingelt sein Handy. Aber es war ja klar, dass wir genau jetzt unterbrochen werden würden. Unser Kuss war einfach zu perfekt.
Als er sich von mir löst, wirkt sein Blick satt und hungrig zugleich. Er zieht sein Telefon aus der Tasche und schaut drauf. »Hm …?« Er sieht mich fragend an. »Hast du dein Handy irgendwo liegen lassen oder ist das jetzt ein Witz?«
Ich zucke nur mit den Schultern, weil ich keine Ahnung habe, welchen Teil von dem, was hier passiert, er für einen Witz hält. Dass ich zugelassen habe, dass er mich küsst? Dass ihn mitten in diesem Kuss jemand anruft?
Mit leisem Lachen hält er sich das Handy ans Ohr. »Äh … hallo?« Sein Lächeln erstirbt und jetzt sieht er nur noch verwirrt aus. »Wer ist dran?« Nach einer kurzen Pause nimmt er das Handy vom Ohr, schaut aufs Display, dann wieder zu mir, dann wieder aufs Display. »Im Ernst jetzt, was soll das? Wollt ihr mich irgendwie verarschen?«
Ich weiß nicht, ob er mit mir redet oder mit dem Anrufer, weshalb ich noch mal mit den Schultern zucke. Er nimmt das Handy wieder ans Ohr und tritt ein paar Schritte zurück. »Wer ist da dran?«, fragt er noch mal. Er lacht nervös und greift sich in den Nacken. »Aber du … du stehst doch direkt vor mir.«
Ich spüre, wie mir alle Farbe aus dem Gesicht oder wahrscheinlich aus dem ganzen Körper weicht und sich als Pfütze zu meinen Füßen sammelt, während ich mich wie eine schlechte Schwarz-Weiß-Kopie fühle. Eine billige Kopie von Honor Voss, meiner Zwillingsschwester – dem Mädchen, mit dem er offensichtlich gerade telefoniert.
Erst schlage ich die Hände vors Gesicht, dann bücke ich mich hastig nach meinen Schuhen, nehme meine Tüte und bringe so schnell wie möglich Abstand zwischen diesen Typen und mich, bevor ihm endgültig klar wird, dass das Mädchen, das er geküsst hat, nicht Honor war.
Ich fasse es nicht, dass das gerade wirklich passiert ist. Ich habe den Freund meiner Schwester geküsst!
Natürlich nicht mit Absicht. Ja, gut, ich hatte in letzter Zeit den Verdacht, dass sie vielleicht wieder jemanden kennengelernt haben könnte, weil sie so oft unterwegs war. Aber wie hätte ich ahnen sollen, dass ihr neuer Freund von allen Menschen auf der Welt ausgerechnet dieser Typ ist? Hektisch gehe ich davon, bin aber noch nicht weit gekommen, als ich seine Schritte hinter mir höre. »Hey!«, ruft er.
Jetzt ist klar, warum er mich in dem Laden so angelächelt hat. Er hat mich für sie gehalten. Deswegen hat er mich gefragt, warum ich nicht in der Schule bin. Wenn er Honor gut genug kennt, um sie zu küssen, kennt er sie auch gut genug, um zu wissen, dass sie niemals blaumachen würde.
Glühende Hitze steigt mir ins Gesicht, als ich begreife, was passiert ist. Das war keine schicksalhafte Begegnung zwischen zwei vollkommen Fremden. Das war ein Typ, der mich aus Versehen für seine Freundin gehalten hat. Und ich bin eine grenzenlose Idiotin, dass ich nicht gleich kapiert habe, was los ist.
Er fasst mich am Ellbogen, und mir bleibt gar nichts anderes übrig, als mich zu ihm umzudrehen, weil ich sicherstellen muss, dass Honor niemals davon erfährt. In seinem Blick ist jetzt keine Spur von Faszination mehr. Verlegen schaut er von mir zum Handy und dann wieder zu mir. »Sorry, das … das ist mir wahnsinnig peinlich«, sagt er. »Ich dachte, du wärst …«
»Ja, toll. Falsch gedacht«, fahre ich ihn an, obwohl er ja gar nichts dafür kann.
Honor und ich sind zwar eineiige Zwillinge, aber wenn er meine Schwester wirklich gut kennen würde, wüsste er, dass sie sich niemals so in der Öffentlichkeit blicken lassen würde, wie ich jetzt gerade aussehe. Ungeschminkt, ungekämmt und in denselben Klamotten wie gestern.
Wieder klingelt sein Handy und Honors Name blinkt im Display auf. Ich greife danach. »Hey.«
»Merit?« Honor lacht. »Wo bist du? Wo hast du Sagan getroffen?«
Sagan? Selbst sein Name ist perfekt.
»Wir sind uns … eben in der Stadt über den Weg gelaufen. Er dachte, ich wäre du, aber als du angerufen hast … na ja, sagen wir mal, er war ziemlich verwirrt.« Während ich spreche, sehe ich Sagan fest in die Augen. Er erwidert meinen Blick ruhig und macht keinen Versuch, mir das Handy abzunehmen.
»Echt? Wie krass.« Honor lacht wieder. »Ich hätte zu gern sein Gesicht gesehen.«
»Ja, das war ziemlich göttlich«, sage ich. »Trotzdem hättest du deinen Freund ruhig vorwarnen können, dass du eine eineiige Zwillingsschwester hast. Bis nachher.« Ich gebe Sagan das Handy zurück und gehe ein paar Schritte rückwärts, während er mich stumm ansieht. »Sag ihr bloß nicht, was passiert ist«, flüstere ich. »Sag es niemandem. Niemals.«
Er zögert, dann nickt er. Sobald ich die Bestätigung habe, dass Honor nichts erfahren wird, drehe ich mich um und gehe schnell davon. Das ist das Peinlichste, was mir in meinem ganzen Leben jemals passiert ist.
2.
Ich bin so doof.
Aber es war so schön … so schön unerwartet. Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. In der Sekunde, in der er mich geküsst hat, war ich verloren. Er schmeckte nach Pfefferminzeis und sein Mund war weich und warm und dann plätscherte das Wasser los, und dieser Ansturm auf alle meine Sinne hat dazu geführt, dass ich noch mehr wollte – die totale Überdosis. Ich wollte nicht denken, sondern nur noch fühlen. Und zwar alles. Dieser unerwartete Kuss hat mir das Gefühl gegeben, lebendig zu sein, und das hatte ich schon ewig nicht mehr … ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt schon jemals so lebendig gefühlt habe.
Genau das ist der Grund, warum ich gar nicht auf den Gedanken gekommen bin, er könnte mich mit Honor verwechseln. Ich war überwältigt – aber für ihn war das ganz normal. Klar. Wahrscheinlich küsst er Honor die ganze Zeit so.
Mich wundert nur, dass er so gesund aussah. Normalerweise hat meine Schwester ein ganz anderes Beuteschema.
Apropos meine Schwester …
Ich setze den Blinker und nehme beim zweiten Klingeln mein Handy vom Beifahrersitz. Komisch, dass sie mich anruft. Wir telefonieren sonst nie. Als ich an einem Stoppschild warten muss, melde ich mich mit bewusst gleichgültiger Stimme. »Hey.«
»Ist Sagan noch bei dir?«, fragt sie.
Ich schließe die Augen und stoße das letzte bisschen Restluft aus, das nach dem atemberaubenden Kuss noch in meiner Lunge übrig ist. »Sagan? Nein.«
Sie seufzt. »Komisch. Er geht nicht mehr ans Handy. Na gut, dann versuche ich es noch mal bei ihm.«
»Alles klar.«
Ich will gerade auflegen, da sagt sie: »Warum bist du eigentlich nicht in der Schule?«
»Mir war irgendwie schlecht, deswegen bin ich gegangen.«
»Ah. Okay. Dann bis später.«
»Honor, warte«, sage ich, bevor sie auflegt. »Was ist mit … Was hat Sagan?«
»Was soll er haben?«
»Na ja, du weißt schon. Bist du mit ihm befreundet, weil er … weil er bald stirbt?«
Einen Moment lang herrscht Stille in der Leitung, dann höre ich leichte Gereiztheit in Honors Stimme, als sie antwortet: »Oh Mann, Merit. Nein, natürlich stirbt er nicht. Du kannst manchmal echt ganz schön scheiße sein.« Sie legt auf und ich starre auf mein Handy.
Ich wollte sie mit der Frage nicht verletzen. Es interessiert mich wirklich, ob sie sich in ihn verliebt hat, weil er todkrank ist. Seit sie als Dreizehnjährige mit Kirk zusammen war, hatte sie nämlich nie mehr einen Freund mit normaler Lebenserwartung. Die Sache mit Kirk damals hat ihr das Herz gebrochen.
Kirk ist auf einer Farm in unserer Nähe aufgewachsen. Er war ein echt netter Kerl, konnte Traktor fahren, Heuballen pressen, wusste, was bei einem Kurzschluss zu tun ist, und hat sogar mal einen Wagen wieder fit bekommen, den mein Vater schon aufgegeben hatte.
Ungefähr einen Monat vor Honors und meinem fünfzehnten Geburtstag und zwei Wochen, nachdem sie mit Kirk zum ersten Mal Sex gehabt hatte, hat sein Vater ihn mit blutig gequetschtem Arm und halb bewusstlos auf einem Feld gefunden. Offenbar war er vom Traktor gerutscht und anschließend überrollt worden. Die Verletzung war zwar nicht lebensbedrohlich, aber der Arzt bestand trotzdem darauf, ihn gründlich zu untersuchen, um herauszufinden, weshalb er überhaupt vom Traktor gefallen war. Es stellte sich heraus, dass er einen epileptischen Anfall gehabt hatte. Ausgelöst durch einen Tumor, der in seinem Gehirn wuchs.
»Möglicherweise schon seit seiner Kindheit«, sagte der Arzt damals.
Nach der Diagnose hat Kirk noch drei Monate gelebt und Honor ist ihm in dieser Zeit praktisch nicht von der Seite gewichen. Sie war das erste und das letzte Mädchen, das er geliebt hat, und der letzte Mensch, den er sah, bevor er starb.
Kirks Tod – die Tatsache, dass ihre erste Liebe so früh gestorben ist – hat sie nachhaltig verstört. Seitdem hat sie nie mehr Interesse an gesunden Jungs mit durchschnittlicher Lebenserwartung gehabt, sondern treibt sich abends immer in irgendwelchen Patientenforen herum, wo sie mit Todkranken chattet. In unserer Kleinstadt leben natürlich nicht so viele tödlich erkrankte Typen in unserem Alter, aber Dallas ist nur zwei Stunden entfernt, und dort gibt es einige Kliniken mit hoffnungslosen Fällen. Seit Kirks Tod hatte meine Schwester mindestens zwei Freunde, die nur noch sechs Monate oder weniger gelebt haben. Honor ist in jeder freien Minute nach Dallas gefahren, um an den Tagen, die ihnen noch blieben, an ihrem Krankenbett zu sitzen. Irgendwie hat sie den – wenn man mich fragt – kranken Ehrgeiz entwickelt, möglichst das letzte Mädchen zu sein, das irgendwelche todgeweihten Jungs lieben, bevor sie das Zeitliche segnen.
Und deshalb interessiert es mich, was sie an Sagan reizt. Ist doch verständlich, dass ich sofort angenommen habe, er müsste todkrank sein, oder? Aber anscheinend macht mich das in ihren Augen zu jemandem, der ganz schön scheiße ist.
Als ich in die Einfahrt biege, stelle ich erleichtert fest, dass abgesehen von der Kellerbewohnerin niemand von der Familie da ist. Ich greife nach der Tüte mit dem Pokal und steige aus. Wenn ich vorhin im Laden geahnt hätte, dass ich gleich den mit Abstand erniedrigendsten Moment meines siebzehnjährigen Lebens durchmachen muss, hätte ich jeden einzelnen Pokal gekauft, den es dort gab. Dafür hätte ich dann zwar die Kreditkarte einsetzen müssen, die Dad mir »nur für Notfälle« gegeben hat, aber das wäre es mir wert gewesen.
Auf dem Weg über den Rasen werfe ich einen Blick auf die große Leuchttafel neben dem Eingang. Seit wir hier wohnen, geht mein Bruder Utah jeden Morgen mit einem Kasten Steckbuchstaben raus, um eine neue, mehr oder weniger nützliche Information daraufzuschreiben. Das macht er genauso verlässlich und gewissenhaft, wie er auch alles andere in seinem Leben erledigt.
Utah steht jeden Morgen um Punkt 6:20 auf, duscht um 6:30, zieht sich an und bereitet um 6:55 zwei grüne Smoothies zu – einen für sich und einen für Honor (falls sie das nicht schon vor ihm getan hat). Pünktlich um 7:10 erneuert er die Info an der Leuchttafel, gegen 7:30 führt er mit unserem kleinen Bruder Moby einen immer gleichen, total nervigen Motivationsdialog und fährt anschließend pünktlich zur Schule beziehungsweise (an den Wochenenden) ins Fitnessstudio. Sein Trainingsplan ist immer derselbe: 45 Minuten bei Stufe 5 auf dem Laufband, danach einhundert Liegestütze und zweihundert Sit-ups.
Mit Spontaneität kann er nicht umgehen. Für ihn müsste der Satz »Erwarte das Unerwartete« umgeschrieben werden in »Erwarte nur das Erwartbare«. Utah hält nichts davon, wenn Dinge passieren, mit denen er nicht gerechnet hat.
Er hat nichts davon gehalten, dass unsere Eltern sich vor ein paar Jahren scheiden ließen. Er hat nichts davon gehalten, dass unser Vater kurz darauf neu geheiratet hat. Und er hat erst recht nichts davon gehalten, dass unsere neue Stiefmutter zu dem Zeitpunkt schon ziemlich schwanger war.
Dafür hält er umso mehr von dem Kind, das aus dieser Schwangerschaft hervorgegangen ist – unserem Halbbruder Moby Voss. Es ist aber auch schwierig, Moby nicht zu mögen. Nicht weil er jetzt so wahnsinnig außergewöhnlich toll wäre, sondern weil er erst vier ist. Vierjährige findet ja fast jeder süß.
Heute steht auf der Leuchttafel: WENNMANSICHDIENASEZUHÄLT, KANNMANNICHTSUMMEN.
Das stimmt. Ich habe es heute Morgen ausprobiert, als ich den Spruch beim Rausgehen gelesen habe, und teste es gleich noch mal, während ich auf die große, aus Zedernholz geschnitzte Flügeltür zugehe.
Es ist mit Sicherheit nicht übertrieben zu sagen, dass wir im ungewöhnlichsten Gebäude des gesamten Landkreises leben. Ich sage »Gebäude«, weil ich es nicht wirklich als Haus und noch viel weniger als Zuhause bezeichnen kann. Von außen betrachtet würde kein Mensch auf die Idee kommen, dass hier eine siebenköpfige Familie wohnt, zu deren Mitgliedern unter anderem ein eingefleischter Atheist, eine ehemalige heimliche Geliebte, eine Ex-Ehefrau mit ausgeprägter Angststörung und ein Mädchen mit fast schon nekrophilen Neigungen gehören.
Von innen würde man allerdings auch nicht darauf kommen, dass irgendetwas ungewöhnlich sein könnte, weil sämtliche Mitglieder der Familie Voss Meister im Bewahren dunkler Geheimnisse sind.
Das Gebäude liegt etwas abseits der Hauptstraße einer mikroskopisch kleinen Gemeinde im Nordwesten von Texas. Früher war darin einmal die meistbesuchte Kirche des Bezirks untergebracht, bis unser Vater, Barnaby Voss, sie gekauft und ihre Türen auf unbestimmte Zeit vor den Gläubigen verschlossen hat. Was erklärt, weshalb eine Leuchttafel neben dem Eingang steht. Als das Gebäude noch eine Kirche war, konnte man darauf erbauliche Bibelsprüche und die Anfangszeiten der Gottesdienste lesen, heute stehen dort Utahs täglich wechselnde Fun Facts.
Mein Vater ist zwar Atheist, aber das ist nicht der Grund, warum er die Kirche gekauft und der Gemeinde entrissen hat. Nein, Gott hatte damit rein gar nichts zu tun.
Er hat die Kirche gekauft, weil er den Hund, der damals auf dem Grundstück lebte, aus tiefstem Herzen gehasst hat, und damit auch seinen Besitzer, Pastor Brian.
Wolfgang war ein riesiger schwarzer Labrador, der entsprechend laut bellte, aber von eher schlichtem Gemüt war. Wäre die Hundewelt eine Highschool, wäre Wolfgang das lauteste Großmaul aus dem Footballteam gewesen. Von den acht kostbaren Stunden Schlaf, die mein Vater nachts braucht, um morgens fit zu sein, bellte er mindestens sieben ununterbrochen durch. Das nervte.
Damals wohnten wir noch in dem Haus hinter der Kirche, wodurch wir dummerweise Wolfgangs direkte Nachbarn waren. Vom Schlafzimmer meiner Eltern aus schaute man auf den Platz hinter dem Gebäude, auf dem Wolfgang sich meistens herumtrieb und alles und jeden anbellte – genau zu der Zeit, zu der mein Vater ihn lieber schlafend gesehen hätte. Aber Wolfgang ließ sich nicht vorschreiben, was er zu tun oder wann er zu ruhen hatte. Er tat gern das Gegenteil von dem, was andere von ihm wollten.
Pastor Brian hatte sich Wolfgang als Welpen zugelegt, nachdem in der Woche zuvor eine Gruppe von Jugendlichen in seine Kirche eingebrochen war und die Kollekte geklaut hatte. Er hoffte, ein Wachhund würde so etwas in Zukunft verhindern. Allerdings hatte Pastor Brian offensichtlich keine Ahnung von Hunden und dass sie erzogen werden müssen, erst recht solche mit den beschränkten geistigen Fähigkeiten eines Highschool-Quarterbacks. Weil Wolfgang von klein auf praktisch nur mit seinem Besitzer Kontakt hatte, richtete er seine grenzenlose Energie und Neugier auf den Menschen, der hinter dem Zaun neben seiner Hütte lebte: meinen Vater Barnaby Voss. Und da er nie gelernt hatte, wie man sich im Kontakt mit anderen Lebewesen verhält, bellte er eben.
Klar, dass mein Vater kein Fan von Wolfgang wurde. Er verbot mir und meinen Geschwistern, in die Nähe des Hundes zu gehen, und wir hörten ihn oft wütend zischen, dass er Wolfgang eines Tages umbringen würde. Manchmal brüllte er es auch.
Mein Vater glaubt zwar nicht an Gott, aber er ist der festen Überzeugung, dass es so etwas wie Karma gibt. Obwohl er sich manchmal ausgemalt hat, Wolfgang umzubringen, wollte er auf keinen Fall einen Mord an einem Tier begehen. Nicht einmal an dem Tier, das er mehr hasste als alle anderen Tiere, denen er je begegnet war.
Es ist anzunehmen, dass Wolfgang ihm gegenüber auch keine sonderlich freundschaftlichen Gefühle hegte, jedenfalls verbrachte er den größten Teil seines Lebens damit, meinen Vater abwechselnd anzubellen oder anzuknurren, egal ob es Tag oder Nacht war, unter der Woche oder Wochenende. Nur ganz selten gab es mal kurze Bellpausen, wenn er abgelenkt war und einem Eichhörnchen hinterherjagte.
Im Laufe der Jahre versuchte mein Vater alles Mögliche, um der unaufhörlichen Ruhestörung ein Ende zu setzen: von Ohrstöpseln bis hin zu Unterlassungsklagen. An einem Freitag, an dem er nicht wie sonst ein, sondern vier Gläser Wein zum Feierabend getrunken hatte, probierte er es sogar drei ganze Stunden lang damit, zurückzubellen. Nichts davon brachte irgendetwas. Er sehnte sich so verzweifelt nach Schlaf, dass er zuletzt einen ganzen Sommer lang alles tat, um sich mit Wolfgang anzufreunden, in der Hoffnung, dass das Gebell dann endlich aufhören würde.
Tat es nicht.
Nichts funktionierte. Und so wie es aussah, würde sich an der Situation auch nie mehr etwas ändern, weil Pastor Brian Wolfgang nun mal mehr liebte als seinen atheistischen Nachbarn Barnaby Voss. Zu Pastor Brians Pech kämpfte seine Kirche aber ausgerechnet zu dem Zeitpunkt mit finanziellen Schwierigkeiten, zu dem der Gebrauchtwagenhandel meines Vaters satte Gewinne abwarf. Gewinne, die so groß waren wie sein Rachedurst.
Vor fünf Jahren machte mein Vater der Bank, der das Kirchengebäude gehörte, schließlich ein Kaufangebot, das so hoch war, dass Pastor Brian ihm beim besten Willen nichts entgegensetzen konnte. Dass der zuständige Sachbearbeiter der Kreditabteilung in derselben Woche bei meinem Vater zu einem erstaunlich günstigen Preis einen gebrauchten Volvo erwerben konnte, hat sicher auch nicht geschadet.
An dem Tag, an dem Pastor Brian seinen Schäfchen verkündete, dass er den Bieterwettstreit verloren hatte und dass mein Vater mit seiner gesamten Familie in die Kirche einziehen würde, weshalb sich die Kirchengemeinde eine neue Unterkunft suchen müsse, begann das Gerede über uns. Und seitdem ist es nie mehr verstummt.
Nachdem mein Vater den Kaufvertrag unterschrieben hatte, gab er Pastor Brian und Wolfgang zwei Tage, das Grundstück zu verlassen. Sie brauchten drei. In der vierten Nacht schlief mein Vater dreizehn Stunden am Stück.
Pastor Brian war gezwungen, seine Sonntagspredigten woanders zu halten, aber da er göttlichen Beistand hatte, fand er innerhalb kürzester Zeit einen Alternativstandort für seine Kirche. Schon eine Woche später konnte er seine Gemeinde in einer ausgebauten Scheune empfangen, in der unser örtlicher Diakon bis dahin seine persönliche Traktorensammlung untergestellt hatte. Die ersten drei Monate saßen die Gemeindemitglieder auf Heuballen, während Pastor Brian von einer improvisierten, aus Paletten zusammengebauten Kanzel zu ihnen sprach.
Sechs ganze Monate lang betete Pastor Brian jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes für die Errettung der fehlgeleiteten Seele meines Vaters. »Möge er seinen Irrtum eines Tages einsehen«, flehten Pastor und Schäfchen inbrünstig, »und uns unser schönes Haus des Herrn zurückgeben … zu einem guten Preis.«
Dass er auf Pastor Brians Fürbittenliste ganz oben stand, gefiel meinem Vater gar nicht. Er glaubt nicht daran, dass er eine Seele hat, erst recht keine fehlgeleitete. Und auf gar keinen Fall wollte er, dass die Kirchgänger auch noch für diese nicht existierende Seele beteten.
Etwa sieben Monate nach dem Einzug unserer Familie in die ehemalige Kirche sah man Pastor Brian das erste Mal in einem gebrauchten, aber äußerst gut erhaltenen kirschroten Cadillac Cabrio durch den Ort fahren. Zufälligerweise fehlte der Name Barnaby Voss am darauffolgenden Sonntag im Fürbittengebet und wurde seitdem auch nie wieder erwähnt.
In den vergangenen fünf Jahren, in denen mein Vater wieder ungestört schlafen konnte, haben wir eine Menge getan, um die Kirche umzubauen, trotzdem gibt es ein paar Dinge, die uns und andere immer daran erinnern werden, dass dies früher einmal ein Haus Gottes war.
Die Buntglasfenster.
Das zweieinhalb Meter hohe Kruzifix an der Wohnzimmerwand.
Die Leuchttafel neben dem Eingang.
Vor unserem Einzug stand oben auf der Tafel groß der Name der Kirche – »Crossroads Lutheran Church« –, den mein Vater allerdings umgehend abgenommen hat. Heute steht dort »The Voss Dollar«.
Er hat das Gebäude so getauft, weil es genau wie ein Dollar in vier Quarter beziehungsweise Quartiere unterteilt ist und weil unsere Familie Voss mit Nachnamen heißt. Ja, ich weiß … ich wünschte, es gäbe eine weniger bescheuerte Erklärung.
Ich ziehe die schwere Flügeltür am Eingang auf und betrete Quartier Eins, die ehemalige Andachtshalle, die in einen modernen Wohnbereich mit offener Küche umgewandelt wurde, in dem nichts mehr an eine Kirche erinnert bis auf besagten Jesus am Kreuz, der nach wie vor an der Wand hängt. Utah und mein Vater haben im ersten Sommer ein paar Tage lang im Schweiße ihres Angesichts versucht, das Kreuz von der Wand zu stemmen, was aber, wie sich herausstellte, unmöglich war, da es so mit dem Haus verbaut ist, dass man die ganze Wand einreißen müsste, um es zu entfernen. Weil das meinem Vater dann doch zu weit gegangen wäre, hat er sich damit abgefunden, den gigantischen Jesus hängen zu lassen. »Hässlich ist er ja nicht«, hat er gesagt.
Für einen Atheisten wie ihn ist ein ans Kreuz genagelter Jesus Christus nichts weiter als ein dekorativer Wandschmuck. Ein Wandschmuck mit durchbohrten Händen und Füßen, aus denen Blut quillt. Irgendwann fing ich an, unseren Herrn Jesus immer passend zur Jahreszeit oder zu aktuellen Anlässen anzuziehen. Weil Halloween ist, trägt er im Moment ein weißes Laken mit Augenlöchern.
Im Quartier Zwei, wo sich früher drei Klassenzimmer für die Sonntagsschule und Gebetskreise befanden, sind Zwischenwände eingezogen worden, um es in sechs kleine Räume zu unterteilen. Meine drei Geschwister und ich bewohnen vier davon. Der fünfte ist ein Gästezimmer, und im sechsten hat sich mein Vater ein Arbeitszimmer eingerichtet, das er allerdings noch nie benutzt hat.
Quartier Drei ist der ehemalige Speisesaal, der zum großen Elternschlafzimmer umfunktioniert wurde. Hier schlummert mein Vater jede Nacht mindestens acht Stunden tief, fest und ungestört neben Victoria Finney-Voss, die seit vier Jahren und zwei Monaten im Voss Dollar wohnt. Sie ist drei Monate vor der Scheidung meines Vaters von meiner Mutter und sechs Monate vor der Geburt des vierten und hoffentlich auch letzten Kindes meines Vaters hier eingezogen.
Kommen wir zum vierten Quartier des Voss Dollars, das ein wenig abgelegener ist. Ein etwas heikles Thema.
Es geht um den Keller.
Den Keller, der zu einem kleinen Apartment umgebaut worden ist, das aus einem Wohn- und Schlafbereich mit Miniküche und einem Duschbad besteht.
Hier ist das Reich meiner Mutter Victoria Voss, nicht zu verwechseln mit der derzeitigen Frau meines Vaters gleichen Namens. Es ist etwas unglücklich, dass sich mein Vater von einer Victoria scheiden ließ und sofort eine andere Victoria heiratete, aber nicht annähernd so unglücklich wie die Tatsache, dass beide Victorias im Voss Dollar wohnen.
Die aktuelle Victoria Voss ist übrigens nicht nach der Scheidung in das Leben meines Vaters getreten, um ihn über seine gescheiterte erste Ehe hinwegzutrösten. Im Gegenteil. Man muss hier eher von einem gleitenden Übergang sprechen, der das Verhältnis der drei erwachsenen Bewohner nach wie vor belastet.
Obwohl meine Mutter nie aus den Tiefen ihre Quartiers nach oben steigt, ist ihre Anwesenheit doch für alle deutlich spürbar. Am meisten vermutlich für die neue Frau meines Vaters, die nicht allzu glücklich darüber war, dass seine ehemalige Frau weiterhin im Voss Dollar wohnen blieb.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es hart ist, mit der Ex-Frau des eigenen Mannes zusammenleben zu müssen. Aber wahrscheinlich ist es nicht mal annähernd so hart, wie todkrank zu sein und zu erfahren, dass der eigene Mann ein Verhältnis mit der Pflegerin angefangen hat.
Aber das ist jetzt ja schon viele, viele Jahre her und meine Geschwister und ich haben meinem Vater längst verziehen.
Irrtum. Haben wir nicht. Ganz und gar nicht.
Das Thema wird bei uns allerdings nicht offen angesprochen, was sicher auch damit zu tun hat, dass wir in den letzten Jahren vor allem damit beschäftigt waren, das Gebäude so umzubauen, dass wir alle darin wohnen können. Im Übrigen wirken wir – auch wenn wir das nicht sind – wie eine ganz normale Familie, und selbst der Voss Dollar sieht – abgesehen von den Buntglasfenstern, dem Riesenkruzifix im Wohnzimmer und der Leuchttafel – wie ein relativ normales Wohnhaus aus.
Als hier noch eine Kirche war, standen auf der Leuchttafel Sachen wie WERGEGENÜBERALLEMOFFENIST, MUSSAUFPASSEN, DASSIHMDASHIRNNICHTRAUSFÄLLToder THEMADERSONNTAGSPREDIGT: FIFTYSHADESOFPRAY.
Ich frage mich, was die Leute denken, wenn sie jetzt bei uns vorbeifahren und lesen, was Utah zu verkünden hat. Gestern zum Beispiel: AUFDERMEDAILLEFÜRDENFRIEDENSNOBELPREISSINDDREINACKTEMÄNNERABGEBILDET, DIESICHUMARMEN.
Manchmal lache ich darüber, aber eigentlich ist es mir eher peinlich. Die Leute lassen uns sowieso schon spüren, wie unangebracht sie es finden, dass wir in ihrer ehemaligen Kirche wohnen. Solche Aktionen verstärken ihre Vorurteile nur noch. Dabei gibt sich mein Vater wirklich Mühe, das Gebäude mehr nach Wohn- als nach Gotteshaus aussehen zu lassen. Letztes Jahr hat er sogar zwei Wochen damit verbracht, einen spießigen Gartenzaun aus Holzlatten zu zimmern und weiß anzustreichen. Ich weiß nicht, ob das viel gebracht hat. Jetzt sieht das Gebäude aus wie eine ehemalige Kirche mit einem weißen Lattenzaun drum herum. Immerhin hat er guten Willen bewiesen.
Ich gehe direkt ins Quartier Zwei, mache die Tür meines Zimmers hinter mir zu, lasse die Tüte auf den Boden fallen und werfe mich aufs Bett.
Mittlerweile ist es kurz vor drei, was bedeutet, dass Moby und Victoria bald wieder zurück sein müssen. Honor und Utah kommen danach auch langsam aus der Schule. Zuletzt mein Vater. Und anschließend gibt es Abendessen. Halleluja.
Ich habe schon jetzt mehr als genug von diesem Tag und bin mir nicht sicher, ob ich den Rest davon auch noch ertragen kann. Seufzend hieve ich mich vom Bett hoch, gehe ins Bad und krame in den Schränken nach einem Schlafmittel. Normalerweise nehme ich so etwas nicht, aber ich weiß nicht, wie ich den Tag überstehen soll, wenn mich die ganze Zeit paranoide Gedanken quälen, weil ich Honors Freund geküsst habe. Zum Glück finde ich im Schrank unter dem Waschbecken eine noch halb volle Flasche NyQuil Erkältungssaft für die Nacht. Genau das, was ich jetzt brauche.
Nachdem ich einen großen Schluck genommen habe, verkrieche ich mich in meinem Bett unter der Decke und schicke meinem Vater eine Nachricht aufs Handy:
Ich: Ich fühle mich ein bisschen krank und bin früher aus der Schule nach Hause, um mich hinzulegen. Kann gut sein, dass ich bis morgen durchschlafe.
Ich schalte mein Handy stumm, lege mir ein Kissen aufs Gesicht und schließe die Augen, was aber überhaupt nicht hilft. Ich sehe immer noch Sagan vor mir. Dadurch, dass Honor und ich kein so enges Verhältnis mehr haben wie früher, ist es nicht verwunderlich, dass ich nichts von ihm wusste. Mir ist zwar aufgefallen, dass sie öfter unterwegs war, aber ich habe sie nie gefragt, was sie macht. Keine Ahnung, ob sie ihn jemals hierher mitgebracht hat, falls ja, bin ich ihm jedenfalls nicht begegnet. Woher hätte ich denn bitte wissen sollen, dass der Typ ihr neuer Freund ist?
Hätte ich es gewusst, wäre diese grauenhafte Peinlichkeit am Brunnen niemals passiert. Wenn dieser Sagan auch nur einen Funken Anstand im Leib hat, muss er sofort mit ihr Schluss machen und darf niemals einen Fuß in dieses Gebäude setzen, damit wir uns nicht noch mal über den Weg laufen. So verliebt können die beiden nicht sein. Sie kennen sich ja kaum. Das Ganze kann erst ein paar Wochen gehen, sonst hätte ich davon gewusst. Kein Typ, der einigermaßen bei Verstand ist, würde sich zwischen zwei Schwestern drängen. Erst recht nicht zwischen Zwillinge.
Wobei ich nicht so verblendet bin zu glauben, er könnte an mir interessiert sein. Nein. Das war eindeutig eine Verwechslung. Er hat mich für Honor gehalten. Wenn er gewusst hätte, dass ich ihre Schwester bin, hätte er niemals solche kitschigen und verwirrenden Sachen gesagt wie »Begrabe mich« und danach seine Lippen auf meine gepresst. Bestimmt lacht er sich gerade über mich tot. Wahrscheinlich erzählt er Honor früher oder später davon und dann lachen sich beide über mich tot.
Über die jämmerliche, doofe Merit, die sich ernsthaft eingebildet hat, dieser süße Typ hätte sich spontan in sie verknallt.
Ich schäme mich und das macht mich wütend. Als er mich geküsst hat, hätte ich ihm eine runterhauen sollen. Wenn ich das gemacht hätte, würden wir jetzt zusammen darüber lachen, dass er mich verwechselt hat. Stattdessen habe ich mich ihm an den Hals geworfen und so viel von ihm aufgesaugt, wie ich nur konnte. So viel, dass ich mehr davon möchte. Und genau das regt mich am meisten auf. Ich will nicht neidisch auf Honor sein. Aber wenn ich daran denke, dass Sagan sie so küsst, wie er mich geküsst hat, spüre ich richtig, wie mich der Neid grün färbt.
Ich habe immer Angst davor gehabt, dass so etwas mal passiert. Dass mich irgendjemand mit ihr verwechseln und in eine peinliche Situation bringen könnte. Leider sehen wir uns wirklich sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass sie Kontaktlinsen trägt und ich nicht. Im Laufe unseres Lebens habe ich alles Mögliche ausprobiert, um mich von Honor zu unterscheiden. Ich habe abwechselnd gehungert oder mich mit Fast Food und Süßigkeiten vollgestopft und mir sogar die Haare gefärbt und abgeschnitten, aber es hilft nichts. Irgendwie sehen wir trotzdem immer gleich aus, wiegen gleich viel und klingen gleich.
Aber wir sind nicht gleich.
Ich bin kein bisschen wie meine eineiige Zwillingsschwester, die tote Herzen den lebendigen vorzieht.
Ich bin auch nicht wie mein Vater Barnaby, der aus Hass auf einen Hund unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat.
Ich bin ganz bestimmt kein bisschen so wie mein Bruder Utah, der jeden wachen Moment damit verbringt, so perfekt und fehlerfrei und angepasst wie möglich zu wirken, weil er genau weiß, dass er in Wirklichkeit alles andere als perfekt und fehlerfrei ist.
Und ich bin mit absoluter Sicherheit weit davon entfernt, wie meine Mutter Victoria zu sein, die Tag und Nacht in Quartier Vier hockt, Netflix schaut, das Salz von Kartoffelchips leckt, von ihrer Behindertenrente lebt und sich weigert, aus dem Gebäude auszuziehen, in dem ihr Ex-Mann mit seiner neuen Victoria eine Zweitfamilie gegründet hat.
Als ich höre, wie die Eingangstür aufgeschlossen wird, beginnt das NyQuil zum Glück schon zu wirken. Moby stürmt in die Küche, und seine laute Stimme hallt durch den Flur, gefolgt von der seiner Mutter, die ihn ermahnt, sich unbedingt die Hände zu waschen, bevor er etwas isst.
Ich nehme meine Kopfhörer vom Nachttisch, um den Klang meiner Familie mit dem von Seafret zu übertönen.
3.
Ich hatte so sehr gehofft, Sagan nicht wiedersehen zu müssen. Ich hatte gehofft, Honor würde ihn niemals hierherbringen, weil er sich von ihr getrennt hätte. Diese Hoffnung hielt mich aufrecht, bis sie jäh zerstört wurde.
Das ist jetzt fast zwei Wochen her.
Und in diesen zwei Wochen war er öfter hier, als ich zählen kann. Er kommt schon zum Frühstück, isst mit uns zu Abend und scheint sich in unserer Familie so wohlzufühlen, dass er auch zwischendurch gerne hier abhängt.
Ich habe kein einziges Wort mit ihm gewechselt, seit er – keine vierundzwanzig Stunden nach dem verhängnisvollen Kuss – das erste Mal bei uns aufgetaucht ist. Nichts ahnend war ich morgens im Schlafanzug zum Frühstückstisch geschlurft, als ich ihn am Tisch sitzen sah und mir kurz das Herz stehen blieb. Ich bin ganz schnell abgebogen und zum Kühlschrank gegangen, aber mein Herz hat sich angefühlt wie eine Flipperkugel, die klackernd zwischen meinen Rippen hin und her springt.
Irgendwie habe ich das Frühstück überstanden, indem ich mich aufs Essen konzentriert und mit niemandem geredet habe. Als nach und nach alle ihre Sachen zusammengepackt haben, wollte ich gerade einen erleichterten Seufzer ausstoßen, bis mir auffiel, dass Sagan immer noch in der Küche stand und keine Anstalten machte, das Haus zu verlassen. Ich hörte, wie Honor sich von ihm verabschiedet hat. Ob sie ihm einen Abschiedskuss gegeben hat, weiß ich nicht, weil ich mit dem Rücken zu ihnen saß und mich bewusst nicht umgedreht habe. So interessant finde ich die beiden dann auch nicht. Wobei ich schon gern wüsste, wie er darauf kommt, dass es okay ist, im Haus seiner neuen Freundin zu bleiben, nachdem sie selbst zur Schule gefahren ist. Denn das ist genau das, was er getan hat.
Als alle weg waren und nur noch wir beide am Tisch saßen, war mir das so unangenehm, dass ich aufgesprungen bin, in die Küche rannte und anfing, die Arbeitstheke zu wischen, obwohl sie blitzsauber war. Er hat drei halb volle Gläser vom Tisch gebracht und die Reste ins Spülbecken gegossen.
Im Raum hing eine bleierne Stille, die das, was zwischen uns passiert war, noch viel dramatischer wirken ließ, als es war.
»Willst du darüber reden?«, fragte er und öffnete die Spülmaschine, als hätte er das Recht, bei uns Geschirr einzuräumen. Er stellte die Gläser in den oberen Spülkorb, machte die Klappe zu, trocknete sich die Hände am Geschirrtuch ab und warf es auf die Theke. Ich schüttelte nur den Kopf, um zu zeigen, dass ich kein Interesse daran hatte, das Thema aufzuwärmen.
Er seufzte. Dann sagte er: »Merit?«, und ich machte den Fehler, ihn anzusehen. Was keine gute Idee war, weil er so zerknirscht aussah, dass ich nicht wütend sein konnte. »Es tut mir wirklich leid. Ich hab einfach … ich hab wirklich gedacht, du wärst sie. Sonst hätte ich dich doch niemals geküsst.«
Die Entschuldigung klang aufrichtig, aber sosehr ich versuchte, seine Offenheit zu würdigen, war es doch vor allem der letzte Satz, der hängen blieb. Sonst hätte ich dich doch niemals geküsst.
Irgendwie fühlte sich das eher nach Beleidigung als nach Entschuldigung an. Eigentlich sollte ich darüber lachen. Das Ganze war nichts weiter als eine dumme Verwechslung, von der Honor nie erfahren wird, aber ich kann nicht darüber lachen, dazu hat es mich viel zu tief berührt. Trotzdem habe ich mein Bestes getan, gleichgültig zu wirken.
»Mach dir deswegen keinen Kopf«, sagte ich achselzuckend. »Normalerweise hätte ich dir gleich eine geknallt, aber ich war einfach zu überrumpelt, um zu reagieren, als du plötzlich über mich hergefallen bist.«
Über sein Gesicht huschte ein Ausdruck, den ich nicht deuten konnte, aber ich wartete nicht ab, ob er noch etwas sagen würde, sondern grinste gezwungen und ging dann schnell in mein Zimmer.
Seit diesem Tag haben wir kein einziges Wort mehr gewechselt.
Nicht beim Frühstück, nicht beim Abendessen und auch nicht, wenn er bei uns im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzt.
Dass wir nicht miteinander sprechen, heißt leider nicht, dass ich es nicht jedes Mal ganz deutlich spüre, wenn er mich ansieht. Ich atme dann immer tief durch, um meinen Puls unter Kontrolle zu bekommen, weil ich seinen Blick nicht spüren will. Ich will nicht neidisch auf Honor sein. Wahrscheinlich ist es ja auch gar nicht ihr blöder Freund, der mir gefällt, sondern nur die Vorstellung, jemand könnte so fasziniert von mir sein, dass er das Verlangen hat, mich so zu küssen, wie er mich an dem Tag geküsst hat. Mit ihm als Person hat das gar nichts zu tun. Ich könnte nicht mal sagen, ob ich ihn überhaupt sympathisch finde. Ich kenne ihn ja gar nicht! Und weil ich ihn auch nicht näher kennenlernen will, gehe ich ihm aus dem Weg.
Übrigens bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass er gar nicht Honors Typ ist. Vielleicht ist es ja Wunschdenken, aber ich spüre zwischen den beiden nicht den kleinsten Funken.
Ich gebe mir Mühe, seine ständige Anwesenheit bei uns hinzunehmen, trotzdem macht mich die Situation ziemlich fertig. Wobei ich jetzt im Moment gerade das Gefühl habe, dass mein eigenes Unglück vielleicht gar nicht so schlimm ist, denn der Anblick, der sich mir bietet, ist wirklich mitleiderregend.
Es ist schon weit nach Mitternacht. Eben habe ich die Eingangstür geöffnet und starre in die verängstigten Augen von Wolfgang. Ja, genau. In die Augen des Hundes, der meinen Vater so viele Jahre lang mit seinem Gebell terrorisiert hat.
Was für eine reizende Überraschung.