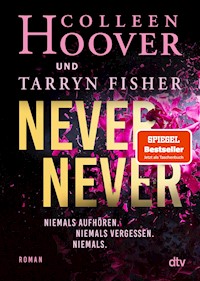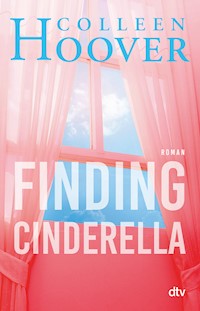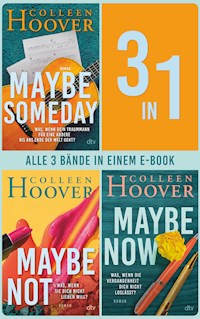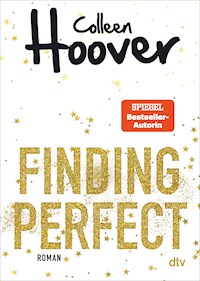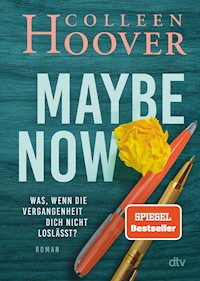12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: dtv bold
- Sprache: Deutsch
»Voller aufwühlender Emotionen, düster, faszinierend und extrem süchtig machend.« TotallyBooked Blog Ein unmoralisches Angebot. Eine unmögliche Liebe. Und ein Tagebuch, das Unvorstellbares enthüllt … Ein Romantik-Thriller voller Emotionen und Gänsehaut-Faktor. Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann: Sie soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den Tod ihrer beiden Töchter folgte, nicht mehr ansprechbar und ein dauerhafter Pflegefall. Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und darin offenbart sich Lowen Schreckliches … Leidenschaftliche Gefühle, dunkle Atmosphäre und nervenzerreißende Spannung. »Warnung: Verity wird Ihr Herz nicht erweichen. Es wird Ihnen die Seele erstarren lassen.« Kindle Crack Book Reviews Mit einem neuen Epilog, der alles verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann: Sie soll die erfolggekrönten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den Tod ihrer beiden Töchter folgte, nicht mehr ansprechbar und zum Pflegefall geworden. Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy stark hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und liest darin Erschreckendes …
Von Colleen Hoover sind bei dtv lieferbar:
Weil ich Layken liebe | Weil ich Will liebe | Weil wir uns lieben
Hope Forever | Looking for Hope | Finding Cinderella
Love and Confess
Zurück ins Leben geliebt – Ugly Love
Nächstes Jahr am selben Tag – November 9
Nur noch ein einziges Mal – It ends with ust
Never Never (zusammen mit Tarryn Fisher)
Maybe Someday | Maybe not | Maybe Now
Die tausend Teile meines Herzens
Was perfekt war
Verity
All das Ungesagte zwischen uns
Finding Perfect
Layla
Für immer ein Teil von dir
Summer of Hearts and Souls
It starts with us – Nur noch einmal und für immer
Too Late – Wenn Nein sagen zur tödlichen Gefahr wird
Nur noch wenige Tage – Saint & The Dress. Zwei Stories
Colleen Hoover
Verity
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katarina Ganslandt
Dieses Buch ist dem einzigen Menschen
gewidmet, dem man dieses Buch
widmen kann:
Tarryn Fisher,
danke, dass du in anderen die Finsternis
genauso akzeptieren kannst wie das Licht
1
Erst höre ich das Geräusch seines berstenden Schädels, dann spritzt mir sein Blut entgegen.
Ich ringe entsetzt nach Luft und springe mit einem Satz auf den Gehweg zurück, bleibe aber mit einem meiner hohen Absätze an der Bordsteinkante hängen und muss mich an einem Parkverbotsschild festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Eben stand der Mann noch direkt vor mir. Wir haben zusammen mit einer Gruppe anderer Fußgänger darauf gewartet, dass die Ampel auf Grün schaltet, als er unvermittelt loslief. Aus dem Augenwinkel sah ich den Lieferwagen heranrasen, machte instinktiv einen Schritt nach vorn und streckte den Arm aus, da erfasste ihn der Wagen mit voller Wucht und ich griff ins Leere. Bevor er überrollt wurde, schloss ich die Augen, hörte aber deutlich dieses Geräusch, das sich anhörte wie das Ploppen eines Champagnerkorkens.
Sein Blick war beiläufig auf sein Handy gerichtet gewesen, als es ihn erwischte. Wahrscheinlich hatte er die Straße an dieser Ampel schon so oft überquert, ohne dass etwas passiert war, dass er unvorsichtig geworden war. Tod durch Routine.
Die Leute um mich herum schnappen nach Luft, aber niemand schreit. Die Beifahrertür des Lieferwagens wird aufgerissen, ein Mann springt heraus und kniet sich neben den Überfahrenen. Ein paar der Umstehenden stürzen los, um zu helfen, ich nicht. Ich muss nicht hinsehen, um zu wissen, dass er nicht überlebt haben kann. Ein Blick auf meine eben noch blütenweiße, jetzt mit Blut befleckte Bluse genügt und es ist klar, dass hier kein Kranken-, sondern ein Leichenwagen gebraucht wird.
Ich drehe mich um, will weg von hier, irgendwohin, wo ich tief durchatmen kann, aber mittlerweile leuchtet das WALK-Zeichen und die Menge um mich herum setzt sich mechanisch in Bewegung. Es ist, als würde ich mitten in Manhattan in einem reißenden Fluss stehen. Unmöglich, gegen den Strom anzuschwimmen. Einige Leute schauen nicht mal von ihrem Telefon auf, als sie an dem Ort vorbeigehen, an dem gerade ein Mensch sein Leben verloren hat. Während ich darauf warte, dass sich das Gedränge lichtet, werfe ich einen Blick zur Unfallstelle. Der Fahrer des Trucks steht jetzt am Heck seines Fahrzeugs und spricht mit schreckgeweiteten Augen in sein Handy. Drei, vier Passanten versuchen sich nützlich zu machen, ein paar sensationslüsterne Gaffer filmen die gruselige Szene.
Wäre dieser Unfall in Virginia passiert, wo ich lange gelebt habe, wäre niemand einfach weitergegangen, im Gegenteil – Panik wäre ausgebrochen, Leute hätten entsetzt aufgeschrien, innerhalb von Minuten wäre der Übertragungswagen eines Nachrichtensenders vor Ort gewesen. Aber hier in Manhattan ist man an Unfälle so gewöhnt, dass sie von den meisten Leuten wohl in erster Linie als Unannehmlichkeit wahrgenommen werden. Für die einen bedeuten sie ein Verkehrshindernis, für andere ein ruiniertes Kleidungsstück. Wahrscheinlich ist das hier nicht einmal eine Randnotiz in den Zeitungen wert.
Sosehr mich diese Gleichgültigkeit der Masse stört, ist sie doch genau der Grund, warum ich vor mittlerweile zehn Jahren nach New York City gezogen bin. Für Leute wie mich sind Millionenstädte der ideale Lebensraum. An Orten dieser Größe ist die persönliche Situation des Einzelnen irrelevant. Hier gibt es unzählige Menschen, deren Lebensgeschichte weitaus tragischer ist als meine.
Ich bin unsichtbar. Unwichtig. Manhattan ist zu überfüllt, als dass sich irgendjemand für mich interessieren würde, und dafür liebe ich die Stadt.
»Sind Sie verletzt?«
Ich sehe auf, als mich ein Mann am Arm berührt und besorgt auf meine blutbefleckte Bluse zeigt. Er mustert mich von oben bis unten, als würde er nach einer Verletzung suchen. Das kann kein abgehärteter New Yorker sein. Vielleicht wohnt er hier, aber aufgewachsen ist er mit Sicherheit woanders, wo ihm nicht von frühester Kindheit an jegliches Mitgefühl ausgetrieben wurde.
»Sind Sie verletzt?«, erkundigt er sich noch einmal und sieht mir diesmal in die Augen.
»Nein. Das ist nicht mein Blut. Ich stand nur direkt daneben, als …« Ich stocke mitten im Satz. Ich habe einen Menschen sterben sehen. War ihm so nah, dass sein Blut meine Bluse durchtränkt hat.
Ich bin in diese Stadt gezogen, um unsichtbar zu werden, doch unberührbar bin ich nicht. Ich habe zwar daran gearbeitet – habe versucht, so hart zu werden wie der Asphalt unter meinen Sohlen –, aber das hat anscheinend nicht so gut geklappt. Was ich gerade miterlebt habe, hat mich im Innersten erschüttert.
Unwillkürlich lege ich eine Hand an den Mund, ziehe sie aber sofort erschrocken weg, als ich etwas Klebriges spüre. Blut. Ich sehe an meiner Bluse herunter. So viel Blut und es ist nicht meins. Ich fasse den Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe daran, aber an den Stellen, wo das Blut bereits zu trocknen beginnt, haftet er an meiner Haut.
Mir wird schwindelig. Wasser wäre jetzt gut. Ich kämpfe gegen das Bedürfnis an, mir über die Stirn zu reiben, weil ich mich davor ekle, mich anzufassen.
»Ist es auch auf meinem Gesicht?«, frage ich den Mann.
Er presst die Lippen aufeinander, dann sieht er sich suchend um. »Lassen Sie uns da reingehen.« Er zeigt auf einen nahe gelegenen Coffeeshop. »Dort gibt es bestimmt eine Toilette. Kommen Sie.« Er legt mir eine Hand auf den Rücken und führt mich zu dem Café.
Ich werfe über die Schulter einen Blick zu dem Verlagsgebäude von Pantem Press auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo ich hinwollte, bevor der Unfall passiert ist. Ich war schon fast da. War nur noch fünfzehn, vielleicht zwanzig Meter von dem Ort entfernt, an dem gleich ein Meeting stattfindet, das ich auf gar keinen Fall versäumen darf.
Wie weit wohl der Mann, der jetzt tot ist, noch von dem Ort entfernt war, an den er wollte?
Der Fremde hält mir die Tür des Coffeeshops auf. Eine Frau mit zwei Kaffeebechern in den Händen will sich an mir vorbei nach draußen schieben, als ihr Blick auf meine Bluse fällt. Sie weicht zurück und lässt uns den Vortritt. Ich gehe durch das Lokal direkt zur Damentoilette, aber sie ist abgeschlossen. Der Mann stößt die Tür zur Herrentoilette auf und winkt mir, ihm zu folgen.
Er schließt nicht hinter uns ab, sondern geht gleich zum Waschbecken und dreht das Wasser auf. Als ich in den Spiegel sehe, stelle ich erleichtert fest, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie ich befürchtet hatte. Auf meinen Wangen und quer über der Stirn sind zwar ein paar Blutspritzer zu sehen, die schon angetrocknet und daher dunkler sind, aber die Bluse hat das meiste abbekommen.
Der Mann reicht mir einen Stapel Papiertücher, die er unter den Wasserstrahl gehalten hat, und ich säubere mir das Gesicht, während er weitere Tücher aus dem Spender zieht und nass macht. Jetzt ist das Blut auch zu riechen. Der leicht metallische Geruch reißt mich in einen Zeittunnel zurück – plötzlich bin ich wieder das zehnjährige Mädchen von damals. Der Blutgeruch war so stark, dass ich mich noch Jahre später an ihn erinnern konnte.
Ich halte die Luft an, damit mir nicht übel wird. Ich will mich nicht übergeben. Aber die blutige Bluse, die will ich loswerden. Jetzt sofort.
Mit zitternden Fingern knöpfe ich sie auf, streife sie ab und werfe sie ins Waschbecken. Der Mann gibt mir weiter feuchte Papiertücher, mit denen ich mir das angetrocknete Blut vom Oberkörper wische.
Jetzt wendet er sich zur Tür, aber nicht, wie ich im ersten Moment annehme, weil ich halb nackt in einem meiner unattraktivsten BHs dastehe und er diskret hinausgehen möchte, sondern um von innen abzuschließen. Ich beobachte im Spiegel mit leichtem Unbehagen, wie er sich wieder zu mir umdreht.
Jemand rüttelt an der Tür und klopft.
»Einen Moment noch«, ruft der Mann.
Ich entspanne mich etwas. Das Wissen, dass da draußen jemand steht, der meine Schreie hören würde, falls ich schreien müsste, beruhigt mich.
Ich konzentriere mich wieder darauf, das Blut abzuwischen, bis ich mir sicher bin, dass ich sämtliche Spuren von meinem Oberkörper und meinem Hals entfernt habe. Danach untersuche ich meine Haare, drehe mich vor dem Spiegel nach rechts und links, sehe aber nichts als den Zentimeter herausgewachsenen dunklen Ansatz über hellem Karamellbraun.
»Hier.« Der Mann öffnet die Knöpfe seines frisch gebügelten weißen Hemds. »Ziehen Sie das an.«
Sein Jackett hat er schon abgelegt und über den Türknauf gehängt. Er streift sich das Hemd ab, unter dem er ein weißes Unterhemd trägt. Er ist größer als ich und ziemlich muskulös. Ich werde in seinem Hemd untergehen. Eigentlich kann ich unmöglich so zu dem Meeting, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, also nehme ich es, als er es mir reicht. Ich ziehe ein paar frische Papiertücher aus dem Spender und tupfe meinen Oberkörper trocken, dann schlüpfe ich in das Hemd und knöpfe es zu. Ich sehe absurd aus, aber wenigstens war es nicht mein Kopf, der auf der Kleidung von jemand anderem explodiert ist. Es gibt immer einen Silberstreif am Horizont.
Ich nehme meine nasse Bluse aus dem Waschbecken, finde mich damit ab, dass sie nicht mehr zu retten ist, und entsorge sie im Mülleimer. Danach stütze ich mich mit beiden Händen auf den Beckenrand und betrachte mich im Spiegel. Zwei müde, leere Augen starren zurück. Das Grauen, das sie gerade gesehen haben, hat ihren sonst warmen Haselnusston zu Schlammbraun getrübt. Um wenigstens ein bisschen Farbe in mein Gesicht zurückzuholen, reibe ich mir mit den Handballen über die Wangen, aber es ist zwecklos. Ich sehe aus wie der lebende Tod.
Ich lehne mich an die Wand und atme tief durch. Der Mann rollt währenddessen seine Krawatte zusammen, schiebt sie in die Tasche seines Jacketts und betrachtet mich forschend. »Schwer zu sagen, ob Sie einfach unglaublich gefasst sind oder unter Schock stehen.«
Ich stehe nicht unter Schock, aber gefasst bin ich ganz sicher nicht. »Tja, keine Ahnung«, gebe ich zu. »Wie fühlen Sie sich?«
»Es geht«, sagt er. »Ich habe leider schon Schlimmeres gesehen.«
Ich schaue ihn fragend an, während ich versuche, durch die Schichten dieser kryptischen Antwort zu ihrem Kern vorzudringen. Dass er meinem Blick ausweicht, macht mich noch neugieriger. Was könnte schlimmer sein, als mitanzusehen, wie der Kopf eines Menschen unter einem Lieferwagen zerquetscht wird? Vielleicht ist er ja doch waschechter New Yorker. Oder er arbeitet in einem Krankenhaus. Er strahlt so eine entschlossene Tatkraft aus, die Menschen, die sich beruflich um andere kümmern, oft an sich haben.
»Sind Sie Arzt?«
Er schüttelt den Kopf. »Immobilienmakler. War ich jedenfalls lange.« Er kommt auf mich zu und schnippt etwas von der Schulter meines Hemds. Seines Hemds. Als er den Arm wieder sinken lässt, sieht er mir einen Moment ins Gesicht, bevor er einen Schritt zurück macht.
Seine Augen haben denselben Farbton wie die Krawatte, die er gerade eingesteckt hat. Ein helles Grün. Er sieht gut aus, macht aber aus irgendeinem Grund den Eindruck, als wäre ihm das unangenehm. Es wirkt beinahe so, als würde er sein gutes Aussehen als Last empfinden. Als würde er nicht wollen, dass man ihn bemerkt. Als wollte er unsichtbar sein. Genau wie ich.
Die meisten Leute, die nach New York kommen, legen es darauf an, entdeckt zu werden. Wir Übrigen kommen hierher, um uns zu verstecken.
»Wie heißen Sie eigentlich?«, fragt er.
»Lowen.«
Er stutzt kurz, dann ist der Moment vorüber.
»Freut mich. Ich bin Jeremy«, stellt er sich vor. Er geht zum Waschbecken, dreht das Wasser auf und wäscht sich die Hände.
Ich wende den Blick nicht von ihm ab. Was hat er gemeint, als er sagte, er hätte schon Schlimmeres gesehen? Okay, er hat in der Immobilienbranche gearbeitet, aber selbst der schlimmste Tag im Leben eines Maklers kann nicht die Ursache für die ernste, fast melancholische Aura sein, die diesen Mann umgibt.
»Was haben Sie erlebt?«
Er sieht mich im Spiegel an. »Wie bitte?«
»Sie haben eben gesagt, Sie hätten Schlimmeres gesehen. Was war das?«
Er dreht das Wasser aus, trocknet sich die Hände ab und dreht sich dann wieder zu mir. »Wollen Sie das wirklich wissen?«
Ich nicke.
Er wirft die Tücher in den Mülleimer und schiebt die Hände in die Taschen. Seine ganze Haltung lässt ihn jetzt noch düsterer wirken. Er sieht mir in die Augen, aber ich habe das Gefühl, als wäre er in diesem Moment ganz woanders.
»Ich habe vor fünf Monaten die Leiche meiner achtjährigen Tochter aus einem See gezogen.«
Ich hole scharf Luft und lege instinktiv die Hand an meine Kehle. Was ich für Melancholie gehalten habe, war etwas ganz anderes. Es ist verzweifelter Schmerz, der ihn erfüllt.
»Das tut mir so leid«, flüstere ich, und das kommt aus tiefstem Herzen. Es tut mir für seine Tochter leid und für ihn … und dafür, dass ich so neugierig war.
»Und Sie? Was haben Sie erlebt?«, fragt er. Er lehnt sich ans Waschbecken und sieht mich ruhig an – als wäre er bereit für dieses Gespräch. Fast macht es den Eindruck, als hätte er genau auf diesen Moment gewartet. Den Moment, in dem jemand vorbeikommt, der es vielleicht schafft, seiner Tragödie etwas von ihrer Tragik zu nehmen. Denn genau das braucht man, wenn man das Schlimmstmögliche erlebt hat. Man sucht nach Menschen in vergleichbaren Situationen … Menschen, denen es womöglich noch schlechter geht als dir … weil das hilft, mit dem Schrecklichen, das dir passiert ist, besser umgehen zu können.
Ich schlucke. Die kleinen Tragödien meines Lebens verblassen im Vergleich zu seiner. Ich denke an die jüngste, die ich gerade hinter mir habe, und schäme mich, überhaupt davon zu erzählen, weil sie mir gemessen an seinem Unglück so nichtig erscheint. »Letzte Woche ist meine Mutter gestorben.«
Er reagiert nicht so wie ich eben. Um genau zu sein, reagiert er gar nicht. Hatte ich also recht mit meiner Vermutung, dass er gehofft hat, meine Geschichte wäre schlimmer als seine? Das ist sie nicht. Seine steht weiter unangefochten auf Platz eins.
»Woran ist sie gestorben?«
»Krebs. Ich habe sie das ganze letzte Jahr bei mir zu Hause gepflegt.« Er ist der erste Mensch, dem ich das erzähle. Ich spüre meinen Puls im Handgelenk pochen und schließe die Finger der anderen Hand darum. »Heute habe ich zum ersten Mal seit Wochen meine Wohnung verlassen.«
Wir sehen uns einen Moment an. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht noch eine Erklärung hinterherschicken sollte, aber ich habe noch nie mit einem mir völlig unbekannten Menschen ein so intensives Gespräch gehabt, und weiß nicht, ob ich es nicht besser beenden sollte, denn … wo sollte das hinführen?
Nirgendwohin. Es endet. Einfach so.
Jeremy dreht sich wieder zum Spiegel und streicht sich eine dunkle Haarsträhne aus der Stirn. »Ich habe gleich ein Meeting, zu dem ich mich nicht verspäten möchte. Alles okay bei Ihnen? Kommen Sie klar?« Er sieht mich im Spiegel an.
»Ja. Alles in Ordnung.«
»In Ordnung?« Er dreht sich um und wiederholt die Worte wie eine Frage, so als fände er sie beunruhigender, als wenn ich gesagt hätte, alles wäre okay.
»Es wird schon wieder«, sage ich. »Danke für Ihre Hilfe.«
Plötzlich möchte ich, dass er lächelt, aber das passt nicht zu unserer Situation. Mich würde einfach interessieren, wie sein Gesicht aussieht, wenn er lächelt. Stattdessen zuckt er leicht mit den Schultern und sagt: »In Ordnung, dann …« Er geht zur Tür, entriegelt sie und hält sie für mich auf. Aber ich zögere. Ich fühle mich noch nicht ganz so weit, der Welt da draußen gegenüberzutreten. Außerdem würde ich mich gern bei ihm bedanken, ihn vielleicht an einem anderen Tag auf einen Kaffee einladen oder zumindest nach seiner Adresse fragen, um ihm das Hemd zurückzugeben. Man trifft heutzutage selten so selbstlos freundliche Menschen, das finde ich anziehend. Aber dann verabschiede ich mich auf einmal doch ganz schnell von ihm. Das plötzliche Aufblitzen eines Eherings an seiner linken Hand katapultiert mich aus der Toilette, durch das Café auf die Straße hinaus, wo sich mittlerweile eine größere Menschenmenge rings um die Unfallstelle gesammelt hat.
Ein Notarztwagen mit rotierendem Blaulicht blockiert den Verkehr in beide Richtungen. Vielleicht sollte ich mich als Augenzeugin melden? Ich gehe auf einen der Polizisten zu, der gerade dabei ist, die Aussagen mehrerer Leute aufzunehmen. Obwohl sie auch nicht viel anderes sagen als das, was ich mitbekommen habe, gebe ich meine Beobachtungen anschließend ebenfalls zu Protokoll. Ob meine Aussage irgendetwas nützt, weiß ich allerdings nicht. Ich stand so nah, dass ich mehr gehört habe, was passiert ist, als es zu sehen. So nah, dass meine Bluse in ein Jackson-Pollock-Gemälde verwandelt wurde.
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Jeremy mit einem Becher in der Hand aus dem Coffeeshop kommt. Tief in Gedanken versunken überquert er die Straße. Er ist schon wieder ganz woanders, weit weg von mir. Wahrscheinlich bei seiner Frau und wie er ihr später erklärt, warum er ohne Hemd nach Hause kommt.
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und werfe einen Blick darauf. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit bis zu dem Treffen mit Corey und den Leuten von Pantem Press. Jetzt, wo niemand mehr bei mir ist, der mich ablenken kann, merke ich, wie heftig meine Hände zittern. Kaffee würde vielleicht helfen. Oder Morphium. Letzteres würde ganz sicher helfen, aber die Leute vom Hospizdienst haben alle Medikamente letzte Woche mitgenommen, als sie nach dem Tod meiner Mutter da waren, um die geliehenen Hilfsmittel abzuholen. Schade, dass ich in dem Moment zu durcheinander war, um daran zu denken, einen kleinen Vorrat für mich abzuzweigen. Jetzt könnte ich wirklich etwas davon gebrauchen.
2
Coreys Nachricht, in der er mich über das heutige Meeting informiert hat, war nach Monaten der Funkstille das erste Lebenszeichen von ihm. Ich hatte an meinem Schreibtisch gesessen und einer Ameise zugesehen, die auf meiner großen Zehe herumkrabbelte.
Die Ameise war allein, wandte sich erst nach links und dann nach rechts, lief mal nach oben, mal nach unten, suchte Fressen oder Freunde. Sie wirkte verwirrt darüber, dass sie so allein war … möglicherweise erfreute sie sich aber auch einfach nur ihrer Freiheit. Ich fragte mich, warum sie wohl allein unterwegs war. Normalerweise bewegen sich Ameisen ja immer im Trupp.
Die Tatsache, dass ich mir allen Ernstes Gedanken über die Befindlichkeit einer Ameise machte, war ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich dringend mal wieder rausmusste. Nachdem ich so lange in meiner Wohnung eingepfercht und ganz auf die Pflege meiner Mutter konzentriert gewesen war, hatte ich Angst vor dem Moment, in dem ich zum ersten Mal wieder vor die Tür ging. Womöglich würde ich genauso planlos herumirren wie diese Ameise. Nach links oder nach rechts, rein oder raus, wo sind meine Freunde, wo gibt es Fressen?
Die Ameise hatte meinen Zeh verlassen, um übers Parkett zu marschieren, und war gerade in einem Riss in der Wand verschwunden, als mein Handy vibrierte und mir Coreys Nachricht anzeigte.
Eigentlich hatte ich gehofft, er hätte verstanden, was ich ihm vor Monaten begreiflich zu machen versucht hatte: dass es mir jetzt, wo das Thema Sex zwischen uns durch war, angemessener erschien, wenn die Kommunikation zwischen ihm als meinem Literaturagenten und mir als seiner Autorin nur noch per E-Mail stattfinden würde.
Seine Nachricht hatte folgenden Inhalt gehabt:
Morgen um neun bei Pantem Press, 14. Stock. Sie wollen uns ein Angebot machen.
Nach meiner Mutter erkundigte er sich nicht, was mich nicht weiter überraschte. Genau dieses mangelnde Interesse an allem, was nicht mit seinem Job oder ihm selbst zu tun hatte, war der Grund, weshalb wir nicht mehr zusammen waren. Ich spürte eine leichte Gereiztheit, auch wenn sie ungerechtfertigt war – schließlich schuldete er mir nichts. Trotzdem: Hätte er nicht wenigstens ein bisschen Anteilnahme heucheln können?
Statt ihm zurückzuschreiben, legte ich mein Handy wieder weg und starrte auf den Riss, durch den die Ameise verschwunden war. Hatte sie zwischen den Rigipswänden ihre Ameisenkumpel getroffen oder war sie eine Einzelgängerin? Vielleicht war sie ja wie ich und mochte andere Artgenossen einfach nicht.
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, woher meine tief sitzende Scheu vor anderen Menschen kommt, aber wenn ich eine Vermutung äußern müsste, würde ich schwer darauf tippen, dass sie ein direktes Ergebnis der Tatsache ist, dass meine eigene Mutter Angst vor mir hatte.
Angst klingt heftig, ich weiß. Aber es ist tatsächlich so, dass sie mir als Kind keinen Zentimeter über den Weg traute. Sie hatte solche Panik vor dem, was ich während meiner häufigen schlafwandlerischen Ausflüge anrichten könnte, dass sie mich außerhalb der Schule von anderen so komplett wie möglich abschirmte. Ihre Paranoia hat mich bis zur Pubertät begleitet und nachhaltig geprägt. Ich bin zur Einzelgängerin geworden. Habe wenige Freunde und gehe kaum aus. Was auch erklärt, weshalb ich heute zum ersten Mal seit Moms Tod die Wohnung verlassen habe.
Allerdings hätte ich mir vorgestellt, dass mein erster Ausflug mich eher an einen Ort führen würde, den ich vermisst habe, in den Central Park vielleicht oder eine Buchhandlung.
Ich hätte niemals damit gerechnet, mich als Allererstes in der Eingangshalle eines Verlagshauses in der Schlange vor der Sicherheitsschleuse wiederzufinden, stumm darum betend, dass dieses »Angebot« lukrativ genug ist, um meine Mietrückstände zu begleichen, damit ich nicht auf der Straße lande. Aber genauso ist es. Hier stehe ich, und in einer halben Stunde wird sich entscheiden, ob ich bald obdachlos bin oder nicht.
Ich sehe an mir herunter und zupfe nervös an dem weißen Hemd herum, das mir mein barmherziger Samariter Jeremy in der Männertoilette des Coffeeshops überlassen hat. Vielleicht schaffe ich es ja, so selbstbewusst aufzutreten, dass die Leute denken, solche viel zu großen Herrenhemden wären der neueste Trend.
»Hübsches Outfit«, sagt eine Stimme hinter mir.
Als ich mich umdrehe, bleibt mir kurz das Herz stehen.
Ist er mir gefolgt?
In diesem Moment bittet mich der Wachmann, mich auszuweisen. Ich reiche ihm meinen Führerschein, drehe mich wieder zu Jeremy und stelle fest, dass er unter seinem Jackett ein neues Hemd trägt. »Haben Sie etwa immer ein Ersatzhemd dabei?«
»Fast. Mein Hotel ist gleich um die Ecke. Ich bin schnell zurückgegangen und habe mich umgezogen.«
Sein Hotel. Irgendwie beruhigt mich das. Wenn er in einem Hotel wohnt, arbeitet er vermutlich nicht bei Pantem Press und hat nichts mit dem bevorstehenden Meeting zu tun. Keine Ahnung, wie ich auf diesen eigentlich absurden Gedanken komme. Vielleicht, weil ich nicht weiß, mit wem Corey dieses Treffen vereinbart hat, und es zu diesem krassen Tageseinstieg passen würde, wenn es etwas mit dem Mann zu tun hätte, mit dem ich eben halb nackt in einer Herrentoilette stand.
»Arbeiten Sie hier?«
Er gibt dem Sicherheitsmann seinen Führerschein. »Nein. Aber ich habe gleich ein Meeting im vierzehnten Stock.«
O–kay.
»Was für ein Zufall. Ich auch«, sage ich.
Ein Lächeln zuckt um seine Mundwinkel und verschwindet wieder, als hätte er vielleicht auch gerade an die Szene auf der Männertoilette gedacht. »Könnte es sein, dass es sich um dasselbe Meeting handelt?«
Der Sicherheitsmann streckt ihm seinen Führerschein hin und zeigt in Richtung der Aufzüge.
»Tja, keine Ahnung«, sage ich achselzuckend. »Man hat mir nicht gesagt, worum es konkret geht.« Wir steigen in den Aufzug, er drückt auf den Knopf für den vierzehnten Stock und betrachtet mich nachdenklich, während er seine Krawatte aus der Jacketttasche zieht und sich umlegt.
Mein Blick bleibt wieder an dem Ehering an seiner Hand hängen.
»Sind Sie Autorin?«, fragt er.
Ich nicke. »Und Sie? Auch Autor?«
»Nein. Aber meine Frau schreibt.« Er zieht an der Krawatte, bis der Knoten sitzt. »Haben Sie etwas veröffentlicht, das ich kennen könnte?«
»Das bezweifle ich. Niemand liest meine Bücher.«
Er lächelt. »Lowen ist kein sehr häufiger Vorname. Ich bin mir sicher, dass ich herausfinden kann, was für Bücher Sie geschrieben haben.«
Warum? Will er sie etwa lesen?
Er holt sein Handy aus dem Jackett und beginnt zu tippen.
»Wer sagt, dass ich unter meinem richtigen Namen veröffentliche?«
Er sieht nicht vom Display auf, bis sich die Aufzugtüren öffnen und er einen Schritt nach vorn macht. In der Tür dreht er sich zu mir um, hält sein Handy hoch und grinst. »Sie haben kein Pseudonym. Sie schreiben als Lowen Ashleigh, was witzigerweise ausgerechnet der Name der Autorin ist, mit der ich hier um halb zehn eine Verabredung habe.«
Endlich bekomme ich das Lächeln zu sehen, das ich mir vorhin gewünscht habe, und so umwerfend es ist – jetzt will ich es nicht mehr.
Er hat mich gerade gegoogelt. Und obwohl mein Meeting um neun stattfindet, nicht um halb zehn, scheint er mehr darüber zu wissen als ich. Seltsam, dass wir uns unter so merkwürdigen Umständen kennengelernt haben und sich jetzt auch noch herausstellt, dass wir beide aus demselben Grund hier sind. Andererseits ist es natürlich auch nicht so ungewöhnlich, dass wir – nachdem wir zur selben Zeit in dieselbe Richtung unterwegs waren – beide Zeugen des Unfalls geworden sind.
Jeremy tritt zur Seite und ich steige aus dem Aufzug. Ich öffne den Mund, um noch etwas zu sagen, aber da ist er schon an mir vorbeigegangen und ruft über die Schulter: »Dann bis gleich.«
Ich habe zwar keine Ahnung, welche Rolle er bei diesem Meeting spielen wird, aber er ist mir jetzt schon sympathisch. Der Mann hat mir praktisch sein letztes Hemd gegeben – er kann kein schlechter Mensch sein.
Ich lächle, bevor er um die Ecke biegt. »In Ordnung. Bis gleich.«
Er erwidert das Lächeln. »In Ordnung.«
Ich sehe ihm hinterher. Sobald er aus meinem Blickfeld verschwunden ist, entspanne ich mich etwas. Das war alles … ein bisschen viel für einen Vormittag. Erst dieser entsetzliche Unfall, dann die Aktion auf der engen Herrentoilette, das unerwartete Wiedersehen hier. Alles sehr, sehr seltsam und verwirrend. Ich lehne mich kurz an die Wand und atme tief ein.
»Oha, du bist pünktlich«, höre ich plötzlich Coreys Stimme und zucke zusammen. Ich drehe mich um und sehe, wie er auf mich zuschlendert. Als er bei mir ist und sich vorbeugt, um mich auf die Wange zu küssen, versteife ich mich. »Du bist nie pünktlich.«
»Ich wäre sogar noch früher hier gewesen, wenn …« Aber ich beende den Satz nicht. Corey scheint sich sowieso nicht dafür zu interessieren, was mich aufgehalten hat. Er geht in die Richtung, in der Jeremy eben verschwunden ist.
»Das Meeting ist auf halb zehn angesetzt, aber ich habe dir geschrieben, dass du um neun hier sein sollst, weil ich damit gerechnet habe, dass du zu spät kommst.«
Ich bleibe stehen und starre auf seinen Hinterkopf. Ganz toll, Corey, echt. Wenn er mir gesagt hätte, dass das Meeting um halb zehn stattfindet, hätte ich den furchtbaren Unfall nicht miterlebt und wäre nicht mit dem Blut eines fremden Menschen bespritzt worden.
»Kommst du?« Corey dreht sich nach mir um.
Ich schlucke meinen Ärger herunter. Das habe ich während der Affäre mit ihm oft genug getan.
Er führt mich in einen leeren Besprechungsraum und schließt die Tür hinter uns. Ich setze mich an den Tisch. Er nimmt am Kopfende Platz und mustert mich forschend. Ich erwidere seinen Blick und bemühe mich um einen neutralen Gesichtsausdruck. Er hat sich in den Monaten, die wir uns nicht gesehen haben, nicht verändert: sehr gepflegt, sehr glatt, mit Krawatte, einer Brille und einem Lächeln im Gesicht. Wie immer das krasse Gegenteil von mir selbst.
»Du siehst furchtbar aus.« Das sage ich, weil er nicht furchtbar aussieht. Das tut er nie und weiß es auch.
»Du siehst ausgeruht und hinreißend aus.« Das sagt er, weil ich nie ausgeruht und hinreißend aussehe. Ich sehe immer müde aus und vielleicht auch angeödet. In letzter Zeit hört man ja öfter vom Phänomen des »Resting Bitch Face«, das Leute haben, deren Gesicht im Ruhezustand immer schlecht gelaunt aussieht. In meinem Fall müsste man wohl eher vom »Resting Bored Face« sprechen.
»Wie geht es deiner Mutter?«
»Sie ist letzte Woche gestorben.«
Damit hat er nicht gerechnet. Er lehnt sich im Stuhl zurück und sieht mich mit schräg gelegtem Kopf an. »Warum hast du mir das nicht gesagt?«
Warum hast du mich nicht nach ihr gefragt? Ich zucke mit den Achseln. »Ich bin noch dabei, es zu verarbeiten.«
Meine Mutter hat die letzten neun Monate, seit bei ihr Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde, bei mir gelebt. Vergangenen Mittwoch ist sie gestorben, zum Ende hin wurde sie nur noch palliativ behandelt. Es war schwierig für mich, die Wohnung zu verlassen, weil sie in jeder Hinsicht auf mich angewiesen war – ich gab ihr zu trinken, fütterte sie und musste sie regelmäßig umlagern. In den letzten Wochen ging es ihr so schlecht, dass ich buchstäblich gar nicht mehr aus dem Haus kam. Zum Glück muss man in Manhattan sein Apartment auch nicht verlassen, wenn man Internet und eine Kreditkarte hat. Man kann sich alles, was man braucht, liefern lassen.
Schon witzig, dass eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt gleichzeitig ein Paradies für Soziophobiker ist.
»Wie geht es dir damit?«, erkundigt sich Corey.
Ich lächle, obwohl ich weiß, dass seine Besorgnis reine Höflichkeit ist. »Es geht schon. Ich war ja darauf vorbereitet.« Ich sage das, von dem ich glaube, dass er es hören möchte. Keine Ahnung, wie er auf die Wahrheit reagieren würde – nämlich, dass ich erleichtert bin, dass sie tot ist. Meine Mutter hat immer nur Schuldgefühle in mir erzeugt. Nicht mehr, nicht weniger. Nur ständige Schuldgefühle.
Corey steht auf und geht zu einem Beistelltisch, auf dem Gebäck, Mineralwasser und eine Thermoskanne Kaffee bereitstehen. »Möchtest du etwas?«
»Ein Wasser bitte.«
Er nimmt zwei Flaschen, hält mir eine hin und setzt sich wieder. »Brauchst du Hilfe, um die Erbangelegenheiten zu regeln? Edward würde dir sicher helfen.«
Edward ist Anwalt in der Literaturagentur, bei der Corey angestellt ist. Es ist eine kleine Agentur, weshalb er nicht so viel zu tun hat und viele der Autoren auch in anderen Fragen berät. Leider werde ich seine Dienste nicht benötigen. Bevor ich letztes Jahr den Vertrag für meine Drei-Zimmer-Wohnung unterschrieben habe, hat Corey mich noch gewarnt, dass die Miete meine Mittel übersteigen würde. Aber meine Mutter hat darauf bestanden, in Würde sterben zu dürfen – in ihrem eigenen Zimmer. Nicht in einem Pflegeheim. Nicht im Krankenhaus. Und auch nicht in einem Krankenhausbett in dem winzigen Apartment, in dem ich damals noch gelebt habe. Nein, sie wollte ein eigenes Zimmer mit eigenen Möbeln.
Sie hatte mir versprochen, dass ich mit dem nach ihrem Tod auf ihrem Konto verbleibenden Geld den finanziellen Verlust ausgleichen könnte, der mir dadurch entstanden ist, dass ich während der Zeit ihrer Pflege nicht zum Schreiben gekommen bin. Das vergangene Jahr habe ich vom Rest des Vorschusses für mein letztes Buch gelebt. Aber dieses Geld ist jetzt aufgebraucht – genau wie offenbar das Vermögen meiner Mutter. Kurz vor ihrem Tod hat sie mir gestanden, dass nichts mehr übrig ist. Ich hätte sie auf jeden Fall bei mir aufgenommen und gepflegt. Schließlich war sie meine Mutter. Aber dass sie es für nötig gehalten hat, mich zu belügen, damit ich mich um sie kümmere, zeigt wahrscheinlich ganz gut, wie desolat unser Verhältnis war.
Ich trinke einen Schluck von dem Wasser und schüttle den Kopf. »Ich brauche keinen Anwalt. Alles, was sie mir hinterlassen hat, sind Schulden. Aber danke für das Angebot.«
Corey sieht mich an und spitzt die Lippen. Weil er mein Agent ist, kümmert er sich um die Abwicklung der Honorar- und Tantiemenzahlungen für meine Bücher und hat dadurch Einblick in meine finanziellen Verhältnisse. Deswegen der mitleidige Blick. »Die Beteiligungen für die ausländischen Lizenzen sind bald fällig«, sagt er, als wüsste ich nicht bis auf den letzten Cent, welche Summen ich in den nächsten sechs Monaten noch zu erwarten habe. Als hätte ich dieses Geld nicht schon längst ausgegeben.
»Ich weiß. Wird schon irgendwie klappen.« Ich will meine finanziellen Schwierigkeiten nicht mit Corey besprechen. Mit ihm nicht und auch mit sonst niemandem.
Corey zuckt mit den Achseln, sieht aber nicht überzeugt aus. Er senkt den Blick und rückt seine Krawatte zurecht. »Vielleicht kommt dieses Angebot ja für uns beide gerade zur richtigen Zeit«, sagt er.
Ich bin froh über den Themawechsel. »Warum musste ich überhaupt herkommen? Du weißt doch, dass es mir lieber ist, solche Dinge per Mail zu regeln.«
»Ich weiß auch nicht viel mehr, als dass sie persönlich mit dir reden wollen. Als ich gestern kontaktiert wurde, hieß es nur, es ginge um einen Auftrag, dessen Details man nicht am Telefon besprechen möchte.«
»Hattest du nicht gesagt, du wolltest mit meinem Verlag über einen Nachfolger meines letzten Titels verhandeln?«
»Deine Bücher verkaufen sich ganz ordentlich, aber nicht so gut, dass der Verlag bereit wäre, über einen Nachfolger zu reden, solange du nicht bereit bist, auch etwas von deiner Zeit zu opfern. Du müsstest denen schon zusagen, dass du dich in den sozialen Medien engagierst, auf Lesereise gehst und daran arbeitest, eine Fanbasis aufzubauen. Nur über die Buchhandlungen erreichst du auf dem Markt heutzutage nicht die nötigen Verkaufszahlen.«
Genau das hatte ich befürchtet. Ich hatte so sehr gehofft, dass mein Stammverlag Interesse an einem weiteren Titel haben würde. Die Tantiemen für meine bisher erschienenen Bücher sind in der letzten Zeit genauso mager ausgefallen wie die aktuellen Verkaufszahlen. Aber die Pflege meiner Mutter hat mich so in Anspruch genommen, dass ich kaum zum Schreiben gekommen bin und dementsprechend auch nichts Neues anzubieten habe.
»Ich habe keine Ahnung, was Pantem von dir will und ob es etwas ist, was dich interessiert«, sagt Corey. »Aber sie haben angekündigt, dass wir eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen sollen, bevor sie mit den Details rausrücken. Ich muss zugeben, dass mich diese Geheimniskrämerei neugierig macht. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Wir brauchen einen lukrativen Auftrag.«
Er spricht von »wir«, weil er mit fünfzehn Prozent an meinem Honorar beteiligt ist, falls ich zusage. Das ist der branchenübliche Standard. Eher nicht branchenüblich war unsere sechsmonatige feste Beziehung und die zweieinhalbjährige lockere Affäre, die wir nach der Trennung hatten.
Allerdings zog sich unsere sexuelle Beziehung nur deswegen so lang hin, weil sich während dieser Zeit keiner von uns beiden ernsthaft für jemand anderen interessiert hat. Unser Verhältnis war praktisch und bequem, bis es das irgendwann nicht mehr war. Aber der Grund, weshalb unsere »richtige« Beziehung nicht funktionierte, hat damit zu tun, dass er eine andere Frau geliebt hat.
Dass diese andere Frau auch ich war, änderte nichts.
Es gibt Leser, denen es schwerfällt, zwischen einer fiktiven Figur und dem Menschen, der sie erschaffen hat, zu trennen. Überraschenderweise gehört sogar Corey zu dieser Sorte Leser, obwohl er es als Literaturagent eigentlich besser wissen müsste. Noch bevor wir uns persönlich getroffen haben, hatte er sich in die Protagonistin meines ersten Romans Ende offen verliebt. Es muss verwirrend sein, sich in die Sprache einer Autorin zu verlieben, ohne den Menschen zu kennen, der sie zu Papier gebracht hat. Aus irgendeinem Grund ging Corey davon aus, meine Romanfigur wäre ein Spiegelbild von mir selbst – obwohl wir in Wahrheit nicht unterschiedlicher sein könnten.
Als ich mich auf die Suche nach einer Literaturagentur gemacht hatte, war Corey der Einzige gewesen, der auf meine Anfrage reagierte, und auch das erst nach mehreren Monaten. Seine Mail war nur ein paar Sätze lang, aber die reichten, um meiner ersterbenden Hoffnung neues Leben einzuhauchen.
Ich habe das Manuskript Ihres Romans »Ende offen« innerhalb von ein paar Stunden gelesen. Ich glaube an das Buch. Rufen Sie mich an, falls Sie noch keinen Agenten haben.
Seine Mail kam an einem Donnerstagmorgen. Zwei Stunden später führten wir am Telefon ein intensives Gespräch über meinen Roman. Freitagnachmittag trafen wir uns zum Kaffee und ich unterschrieb einen Vertrag mit seiner Agentur.
Bis zum Samstagabend hatten wir schon dreimal miteinander geschlafen.
Mit unserer Beziehung verstießen wir sicher gegen irgendeinen Berufskodex, aber das war nicht der Grund, weshalb sie scheiterte. Nein, es war etwas anderes. Corey erkannte ziemlich schnell, dass ich und meine Romanfigur nicht identisch waren, und begriff, dass ich eine andere war als die, in die er sich verliebt hatte. Im Gegensatz zu ihr war ich nicht tapfer. Ich war nicht umgänglich. Ich war schwierig. Ein emotional herausforderndes Rätsel, das zu entschlüsseln er nicht bereit war.
Was okay war. Ich hatte keine Lust, entschlüsselt zu werden.
So schwierig ich ihn als Partner fand, so überraschend angenehm ist es, seine Klientin zu sein. Deshalb habe ich mir nach unserer Trennung auch keinen neuen Agenten gesucht. Wenn es um meine Karriere ging, ist Corey immer loyal und unvoreingenommen gewesen.
»Du siehst ein bisschen blass aus«, reißt er mich jetzt aus meinen Gedanken. »Bist du nervös?«
Ich nicke und hoffe, dass er mir das abnimmt, weil ich ihm nicht erklären möchte, warum ich so blass bin. Es ist kaum zwei Stunden her, dass ich heute Morgen meine Wohnung verlassen habe, aber gefühlt ist in diesen zwei Stunden mehr passiert als im gesamten letzten Jahr. Ich sehe auf meine Hände … meine Arme … suche nach Blutspritzern. Es ist nichts mehr zu sehen, aber ich kann das Blut noch auf der Haut spüren. Kann es riechen.
Meine Hände zittern nach wie vor, also verstecke ich sie unter dem Tisch. Jetzt, wo ich hier sitze, wird mir klar, dass es besser gewesen wäre, das Meeting kurzfristig abzusagen. Aber ich kann es mir nicht leisten, ein Angebot auszuschlagen. Es ist nicht so, als könnte ich mich vor Aufträgen kaum retten, und wenn sich nicht bald etwas ergibt, werde ich mir einen Brotjob suchen müssen. Dann hätte ich zwar nicht genug Zeit zum Schreiben, könnte aber zumindest meine Rechnungen bezahlen.
Corey zieht ein Taschentuch aus der Jacketttasche und wischt sich über die Stirn. Er schwitzt nur, wenn er nervös ist. Dass er nervös ist, macht mich noch nervöser.
»Sollen wir so eine Art Geheimsignal verabreden für den Fall, dass du nicht interessiert bist?«, fragt er.
»Hören wir uns doch erst mal an, worum es überhaupt geht. Dann können wir ihnen immer noch sagen, dass wir unter vier Augen darüber sprechen wollen.«
Corey setzt sich in seinem Stuhl aufrecht hin, strafft die Schultern und lässt die Mine seines Kugelschreibers herausklicken, als würde er vor einer Schlacht sein Gewehr laden. »Überlass das Reden vielleicht lieber mir, okay?«
Nichts anderes hatte ich vor. Corey ist charismatisch und charmant. Man müsste lange suchen, um jemanden zu finden, der dasselbe von mir behaupten würde. Es ist für alle Beteiligten besser, wenn ich mich zurücklehne und erst mal einfach zuhöre.
»Sag mal, was hast du da eigentlich an?« Corey starrt verblüfft auf mein Hemd, das er anscheinend erst jetzt bemerkt, obwohl wir schon fast eine Viertelstunde hier sitzen.
Ich schaue an dem viel zu großen Männerhemd hinunter. Einen Moment lang hatte ich vergessen, wie albern ich aussehe. »Ich hab heute Morgen Kaffee auf meiner Bluse verschüttet und musste mich umziehen.«
»Wessen Hemd ist das?«
Ich zucke mit den Achseln. »Wahrscheinlich deins. Es hing bei mir im Schrank.«
»Du bist so aus dem Haus gegangen? Hattest du nichts anderes anzuziehen?«
»Sehe ich etwa nicht aus, als käme ich direkt vom Pariser Laufsteg?« Das ist sarkastisch gemeint, aber das entgeht ihm.
»Äh … nein.« Corey verzieht das Gesicht. »Dachtest du etwa, du würdest so aussehen?«
Arschloch. Aber wie die meisten Arschlöcher ist er gut im Bett.
Ich bin erleichtert, als die Tür aufgeht und eine Frau hereinkommt. Ein älterer Mann folgt ihr so dicht auf, dass er slapstickartig in sie hineinläuft, als sie stehen bleibt.
»Herrgott, Barron«, höre ich sie zischen.
Ich muss mir ein Lächeln verkneifen, als ich mir vorstelle, dass das sein Name ist. Herrgott Barron.
Jeremy tritt als Letzter in den Raum. Er nickt mir so unmerklich zu, dass keiner der anderen es mitbekommt.
Die Frau ist stilsicherer gekleidet als ich an meinen besten Tagen, hat kurz geschnittene schwarze Haare und trägt einen Lippenstift, der für diese frühe Uhrzeit geradezu irritierend rot leuchtet. Sie scheint hier die Chefin zu sein, denn sie hält erst Corey und dann mir die Hand zur Begrüßung hin, während Herrgott Barron sich im Hintergrund hält.
»Amanda Thomas«, stellt sie sich vor. »Ich bin Lektorin bei Pantem Press. Das sind Barron Stephens, unser Anwalt, und Jeremy Crawford – der Auftraggeber.«
Als Jeremy und ich uns die Hand schütteln, gelingt es ihm bewundernswert gut, sich nicht anmerken zu lassen, was für eine extrem bizarre Begegnung wir heute Morgen schon hatten. Wir setzen uns. Obwohl ich versuche, Jeremy nicht anzusehen, zieht es meinen Blick immer wieder zu ihm hin. Ich verstehe selbst nicht, warum ich mir mehr Gedanken über ihn mache als über den Anlass dieses Meetings.
Amanda holt ein paar Folder aus ihrer Tasche und reicht sie mir und Corey.
»Ich freue mich, dass Sie sich zu diesem Treffen bereit erklärt haben«, sagt sie. »Wir sollten keine Zeit verlieren, weshalb ich gleich zum Kern unseres Anliegens kommen werde. Eine unserer Autorinnen ist bedauerlicherweise nicht in der Lage, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, und jetzt suchen wir eine erfahrene Kollegin, die im selben Genre schreibt und Interesse hätte, in Co-Autorenschaft die drei noch fehlenden Titel der Reihe zu verfassen.«
Ich werfe Jeremy einen schnellen Seitenblick zu, aber seine Miene lässt keine Rückschlüsse darauf zu, in welcher Rolle er an diesem Meeting teilnimmt.
»Um wen handelt es sich bei dieser Autorin?«, fragt Corey.
»Die Details besprechen wir gerne mit Ihnen, allerdings muss ich Sie vorher beide bitten, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Uns liegt daran, dass nichts über die momentane Situation der Autorin an die Öffentlichkeit gelangt.«
»Selbstverständlich«, sagt Corey.
Ich nicke nur stumm, dann lesen wir die vorgedruckte Erklärung durch und unterschreiben. Corey schiebt Amanda die Blätter über den Tisch zu.
»Es geht um Verity Crawford«, sagt sie. »Ich nehme an, Sie wissen, von wem ich spreche?«
Corey ist bei der Erwähnung des Namens erstarrt. Natürlich kennen wir Verity Crawford. Jeder kennt sie. Ich werfe einen verstohlenen Blick in Jeremys Richtung. Sie haben denselben Nachnamen. Ist Verity seine Frau? Wahrscheinlich. Vorhin hat er mir erzählt, seine Frau sei Autorin. Aber warum sitzt er in diesem Meeting und nicht sie?
»Der Name ist mir ein Begriff, ja«, sagt Corey vorsichtig. Offensichtlich will er sich nicht in die Karten schauen lassen.
»Verity Crawford schreibt eine sehr erfolgreiche Reihe für uns, und es wäre für alle Beteiligten außerordentlich bedauerlich, wenn sie nicht fortgeführt werden würde«, sagt Amanda. »Aus diesem Grund suchen wir eine Autorin, die bereit ist, die noch fehlenden Titel an ihrer Stelle weiterzuschreiben und auch alle anderen Verpflichtungen wahrzunehmen. Lesereisen, Interviews et cetera. Wir werden eine Pressemitteilung herausgeben, in der die neue Co-Autorin vorgestellt, aber auf Veritys private Situation nicht näher eingegangen wird.«
Lesereisen? Interviews?
Corey sieht mich an. Er weiß, dass ich mit diesem Punkt Probleme habe. Viele Autorinnen und Autoren genießen den direkten Kontakt mit ihren Lesern, aber ich bin sozial so unbeholfen, dass ich Angst habe, meine Leser könnten meinen Büchern für immer abschwören, sobald sie mich einmal »in echt« erlebt hätten. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nur einmal zu einer Signierstunde überreden lassen und konnte vorher eine ganze Woche lang nicht schlafen. Während der Veranstaltung war ich so angespannt, dass ich kaum ein Wort herausgebracht habe. Am nächsten Tag bekam ich eine Mail von einer Leserin, die mich als arrogante Zicke beschimpfte und ankündigte, nie mehr ein Buch von mir zu lesen.
Deswegen bleibe ich lieber zu Hause und schreibe. Ich glaube, die Vorstellung, die meine Leser von mir haben, ist angenehmer als mein wahres Ich.
»Darf ich fragen, welches Honorar mit Mrs Crawford für die drei Romane vereinbart wurde?«, erkundigt sich Corey.
Jetzt schaltet sich Herrgott Barron zum ersten Mal ein. »Der Vertrag zwischen Mrs Crawford und dem Verlag bleibt bestehen, und über die Einzelheiten kann ich Ihnen, wie Sie sicherlich verstehen werden, keine Auskunft geben. Alle Beteiligungen werden weiterhin an Mrs Crawford ausgezahlt. Aber mein Mandant, Jeremy Crawford, ist bereit, pro Buch ein Pauschalhonorar von fünfundsiebzigtausend Dollar zu zahlen.«
Mein Magen schlägt einen Salto, als ich diese irre Summe höre, zieht sich aber sofort wieder zusammen, als ich mir klarmache, welche enorme Lebensveränderung damit verbunden wäre. Von einer quasi unbekannten Schriftstellerin zur Co-Autorin einer literarischen Sensation – dieser Sprung ist definitiv zu groß für mich. Schon allein beim Gedanken daran bekomme ich Atemnot.
Corey beugt sich vor und legt die Arme auf den Tisch. »Schön. Ich nehme an, dabei handelt es sich um das Einstiegsangebot?«
Ich werfe ihm einen Blick zu. Er soll wissen, dass er gar nicht erst anfangen muss zu verhandeln. Ich werde diese Reihe auf gar keinen Fall weiterschreiben. Das ist eine Aufgabe, die mein Können bei Weitem übersteigt.
Herrgott Barron richtet sich in seinem Stuhl auf. »Ohne Ihrer Klientin zu nahe treten zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, dass Verity Crawford über zehn Jahre lang daran gearbeitet hat, mit ihren Romanen eine Marke aufzubauen. Eine Marke, die es ohne sie nicht gäbe. Das Angebot gilt für alle drei Bücher. Fünfundsiebzigtausend pro Buch, das macht insgesamt zweihundertfünfundzwanzigtausend Dollar.«
Corey wirft seinen Kuli auf den Tisch und lehnt sich zurück, als würde ihn das Gesagte nicht beeindrucken. »An welchen Zeitrahmen haben Sie gedacht?«, wendet er sich wieder an Amanda.
»Wir stehen durch die Programmplanung terminlich unter Druck, weshalb wir gern sechs Monate nach Vertragsunterzeichnung ein fertiges Manuskript vorliegen hätten.«
Während sie redet, kann ich den Blick nicht von ihren Zähnen abwenden, auf die der rote Lippenstift abgefärbt hat.
»Über die Abgabetermine für die anderen Bände können wir dann noch einmal reden. Idealerweise hätten wir aber alle drei gern innerhalb der nächsten vierundzwanzig Monate.«
Ich sehe Corey an, dass er im Kopf Zahlen addiert, und frage mich, ob er das tut, um zu schauen, was für mich dabei herauskommt oder für ihn. Mit seinen fünfzehn Prozent käme er auf einen Anteil von fast vierunddreißigtausend Dollar, einfach nur, weil er mein Agent ist. Die Hälfte der übrigen Summe ginge ans Finanzamt und auf meinem Konto würden knapp hunderttausend landen. Fünfzigtausend pro Jahr.
Das ist mehr als das Doppelte von dem, was ich als Vorschuss für meine letzten Romane bekommen habe, aber trotzdem nicht genug, um meine Zweifel an meiner Fähigkeit, eine derart erfolgreiche Reihe fortzuführen, zu zerstreuen. Eigentlich ist jedes weitere Gespräch sinnlos, weil ich jetzt schon weiß, dass ich das Angebot ablehnen werde. Als Amanda Vertragsunterlagen aus der Tasche zieht, räuspere ich mich.
»Es schmeichelt mir, dass Sie mir dieses Angebot machen«, sage ich und sehe dabei Jeremy an, weil er wissen soll, dass ich das wirklich so meine. »Aber ich bin mir sicher, dass es andere Autorinnen gibt, die sich weitaus besser als ich dafür eignen, als neues Gesicht die Reihe in der Öffentlichkeit zu repräsentieren.«
Jeremy bleibt stumm, sieht mich aber jetzt, da ich zum ersten Mal etwas gesagt habe, mit neu erwachtem Interesse an.
»Es tut mir leid.« Ich stehe auf und wende mich zur Tür, enttäuscht darüber, dass sich mein erster Ausflug vor die Haustür auf allen Ebenen als Desaster entpuppt hat. Ich will jetzt nur noch nach Hause und mich unter die Dusche stellen.
Corey springt auf. »Ich würde mich gern einen Moment unter vier Augen mit meiner Klientin besprechen.«
Amanda nickt, schließt ihre Aktentasche und erhebt sich ebenfalls von ihrem Stuhl. »Selbstverständlich«, sagt sie. »Sie finden sämtliche Unterlagen zu den vertraglichen Einzelheiten in den Foldern, die ich Ihnen gegeben habe. Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass wir noch zwei weitere Autorinnen im Auge haben. Deswegen wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns spätestens bis morgen Nachmittag informieren würden, wie Sie sich entschieden haben.«
Jeremy ist als Einziger sitzen geblieben. Bis jetzt hat er noch kein Wort gesagt. Amanda beugt sich über den Tisch, um mir die Hand zu schütteln. »Rufen Sie mich bitte jederzeit an, falls Sie Fragen haben.«
»Danke«, sage ich. Amanda und Herrgott Barron gehen hinaus, aber Jeremy bleibt sitzen. Corey schaut zwischen uns hin und her und wartet offensichtlich darauf, dass Jeremy auch geht. Doch der beugt sich stattdessen zu mir vor.
»Könnte ich mich kurz allein mit Ihnen unterhalten?«, fragt er mich und sieht dann Corey an – nicht, um ihn um sein Einverständnis zu bitten, sondern als Aufforderung zu gehen.
Corey wirkt verblüfft über diese Unverfrorenheit. Er dreht mir langsam den Kopf zu und verengt die Augen. Seine ganze Haltung drückt aus: Was bildet sich dieser Kerl ein? Es ist klar, dass er damit rechnet, dass ich mitkomme.
Aber er kann ja auch nicht wissen, dass ich mir nichts mehr wünsche als dieses Gespräch. Ich kann es gar nicht erwarten, dass er endlich geht, weil ich so viele Fragen an Jeremy habe: Wie sind die Leute von Pantem Press auf mich gekommen, was ist mit seiner Frau, und warum ist sie nicht in der Lage, ihre Reihe selbst zu beenden?
»Du kannst ruhig gehen«, sage ich zu Corey.
Er versucht, sich seine Gereiztheit nicht anmerken zu lassen, aber die pulsierende Ader an seiner Schläfe verrät ihn. Seine Kiefermuskulatur verhärtet sich, doch er fügt sich schließlich und geht.
Jetzt sind nur noch Jeremy und ich im Raum.
Zum zweiten Mal an diesem Tag.
Wenn man die Aufzugfahrt mitzählt, ist es sogar das dritte Mal, seit sich unsere Wege heute Vormittag gekreuzt haben.
Aber diesmal scheint die Luft vor nervöser Energie geradezu zu vibrieren. Ich bin mir sicher, dass das meine Angespanntheit ist. Jeremy wirkt genauso ruhig wie vor einer Stunde, als er mir geholfen hat, die Blutspritzer eines überfahrenen Fußgängers von meinem Körper zu entfernen.
Ich gehe zum Tisch und setze mich ihm gegenüber. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und fährt sich mit beiden Händen übers Gesicht. »Jesus«, murmelt er. »Laufen Gespräche mit Verlagen immer so steif ab?«
Ich lache leise. »Keine Ahnung. Ich kommuniziere mit meinen Ansprechpartnern am liebsten per Mail.«
»Scheint eine gute Entscheidung zu sein.« Er steht auf, geht zum Beistelltisch und nimmt sich eine Wasserflasche. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt sitze, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich in seiner Gegenwart vorhin so klein gefühlt habe. Zu wissen, dass er mit Verity Crawford verheiratet ist, schüchtert mich mehr ein, als nur in BH und Rock vor ihm zu stehen.
Er lehnt sich gegen den Tisch und stellt einen Fuß vor den anderen. »Alles okay? Sie hatten noch nicht viel Zeit, das zu verdauen, was unten auf der Straße passiert ist.«
»Sie auch nicht.«
»Ich bin in Ordnung«, sagt er und benutzt wieder den Ausdruck, der in unseren Gesprächen ziemlich häufig auftaucht. »Aber ich bin mir sicher, Sie haben Fragen.«
»Haufenweise«, gebe ich zu.
»Was möchten Sie wissen?«
»Warum kann Ihre Frau die Reihe nicht weiterschreiben?«
»Sie hatte einen Autounfall«, sagt er. Seine Stimme klingt mechanisch, als würde er versuchen, sich von dem, was passiert ist, emotional abzukoppeln.
»Oh, das … Ich hatte keine Ahnung. Das tut mir leid.« Ich rutsche unbehaglich auf meinem Stuhl hin und her und weiß nicht, was ich sonst sagen könnte.
»Zuerst war ich nicht begeistert von der Idee des Verlags, jemanden zu beauftragen, der die Reihe fortsetzt. Ich hatte die Hoffnung, sie würde sich wieder ganz erholen, aber …« Er zögert. »Tja, danach sieht es nicht aus.«
Dann ist das also der Grund, warum Jeremy so distanziert und wortkarg wirkt. Die Trauer, die ihn umgibt, ist fast mit Händen greifbar. Zu dem, was er mir vorhin erzählt hat – dass seine Tochter vor ein paar Monaten ertrunken ist –, kommt auch noch der Unfall seiner Frau. Innerhalb kürzester Zeit ist ihm zweimal der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Man kann sich kaum vorstellen, was das mit einem Menschen macht. »Das tut mir unendlich leid.«
Er nickt, sagt aber nichts. Als er sich wieder auf seinen Stuhl setzt, frage ich mich, ob er davon ausgeht, dass ich die Sache mit der Buchreihe jetzt noch einmal überdenke. Aber ich will seine Zeit nicht unnötig verschwenden.
»Ich freue mich wirklich sehr über das Angebot, Jeremy, trotzdem muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit nicht wohlfühle. Ich bin nicht sehr geschickt im Umgang mit anderen Menschen. Ich weiß nicht mal, warum der Verlag Ihrer Frau auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet mich zu fragen.«
»Ende offen«, sagt Jeremy.
Ich erstarre, als er den Titel meines ersten Romans nennt.
»Das Buch hat meine Frau sehr beeindruckt.«
»Ihre Frau hat mein Buch gelesen?«
»Sie hat gesagt, dass Sie eine echte Entdeckung seien. Ich habe dem Verlag Ihren Namen genannt, weil Verity der Meinung ist, dass Ihr Schreibstil ihrem eigenen ähnelt. Und wenn irgendjemand Veritys Reihe fortführt, sollte das eine Autorin sein, deren Arbeit sie schätzt.«
Ich schüttle den Kopf. »Wow. Ich fühle mich sehr geehrt, aber … ich kann das nicht.«
Jeremy beobachtet mich stumm. Bestimmt fragt er sich, warum ich nicht so reagiere, wie es vermutlich die meisten anderen Autoren tun würden, wenn sie so eine Chance bekämen. Er hat keine Ahnung, was in mir vorgeht. Normalerweise würde mich das mit Genugtuung erfüllen. Ich mag es nicht, durchschaut zu werden, aber in dieser Situation fühlt es sich falsch an. Plötzlich habe ich das Bedürfnis, ihm mehr von mir preiszugeben, einfach weil er heute Morgen so freundlich war. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.
Jeremy beugt sich vor, in seinen Augen schimmert Neugier. Er sieht mich einen Moment lang an, dann legt er die Faust auf den Tisch und steht auf. Ich nehme an, dass unser Meeting damit endgültig beendet ist, aber Jeremy geht nicht zur Tür, sondern wendet sich zur Wand, an der diverse gerahmte Auszeichnungen hängen, also lasse ich mich in den Stuhl zurücksinken. Er kehrt mir den Rücken zu und betrachtet die Urkunden. Erst als er über einen der Rahmen streicht, erkenne ich, dass es ein Preis ist, den seine Frau gewonnen hat. Er seufzt, dann dreht er sich zu mir um.
»Haben Sie schon mal den Ausdruck ›Chroniker‹ gehört?«, fragt er.
Ich schüttle den Kopf.
»Ich glaube, Verity hat diesen Begriff erfunden. Nach dem Tod unserer Töchter hat sie uns als Chroniker bezeichnet. Menschen, in deren Leben sich in chronischer Regelmäßigkeit Tragödien ereignen. Ein schreckliches Ereignis nach dem anderen.«
Ich sehe ihn einen Augenblick lang stumm an und verarbeite, was ich gerade gehört habe. Vorhin hat er mir von der Tochter erzählt, die er verloren hat, aber gerade eben hat er die Pluralform verwendet. »Töchter?«
Er holt tief Luft. Atmet resigniert aus. »Ja. Zwillinge. Chastin ist sechs Monate vor Harper gestorben. Es war …« Diesmal gelingt es ihm nicht, Distanz zu seinen Emotionen zu halten. Er fährt sich mit der Hand übers Gesicht und kehrt zu seinem Platz zurück. »Manche Familien haben das große Glück, in ihrem Leben nie auch nur eine einzige Tragödie erleben zu müssen. Und dann gibt es welche, bei denen die Tragödien geradezu Schlange zu stehen scheinen. Was schiefgehen kann, geht schief. Und zuletzt kommt alles noch mal schlimmer.«
Ich weiß nicht, warum er mir das erzählt, stelle es aber trotzdem nicht infrage. Ich höre ihn gern sprechen, auch wenn die Worte, die aus seinem Mund kommen, mir ans Herz gehen.
Er dreht seine Wasserflasche langsam in einem Kreis und betrachtet sie nachdenklich. Ich habe den Verdacht, dass es ihm nicht darum ging, mit mir zu sprechen, um mich umzustimmen, sondern dass er vor allem allein sein wollte. Vielleicht hat er es nicht ertragen, wie geschäftsmäßig während des Meetings über seine Frau gesprochen wurde. Ich finde es schön, dass ich ihn in seinem Alleinsein offenbar nicht störe.
Vielleicht fühlt er sich aber auch grundsätzlich allein. Wie unser ehemaliger Nachbar, der – Veritys Definition nach – ebenfalls Chroniker war.
»Ich bin in Richmond aufgewachsen«, erzähle ich. »Ein Mann, der bei uns in der Straße wohnte, hat innerhalb von weniger als zwei Jahren seine gesamte Familie verloren. Sein Sohn war in der Armee und kam bei einem Kampfeinsatz ums Leben. Sechs Monate später starb seine Frau an Krebs. Und dann hatte seine Tochter einen tödlichen Autounfall.«
Jeremy hört auf, die Wasserflasche zu drehen, und schiebt sie von sich weg. »Wo ist dieser Mann jetzt?«
Ich hole tief Luft. Diese Frage hatte ich nicht erwartet.
Die Wahrheit ist, dass er es nicht ertragen hat, alles verloren zu haben, was ihm etwas bedeutet hat. Ein paar Monate nach dem Tod seiner Tochter hat er sich das Leben genommen, aber es wäre grausam, wenn ich das Jeremy sagen würde, der um seine beiden Töchter trauert und jetzt auch noch um seine Frau bangt.
»Er lebt nach wie vor in Richmond. Ein paar Jahre später hat er wieder geheiratet. Er hat ein paar Stiefkinder und mittlerweile auch Enkel.«
Irgendetwas in Jeremys Gesichtsausdruck sagt mir, dass er weiß, dass ich lüge, mir aber dankbar dafür ist.
»Sie werden einige Zeit brauchen, um Veritys Aufzeichnungen zu sichten. Sie führt seit Jahren Notizbücher mit Handlungsskizzen, Charakterzeichnungen – Dinge, von denen ich keine Ahnung habe.«
Ich schüttle den Kopf. Hat er mir nicht zugehört? »Jeremy, ich habe Ihnen eben gesagt, dass ich auf gar keinen Fall …«
»Der Anwalt versucht Sie zu drücken. Sagen Sie Ihrem Agenten, dass er eine halbe Million verlangen soll. Sagen Sie ihm, dass die Presse nichts von Ihnen erfahren darf, dass Sie unter Pseudonym schreiben wollen und einen wasserdichten Vertrag fordern, in dem steht, dass Ihre Identität nicht gelüftet wird. Auf diese Weise wird nichts von dem, was Sie verbergen möchten, an die Öffentlichkeit gelangen.«
Ich will ihm gerade sagen, dass ich nichts anderes zu verbergen habe als meine soziale Inkompetenz, aber bevor ich dazu komme, ist er auch schon aufgestanden und zur Tür gegangen.
»Wir leben in Vermont«, sagt er. »Ich werde Ihnen die Adresse zukommen lassen, sobald Sie den Vertrag unterschrieben haben. Sie können so lange bei uns bleiben, wie Sie brauchen, um Veritys Unterlagen durchzuarbeiten.«
Er legt die Hand an die Tür. Ich öffne den Mund, um zu protestieren, aber das Einzige, was herauskommt, ist ein sehr unsicheres »In Ordnung«.
Jeremy sieht mich einen Moment lang an, als würde er gern noch etwas hinzufügen, doch dann sagt er auch nur: »In Ordnung.«
Er öffnet die Tür und geht in den Flur hinaus, wo Corey wartet, der sich an ihm vorbei in den Besprechungsraum schiebt und die Tür hinter sich zudrückt.
Ich starre auf die Tischplatte, immer noch verwirrt über das, was ich eben erlebt habe. Verwirrt darüber, dass ich für eine Arbeit, von der ich mir nicht einmal sicher bin, ob ich sie leisten kann, eine solche Summe angeboten bekomme. Eine halbe Million Dollar? Und ich darf unter Pseudonym schreiben und muss keinerlei öffentliche Auftritte absolvieren? Womit habe ich es verdient, dass er mir so ein Angebot macht?
»Ich mag den Kerl nicht.« Corey lässt sich wieder auf seinen Stuhl fallen. »Was hat er gesagt?«
»Er hat gesagt, dass sie versuchen, das Honorar zu drücken, und dass ich eine halbe Million verlangen soll. Und die Zusicherung, dass meine Identität geheim bleibt.«
Als ich den Blick hebe, sehe ich, wie Corey nach Luft schnappt. Er greift nach meiner Wasserflasche und trinkt einen Schluck. »Verdammt.«
3
Mit Anfang zwanzig war ich einige Zeit mit einem Typen namens Amos zusammen, der beim Sex gewürgt werden wollte.
Wir haben uns schließlich getrennt, weil ich mich geweigert habe, ihn zu würgen. Aber manchmal frage ich mich, wie mein Leben jetzt aussähe, wenn ich seinem Drängen nachgegeben hätte. Wären wir verheiratet? Hätten wir Kinder? Würden wir mittlerweile im Bett noch extremere, womöglich sogar gefährliche Praktiken ausprobieren?
Ich glaube, diese Aussicht war das, was mich daran am meisten beunruhigt hat. Mit Anfang zwanzig sollte man an Blümchensex noch so viel Spaß haben, dass man nicht auf den Gedanken kommt, irgendwelche krassen Fantasien ausleben zu wollen … oder?