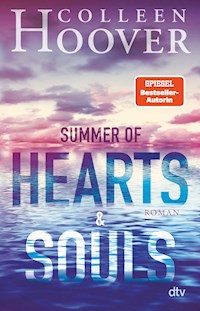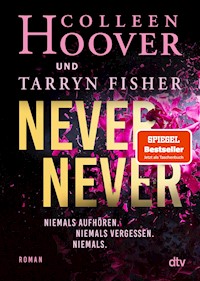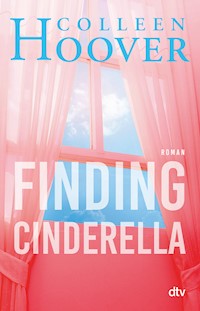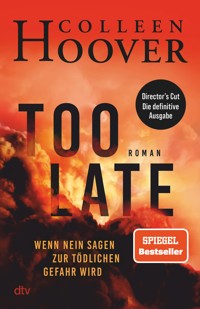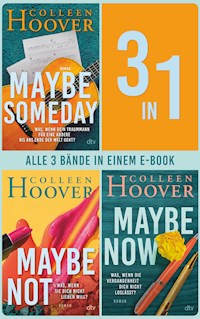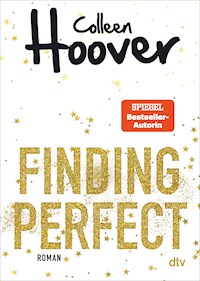12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur die Erinnerung bleibt … Ein schicksalhafter Liebes- und Familienroman von Spiegel-Bestsellerautorin Colleen Hoover: Eine bewegende Geschichte über Schuld, die schiere Unmöglichkeit zu verzeihen – und über eine Liebe, die nicht sein darf. Eine junge Mutter, die um ihr Kind kämpfen muss – und eine intensive Achterbahnfahrt der Gefühle … Fünf Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch: endlich ihre vierjährige Tochter Diem, die bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, der erste Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt – und er sich umgekehrt auch zu ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass Ledger Scotts engster Freund seit Kindertagen war. Und dass er geschworen hat, dass die ihm unbekannte Mutter, die Schuldige am Tod seines Freundes, niemals eine Rolle in Diems Leben spielen wird … »Colleen Hoover überzeugt jedes Mal aufs Neue.« Publishers Weekly »Colleen Hoover schreibt die Art von Büchern, über die noch lange gesprochen wird.« USA Today
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Eine junge Mutter, die um ihr Kind kämpfen muss – und eine Liebe, die nicht sein darf …
Fünf Jahre nach dem tragischen Verlust ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch: endlich ihre vierjährige Tochter, die bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, den ersten Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt—und er sich umgekehrt auch zu ihr. Doch Kenna erkennt schnell: Ledger ist der eine Mann, von dem sie sich fernhalten sollte. Der eine, der der Schlüssel zu ihrem Lebensglück oder ihrem Unglück sein könnte …
Von Colleen Hoover ist bei dtv außerdem lieferbar:
Weil ich Layken liebe/Weil ich Will liebe/Weil wir uns lieben
Hope Forever/Looking for Hope/Finding Cinderella
Love and Confess
Maybe Someday/Maybe Not/Maybe Now
Zurück ins Leben geliebt
Nächstes Jahr am selben Tag
Nur noch ein einziges Mal
Never Never (zusammen mit Tarryn Fisher)
Die tausend Teile meines Herzens
Too Late
Was perfekt war
Verity
All das Ungesagte zwischen uns
Finding Perfect
Layla
Finding Perfect
Für immer ein Teil von dir
Summer of Hearts and Souls
It starts with us – Nur noch einmal und für immer
Colleen Hoover
Für immer ein Teil von dir
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Michelle Landau und Kattrin Stier
Dieses Buch ist Tasara gewidmet
Kapitel 1
Kenna
Am Straßenrand steht ein kleines Holzkreuz mit dem Datum seines Todestages.
Scotty hätte das nicht gewollt. Bestimmt hat seine Mutter es dort aufgestellt.
»Können Sie bitte anhalten?«
Der Fahrer verlangsamt und bringt das Taxi zum Stehen. Ich steige aus und gehe zu der Stelle mit dem Kreuz zurück. Ich bewege es hin und her, bis sich die Erde darum herum lockert, und ziehe es dann heraus.
Ist das genau die Stelle, an der er gestorben ist? Oder war es auf der Straße?
Ich habe in der Vorverhandlung nicht zugehört, als es um die Einzelheiten ging. Als davon die Rede war, er sei mehrere Meter vom Auto weggekrochen, habe ich angefangen zu summen, weil ich mir die Ausführungen des Staatsanwalts nicht anhören wollte. Und dann habe ich mich lieber gleich schuldig bekannt, um im Falle eines Verfahrens nicht mit allen Details konfrontiert zu werden.
Denn im Prinzip war es ja meine Schuld.
Ich habe ihn zwar nicht durch meine Taten getötet, aber ganz gewiss durch meine Tatenlosigkeit.
Ich dachte, du wärst tot, Scotty. Aber Tote können nicht mehr kriechen.
Mit dem Kreuz in der Hand gehe ich zum Taxi zurück. Ich lege es neben mich auf die Rückbank und warte, dass der Fahrer wieder losfährt, aber das tut er nicht. Als ich in den Rückspiegel schaue, stelle ich fest, dass er mich mit hochgezogenen Augenbrauen ansieht.
»Das bringt bestimmt schlechtes Karma, so ein Straßenkreuz zu klauen. Sind Sie sicher, dass Sie das Ding da mitnehmen wollen?«
Ich wende den Blick ab und lüge. »Ich hab es ja selbst dort aufgestellt.« Er fährt los, aber ich spüre genau, dass er mich weiter anstarrt.
Bis zu meiner neuen Wohnung sind es von hier nur noch drei Kilometer. Früher habe ich ein Stück in die andere Richtung gewohnt, aber jetzt, ohne Auto, habe ich mir lieber etwas Zentraleres gesucht, damit ich zu Fuß zur Arbeit gehen kann. Falls ich überhaupt Arbeit finde. Mit meiner Vorgeschichte und meiner mangelnden Erfahrung wird das nicht einfach. Ganz abgesehen von dem miesen Karma, das ich nach Meinung des Taxifahrers von nun an mit mir rumschleppe.
Mag sein, dass es schlechtes Karma bringt, Scottys Kreuz zu klauen, aber ein Kreuz für einen Mann stehen zu lassen, der ganz eindeutig etwas gegen Straßenkreuze hatte, wäre auch nicht besser. Darum wollte ich den Umweg über diese Nebenstraße nehmen. Mir war schon klar, dass Grace vermutlich etwas an der Unglücksstelle aufgestellt hatte, und das wieder wegzunehmen, war ich Scotty irgendwie schuldig, fand ich.
»Bar oder mit Karte?«, fragt der Fahrer.
Nach einem raschen Blick auf das Taxameter ziehe ich ein paar Geldscheine aus dem Portemonnaie und reiche sie ihm, sobald er anhält. »Stimmt so.« Dann steige ich mitsamt Koffer und dem soeben entwendeten Holzkreuz aus dem Taxi und gehe zum Haus hinüber.
Meine neue Wohnung gehört nicht zu einer großen Wohnanlage, sondern zu einem einzelnen Gebäude, das auf der einen Seite von einem verlassenen Parkplatz und auf der anderen von einer Tankstelle flankiert wird. Eines der Fenster im Erdgeschoss ist mit Holz zugenagelt. Bierdosen in unterschiedlichen Zuständen des Verfalls fliegen auf dem Grundstück herum. Ich kicke eine beiseite, damit sie den Rollen meines Koffers nicht in die Quere kommt.
In der Realität sieht es hier noch übler aus als auf den Bildern im Internet, aber damit hatte ich schon gerechnet. Als ich angerufen habe, um mich nach einem freien Apartment zu erkundigen, hat die Besitzerin noch nicht einmal nach meinem Namen gefragt. Sie meinte nur: »Bei uns ist immer was frei. Zahlen Sie bar. Ich bin in Apartment eins.« Und damit legte sie auf.
Ich klopfe an der Tür mit der Nummer eins. Im Fenster sitzt eine Katze und starrt mich an. Sie sitzt so regungslos da, dass ich mich schon frage, ob es nur eine Figur ist, doch dann zwinkert sie und schlüpft davon.
Die Tür öffnet sich und eine kleine, ältere Frau blickt missmutig zu mir auf. Sie hat Lockenwickler im Haar und ihr Lippenstift ist bis zur Nase hinauf verschmiert. »Ich kaufe nichts.«
Ich starre den Lippenstift an, der in die Falten um ihren Mund gekrochen ist. »Wir haben letzte Woche telefoniert wegen einer Wohnung. Sie sagten, Sie hätten was frei.«
Über das faltige Gesicht der Frau huscht ein Hauch von Erinnerung. Mit einem Hmph mustert sie mich von oben bis unten. »Hätte Sie mir anders vorgestellt.«
Ich weiß nicht, was ich von dieser Bemerkung halten soll, und schaue an meiner Jeans und meinem T-Shirt hinunter, während sie sich kurz von der Tür entfernt. Dann kommt sie mit einem Schlüssel und einem Reißverschlusstäschchen zurück. »Fünfhundertfünfzig im Monat. Die erste und letzte Monatsmiete wird heute fällig.«
Ich zähle das Geld und reiche es ihr. »Kriege ich keinen Vertrag?«
Sie lacht und stopft das Geld in ihr Täschchen. »Sie sind in Nummer sechs.« Sie reicht mir den Schlüssel und deutet nach oben. »Das ist direkt über mir, also sehen Sie zu, dass Sie leise sind. Ich gehe früh schlafen.«
»Was ist mit den Nebenkosten?«
»Wasser und Müll sind inklusive, aber Sie zahlen den Strom. Der läuft jetzt – Sie haben drei Tage, um ihn auf Ihren Namen umschreiben zu lassen. Der Stromlieferant verlangt zweihundertfünfzig Vorauszahlung.«
Scheiße. Wie soll ich innerhalb von drei Tagen 250 Dollar auftreiben? Ich frage mich langsam, ob es gut war, jetzt schon zurückzukommen, aber als ich aus dem Übergangswohnheim entlassen wurde, hatte ich nur zwei Möglichkeiten: mein ganzes Geld dafür auszugeben, mich in der Stadt dort über Wasser zu halten, oder fünfhundert Kilometer zu fahren und mein restliches Geld hier auszugeben.
Und ich bin einfach lieber in der Stadt, in der auch die Leute sind, die Scotty nahegestanden haben.
Die Frau tritt einen Schritt zurück. »Willkommen in den Paradise Apartments. Sobald Sie sich eingerichtet haben, bringe ich Ihnen ein Kätzchen vorbei.«
Instinktiv lege ich die Hand auf ihre Tür, um zu verhindern, dass sie sie schließt. »Moment mal. Wie bitte? Ein Kätzchen?«
»Ja, genau. Eine kleine Katze.«
Ich weiche einen Schritt von der Tür zurück, als könnte mich das irgendwie vor dem schützen, was sie soeben gesagt hat. »Nein danke. Ich möchte kein Kätzchen.«
»Ich habe zu viele.«
»Ich möchte kein Kätzchen«, wiederhole ich.
»Aber jeder hätte doch gerne ein Kätzchen.«
»Ich nicht.«
Sie seufzt, als wäre meine Antwort vollkommen unverständlich. »Okay, ich mache Ihnen ein Angebot. Ich lasse den Strom noch zwei Wochen laufen, wenn Sie ein Kätzchen nehmen.« Was zum Teufel geht hier eigentlich ab? »Na gut«, sagt sie als Antwort auf mein Schweigen, »für den ganzen Monat. Ich lasse den Strom noch einen Monat laufen, wenn Sie dafür ein einziges Kätzchen nehmen.« Sie geht in ihre Wohnung zurück und lässt die Tür offen stehen.
Ein Kätzchen ist wirklich das Letzte, was ich will, aber diesen Monat nicht schon gleich 250 Dollar für Strom hinblättern zu müssen, könnte mehrere Kätzchen wert sein.
Sie kommt zurück mit einem kleinen schwarz-orange getigerten Kätzchen auf dem Arm, das sie mir in die Hände legt. »Bitte sehr. Ich heiße übrigens Ruth, wenn was wäre, aber sorgen Sie dafür, dass nichts ist.« Sie macht wieder Anstalten, die Tür zu schließen.
»Warten Sie. Können Sie mir sagen, wo ich hier eine Telefonzelle finde?«
Sie kichert. »Ja, irgendwo im Jahr 2005 oder so.« Und damit geht die Tür endgültig zu.
Das Kätzchen miaut, aber es klingt nicht süß, sondern eher verzweifelt, wie ein Hilferuf. »Mir geht’s genauso, glaub mir«, flüstere ich.
Mit meinem Koffer, dem Holzkreuz und dem Kätzchen gehe ich zur Treppe hinüber. Vielleicht hätte ich meine Rückkehr noch ein paar Monate länger hinauszögern sollen. Ich habe gearbeitet und mir gut 2000 Dollar zusammengespart, aber für den Umzug hierher ist jetzt schon der Großteil draufgegangen. Ich hätte noch mehr sparen sollen. Was ist, wenn ich nicht gleich Arbeit finde? Und jetzt bin ich auch noch für das Leben eines kleinen Kätzchens verantwortlich.
Mein Leben ist soeben zehnmal komplizierter geworden, als es bis gestern noch war.
Unterwegs nach oben zu meinem Apartment krallt sich das Kätzchen an meinem Shirt fest. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss und muss mit beiden Händen an der Tür ziehen, um ihn drehen zu können. Als ich die Tür aufstoße, halte ich die Luft an, weil ich Angst habe, wie es wohl riechen wird.
Ich schalte das Licht ein und sehe mich um, während ich langsam ausatme. Es riecht nicht besonders. Das ist sowohl gut als auch schlecht.
Im Wohnzimmer steht ein Sofa und es gibt einen Wandschrank, aber mehr auch nicht. Das Wohnzimmer ist klein, die Küche winzig und ein Schlafzimmer gibt es nicht. Das Bad dieses Mini-Apartments ist so eng, dass das Klo die Badewanne berührt.
Eine echte Absteige. Ein Loch von gut 30 Quadratmetern, aber für mich ist es ein Aufstieg. Immerhin habe ich mich von einer 10-m2-Zelle, die ich mir mit einer Zellengenossin geteilt habe, über die Übergangswohnung mit sechs Mitbewohnerinnen zu einer 30-m2-Wohnung für mich alleine vorgearbeitet.
Ich bin jetzt sechsundzwanzig und wohne zum allerersten Mal ganz allein. Das macht mir Angst, fühlt sich aber zugleich befreiend an.
Ich weiß nicht, ob ich mir diese Wohnung länger als einen Monat lang leisten kann, aber ich werde es versuchen. Auch wenn ich dafür in jedem Laden, an dem ich vorbeikomme, nach Arbeit fragen muss.
Eine eigene Wohnung zu haben kann von Vorteil sein, wenn ich mich an die Landrys wende. Es zeigt, dass ich jetzt unabhängig bin. Auch wenn diese Unabhängigkeit viel Kraft kosten wird.
Das Kätzchen zappelt und ich setze es auf den Boden. Es läuft überall im Wohnzimmer umher und ruft nach den anderen, die es unten zurückgelassen hat. Es versetzt mir einen Stich zu sehen, wie es in allen Ecken nach einem Weg nach draußen sucht. Nach einem Weg zurück nach Hause. Einem Weg zurück zu seiner Mutter und seinen Geschwistern.
Mit seinen schwarzen und orangen Flecken sieht es aus wie eine Hummel, oder wie eine Halloween-Deko.
»Wie sollen wir dich nennen?«
Ich weiß jetzt schon, dass das Kätzchen ziemlich sicher noch ein paar Tage namenlos bleiben wird, während ich darüber nachdenke. Einen Namen auszusuchen ist eine große Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Als ich mir das letzte Mal einen Namen für jemanden überlegen musste, habe ich es so ernst genommen wie noch nie etwas zuvor. Was auch damit zu tun haben könnte, dass ich während der Schwangerschaft die ganze Zeit in meiner Zelle hockte und nichts anderes zu tun hatte, als mir Babynamen zu überlegen.
Ich habe den Namen Diem gewählt, weil mir klar war, dass ich sofort nach meiner Entlassung hierher zurückkommen und alles in meiner Macht Stehende tun würde, um sie zu finden.
Und jetzt bin ich hier.
Carpe Diem.
Kapitel 2
Ledger
Als ich meinen Pick-up in die Gasse hinter der Bar steuere, fällt mir auf, dass die Fingernägel meiner rechten Hand immer noch lackiert sind. Mist. Ich habe vergessen, dass ich gestern Abend mit einer Vierjährigen Verkleiden gespielt habe.
Wenigstens passt das Lila zu meinem Arbeitshemd.
Roman ist gerade dabei, mehrere Müllsäcke in den Container zu werfen, als ich aus dem Wagen steige. Er entdeckt sofort die Geschenktüte in meiner Hand und greift danach, weil er weiß, dass sie für ihn ist. »Lass mich raten. Kaffeebecher?« Er wirft einen Blick in die Tüte.
Es ist ein Kaffeebecher. So wie immer.
Er bedankt sich nicht. Das tut er nie.
Wir verlieren kein Wort darüber, wofür diese Tassen stehen, aber ich kaufe ihm jeden Freitag eine, seit er clean ist. Das ist die sechsundneunzigste Tasse, die ich ihm gekauft habe.
Vermutlich sollte ich damit aufhören, denn seine Wohnung quillt vor lauter Kaffeebechern schon über, aber inzwischen stecke ich zu tief drin, um einfach aufzugeben. Er ist seit fast einhundert Wochen clean und die Tasse für diesen ganz besonderen einhundertsten Freitag habe ich schon eine ganze Weile. Es ist ein Becher mit dem Logo der Denver Broncos darauf. Das Team, das er absolut nicht ausstehen kann.
Roman deutet auf die Hintertür der Bar. »Da ist ein Pärchen, das die anderen Kunden belästigt. Ich glaube, die solltest du besser im Auge behalten.«
Das ist seltsam. Normalerweise müssen wir uns so früh am Abend noch nicht mit Betrunkenen rumschlagen. Es ist noch nicht mal sechs Uhr. »Wo sitzen sie?«
»Neben der Jukebox.« Sein Blick fällt auf meine Hand. »Hübsche Nägel, Alter.«
»Ja, oder?« Ich halte meine Hand hoch und wackle mit den Fingern. »Für eine Vierjährige hat sie das echt gut gemacht.«
Ich schiebe die Hintertür der Bar auf und werde von den scheppernden Klängen meines Lieblingssongs begrüßt, allerdings in der abartigen Version von Ugly Kid Joe.
Das kann nicht sein.
Ich gehe durch die Küche in den Barbereich und entdecke sie sofort. Sie stehen beide mit dem Rücken zu mir über die Jukebox gebeugt. Leise gehe ich zu ihnen hinüber und sehe, wie die Frau immer wieder dieselben vier Nummern drückt. Ich schaue über ihre Schultern hinweg auf den Bildschirm, während die beiden kichern wie schadenfrohe Kinder. Sie haben die Maschine so eingestellt, dass Cat’s in the Cradle sechsunddreißig Mal hintereinander abgespielt wird.
Ich räuspere mich. »Findet ihr das witzig? Mich zu zwingen, die nächsten sechs Stunden immer wieder denselben Song zu hören?«
Mein Vater dreht sich um, als er meine Stimme hört. »Ledger!« Er zieht mich in seine Arme. Er riecht nach Bier und Motoröl. Und nach Limetten. Sind sie etwa betrunken?
Meine Mutter tritt von der Jukebox zurück. »Wir haben nur versucht, das zu reparieren. Wir waren das nicht.«
»Natürlich nicht.« Ich umarme sie.
Sie geben nie Bescheid, bevor sie vorbeikommen. Sie tauchen einfach auf und bleiben einen Tag lang oder zwei oder drei und ziehen dann in ihrem Wohnmobil weiter.
Dass sie betrunken auftauchen, ist allerdings neu. Über die Schulter werfe ich einen Blick zu Roman, der inzwischen hinter der Theke steht. Ich deute auf meine Eltern. »Hast du sie abgefüllt oder sind sie schon so angekommen?«
Roman zuckt mit den Schultern. »Ein bisschen von beidem.«
»Heute ist unser Hochzeitstag«, erklärt meine Mutter. »Wir feiern.«
»Ich hoffe, ihr seid nicht mit dem Auto da.«
»Keine Sorge«, sagt mein Vater. »Unser Wagen ist mit dem Wohnmobil zum Routinecheck in der Werkstatt, deswegen haben wir ein Taxi genommen.« Er tätschelt meine Wange. »Wir wollten dich sehen, aber wir warten schon seit zwei Stunden darauf, dass du endlich auftauchst, und jetzt müssen wir gehen, weil wir Hunger haben.«
»Genau deswegen sollt ihr mich ja vorwarnen, wenn ihr in die Stadt kommt. Ich habe ein Leben.«
»Hast du an unseren Hochzeitstag gedacht?«, fragt mein Vater.
»Nein, hab ich vergessen. Sorry.«
»Wusste ich’s doch«, sagt er zu meiner Mutter. »Zahltag, Robin.« Meine Mutter greift in ihre Tasche und gibt ihm einen Zehndollarschein.
Die beiden wetten auf fast alles. Mein Liebesleben. An welche Feiertage ich denke. Jedes Footballmatch, das ich jemals gespielt habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schon seit Jahren denselben Zehndollarschein immer wieder hin und her schieben.
Mein Vater hebt sein leeres Glas und schüttelt es. »Besorg uns mal Nachschub, Barkeeper.«
Ich nehme sein Glas. »Wie wäre es mit Wasser?« Ich lasse die beiden bei der Jukebox stehen und gehe hinter die Theke.
Ich bin gerade dabei, zwei Gläser mit Wasser zu füllen, als eine junge Frau in die Bar kommt, die etwas verloren wirkt. Sie sieht sich um, als wäre sie noch nie hier gewesen, und als sie eine freie Ecke am anderen Ende der Bartheke entdeckt, steuert sie direkt darauf zu.
Ich folge ihr mit meinem Blick, während sie durch die Bar läuft. Ich starre sie so konzentriert an, dass ich die Gläser zu voll laufen lasse und das Wasser überallhin spritzt. Schnell schnappe ich mir ein Handtuch und wische die Pfütze weg. Als ich wieder aufsehe, merke ich, dass meine Mutter das Mädchen ebenfalls anstarrt. Dann mich. Dann wieder das Mädchen.
Scheiße. Ich kann es jetzt wirklich nicht gebrauchen, dass sie versucht, mich mit einer Kundin zu verkuppeln. Sie spielt schon nüchtern oft genug die Kupplerin, ich will gar nicht wissen, was das für Ausmaße annimmt, wenn sie ein paar Drinks intus hat. Ich muss sie schleunigst hier rausschaffen.
Ich bringe ihnen das Wasser und gebe meiner Mutter dann meine Kreditkarte. »Ihr solltet zu Jake’s Steakhouse rübergehen und euch einen schönen Abend machen. Geht auf mich. Aber lauft am besten zu Fuß, damit ihr unterwegs ein bisschen ausnüchtert.«
»Du bist so lieb.« Sie legt dramatisch die Hände an ihre Brust und sieht meinen Vater an. »Benji, wir haben das echt gut gemacht mit ihm. Lass uns diesen Erziehungserfolg mit seiner Kreditkarte feiern.«
»Ja, das haben wir wirklich gut gemacht«, stimmt mein Vater zu. »Wir sollten mehr Kinder haben.«
»Menopause, Liebling. Weißt du noch, als ich dich ein ganzes Jahr lang gehasst habe?« Meine Mutter greift nach ihrer Tasche und sie verlassen die Bar mitsamt ihren Wassergläsern.
»Wenn er zahlt, sollten wir Rib-Eye-Steaks bestellen«, murmelt mein Vater, als sie hinausgehen.
Ich seufze erleichtert und gehe dann zurück zur Theke. Das Mädchen hat sich leise an die Ecke der Bar zurückgezogen und schreibt in ein Notizbuch. Roman steht gerade nicht hinter dem Tresen, also gehe ich davon aus, dass noch niemand ihre Bestellung aufgenommen hat.
Da melde ich mich doch gern freiwillig.
»Was darf’s denn sein?«, frage ich sie.
»Ein Glas Wasser und eine Cola light, bitte.« Sie sieht nicht von ihren Notizen auf, also kümmere mich um ihre Bestellung. Sie schreibt immer noch in ihr Büchlein, als ich kurz darauf mit den zwei Gläsern zu ihr zurückkehre. Ich versuche, einen Blick auf das zu erhaschen, was sie da schreibt, aber sie klappt ihr Notizbuch zu und sieht zu mir auf. »Dank…« Sie verstummt mitten im Wort. Dann murmelt sie noch das letzte e, bevor sie den Strohhalm zwischen ihre Lippen schiebt.
Sie wirkt nervös.
Ich will sie fragen, wie sie heißt und wo sie herkommt, aber in den Jahren, seit ich diese Bar besitze, habe ich gelernt, dass solche Fragen bei einsamen Leuten an meiner Theke schnell zu Gesprächen führen, aus denen ich mich dann mit Händen und Füßen wieder befreien muss.
Aber die meisten Leute, die hierherkommen, ziehen mich auch nicht so in ihren Bann wie sie. Ich deute auf ihre zwei Gläser und frage: »Wartest du auf jemanden?«
Sie zieht beide Getränke näher zu sich heran. »Nee. Bin nur durstig.« Sie wendet den Blick ab und lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück. Dabei schlägt sie ihr Notizbuch wieder auf und widmet ihm ihre gesamte Aufmerksamkeit.
Ich verstehe den Wink mit dem Zaunpfahl und gehe ans andere Ende der Theke, um ihr etwas Privatsphäre zu geben.
Roman kommt aus der Küche und nickt in ihre Richtung. »Wer ist das denn?«
»Keine Ahnung, aber sie trägt keinen Ehering, ist also nicht dein Typ.«
»Sehr witzig.«
Kapitel 3
Kenna
Lieber Scotty,
sie haben eine Bar aus dem alten Buchladen gemacht. Krass, oder?
Was sie wohl mit dem Sofa angestellt haben, auf dem wir beide jeden Sonntag gesessen haben?
Die ganze Stadt kommt mir vor wie ein riesiges Monopoly-Spiel, bei dem nach deinem Tod einfach jemand das Brett hochgehoben und alle Teile durcheinandergeworfen hat.
Nichts ist mehr, wie es war. Alles kommt mir fremd vor. Ich bin in den letzten Stunden kreuz und quer durch die Stadt gelaufen und habe alles auf mich wirken lassen. Als ich einkaufen war, bin ich an der Bank vorbeigekommen, auf der wir immer gesessen und Eis gegessen haben. Ich habe mir die Zeit genommen, mich hinzusetzen und eine Weile die Leute zu beobachten.
In dieser Stadt scheint keiner irgendwelche Sorgen zu haben. Die Menschen laufen rum, als wäre in ihrer Welt alles in bester Ordnung – so als könnten sie nicht jeden Augenblick vom Gehweg fallen und irgendwo am Himmel oben landen. Sie bewegen sich einfach von einem Augenblick zum nächsten und nehmen es nicht einmal wahr, wenn hier Mütter ohne ihre Töchter herumlaufen.
Wahrscheinlich hätte ich lieber nicht in eine Bar gehen sollen, schon gar nicht gleich am ersten Abend hier. Nicht, dass ich ein Alkoholproblem hätte. Dieser eine entsetzliche Abend war eine Ausnahme. Trotzdem, das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, ist, dass deinen Eltern womöglich zu Ohren kommt, ich sei erst mal in eine Bar gegangen, noch bevor ich bei ihnen vorbeigeschaut habe.
Allerdings dachte ich ja, hier wäre noch immer der Buchladen, und in vielen Buchläden kriegt man auch einen Kaffee. Ich war echt enttäuscht, als ich hier reinkam. Ich hab so eine lange Fahrt hinter mir, zwölf Stunden, erst mit dem Bus und dann mit dem Taxi. Da hatte ich auf mehr Koffein gehofft, als eine Cola light bieten kann.
Aber vielleicht gibt’s ja in der Bar auch Kaffee. Ich habe noch gar nicht gefragt.
Vermutlich sollte ich dir das jetzt lieber nicht verraten, aber du wirst gleich verstehen, warum ich es dir erzähle: Ich habe mal einen von den Gefängnisaufsehern geküsst.
Man hat uns erwischt und ihn in einen anderen Bereich versetzt, und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil er wegen diesem Kuss Ärger bekommen hatte. Aber er war einer, der mich nicht wie eine Nummer, sondern wie einen Menschen behandelte. Ich selbst hatte kein Interesse an ihm, aber ich merkte, dass er mich anziehend fand, und deswegen habe ich seinen Kuss erwidert, als er sich zu mir beugte. Es war meine Art, mich bei ihm zu bedanken, und ich glaube, das war ihm sogar klar und es war okay für ihn. Damals war es schon zwei Jahre her, seit du mich zum letzten Mal berührt hattest, und so hätte ich eigentlich erwartet, dass ich mehr fühlen würde, als er mich gegen die Wand drückte und meine Taille umfasste.
Doch ich empfand nichts und das machte mich traurig.
Ich erzähle dir das, weil er nämlich nach Kaffee schmeckte, aber nach einem besseren Kaffee, nicht nach dem, den sie den Gefängnisinsassen servieren. Er schmeckte nach teurem Acht-Dollar-Kaffee von Starbucks mit Karamell und Sahnehäubchen und einer Kirsche obendrauf. Deswegen habe ich ihn immer weiter geküsst. Nicht weil mir der Kuss gefiel oder er selbst oder seine Hand an meiner Taille, sondern weil ich Sehnsucht nach teurem aromatisiertem Kaffee hatte.
Und nach dir. Ich habe Sehnsucht nach teurem Kaffee und nach dir.
In Liebe
Kenna
»Noch eine Cola?«, fragt der Barkeeper, dessen Tattoos unter seinen aufgekrempelten Hemdsärmeln verschwinden. Sein Hemd ist dunkelviolett, ein Farbton, den man im Gefängnis nicht oft zu sehen bekommt.
Das ist etwas, worüber ich zuvor nie nachgedacht hatte, aber so ein Gefängnis ist wirklich trist und farblos und nach einer Weile vergisst man sogar, wie Bäume im Herbst aussehen.
»Habt ihr Kaffee?«, frage ich.
»Klar. Milch und Zucker?«
»Habt ihr auch Karamell? Und Schlagsahne?«
Er wirft sich ein Geschirrhandtuch über die Schulter. »Sicher doch! Soja-, fettarme, Mandel- oder Vollmilch?«
»Voll.«
Der Barkeeper lacht. »Kleiner Scherz. Das ist eine Bar hier; ich hab eine Kanne mit vier Stunden altem Kaffee und du kannst wählen zwischen Milch und Zucker oder einem von beidem oder eben schwarz.«
Und schon wirkt die Farbe seines Hemds, die eben noch so gut zu seinem Hautton passte, gar nicht mehr so toll. Arschloch. »Gib mir einfach irgendwas«, murmele ich.
Der Barkeeper wendet sich ab, um mir einen Standard-Gefängniskaffee zu holen. Ich sehe, wie er die Kanne von der Platte nimmt und daran riecht. Er verzieht das Gesicht und kippt den Inhalt ins Spülbecken. Dann dreht er das Wasser auf, schenkt gleichzeitig einem Gast nach und setzt neuen Kaffee auf, während er bei einem anderen Glas den Bierhahn abdreht, und die ganze Zeit lächelt er dabei leise vor sich hin.
Ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand so geschmeidig bewegt, als hätte er sieben Arme und drei Hirne, die alle gleichzeitig arbeiten. Es ist immer wieder faszinierend, Leuten zuzusehen, die gut sind in dem, was sie tun.
Ich habe keine Ahnung, worin ich gut wäre. Ich bezweifle, dass es irgendetwas auf der Welt gibt, was bei mir mühelos wirken könnte.
Aber es gibt Dinge, die ich gerne gut können würde. Ich möchte eine gute Mutter sein. Für die Kinder, die ich vielleicht einmal bekommen werde, aber vor allem für die Tochter, die ich bereits auf die Welt gebracht habe. Ich möchte einen Garten haben, in dem ich etwas anpflanzen kann. Etwas, das wächst und gedeiht und nicht eingeht. Ich möchte lernen, mit Leuten zu reden, ohne sofort den Wunsch zu verspüren, jedes einzelne Wort zurückzunehmen, das ich gesagt habe. Ich möchte gerne etwas fühlen, wenn ein Mann meine Taille berührt. Ich möchte einfach gut im Leben sein. Ich möchte, dass es mühelos wirkt, aber bis jetzt erscheint mir jeder Aspekt des Lebens so, als wäre er schlicht nicht zu bewältigen.
Sobald der Kaffee durchgelaufen ist, gleitet der Barkeeper wieder zu mir zurück. Während er den Becher einschenkt, mustere ich ihn und nehme diesmal wirklich wahr, was ich da vor mir sehe. Er sieht gut aus, aber auf eine Art, dass eine wie ich, die sich um das Sorgerecht für ihre Tochter bemüht, lieber die Finger von ihm lassen sollte. Er hat Augen, die schon eine Menge gesehen haben, und Hände, die vermutlich schon mal den einen oder anderen Hieb ausgeteilt haben.
Seine Haare sind ebenso geschmeidig wie er selbst. Lange, dunkle Strähnen hängen ihm in die Augen und folgen seinen Bewegungen. Er schiebt sie nicht beiseite, jedenfalls hat er es nicht getan, seit ich hier sitze. Er lässt sie einfach ins Gesicht hängen und macht dann und wann eine rasche Kopfbewegung, nur ganz leicht, um die Haare wieder dorthin zu befördern, wo er sie haben will. Es sind kräftige Haare, gepflegte Haare, und es juckt mich in den Fingern, sie zu berühren.
Mein Kaffeebecher ist jetzt voll, aber er hebt einen Finger und sagt: »Moment noch.« Er macht auf dem Absatz kehrt, öffnet einen Minikühlschrank, holt eine Flasche Vollmilch heraus und gießt etwas davon in den Becher. Dann stellt er die Milch zurück und öffnet einen anderen Kühlschrank: Überraschung, Schlagsahne! Er greift hinter sich, und als seine Hand wieder auftaucht, hält er eine einzelne Kirsche, die er vorsichtig auf der Sahnehaube platziert. Dann schiebt er den Becher zu mir herüber und breitet die Arme aus, als hätte er soeben ein Zauberkunststück vollbracht.
»Kein Karamell«, sagt er, »aber immerhin. Schließlich sind wir hier kein Coffeeshop.«
Bestimmt denkt er, er hätte gerade einen Schickimicki-Kaffee für so eine verwöhnte Tussi gemacht, die unbedingt täglich ihren Acht-Dollar-Kaffee haben muss. Er hat ja keine Ahnung, wie lange es her ist, dass ich einen anständigen Kaffee getrunken habe.
Selbst in den letzten Monaten im Übergangswohnheim gab es nur Gefängniskaffee für die Gefängnismädels mit Gefängnisvergangenheit.
Ich könnte heulen.
Und ich muss heulen.
Sobald er seine Aufmerksamkeit einem anderen Gast an der Bar zuwendet, nehme ich einen Schluck von meinem Kaffee und schließe die Augen und weine, weil das Leben so beschissen grausam und hart sein kann und weil ich mich schon so oft daraus verabschieden wollte, doch dann kommen Augenblicke wie dieser, die mir in Erinnerung rufen, dass das Glück, nach dem wir alle im Leben streben, nichts Dauerhaftes ist, sondern etwas ganz Flüchtiges, das sich von Zeit zu Zeit zeigt und manchmal eben nur in ganz kleinen Portionen, gerade so viel, dass wir irgendwie weitermachen können.
Kapitel 4
Ledger
Ich weiß, was ich tun muss, wenn ein Kind weint, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, wenn eine erwachsene Frau weint. Ich halte möglichst viel Abstand zu ihr, während sie ihren Kaffee trinkt.
Ich habe noch nicht viel über sie herausgefunden, seit sie vor einer Stunde hier reinspaziert ist, aber eins weiß ich sicher: Sie ist nicht hier, um sich mit jemandem zu treffen. Sie ist hier, um allein zu sein. In der letzten Stunde haben drei Männer versucht, sie anzusprechen, aber sie hat nur ihre Hand gehoben und sie alle abblitzen lassen, ohne auch nur einem von ihnen ins Gesicht zu sehen.
Sie hat schweigend ihren Kaffee getrunken. Es ist gerade mal sieben Uhr abends, kann also gut sein, dass sie sich erst noch an die härteren Sachen herantastet. Aber ich hoffe, dass es nicht so ist. Die Vorstellung, dass sie in meine Bar gekommen ist, um Sachen zu bestellen, die wir normalerweise nicht servieren, und Männer abblitzen zu lassen, die sie keines Blickes würdigt, macht mich neugierig.
Roman und ich arbeiten allein, bis Mary Anne und Razi kommen. Die Bar füllt sich mehr und mehr, deswegen kann ich ihr nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, wie ich gern möchte, nämlich meine volle Aufmerksamkeit. Ich achte bewusst darauf, mich gerade genug durch die Bar zu bewegen, um nicht den Anschein zu erwecken, dass ich in ihrer Nähe bleiben will.
Als sie ihren Kaffee ausgetrunken hat, würde ich sie am liebsten sofort fragen, was sie als Nächstes bestellen will, doch stattdessen lasse ich sie gute zehn Minuten mit ihrer leeren Tasse sitzen. Vielleicht warte ich sogar fünfzehn Minuten, bis ich wieder zu ihr gehe.
In der Zwischenzeit sehe ich immer wieder in ihre Richtung. Ihr Gesicht ist ein wahres Kunstwerk. Ich wünschte, es würde als Bild in irgendeinem Museum oder so hängen, damit ich davorstehen und es anstarren kann, so lange ich will. Stattdessen erhasche ich nur hier und da einen kurzen Blick und wundere mich darüber, wie die Elemente, aus denen auch alle anderen Gesichter dieser Welt bestehen, bei ihr so viel besser zusammenpassen.
Am Wochenende kommen die Leute selten so wenig rausgeputzt in die Bar wie sie. Sie trägt ein verblichenes Mountain-Dew-T-Shirt und Jeans, aber das Grün des Shirts passt so perfekt zum Grün ihrer Augen, dass es fast scheint, als hätte sie all ihre Energie darauf verwendet, das T-Shirt mit der absolut perfekten Farbe zu finden, obwohl ich eher vermute, dass sie keinen Gedanken daran verschwendet hat. Ihre rotbraunen Haare haben durchgehend dieselbe kräftige Farbe und sind überall gleich lang, bis kurz unterm Kinn. Ab und zu fährt sie mit den Händen hindurch, und jedes Mal, wenn sie das tut, sieht es aus, als würde sie sich ganz klein zusammenfalten. Diese Geste ruft in mir das Bedürfnis hervor, um die Theke herumzugehen, sie hochzuziehen und zu umarmen.
Was ist ihre Geschichte?
Ich will es nicht wissen.
Ich muss es nicht wissen.
Ich gehe nicht mit Mädels aus, die ich in dieser Bar kennenlerne. Zweimal habe ich diese Regel gebrochen und zweimal hätte ich mir danach in den Hintern treten können.
Außerdem hat dieses Mädchen hier was Furchterregendes an sich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, aber wenn ich mit ihr spreche, fühlt es sich an, als wäre meine Stimme in meiner Brust gefangen. Und zwar nicht so, als würde sie mich einfach sprachlos machen, sondern tiefgreifender, als wolle mein Gehirn mich davor warnen, mit ihr zu interagieren.
Rote Flagge! Gefahr! Abbruch!
Aber wieso?
Unsere Blicke begegnen sich, als ich nach ihrer Tasse greife. Sie hat an diesem Abend niemanden sonst angesehen. Nur mich. Ich sollte mich geschmeichelt fühlen, doch stattdessen macht es mir Angst.
Ich habe professionell Football gespielt und besitze eine Bar, und trotzdem habe ich Angst vor ein bisschen Blickkontakt mit einem hübschen Mädchen. Das sollte meine Kurzbeschreibung bei Tinder sein: Hat für die Broncos gespielt. Besitzt eine Bar. Hat Angst vor Blickkontakt.
»Was darf’s als Nächstes sein?«, frage ich sie.
»Wein. Weiß.«
Es ist keine einfache Balance, eine Bar zu besitzen und selbst keinen Alkohol zu trinken. Einerseits will ich, dass auch alle anderen nüchtern bleiben, andererseits brauche ich zahlende Kunden. Ich schenke den Wein ein und stelle das Glas vor ihr ab.
Ich bleibe in ihrer Nähe, tue so, als würde ich mit einem Lappen Gläser abtrocknen, die schon seit gestern trocken sind. Ich sehe sie schwer schlucken, während sie das Weinglas anstarrt, fast als würde sie zweifeln. Diese Millisekunde des Zögerns, oder vielleicht ist es auch Reue, reicht aus, um mich vermuten zu lassen, dass sie ein Alkoholproblem hat. Ich erkenne jedes Mal den Moment, wenn jemand seine Abstinenz über Bord wirft, allein daran, wie derjenige sein Glas ansieht.
Trinken ist nur für Alkoholiker nervenaufreibend.
Aber sie trinkt den Wein nicht. Sie nippt nur schweigend an ihrer Cola, bis sie leer ist. Dann stellt sie das Glas weg und im selben Moment greife ich danach.
Als unsere Finger sich berühren, spüre ich, dass außer meiner Stimme noch etwas in meiner Brust gefangen ist. Vielleicht sind es ein paar zusätzliche Herzschläge. Vielleicht ist es ein ausbrechender Vulkan.
Sie zieht hastig ihre Finger zurück und legt die Hände in den Schoß. Ich räume das leere Colaglas ab und auch das volle Glas Wein, und sie sieht nicht einmal auf oder fragt mich, wieso. Sie seufzt, vielleicht erleichtert, weil ich den Wein weggenommen habe. Wieso hat sie ihn überhaupt bestellt?
Ich fülle ihre Cola nach, und als sie nicht hinsieht, kippe ich den Wein weg und wasche das Glas aus.
Sie nippt eine Weile an ihrer Cola, doch der Blickkontakt hört auf. Vielleicht habe ich sie wütend gemacht.
Roman bemerkt, dass ich sie anstarre. Er lehnt sich mit einem Ellbogen auf den Tresen und sagt: »Scheidung oder Tod?«
Roman rät immer gern, was dahintersteckt, wenn Leute allein herkommen und einfach fehl am Platz wirken. Die junge Frau macht nicht den Eindruck, als wäre sie wegen einer Scheidung hier. Normalerweise feiern Frauen ihre Scheidungen mit einer Gruppe Freundinnen und tragen Schärpen, auf denen Exfrau steht.
Das Mädchen wirkt traurig, aber nicht auf die Art, als würde sie um jemanden trauern.
»Ich tippe auf Scheidung«, sagt Roman.
Ich antworte ihm nicht. Es fühlt sich nicht richtig an, über ihre Tragödie zu spekulieren, denn ich hoffe, dass es weder Scheidung noch Tod ist, nicht mal ein schlechter Tag. Ich wünsche ihr nur Gutes, denn sie macht den Eindruck, als wäre ihr schon sehr, sehr lange nichts Gutes mehr passiert.
Ich höre auf, sie anzustarren, und widme mich anderen Gästen. Ich tue es, um ihr etwas Privatsphäre zu geben, doch sie nutzt es, um Geld auf den Tresen zu legen und sich rauszuschleichen.
Ich starre ihren leeren Barhocker und die Dollarscheine ein paar Sekunden lang an. Sie ist weg, und ich weiß weder, wie sie heißt, noch, was ihre Geschichte ist, noch, ob ich sie jemals wiedersehe, also haste ich um den Tresen, renne durch die Bar und auf die Tür zu, durch die sie eben verschwunden ist.
Der Himmel steht in Flammen, als ich ins Freie trete, und ich schirme meine Augen mit der Hand ab. Ich hatte schon wieder vergessen, wie blendend das Licht ist, wenn ich vor Sonnenuntergang aus der Bar komme.
Sie dreht sich genau in dem Moment um, als ich sie entdecke. Sie steht etwa drei Meter vor mir. Sie muss ihre Augen nicht beschirmen, denn die Sonne steht hinter ihr, umrahmt ihren Kopf, als hätte sie einen Heiligenschein.
»Ich habe Geld auf den Tresen gelegt«, sagt sie.
»Ich weiß.«
Wir starren uns einen Moment lang stumm an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich stehe einfach nur da wie ein Idiot.
»Was ist denn dann?«
»Nichts«, sage ich. Aber sofort wünsche ich mir, ich hätte »Alles« gesagt.
Sie starrt mich an, und ich tue so etwas sonst nie, ich sollte es auch heute nicht tun, aber ich weiß, wenn ich sie jetzt gehen lasse, werde ich nicht aufhören können, an das traurige Mädchen zu denken, das mir zehn Dollar Trinkgeld gegeben hat, obwohl sie es sich meinem Eindruck nach nicht leisten kann, mir überhaupt Trinkgeld zu geben.
»Komm heute Abend um elf noch mal her.« Ich gebe ihr nicht die Gelegenheit, Nein zu sagen oder mir einen Grund zu nennen, wieso sie nicht kann. Ich gehe zurück in die Bar, in der Hoffnung, dass meine Aufforderung sie neugierig genug macht, um heute Abend noch einmal aufzutauchen.
Kapitel 5
Kenna
Ich sitze mit meinem weiterhin namenlosen Kätzchen auf einer aufblasbaren Matratze und denke über all die Gründe nach, die dagegensprechen, dass ich später noch einmal in diese Bar gehe.
Schließlich bin ich nicht in diese Stadt zurückgekommen, um Männer kennenzulernen. Auch nicht, wenn sie so gut aussehen wie der Barkeeper. Ich bin einzig und allein wegen meiner Tochter hier.
Morgen ist ein wichtiger Tag. Für morgen brauche ich übermenschliche Kräfte, aber der Barkeeper hat mir vorhin, ganz ohne es zu wollen, ein Gefühl von Schwäche vermittelt, indem er mir das Weinglas weggezogen hat. Ich weiß nicht, welche Regung in meinem Gesicht ihn dazu veranlasst hat, mir das Glas wegzunehmen. Ich wollte es ja gar nicht trinken. Ich hatte es nur bestellt, damit mir die Tatsache, es nicht zu trinken, das Gefühl gibt, alles unter Kontrolle zu haben. Ich wollte es ansehen und daran riechen und es dann stehen lassen und mich dabei stärker fühlen als zu dem Zeitpunkt, als ich mich hingesetzt hatte.
Stattdessen bin ich jetzt ganz verunsichert, denn er hat mir das Glas weggenommen, weil er den Blick bemerkt hat, mit dem ich den Wein angesehen habe. Bestimmt denkt er, ich hätte wirklich ein Alkoholproblem.
Habe ich aber nicht. Ich habe schon seit Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, weil dieser eine Abend, an dem der Alkohol mit einem tragischen Ereignis zusammenkam, mir die vergangenen fünf Jahre meines Lebens geraubt hat. Und die vergangenen fünf Jahre meines Lebens haben mich zurück in diese Stadt geführt und diese Stadt macht mich nervös, und das einzige Mittel, meine Nerven zu beruhigen, ist, etwas zu tun, was mir das Gefühl gibt, mein Leben und meine Entscheidungen noch immer unter Kontrolle zu haben.
Und genau deswegen wollte ich diesen Wein unberührt stehen lassen, verdammt noch mal.
Jetzt werde ich heute Nacht wieder schlecht schlafen. Ich habe nicht das Gefühl, zufrieden mit mir sein zu können, weil er mir das genaue Gegenteil vermittelt hat. Wenn ich heute Nacht gut schlafen will, muss ich mir noch irgendetwas anderes verkneifen, das ich gerne hätte.
Oder irgendjemanden.
Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich einen Mann wollte. Nach Scotty war da keiner mehr. Aber dieser Barkeeper ist schon ziemlich heiß und er hat so ein nettes Lächeln und er kann toll Kaffee kochen. Außerdem hat er mich eingeladen wiederzukommen, ich kann also einfach da aufzukreuzen, nur um ihn abblitzen zu lassen.
Und danach werde ich gut schlafen und kann gut vorbereitet in den wichtigsten Tag meines Lebens starten.
Ich wünschte, ich könnte meine Katze mitnehmen. Ein bisschen Beistand wäre nicht schlecht, aber sie schläft bereits auf dem neuen Kissen, das ich vorhin gekauft habe.
Ich habe nicht viel gekauft. Die aufblasbare Matratze, ein paar Kissen und Bettzeug, Cracker, Käse, Katzenfutter und ein Katzenklo. Ich habe beschlossen, dass ich hier in dieser Stadt immer nur für zwei Tage im Voraus planen werde. Ehe ich nicht weiß, was der morgige Tag bringen wird, hat es keinen Sinn, mein mühsam angespartes Geld zu vergeuden. Es geht ohnehin schon zur Neige, weswegen ich mir jetzt auch kein Taxi leiste.
Ich verlasse meine Wohnung und mache mich auf den Weg zurück zu der Bar, nehme aber weder Handtasche noch Geldbeutel mit. Nur meinen Führerschein und den Wohnungsschlüssel, mehr brauche ich nicht. Es sind gute zwei Kilometer zu Fuß von meiner Wohnung bis zur Bar, aber das Wetter ist schön und der Weg gut beleuchtet.
Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass mich dort jemand erkennen könnte oder schon auf dem Weg dorthin, aber ich sehe ganz anders aus als damals. Früher war es mir wichtiger, mich zurechtzumachen, aber nach fünf Jahren im Gefängnis verlieren gefärbte Haare und Extensions und falsche Wimpern und künstliche Nägel einfach an Bedeutung.
Ich habe nicht lange genug in dieser Stadt gelebt, um neben Scotty noch andere Freundschaften zu schließen, deswegen denke ich, dass kaum jemand weiß, wer ich überhaupt bin. Bestimmt haben viele von mir gehört, aber wenn niemand mit einem rechnet, wird man meist auch nicht erkannt.
Patrick und Grace würden mich möglicherweise wiedererkennen, aber auch die beiden habe ich nur einmal getroffen, bevor ich in den Knast gewandert bin.
Knast. An dieses Wort werde ich mich nie gewöhnen. Es klingt so hart. Wenn man die Buchstaben einzeln zu Papier bringt, wirken sie nicht so heftig. Aber wenn man das Wort »Knast« laut ausspricht, klingt es einfach nur bitter.
Wenn ich daran denke, wo ich die letzten fünf Jahre verbracht habe, bezeichne ich es im Geiste lieber als die Einrichtung. Oder ich umschreibe meine Zeit dort einfach mit während meiner Abwesenheit und belasse es dabei. Die Worte »Als ich im Knast war« werden mir nie leicht über die Lippen gehen.
Wenn ich mich morgen auf Jobsuche begebe, werde ich es allerdings aussprechen müssen – zumindest das Wort Gefängnis. Man wird mich fragen, ob ich vorbestraft bin, und dann werde ich antworten müssen: »Ja, ich war fünf Jahre wegen fahrlässiger Tötung im Gefängnis.«
Und dann werde ich entweder trotzdem eingestellt oder auch nicht. Vermutlich eher nicht.
Frauen werden immer mit anderen Maßstäben gemessen, selbst hinter Gittern. Wenn Frauen sagen, dass sie im Gefängnis waren, denken die Leute gleich Abschaum, Nutte, Junkie, Diebin. Aber wenn Männer sagen, dass sie im Gefängnis waren, fügen die Leute den negativen Gedanken noch Auszeichnungen hinzu, so etwas wie: Abschaum, aber gewitzt, Junkie, aber hart im Nehmen, Dieb, aber irgendwie krass.
Auch bei den Männern ist da ein Stigma, aber die Frauen kriegen nie auch noch eine Auszeichnung mit dazu.
Der Uhr auf dem Justizgebäude zufolge ist es halb zwölf, als ich die Stadtmitte erreiche. Hoffentlich ist er noch da, auch wenn ich eine halbe Stunde zu spät bin.
Vorhin habe ich gar nicht auf den Namen der Bar geachtet, vermutlich, weil es noch hell war draußen und ich ohnehin überrascht war, dass da kein Buchladen mehr ist, aber jetzt leuchtet ein kleiner Schriftzug über der Tür: WARD’S.
Ich zögere, bevor ich hineingehe. Allein mein erneutes Auftauchen hier ist schon eine Botschaft an den Typen. Eine Botschaft, die ich vielleicht gar nicht übermitteln will. Aber die Alternative wäre, jetzt in mein Apartment zurückzugehen und dort mit meinen Gedanken allein zu sein.
In den vergangenen fünf Jahren habe ich schon genug Zeit allein mit meinen Gedanken verbracht. Ich sehne mich nach Menschen und Geräuschen und all den Dingen, die ich so lange nicht hatte, und mein Apartment erinnert mich eher ans Gefängnis. Voller Einsamkeit und Stille.
Ich öffne die Tür der Bar. Drinnen ist es lauter und verrauchter und dunkler als zuvor. Es gibt keine freien Plätze mehr und so schlängele ich mich durch die Leute, gehe aufs Klo, warte im Vorraum, warte draußen und drehe erneut eine Runde. Schließlich wird ein Tisch frei. Ich durchquere den Raum und setze mich hin, allein.
Ich beobachte den Barkeeper, der hinter der Bar umhergleitet. Es gefällt mir, dass er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Zwei Typen geraten in Streit, aber das stört ihn nicht weiter – er deutet einfach auf die Tür und die beiden gehen. Das tut er oft. Er deutet auf Dinge, und dann machen die Leute genau das, was er damit bezwecken wollte.
Er deutet auf zwei Gäste und nimmt dabei Blickkontakt zu dem anderen Barkeeper auf. Der geht zu den beiden hinüber und kassiert.
Er deutet auf ein leeres Regal und eine der Kellnerinnen nickt, ein paar Minuten später hat sie das Regal aufgefüllt.
Er deutet auf den Boden und der andere Barkeeper verschwindet durch die Schwingtüren, dann taucht er mit einem Wischlappen wieder auf, um etwas Verschüttetes aufzuwischen.
Er deutet auf einen Haken an der Wand, und eine andere Kellnerin, die offenbar schwanger ist, flüstert tonlos »Danke«, hängt ihre Schürze auf und geht nach Hause.
Er gibt Zeichen und die Leute führen aus, und irgendwann kommt die letzte Runde und dann ist es Zeit zu schließen. Nach und nach tröpfeln die Leute nach draußen. Keiner tröpfelt mehr rein.
Er hat mich nicht angesehen. Kein einziges Mal.
Ich bereue es schon fast, dass ich hier bin. Er wirkt beschäftigt und vielleicht habe ich sein Verhalten vorhin falsch gedeutet. Ich hatte einfach angenommen, dass er aus einem ganz bestimmten Grund gesagt hat, ich solle wiederkommen, aber vielleicht sagt er das zu allen seinen Gästen.
Ich stehe auf, weil ich denke, dass ich vielleicht auch nach draußen tröpfeln sollte, aber sobald er mich bemerkt, streckt er den Finger aus. Mit einer kleinen Bewegung bedeutet er mir, mich wieder hinzusetzen, und ich gehorche.
Ich bin erleichtert, dass meine Intuition doch richtig war, aber je mehr sich die Bar leert, desto mehr wächst meine Nervosität. Er geht davon aus, dass ich eine erfahrene Frau bin, dabei fühle ich mich mit Müh und Not erwachsen. Ich bin ein sechsundzwanzigjähriger Teenager und fange bei null an.
Ich weiß nicht recht, ob ich aus den richtigen Gründen hier bin. Ich dachte, ich könnte einfach reinkommen, ein wenig mit ihm flirten und dann wieder gehen, aber er ist verlockender als jeder Schickimicki-Kaffee. Ich bin hergekommen, um ihn abblitzen zu lassen, aber ich hatte ja keine Ahnung, dass er den ganzen Abend auf Dinge deuten würde, und schon gar nicht, dass er auch auf mich deuten würde.
Ich hatte keine Ahnung, wie sexy dieses Deuten ist.
Ob ich es wohl vor fünf Jahren auch schon so sexy gefunden hätte? Oder ist es inzwischen nur lächerlich einfach, mir zu gefallen?
Um Mitternacht sind schließlich nur noch wir beide da. Die anderen Angestellten sind gegangen, die Tür ist abgeschlossen und er trägt einen Kasten mit leeren Gläsern nach hinten.
Ich ziehe ein Bein hoch und lege die Arme darum. Ich bin nervös, denn ich bin sicher nicht in diese Stadt zurückgekehrt, um einen Mann kennenzulernen, sondern aus einem weit wichtigeren Grund. Den er, wie es scheint, mit einem einzigen Fingerzeig ins Schwanken bringen könnte.
Aber schließlich bin ich auch nur ein Mensch. Menschen brauchen Gefährten, und auch wenn ich nicht hierher zurückgekehrt bin, um Leute kennenzulernen, ist dieser Mann hier schwer zu ignorieren.
Als er durch die Schwingtür zurückkommt, trägt er ein anderes Shirt. Nicht mehr dieses lilafarbene Hemd mit den hochgekrempelten Ärmeln wie auch alle anderen Angestellten, sondern ein weißes T-Shirt. Ganz schlicht und doch so kompliziert.
Er lächelt, als er zu mir tritt, und ich spüre, wie dieses Lächeln sich über mich breitet wie die Wärme einer kuscheligen Daunendecke. »Du bist wiedergekommen.«
Ich gebe mir Mühe, lässig zu klingen. »Das wolltest du doch.«
»Möchtest du was trinken?«
»Nein danke.«
Jetzt berührt er doch sein Haar, schiebt es zurück, während er mich ansieht. In seinem Blick tobt ein Krieg, der mich alles andere als kaltlässt, und schließlich setzt er sich neben mich. Direkt neben mich. Mein Herz schlägt schneller, sogar noch schneller als damals, als Scotty vor vielen Jahren zum vierten Mal an meine Supermarktkasse kam.
»Wie heißt du?«, fragt er.
Ich will ihm meinen Namen nicht verraten. Er sieht aus, als wäre er so alt, wie Scotty jetzt wäre, wenn er noch leben würde, was bedeutet, dass er meinen Namen wiedererkennen oder sich an das erinnern könnte, was damals passiert ist. Ich will nicht, dass mich jemand erkennt oder sich erinnert oder die Landrys warnt, dass ich in der Stadt bin.
Es ist keine kleine Stadt, aber so groß ist sie nun auch wieder nicht. Meine Gegenwart hier wird nicht lange unbemerkt bleiben, aber sie muss wenigstens lange genug unbemerkt bleiben. Deswegen lüge ich, ein wenig, und nenne ihm meinen zweiten Vornamen. »Nicole.«
Ich frage ihn nicht, wie er heißt, weil es mir egal ist. Ich werde diesen Namen nicht benutzen. Nach heute Abend werde ich nie wieder hierherkommen.
Ich ziehe an einer Haarsträhne, weil es mich nervös macht, nach so langer Zeit jemandem so nahe zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich vergessen habe, wie man sich in so einer Situation verhält, und so platze ich einfach mit dem heraus, was ich unbedingt noch loswerden wollte: »Ich hätte ihn nicht getrunken.«
Er legt verwundert den Kopf schief bei diesem Geständnis und ich erläutere es ihm.
»Den Wein. Manchmal muss ich …« Ich schüttele den Kopf. »Es ist bekloppt, aber ich mach das manchmal, dass ich mir Alkohol bestelle, nur um ihn dann stehen zu lassen. Ich habe kein Alkoholproblem. Es geht mir mehr darum, die Kontrolle zu haben, glaube ich. Dann komme ich mir nicht so machtlos vor.«
Mit einem leisen Lächeln mustert er mein Gesicht. »Das respektiere ich«, sagt er. »Ich trinke auch nur sehr wenig aus ähnlichen Gründen. Ich bin jeden Abend von Betrunkenen umgeben, und je mehr das der Fall ist, desto weniger will ich dazugehören.«
»Ein Barkeeper, der nicht trinkt? Das kommt selten vor, oder? Ich dachte immer, dass Alkoholsucht unter Barkeepern besonders weit verbreitet ist. Schon allein weil sie so leicht drankommen.«
»Nein, das ist tatsächlich eher beim Baugewerbe der Fall. Was auch nicht gerade für mich spricht. Ich baue nämlich schon seit mehreren Jahren ein Haus.«
»Du forderst das Unglück ja geradezu heraus.«
Er lächelt. »Sieht so aus.« Er lehnt sich etwas entspannter zurück. »Und was machst du so, Nicole?«
Das ist genau der Augenblick, in dem ich gehen sollte. Bevor ich zu viel sage, bevor er zu viel fragt. Aber ich mag seine Stimme und seine Gegenwart und ich könnte mir vorstellen, dass es mich gut ablenken würde, hierzubleiben, und Ablenkung kann ich wirklich dringend brauchen.
Ich will nur einfach nicht reden. Reden wird mir in dieser Stadt nur Ärger einbringen.
»Interessiert dich das wirklich?« Ich bin sicher, er hätte viel lieber seine Hand unter meinem Shirt, als sich anzuhören, was auch immer jemand wie ich in so einem Augenblick zu sagen hätte. Und da ich nicht zugeben will, dass ich überhaupt kein Geld verdiene, weil ich fünf Jahre hinter Gittern saß, lasse ich mich auf seinen Schoß gleiten.
Er wirkt überrascht, fast so, als hätte er wirklich damit gerechnet, dass wir die nächste Stunde hier rumsitzen und plaudern würden.
Sein leicht schockierter Gesichtsausdruck weicht aber rasch der Akzeptanz. Er lässt die Hände auf meine Hüften sinken und packt zu. Ich erschauere unter seiner Berührung.
Er rückt mich ein wenig zurecht, sodass ich etwas höher sitze und ihn durch seine Jeans hindurch spüre, und auf einmal bin ich nicht mehr so sicher wie noch vor fünf Sekunden, dass ich das hier einfach so abbrechen und weggehen kann. Ich dachte, ich könnte ihn küssen und ihm dann Gute Nacht sagen und voller Stolz nach Hause marschieren. Ich wollte vor morgen einfach nur ein bisschen das Gefühl haben, dass ich die Lage im Griff habe. Aber nun fährt er mit den Fingern über die Haut an meinem Bauch und das macht mich immer schwächer und schwächer und so verdammt leichtsinnig. Nicht dass mir auf einmal alles egal wäre, aber mein Kopf fühlt sich plötzlich ganz leer an und die Gefühle stauen sich in meiner Brust, als würde sich in mir ein Feuerball aufbauen.
Seine rechte Hand fährt meinen Rücken hinauf und ich stöhne leise auf, weil es wie ein Strom durch mich hindurchfährt. Jetzt berührt er mein Gesicht, streicht mit den Fingern meine Wangenknochen entlang und dann mit den Fingerspitzen über meine Lippen. Er sieht mich an, als wolle er herausfinden, woher er mich kennt.
Aber vielleicht ist das auch nur meine Angst.
»Wer bist du?«, flüstert er.
Ich habe es ihm zwar schon gesagt, doch ich wiederhole nochmals meinen zweiten Vornamen. »Nicole.«
Er lächelt, doch dann schwindet das Lächeln und er sagt: »Ich weiß, wie du heißt. Aber woher kommst du? Warum haben wir uns früher noch nie gesehen?«
Ich will seine Fragen nicht. Ich kann sie nicht ehrlich beantworten. Ich rücke ein Stück näher an seinen Mund. »Und wer bist du?«
»Ledger«, sagt er, bevor er meine Vergangenheit aufreißt, die Überreste meines Herzens herauszerrt und zu Boden fallen lässt und mich dann küsst.
Auf Englisch heißt sich verlieben to fall in love, dabei ist fallen so ein trauriges Wort, wenn man es sich recht überlegt. Ein Fall ist nie etwas Gutes. Man fällt zu Boden, man fällt zurück oder man fällt in einen Abgrund.
Wer auch immer als Erstes den Ausdruck to fall in love verwendet hat, dem war dieses Gefühl offenbar schon wieder entfallen, denn sonst hätte er oder sie sich bestimmt eine bessere Beschreibung ausgedacht.
Als Scotty mir das erste Mal gesagt hat, dass er mich liebt, waren wir schon eine ganze Weile zusammen. An jenem Abend wollte er mich seinem besten Freund vorstellen. Seine Eltern hatte ich bereits kennengelernt, was ihm auch sehr wichtig gewesen war, aber nicht annähernd so wichtig wie mir diesen Freund vorzustellen, der wie ein Bruder für ihn war.
Dieses Treffen hat nie stattgefunden. Ich weiß nicht mehr, warum, es ist schon so lange her, aber sein Freund musste absagen, worüber Scotty sehr traurig war. Ich habe dann Kekse für ihn gebacken und wir haben einen Joint geraucht und dann habe ich ihm einen geblasen. Best girlfriend ever.
Bis ich ihn umgebracht habe.
Aber das war ja drei Monate vor seinem Tod und an jenem Abend war er zwar sehr traurig, aber doch sehr lebendig. Er hatte ein schlagendes Herz und einen schnellen Puls und Tränen in den Augen, und sein Brustkorb hob und senkte sich, während er sagte: »Verdammt, Kenna, ich liebe dich. Ich habe noch nie einen Menschen so geliebt. Du fehlst mir die ganze Zeit, sogar wenn wir zusammen sind.«
Das habe ich nie vergessen. »Du fehlst mir die ganze Zeit, sogar wenn wir zusammen sind.«
Ich dachte eigentlich, das wäre alles, was mir von diesem Abend in Erinnerung geblieben ist, aber das stimmt nicht. Da ist noch etwas. Ein Name. Ledger.
Der beste Freund, der nie aufgetaucht ist. Der beste Freund, den ich nie kennengelernt habe.
Der beste Freund, dessen Zunge ich jetzt in meinem Mund, dessen Hand ich unter meinem Shirt und dessen Namen ich in meiner Brust spüre.
Kapitel 6
Ledger
Anziehung ist schon etwas Seltsames.
Was genau ist es eigentlich, das einen anderen Menschen anziehend für uns macht? Wie kann es sein, dass jede Woche Dutzende Frauen durch die Tür dieser Bar kommen und nicht eine einzige davon den Drang in mir weckt, ihr auch nur einen zweiten Blick zu schenken? Aber dann kommt dieses Mädchen reinspaziert und ich kann meinen verdammten Blick einfach nicht mehr von ihr losreißen.
Und jetzt kann ich meinen Mund nicht mehr von ihr losreißen.
Ich habe keine Ahnung, wieso ich meine eigene Regel breche, nichts mit Kundinnen anzufangen. Aber sie hat etwas an sich, das mich ahnen lässt, dass ich nur diese eine Chance habe. Ich habe den Eindruck, dass sie entweder nur auf der Durchreise ist oder nicht vorhat, noch einmal hierherzukommen. Der heutige Abend scheint eine Ausnahme von ihrer normalen Routine zu sein, und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich es noch als alter Mann bereuen würde, wenn ich mir jetzt die Chance entgehen lasse, mit ihr zusammen zu sein.
Sie scheint ein stiller Mensch zu sein, aber nicht, weil sie schüchtern ist. Ihre Stille ist wild – ein Sturm, der sich ungesehen anschleicht und den du erst bemerkst, wenn der Donner deine Knochen vibrieren lässt.
Sie ist still, hat aber gerade genug gesagt, dass ich auch den Rest ihrer Worte hören will. Sie schmeckt nach Äpfeln, obwohl sie vorher Kaffee getrunken hat, und Äpfel sind mein Lieblingsobst. Vermutlich sind sie jetzt sogar mein liebstes Essen überhaupt.
Wir küssen uns einige Sekunden lang, und obwohl sie den ersten Schritt gemacht hat, schien sie überrascht, als ich sie zu mir gezogen und geküsst habe.
Vielleicht hat sie gedacht, dass ich etwas länger warte, bis ich sie koste, oder vielleicht hat sie nicht damit gerechnet, dass es sich so anfühlt – ich hoffe, es fühlt sich auch für sie so an –, aber was auch immer sie dazu gebracht hat, scharf Luft zu holen, kurz bevor unsere Lippen sich getroffen haben, es lag nicht daran, dass sie den Kuss nicht wollte.
Sie weicht zurück, für einen kurzen Moment unentschlossen, doch dann scheint sie eine Entscheidung zu treffen, denn sie neigt sich wieder vor und küsst mich mit noch mehr Überzeugung.
Doch diese Überzeugung verschwindet. Viel zu schnell. Sie löst sich ein zweites Mal von mir und dieses Mal ist ihr Blick voller Bedauern. Sie schüttelt den Kopf und legt ihre Hände an meine Brust. Ich bedecke ihre Hände mit meinen, genau in dem Moment, als sie sagt: »Tut mir leid.«
Sie rutscht von meinem Schoß, wobei die Innenseite ihres Schenkels über meinen Reißverschluss reibt und mich noch härter werden lässt, dann steht sie auf. Ich greife nach ihrer Hand, doch ihre Finger gleiten zwischen meinen hindurch, als sie vom Tisch zurückweicht. »Ich hätte nicht noch mal herkommen sollen.«
Sie dreht sich um und geht auf die Tür zu.
Ich sacke zusammen.
Ich habe mir ihr Gesicht nicht eingeprägt, und mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie verschwindet, ohne dass ich mich an die exakte Form ihres Mundes erinnern kann, der Lippen, die eben noch auf meinen lagen.
Ich stehe ebenfalls auf und folge ihr.
Sie bekommt die Tür nicht auf. Sie rüttelt an der Klinke und drückt dagegen, als könnte sie gar nicht schnell genug von mir wegkommen. Ich will sie anflehen, zu bleiben, aber ich will ihr auch helfen, von mir wegzukommen, also greife ich an ihr vorbei, ziehe den oberen Riegel runter und hebe den unteren mit meinem Fuß an. Die Tür schwingt auf und sie stolpert nach draußen.
Sie holt tief Luft und dreht sich dann um, sieht mich an. Ich konzentriere mich auf ihren Mund, wünsche mir, ich hätte ein fotografisches Gedächtnis.
Ihre Augen haben nicht mehr die gleiche Farbe wie ihr Shirt. Das Grün ist jetzt heller, weil sich Tränen darin sammeln. Auch diesmal weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mädchen in so kurzer Zeit so viele widersprüchliche Emotionen zeigt, und nichts davon wirkt aufgesetzt oder überdramatisch. Es ist fast so, als wolle sie jede Entscheidung, die sie trifft, und jedes Gefühl, das sie hat, gleich wieder zurückholen und verstecken.
Sie wirkt verlegen.
Sie schnappt nach Luft, versucht, die paar Tränen wegzuwischen, die sich in ihren Augenwinkeln geformt haben, und weil ich keine Ahnung habe, was zur Hölle ich sagen soll, nehme ich sie einfach in den Arm.
Was kann ich sonst tun?
Als ich sie an mich ziehe, wird sie in der ersten Sekunde ganz steif, doch schon im nächsten Moment entspannt sie sich mit einem Seufzen.
Wir sind die einzigen Menschen hier. Es ist nach Mitternacht, alle sind zu Hause, schlafen, schauen einen Film oder haben Sex. Nur ich bin hier in der Main Street und umarme ein sehr trauriges Mädchen, frage mich, warum sie so traurig ist, und wünsche mir, dass ich sie nicht so wunderschön finden würde.
Sie hat ihr Gesicht an meine Brust gedrückt und die Arme fest um meine Taille geschlungen. Ihre Stirn erreicht genau meinen Mund, aber sie hat den Kopf unter mein Kinn geschoben.
Ich streiche über ihre Arme.
Mein Wagen steht direkt um die Ecke. Ich parke immer in der Gasse hinter der Bar, aber sie scheint echt neben der Spur zu sein und ich will sie in ihrer Verfassung nicht dazu überreden, mir in eine dunkle Gasse zu folgen. Stattdessen lehne ich mich an einen Pfeiler des Vordachs und ziehe sie mit mir.