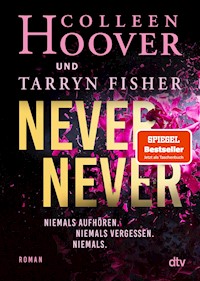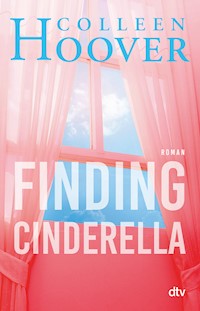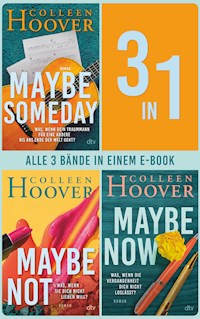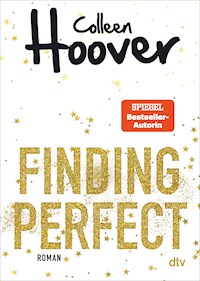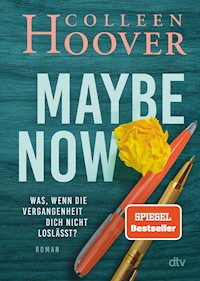10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lily, Ryle und Atlas-Reihe
- Sprache: Deutsch
Manchmal verletzen dich die am tiefsten, die du am meisten liebst Intensiv, überaus fesselnd, hoch emotional: Colleen Hoovers Weltbestseller, der autobiografische Züge trägt So ehrlich und authentisch wie nie – eine intensive Liebes-Dreiecksgeschichte, die mit viel Feingefühl ein ernstes, hoch sensibles Thema behandelt Als Lily nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der Start ins Berufsleben und dann noch Ryle – attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Vergessen ist Lilys schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder, und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte. »Eine Dreiecksbeziehung, die voller Emotionen steckt und bei der garantiert kein Auge trocken bleibt.« Grazia »Was für eine großartige, berührende Lektüre. Eine, die bleibt.« USA Today »Ein mutiger, herzzerreißender Roman, der seine Krallen in einen schlägt und einen nicht mehr loslässt… Niemand schreibt solch hoch emotionale Bücher wie Colleen Hoover!« Anna Todd
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
MANCHMAL SIND ES DIE, DIE MAN AM MEISTEN LIEBT, DIE EINEN AM TIEFSTEN VERLETZEN …
Als Lily nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle – attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Vergessen ist ihre schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte.
Von Colleen Hoover sind bei dtv außerdem lieferbar:
Weil ich Layken liebe | Weil ich Will liebe | Weil wir uns lieben
Hope Forever | Looking for Hope | Finding Cinderella
Finding Perfect
Love and Confess
Maybe Someday | Maybe not | Maybe Now
Zurück ins Leben geliebt – Ugly Love
Nächstes Jahr am selben Tag – November 9
Never Never (zusammen mit Tarryn Fisher)
Die tausend Teile meines Herzens
Was perfekt war
Verity
All das Ungesagte zwischen uns
Layla
Für immer ein Teil von dir
Summer of Hearts and Souls
It starts with us – Nur noch einmal und für immer
Too Late – Wenn Nein sagen zur tödlichen Gefahr wird
Colleen Hoover
Nur nochein einziges Mal
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Katarina Ganslandt
Für meinen Vater,
der sein Bestes getan hat,
uns nie seine schlimme Seite sehen zu lassen.
Und für meine Mutter,
die dafür gesorgt hat, dass wir ihn nie von seiner
schlimmen Seite kennenlernen mussten.
Erster Teil
1.
Ich sitze auf der gemauerten Brüstung einer Dachterrasse, blicke zwölf Stockwerke tief auf Boston hinunter und denke an Selbstmord.
Um Gottes willen, nicht an meinen eigenen – dazu mag ich mein Leben viel zu sehr und möchte keinen einzigen Moment davon verpassen.
Nein, ich denke darüber nach, was Menschen dazu bringt, sich in den Tod zu stürzen, und ob sie in den wenigen Sekunden des freien Falls einen kleinen Stich der Reue verspüren. Schießt ihnen so was wie »Scheiße, war wohl doch keine so gute Idee« durch den Kopf, während sie dem Ende entgegenrasen?
Hoffentlich nicht.
Ich denke viel über den Tod nach. Heute zumindest. Was vermutlich damit zu tun hat, dass ich vor knapp zwölf Stunden auf dem Friedhof von Plethora im Bundesstaat Maine die grandioseste Trauerrede gehalten habe, die dort je zu hören gewesen ist. Okay, vielleicht war sie auch nicht grandios, sondern einfach nur total daneben, das kommt ganz darauf an, wen man fragt: mich oder meine Mutter. Meine Mutter, die sich nach dem, was ich getan habe, wahrscheinlich die nächsten zwölf Monate weigern wird, mit mir zu sprechen.
Meine Rede hat niemanden zu Tränen gerührt wie die, die Brooke Shields für Michael Jackson gehalten hat, und sie war auch nicht so bewegend wie die von Steve Jobs’ Schwester. Aber auf ihre Art war sie definitiv einzigartig.
Ich habe vor Nervosität gezittert, als ich nach vorn zum Rednerpult gegangen bin. Immerhin handelte es sich bei dem Toten, der betrauert wurde, um Andrew Bloom, den hoch angesehenen Bürgermeister meiner Heimatstadt Plethora. Um den Eigentümer des bezirksweit erfolgreichsten Immobilienbüros. Um den Ehemann von Jenny Bloom, der von unzähligen Schülergenerationen heiß geliebten Hilfslehrerin der Grundschule von Plethora. Und um den Vater von Lily Bloom – der rothaarigen Einzelgängerin, die sich als Fünfzehnjährige in einen obdachlosen Jungen verliebte und Schande über ihre Familie brachte.
Ach ja, Lily Bloom bin übrigens ich. Und Andrew Bloom war mein Vater.
Nach meiner Rede bin ich mit der nächsten Maschine zurück nach Boston geflogen und habe mir eine Dachterrasse gesucht. Nicht weil ich Selbstmordgedanken hätte. Ich habe wirklich nicht vor, mich hier runterzustürzen. Es ist nur so, dass ich dringend Ruhe und frische Luft brauche, und da ich in meiner Wohnung beides nicht bekomme, weil sie a) keinen Balkon hat und b) meine Mitbewohnerin sich furchtbar gern selbst singen hört, musste ich mich hierher zurückziehen.
Leider habe ich nicht bedacht, wie kalt es hier oben sein würde. Man kann es aushalten, aber gemütlich ist doch etwas anderes. Wenigstens sieht man die Sterne. Tote Väter, dauersingende Mitbewohnerinnen und fragwürdige Grabreden kommen einem nicht mehr ganz so schlimm vor, wenn die Nacht so sternenklar ist, dass man die Großartigkeit des Weltalls bis in die letzte Faser spürt.
Ich liebe es, zum Himmel aufzuschauen und mich bedeutungslos zu fühlen.
Es ist ein schöner Abend.
Obwohl … vielleicht sollte ich den Satz lieber in die Vergangenheitsform setzen.
Es war ein schöner Abend.
Gerade eben ist nämlich die Stahltür mit so viel Schwung aufgestoßen worden, dass sicher gleich jemand aus dem Treppenhaus auf die Terrasse gestürmt kommt, und dann ist es mit meiner Ruhe dahin. Bingo. Die Tür knallt zu und ich höre schnelle Schritte. Weil derjenige mich in meiner Nische an der Hauswand höchstwahrscheinlich sowieso nicht bemerken wird, mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mich umzudrehen.
Stattdessen schließe ich seufzend die Augen, lehne den Kopf an die Mauer und verfluche das Universum dafür, mich so brutal aus diesem friedvollen Moment gerissen zu haben. Hoffentlich ist der Eindringling wenigstens eine Frau. Wenn ich schon Gesellschaft bekomme, dann lieber weibliche. Mein Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung ist einfach zu groß, um mich so spätabends allein mit einem fremden Mann auf einer Dachterrasse aufzuhalten. Wahrscheinlich würde ich mich so unwohl fühlen, dass ich gehen würde, obwohl ich eigentlich bleiben möchte. Verdammt, ich will doch einfach nur meine Ruhe haben.
Nach einer Weile öffne ich die Augen, drehe den Kopf und lasse meinen Blick zu der Silhouette an der Brüstung gegenüber wandern. Na toll. Vielen Dank, Universum. Natürlich ist es ein Mann. Obwohl er sich vorbeugt, kann ich erkennen, dass er ziemlich groß ist. Er hat den Kopf in die Hände gestützt, was ihn verletzlich wirken lässt und in krassem Gegensatz zu seiner muskulösen Statur und den breiten Schultern steht. Trotz der Dunkelheit sehe ich, wie sein Rücken bebt, während er mehrmals tief Atem holt.
Irgendwie wirkt er ziemlich aufgewühlt. Soll ich ihn ansprechen, damit er mitbekommt, dass noch jemand hier ist? Zumindest räuspern könnte ich mich. Aber bevor ich diesen Gedanken in die Tat umsetzen kann, dreht er sich um und versetzt einem der Kunststoffstühle einen Tritt.
Ich zucke zusammen, als der Stuhl quietschend über den Boden schlittert, und da der Typ sich anscheinend immer noch nicht darüber im Klaren ist, dass er Publikum hat, kickt er noch ein paarmal mit aller Kraft dagegen. Immer und immer wieder. Statt unter der Wucht zu zersplittern, rutscht der Stuhl nur weiter über die Fliesen.
Er muss aus diesem superrobusten Kunststoff hergestellt sein, der auch beim Bau von Hochseejachten verwendet wird und praktisch unzerstörbar ist.
Ich habe mal miterlebt, wie mein Vater mit dem Wagen rückwärts gegen einen Gartentisch aus diesem Material gefahren ist. Seine Stoßstange hatte danach eine Delle, der Tisch nicht einmal einen Kratzer.
Mittlerweile scheint der Typ auch eingesehen zu haben, dass er gegen diesen Wunder-Kunststoff keine Chance hat, jedenfalls hat er aufgehört, dem Stuhl Tritte zu verpassen, und steht mit geballten Händen schwer atmend davor. Ehrlich gesagt beneide ich ihn ein bisschen darum, dass er seine Aggressionen an Terrassenmöbeln auslassen kann. Offensichtlich hatte er einen genauso beschissenen Tag wie ich, aber während ich meine Gefühle in mich hineinfresse, wo sie langsam vor sich hin gären, sucht er sich einfach einen Stuhl und lässt alles raus.
Früher hatte ich auch so ein Ventil. Wenn mich irgendetwas wütend oder traurig gemacht hat, bin ich in den Garten rausgegangen und habe Unkraut gejätet, bis kein Fitzelchen mehr zu finden war. Aber seit ich vor zwei Jahren nach Boston gezogen bin, habe ich keinen Garten mehr. Noch nicht mal einen Balkon. Tja. Nirgendwo auch nur die kleinste Chance auf ein winziges Hälmchen Unkraut.
Vielleicht sollte ich mir wenigstens so einen Stuhl aus unzerstörbarem Kunststoff zulegen.
Ob der Typ sich jemals wieder von der Stelle rühren wird? Er steht einfach nur da und starrt den Stuhl an. Allerdings hat er die Hände jetzt nicht mehr zu Fäusten geballt, sondern in die Seiten gestemmt. Mir fällt auf, wie sehr sein T-Shirt am Bizeps spannt. Er hat einen beeindruckend durchtrainierten Körper. Während ich ihn beobachte, kramt er in den Taschen seiner Jeans, holt etwas heraus und steckt es sich zwischen die Lippen. Als er ein Feuerzeug zückt, dämmert mir, dass er sich wahrscheinlich gerade einen Joint anzündet. Zur Beruhigung, nehme ich an.
Ich bin dreiundzwanzig und war auf dem College. Natürlich habe ich auch schon mal gekifft und finde es überhaupt nicht schlimm, dass dieser Typ hier oben allein einen durchziehen will. Aber genau das ist der Punkt. Er ist nicht allein – er weiß es nur nicht.
Nachdem er den ersten langen Zug genommen hat, dreht er sich um und will wieder zur Brüstung gehen. In dem Moment bemerkt er mich und bleibt abrupt stehen. Er wirkt nicht überrascht oder ertappt, im Gegenteil. Im Mondlicht sehe ich, wie er mich ganz gelassen mustert, ohne dass sein Gesicht verrät, was ihm dabei durch den Kopf geht. Seine Miene ist so undurchdringlich wie die der Mona Lisa.
»Wie heißt du?«, fragt er.
Oh-oh. Ich spüre seine Stimme bis tief in meinen Bauch hinein und das ist nicht gut. Stimmen sollten nur die Ohren erreichen. Allerdings gibt es manche – wenige – Menschen mit Stimmen, die in meinem ganzen Körper nachhallen. Er hat so eine Stimme. Dunkel und selbstbewusst und zugleich butterweich.
Als ich schweige, nimmt er noch einen Zug von seinem Joint.
»Lily«, antworte ich schließlich und hasse meine eigene Stimme, weil sie so dünn klingt, als wäre sie kaum in der Lage, seine Ohren zu erreichen, geschweige denn in seinem Körper nachzuhallen.
Er hebt das Kinn und nickt in meine Richtung. »Okay. Komm bitte da runter, Lily.«
Mir fällt auf, dass er jetzt sehr aufrecht steht und leicht angespannt wirkt. Falls er sich Sorgen macht, ich könnte herunterfallen, ist das komplett unbegründet. Der Sims ist mindestens dreißig Zentimeter breit, ich sitze rittlings darauf und habe ein Bein auf der Terrasse und die Hauswand im Rücken. Außerdem bläst der Wind in Richtung der Dachterrasse.
Ich sehe an mir herunter und dann wieder zu ihm hinüber. »Warum? Ich sitze hier ganz gut.«
Er dreht sich leicht weg, als könnte er nicht mit ansehen, wie ich auf der Brüstung hocke. »Bitte, Lily. Komm runter.« Sein Tonfall lässt keinen Zweifel daran, dass es sich weniger um eine Bitte als einen Befehl handelt. »Hier stehen sieben Stühle herum, auf die du dich setzen kannst.«
»Fast wären es ja nur noch sechs«, sage ich lachend, was er aber anscheinend nicht witzig findet. Er kommt ein paar Schritte auf mich zu.
»Zehn Zentimeter neben dir geht es senkrecht in die Tiefe«, sagt er ernst. »Wenn du das Gleichgewicht verlierst, bist du tot, und ich habe für heute genug Tote gesehen.« Er fordert mich mit einem Nicken erneut auf, herunterzusteigen. »Bitte. Du machst mich nervös, und eigentlich bin ich hier raufgekommen, um mich zu entspannen.«
Ich verdrehe die Augen und schwinge das rechte Bein über die Brüstung. »Wäre ja auch zu schade, wenn du deinen netten kleinen Entspannungs-Joint ganz umsonst rauchen würdest.« Seufzend rutsche ich vom Sims und wische mir die Hände an der Jeans ab. »Besser so?«
Er atmet hörbar aus, als hätte er die ganze Zeit über die Luft angehalten. Als ich an ihm vorbei zur anderen Seite der Dachterrasse schlendere, von wo aus man einen mindestens genauso sensationellen Blick auf die nächtliche Stadt hat, stelle ich bedauernd fest, dass er verdammt süß aussieht.
Obwohl … »Süß« ist in seinem Fall eine Beleidigung.
Er ist schön. Sehr gepflegt. Männlich. Angezogen wie in einer Burberry-Werbung. Ein paar Jahre älter als ich. In seinen Augenwinkeln bilden sich kleine Lachfältchen, als ich an ihm vorbeigehe. Ich stütze mich auf die Brüstung, beuge mich vor und schaue auf die Autos hinunter, ohne mir anmerken zu lassen, wie gut er mir gefällt. Ein Mann, der so aussieht, ist natürlich daran gewöhnt, dass Frauen von ihm beeindruckt sind, und ich habe keine Lust, sein Ego noch zu füttern. Wobei ich zugeben muss, dass er bisher nichts gesagt oder getan hat, was darauf hindeuten würde, dass sein Ego besonders aufgebläht wäre. Trotzdem.
Von hinten nähern sich Schritte und im nächsten Moment lehnt er neben mir. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er noch einen Zug von seinem Joint nimmt. Er bietet ihn mir an, aber ich winke ab. Berauschende Substanzen sind das Letzte, was ich jetzt brauche. Die Stimme dieses Typen allein ist schon Droge genug. Ich würde sie gern noch mal hören.
»Was hat dir der Stuhl eigentlich getan, dass du ihn so treten musstest?«, frage ich betont beiläufig.
Er sieht mich an. Sieht mich richtig an. Als sein Blick meinen trifft, kommt es mir vor, als würde er meine tiefsten Geheimnisse offen vor sich sehen. Ich glaube nicht, dass ich schon mal jemandem begegnet bin, der einen so dunklen, eindringlichen Blick hatte. Und dann auch noch in Kombination mit einem derart einschüchternd selbstbewussten Auftreten. Er reagiert nicht auf meine Frage, aber so schnell lasse ich nicht locker. Wenn er mich schon gezwungen hat, meinen gemütlichen Sitzplatz aufzugeben, soll er wenigstens meine Neugier befriedigen.
»War es wegen einer Frau?«, hake ich nach. »Hat sie dir das Herz gebrochen?«
»Ich wünschte, meine Probleme wären so banal«, antwortet er mit leisem Lachen. Dann dreht er sich mit dem Rücken zur Brüstung und mustert mich ungeniert. »In welchem Stock wohnst du?« Er befeuchtet Zeigefinger und Daumen mit der Zunge, zwickt die Spitze seines Joints ab und schiebt den Rest wieder in die Hosentasche. »Ich glaube nicht, dass wir uns hier schon mal begegnet sind.«
»Das liegt daran, dass ich nicht hier wohne.« Ich deute in die Ferne. »Siehst du das Versicherungsgebäude dahinten?«
Er schaut mit zusammengekniffenen Augen über die Schulter. »Ja.«
»Direkt daneben wohne ich. Aber das Haus ist so niedrig, dass man es von hier aus nicht sieht. Es hat nur drei Stockwerke.«
Er stützt sich mit einem Ellbogen auf die Brüstung und wendet sich mir zu. »Was machst du dann hier? Wohnt dein Freund bei uns im Haus?«
Die Frage passt nicht zu ihm, sie klingt viel zu sehr nach billiger Anmache. Eigentlich hätte ich gedacht, ein Typ wie er hätte bessere Sprüche drauf.
»Nein, aber ihr habt das schönere Dach«, antworte ich. Er zieht fragend eine Augenbraue hoch. »Ich habe frische Luft gebraucht und einen Ort, an dem ich in Ruhe nachdenken kann. Also habe ich mit Google Earth in der Umgebung nach einem Haus mit schicker Dachterrasse gesucht.«
Er grinst. »Wenigstens bist du praktisch veranlagt«, sagt er. »Eine gute Eigenschaft.«
Wenigstens?
Ich nicke, weil ich tatsächlich praktisch veranlagt bin. Und weil das wirklich eine gute Eigenschaft ist.
»Warum hast du frische Luft gebraucht?«, erkundigt er sich.
Weil ich heute meinen Vater beerdigt und eine groteske Trauerrede gehalten habe und danach das Gefühl hatte, ich müsste ersticken.
Ich drehe mich um und atme langsam aus. »Könnten wir vielleicht eine Weile einfach gar nicht reden?«
Er macht fast den Eindruck, als wäre er erleichtert, beugt sich vor und lässt einen Arm über die Brüstung baumeln, während er auf die Straße hinunterstarrt. Ich mustere ihn. Bestimmt spürt er meinen Blick, aber das scheint ihm nichts auszumachen.
»Letzten Monat ist ein Mann von diesem Dach gestürzt«, sagt er plötzlich.
Ich hatte ihn zwar gebeten, nicht zu reden, aber meine Neugier ist dann doch größer als mein Bedürfnis nach Stille.
»Oh. Ein Unfall?«
Er zuckt mit den Schultern. »Tja, das weiß keiner. Seine Frau hat erzählt, dass er vor dem Abendessen noch mal schnell nach oben gehen wollte, um ein paar Fotos vom Sonnenuntergang zu machen. Er war Fotograf. Die Polizei vermutet, dass er sich zu weit vorgebeugt hat, um ein Foto von der Skyline zu schießen, und dabei hat er wohl das Gleichgewicht verloren.«
Ich spähe über die Brüstung und frage mich schaudernd, warum der Mann so ein Risiko eingegangen ist. Dann fällt mir ein, wie ich selbst eben auf der Brüstung saß und dass das auch nicht ganz ungefährlich gewesen ist.
»Als meine Schwester mir davon erzählt hat, war mein erster Gedanke, ob er es wohl noch geschafft hat, auf den Auslöser zu drücken. Ich hoffe, die Speicherkarte mit seinem letzten Foto hat den Sturz überstanden. Wäre schade, wenn er völlig umsonst gestorben wäre, oder?«
Ich muss lachen, obwohl ich nicht weiß, ob man darüber lachen sollte. »Sagst du immer so offen, was du denkst?«
Er zuckt wieder mit den Schultern. »Den meisten Menschen nicht.«
Jetzt lächle ich. Es schmeichelt mir, dass er mich nicht zu den »meisten Menschen« zählt, obwohl wir uns gar nicht kennen.
Wieder stellt er sich mit dem Rücken zur Brüstung und verschränkt die Arme vor der Brust. »Kommst du aus Boston?«
Ich schüttle den Kopf. »Nein. Ich bin erst nach dem College hergezogen. Ursprünglich komme ich aus Maine.«
Er zieht die Nase kraus, was irgendwie total sexy aussieht.
»Dann befindest du dich also quasi noch in der Fegefeuerphase. Das ist hart.«
»Wie meinst du das?«, frage ich.
Er grinst. »Die Touristen behandeln dich wie eine Einheimische und die Einheimischen behandeln dich wie eine Touristin.«
»Das beschreibt es ziemlich gut«, sage ich lachend.
»Mir steht das alles noch bevor, ich wohne nämlich erst seit zwei Monaten hier. Insofern hast du einen Vorsprung.«
»Und was hat dich nach Boston verschlagen?«
»Meine Facharztausbildung. Außerdem wohnt meine Schwester hier.« Er tippt mit dem Fuß auf den Boden. »Direkt unter uns, um genau zu sein. Ihr Mann ist gebürtiger Bostoner. Er entwickelt Apps und ist supererfolgreich damit. Die beiden haben das gesamte oberste Stockwerk gekauft.«
Ich sehe ihn mit offenem Mund an. »Das ganze Stockwerk?«
Er nickt. »Der alte Mistkerl hat das große Los gezogen. Er arbeitet von zu Hause aus, muss also nicht mal seinen Schlafanzug ausziehen, um Millionen zu verdienen.«
Wow, das klingt echt beneidenswert.
»Aber immerhin versetzt mich das in die glückliche Lage, ebenfalls hier wohnen zu können.«
»Und was für ein Arzt bist du?«
»Neurochirurg. Wenn alles nach Plan läuft, bin ich in einem Jahr fertig.«
Er sieht umwerfend aus, ist intelligent, kultiviert, erfolgreich und kifft. Wenn das hier ein Test wäre, würde die Frage lauten: Welches Wort gehört nicht in die Reihe? »Ein angehender Neurochirurg, der kifft?«
Er grinst schief. »Das findest du wohl eher nicht so vertrauenserweckend? Aber wir stehen in unserem Job unter extremem Druck. Wenn wir uns nicht ab und zu mit irgendetwas entspannen würden, würden garantiert einige von uns von irgendwelchen Dachterrassen springen, glaub mir.« Er dreht sich wieder um, beugt sich vor, stützt das Kinn auf die Hände und schließt die Augen, als würde er den leichten Nachtwind genießen, der ihm übers Gesicht streicht. So hat er auf einmal gar nichts Einschüchterndes mehr an sich.
»Soll ich dir was verraten, was garantiert kein Tourist weiß?«
»Unbedingt.« Er sieht mich von der Seite an und zieht eine Augenbraue hoch.
Ich zeige auf die Skyline der Stadt. »Siehst du das Hochhaus mit dem grünen Dach?«
Er nickt.
»Gleich dahinter liegt die Melcher Street, und dort gibt es ein Gebäude, auf dem ein Haus steht. Ein richtiges Einfamilienhaus, das aussieht, als hätte es jemand direkt aus der Vorstadt auf dieses Dach gestellt. Man kann es von der Straße aus nicht erkennen, weil das Gebäude so hoch ist, deswegen wissen auch die wenigsten Bostoner davon.«
Er sieht beeindruckt aus. »Echt?«
Ich nicke. »Ja. Ich habe es zufällig entdeckt, als ich vorhin nach einer Dachterrasse gegoogelt habe. Danach habe ich ein bisschen im Netz recherchiert. Der Bau wurde 1982 von der Stadt genehmigt. Ist das nicht cool? Stell dir mal vor, du würdest in einem Haus wohnen, das so weit oben auf einem anderen Haus steht.«
»Man hätte das ganze Dach für sich allein«, sagt er.
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Wenn ich dort wohnen würde, könnte ich mir einen Garten anlegen. Dann hätte ich wieder ein Ventil und könnte Unkraut zupfen.
»Und wer wohnt in dem Haus?«, fragt er.
»Der Eigentümer ist nicht bekannt«, sage ich. »Das ist eines der großen Geheimnisse von Boston.«
Er lacht und sieht mich dann forschend an. »Und was sind die anderen großen Geheimnisse von Boston?«
»Dein Name zum Beispiel.« Oh mein Gott. Das hört sich so sehr nach einem schlechten Anmachspruch an, dass ich über mich selbst lachen muss.
Er grinst. »Ryle«, stellt er sich vor. »Ryle Kincaid.«
»Toller Name«, seufze ich.
»Warum sagst du das so traurig?«
»Weil ich auch gern so einen tollen Namen hätte.«
»Was gefällt dir an Lily nicht?«
Ich runzle die Stirn. »Vielleicht geht es eher um die Kombination mit meinem Nachnamen … Bloom.«
Er sagt dazu nichts. Wahrscheinlich unterdrückt er mühsam ein Prusten.
»Ziemlich lächerlich, ich weiß. Bei Lily Bloom denkt man an ein zweijähriges Mädchen im rosa Blümchenkleid, aber doch nicht an eine ernst zu nehmende dreiundzwanzigjährige Frau!«
»Aus Namen wächst man nicht heraus, Lily Bloom.«
»Ja, leider«, sage ich. »Das Problem ist, dass ich Blumen über alles liebe. Für mich gibt es nichts Schöneres, als im Garten zu arbeiten und mich mit Pflanzen zu beschäftigen. Das ist meine ganz große Leidenschaft. Ich hab immer davon geträumt, irgendwann einen Blumenladen aufzumachen, aber dann würden die Leute bestimmt denken, ich hätte mir den Namen nur als Marketinggag ausgedacht.«
»Könnte durchaus sein«, sagt er. »Was wäre so schlimm daran?«
»Hm. Wahrscheinlich nichts. Lily Bloom’s Flower Shop …« Ryle lächelt, als ich den Namen leise vor mich hinflüstere. »Eigentlich ist das wirklich der perfekte Name«, sage ich. »Aber ich habe BWL studiert und arbeite für eine der größten Marketingagenturen in Boston. Wäre es nicht eine Schande, wenn ich als Blumenverkäuferin enden würde?«
»Wie könnte es eine Schande sein, ein eigenes Geschäft zu haben?«
Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Zum Beispiel wenn es Pleite macht.«
Er nickt zustimmend. »In dem Fall schon«, sagt er. »Hast du auch noch einen zweiten Vornamen, Lily Bloom?«
Ich stöhne gequält auf.
»Du meinst, es wird noch schlimmer?«
Ich schlage die Hände vors Gesicht und nicke.
»Etwa … Rose?«
Ich schüttle den Kopf. »Übler.«
»Violet?«
»Schön wär’s.« Ich ziehe eine Grimasse und murmele: »Blossom.«
Einen Moment lang ist es still. »Das ist echt gemein«, sagt er schließlich.
»Meine Mutter hieß Blossom mit Mädchennamen. Für sie und meinen Vater war es ein Wink des Schicksals, dass sie beide Blüten-Nachnamen hatten. Deswegen stand für sie sofort fest, dass sie ihre Tochter nach einer Blume nennen müssen.«
Er lacht. »Scheint, als wärst du ganz schön gestraft mit deinen Eltern.«
Mit einem Elternteil schon. Zumindest war ich es. »Mein Vater ist diese Woche gestorben.«
Er sieht mich ungläubig an. »Das ist jetzt ein mieser Witz, oder?«
»Nein, ist es nicht. Deswegen bin ich heute hierhergekommen. Ich habe einen Ort gebraucht, um mich ungestört auszuheulen.«
Ryle runzelt die Stirn, als wäre er immer noch nicht ganz überzeugt davon, dass ich ihn nicht auf den Arm nehme. Schließlich nickt er nachdenklich, entschuldigt sich aber nicht. »Hattet ihr ein gutes Verhältnis?«
Das Kinn in die Hände gestützt, sehe ich wieder auf die Straße hinunter. »Schwer zu sagen. Als Tochter habe ich meinen Vater schon irgendwie geliebt, aber als Mensch … habe ich ihn gehasst.«
Ich spüre Ryles Blick auf mir. »Das finde ich gut«, sagt er. »Dass du so ehrlich bist, meine ich.«
Er findet es gut, dass ich ehrlich bin. Könnte sein, dass ich gerade rot werde.
Wir schweigen eine Weile. »Wünschst du dir manchmal auch, andere Menschen würden dich mehr in sich reinschauen lassen?«, fragt er plötzlich.
»Wie meinst du das?«
Er bricht mit dem Daumen ein Stück gesplitterten Putz ab und schnippt es über die Brüstung. »Die meisten Leute tun so, als hätten sie nie irgendwelche dunklen Gedanken, obwohl wir tief in uns doch alle gleich kaputt sind. Manche von uns können das nur besser verbergen als andere.«
Entweder zeigt der Joint jetzt Wirkung oder Ryle ist grundsätzlich grüblerisch veranlagt. Für mich ist beides okay. Ich rede gern über die großen Fragen des Lebens, auf die es keine einfachen Antworten gibt.
»Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand zurückhaltend ist und nicht gleich sein ganzes Innenleben auspackt«, sage ich. »Die nackte Wahrheit ist nicht immer unbedingt schön.«
Ryle sieht mich einen Moment lang an. »Die nackte Wahrheit«, wiederholt er. »Das gefällt mir.« Er dreht sich um und geht zu den beiden Liegestühlen, die in der Mitte des Dachs stehen. Nachdem er an einem die Rückenlehne ein Stück hochgestellt hat, legt er sich darauf und verschränkt die Hände im Nacken. Ich setze mich auf den anderen, stelle das Kopfteil so, dass es auf gleicher Höhe wie seines ist, und lehne mich zurück.
»Verrätst du mir eine nackte Wahrheit über dich, Lily?«
»An was hast du da gedacht?«
Er zuckt die Achseln. »Keine Ahnung. Irgendwas, auf das du nicht stolz bist. Irgendwas, das mir das Gefühl gibt, mit meiner Kaputtheit nicht ganz so allein zu sein.«
Während er darauf wartet, dass ich etwas sage, sieht er zum Himmel auf. Ich lasse meinen Blick über sein Gesicht wandern, folge den Konturen seiner Wangenknochen bis hinunter zu den geschwungenen Lippen und dem markanten Kinn. Zwischen seinen Augenbrauen steht eine tiefe Falte. Ich habe das Gefühl, dass das aus irgendeinem Grund ein ziemlich wichtiges Gespräch für ihn ist, und versuche, eine ehrliche Antwort auf seine Frage zu finden. Als mir etwas einfällt, was ich ihm erzählen könnte, drehe ich den Kopf wieder von ihm weg und schaue ebenfalls in den Himmel.
»Mein Vater war extrem jähzornig. Wenn er wütend war, ist er manchmal so ausgerastet, dass er … gewalttätig wurde. Nicht mir gegenüber, aber meiner Mutter. Danach tat es ihm immer wahnsinnig leid, und er hat ein paar Wochen lang alles getan, um es wiedergutzumachen. Er hat ihr Blumen mitgebracht, ist mit uns teuer essen gegangen und hat mich mit Geschenken überhäuft, weil er so ein schlechtes Gewissen hatte. Deshalb habe ich mich als Kind irgendwann fast gefreut, wenn sie sich gestritten haben, weil ich wusste, dass er uns in den nächsten zwei Wochen jeden Wunsch erfüllen würde, falls er … falls er sie wieder schlägt.« Ich halte einen Moment den Atem an, weil das etwas ist, das ich bis jetzt nicht einmal mir selbst eingestanden habe. »Natürlich habe ich mir noch viel mehr gewünscht, er würde sie nie wieder schlagen«, spreche ich schnell weiter. »Aber diese Ausbrüche gehörten zu ihrer Ehe irgendwie dazu. Als ich älter wurde, habe ich mich mehr und mehr schuldig gefühlt, weil ich meine Mutter nicht beschützen konnte. Ich habe meinen Vater dafür gehasst, dass er so ein schlechter Mensch war … aber ich habe ihn nie deswegen zur Rede gestellt. Vielleicht macht mich das ja auch zu einem schlechten Menschen.«
Ryle sieht mit nachdenklichem Blick zu mir rüber. »Nein, Lily«, sagt er. »So was wie schlechte Menschen gibt es nicht. Wir sind alle bloß Menschen, die manchmal schlimme Dinge tun.«
Wir sind alle bloß Menschen, die manchmal schlimme Dinge tun. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Niemand ist immer nur böse oder immer nur gut. Vielleicht müssen sich manche Menschen bloß mehr zusammenreißen als andere, um ihre schlimme Seite zu unterdrücken.
»Jetzt bist du dran«, sage ich.
Ryle reagiert, als hätte er keine große Lust, sein eigenes Spiel mitzuspielen. Er fährt sich seufzend durch die Haare, öffnet den Mund und schließt ihn dann doch wieder. »Mir ist heute ein kleiner Junge unter den Händen weggestorben«, sagt er schließlich mit einer Stimme, der die Erschütterung immer noch anzuhören ist. »Er war erst fünf. Er und sein kleiner Bruder haben im Schlafzimmer ihrer Eltern eine Pistole gefunden. Der Jüngere hat danach gegriffen und sie ist losgegangen.«
Mir wird übel.
»Als er bei uns auf dem OP-Tisch lag, war es zu spät. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Alle meine Kollegen hatten Mitleid mit den Eltern. Wie entsetzlich. Die armen Leute. Aber weißt du was? Als ich den beiden gesagt habe, dass ihr Sohn nicht überlebt hat, taten sie mir nicht leid. Im Gegenteil. Es ist nur gerecht, dass sie leiden. Vielleicht erkennen sie dann, wie unfassbar fahrlässig es von ihnen war, eine geladene Waffe so aufzubewahren, dass ihre Kinder sie finden konnten. Sie sind nicht nur daran schuld, dass ihr älterer Sohn jetzt tot ist, sondern auch daran, dass ihr anderer Sohn nie wieder unbelastet glücklich werden kann.«
Ich muss schlucken. Gott, ist das hart. Auf so etwas war ich nicht vorbereitet.
Wie soll eine Familie mit so einer Tragödie jemals fertigwerden? »Der arme Junge«, sage ich. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, was so etwas aus einem Menschen macht.«
Ryle schnippt eine Fluse von seiner Jeans. »Das kann ich dir sagen.« Seine Stimme ist trocken. »Es macht ihn kaputt. Und zwar für immer.«
Ich drehe mich auf die Seite, stütze den Kopf in die Hand und sehe ihn an. »Ist das nicht total schwer für dich, tagtäglich solche Schicksale mitzubekommen?«
Er schüttelt den Kopf. »Dadurch, dass ich mich ständig mit dem Tod auseinandersetzen muss, ist er für mich zu einem Teil des Lebens geworden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich allerdings auch nicht.« Er sieht mir in die Augen. »Lass mich noch eine nackte Wahrheit von dir hören. Ich habe das Gefühl, meine war ein bisschen kaputter als deine.«
Obwohl ich anderer Meinung bin, beschließe ich, ihm zu erzählen, was ich vor ungefähr zwölf Stunden getan habe, weil ich glaube, dass das ziemlich kaputt war.
»Meine Mutter hat mich gebeten, auf der Beerdigung meines Vaters eine Trauerrede zu halten. Ich habe ihr gesagt, dass ich das lieber nicht machen würde, weil ich Angst hätte, vor all den Leuten in Tränen auszubrechen. Aber das war gelogen. Ich wollte es nicht tun, weil Trauerreden von Menschen gehalten werden sollten, die Achtung vor dem Verstorbenen hatten. Und ich hatte nicht besonders viel Achtung vor meinem Vater.«
»Hast du es trotzdem gemacht?«
Ich nicke. »Ja. Heute Vormittag.« Ich setze mich auf und ziehe die Beine an. »Willst du sie hören?«
Er lächelt. »Na klar.«
Ich verschränke die Hände im Schoß und hole tief Luft. »Als ich mich hingesetzt habe, um die Rede zu schreiben, war mein Kopf wie leer gefegt. Eine Stunde vor der Beerdigung habe ich meiner Mutter noch mal gesagt, dass ich lieber doch nichts sagen wollte, aber sie meinte, mein Vater hätte sich gewünscht, dass ich ein paar Worte spreche. Es müsse auch keine lange Rede sein. Sie hat mir vorgeschlagen, einfach ein paar Eigenschaften aufzuzählen, für die ich ihn bewundert hätte. Tja … Genau das hab ich getan.«
Ryle stützt sich auf den Ellbogen. »Und … was hast du gesagt?«
»Wenn du möchtest, kann ich meine Rede für dich gern noch mal nachspielen.« Ich stehe auf, straffe die Schultern und stelle mir die Trauergemeinde vor, der ich heute Vormittag gegenüberstand. »Hallo.« Ich räuspere mich. »Ich heiße Lily Bloom und bin die Tochter des verstorbenen Andrew Bloom. Vielen Dank, dass Sie heute alle gekommen sind, um unseren Verlust gemeinsam mit uns zu betrauern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, an ein paar der Eigenschaften zu erinnern, für die ich ihn als Mensch bewundert habe. Nämlich erstens …« Ich sehe Ryle an und zucke mit den Schultern.
Er setzt sich auf. »Und?«
Ich lege mich wieder auf meinen Liegestuhl. »Nichts. Das war’s. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich stand noch zwei volle Minuten vor den Leuten, ohne ein einziges Wort von mir zu geben. Mir fiel einfach nichts ein, wofür ich meinen Vater als Mensch bewundert hätte, also habe ich nur stumm in die Menge gestarrt, bis meine Mutter irgendwann begriffen hat, was los ist, und meinen Onkel gebeten hat, mich vom Rednerpult wegzuholen.«
Ryle sieht mich skeptisch an. »Ist das dein Ernst? Du hast eine Anti-Trauerrede auf deinen eigenen Vater gehalten?«
Ich nicke. »Aber ich bin nicht stolz darauf. Glaube ich jedenfalls. Ich wäre verdammt froh gewesen, wenn ich einen Vater gehabt hätte, den ich hätte bewundern können. Wäre er ein besserer Mensch gewesen, hätte ich den Leuten liebend gern eine ganze Stunde lang von ihm vorgeschwärmt.«
Ryle lehnt sich wieder zurück. »Wow.« Er schüttelt den Kopf. »Du bist meine Heldin. Du hast es einem alten Ekel noch mal so richtig gegeben.«
»Das ist geschmacklos.«
»Ja, kann sein. Die nackte Wahrheit ist nicht immer unbedingt schön. Hast du selbst gesagt.«
Ich lache. »Na gut. Dann bist du jetzt wieder dran.«
»Das kann ich nicht toppen«, sagt Ryle.
»Ich bin mir sicher, du hast noch irgendwas auf Lager, was zumindest nahe rankommt.«
»Kaum.«
Ich verdrehe die Augen. »Doch, bestimmt. Bitte gib mir nicht das Gefühl, von uns beiden der kaputtere Mensch zu sein. Sag mir den letzten Gedanken, der dir durch den Kopf gegangen ist und den die meisten Leute wahrscheinlich nicht laut aussprechen würden.«
»Na gut.« Ryle dreht mir das Gesicht zu und grinst. »Ich möchte dich ficken.«
Was …?
Es hat mir die Sprache verschlagen.
Er sieht mich mit unschuldigem Augenaufschlag an. »Was denn? Du hast mich nach meinem letzten Gedanken gefragt, also habe ich ihn dir gesagt. Du bist eine schöne Frau. Ich bin ein Mann, der auf Frauen steht. Falls du nichts gegen One-Night-Stands hast, würde ich gern mit dir zu mir nach unten gehen.«
Ich bringe es nicht fertig, ihn anzusehen, weil eine Flutwelle der unterschiedlichsten Gefühle über mich hereinstürzt.
»Tja, Pech«, sage ich nach ein paar Sekunden. »Ich stehe nämlich nicht auf One-Night-Stands.«
»Hab ich mir schon gedacht«, sagt er gelassen. »Na gut. Dann bist du wieder dran.«
Wie kann er nach so einer Bemerkung nur so locker bleiben?
»Das war jetzt aber eine splitterfasernackte Wahrheit«, sage ich. »Davon muss ich mich erst mal erholen.« Ich bin immer noch fassungslos über das, was er gesagt hat. Dass er es laut gesagt hat. Vielleicht weil ich einfach nicht damit gerechnet hätte, dass jemand, der immerhin Neurochirurg ist, so schonungslos vom Ficken reden würde.
»Okay«, sage ich, nachdem ich mich – einigermaßen – gefangen habe. »Ich hätte da was, das sogar zum Thema passt. Mein erstes Mal hatte ich mit einem Obdachlosen.«
Ryle sieht mich an. »Im Ernst? Erzähl mir mehr.«
Ich stütze den Kopf auf meinen rechten Arm. »Ich bin in einer Kleinstadt in Maine aufgewachsen. Unser Grundstück grenzte nach hinten raus an ein anderes, auf dem ein verlassenes Haus stand. Irgendwann habe ich mitbekommen, dass sich dort ein Junge verkrochen hatte, der von zu Hause rausgeworfen worden war. Außer mir wusste niemand, dass er dort lebte. Ich habe Atlas – so hieß er – mit Essen und allem möglichen anderen versorgt und mich ein bisschen um ihn gekümmert. Bis mein Vater irgendwann dahintergekommen ist.«
»Wie hat er reagiert?«
Ich presse die Lippen aufeinander. Keine Ahnung, warum ich ihm von Atlas erzähle, obwohl ich doch so sehr versuche, ihn zu vergessen.
»Er hat ihn zusammengeschlagen.« Mehr möchte ich dazu nicht sagen. »Jetzt wieder du.«
Ryle sieht mich einen Moment lang schweigend an, als wüsste er, dass das nur die halbe Geschichte war, aber dann wendet er den Blick ab, denkt kurz nach und holt tief Luft. »Ich will nicht heiraten. Die Ehe ist ein Konzept, das mich einfach nicht interessiert«, sagt er. »Ich werde jetzt bald dreißig und habe überhaupt kein Bedürfnis nach einer festen Beziehung. Vor allem will ich definitiv keine Kinder. Das Einzige, was mich interessiert, ist Erfolg. Und zwar jede Menge davon. Aber wenn ich das so offen zugeben würde, würden mich alle für ein arrogantes Arschloch halten.«
»Erfolg in Form von Geld oder von Anerkennung?«
»Beides«, sagt er. »Heiraten und Kinder kriegen kann jeder, aber nicht jeder kann Neurochirurg werden. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Allerdings genügt es mir nicht, ein wirklich guter Neurochirurg zu sein, ich will der Beste auf meinem Gebiet werden.«
»Du hast recht. Das klingt arrogant.«
Er grinst. »Meine Mutter wünscht sich, dass ich weniger arbeite. Sie hat Angst, dass ich mein Leben verschwende.«
»Du verschwendest in ihren Augen dein Leben, weil du Neurochirurg bist?« Ich lache. »Das ist doch verrückt. Kann man es seinen Eltern überhaupt jemals recht machen?«
Ryle schüttelt den Kopf. »Meine Kinder könnten es wahrscheinlich nicht. Es gibt nicht viele Menschen, die so ehrgeizig sind wie ich. Gemessen an mir könnten sie nur scheitern. Deswegen will ich auch keine Kinder.«
»Ich finde es bewundernswert, dass du das so offen zugibst. Die wenigsten Menschen gestehen sich ein, dass sie vielleicht keine gute Eltern wären.«
»Mir ist mein Beruf viel zu wichtig. Ich habe nicht genug Zeit, um sie mit Kindern zu teilen«, sagt er. »Schon eine feste Beziehung wäre mir zu viel.«
»Heißt das, du triffst dich nicht mit Frauen?«
Er sieht mir in die Augen und grinst. »Sexuell unterversorgt bin ich jedenfalls nicht, falls du darauf anspielst. Es gibt Mädchen, die bereit sind, sich auf mich einzulassen, wenn ich mal Zeit habe. Aber an die große Liebe glaube ich nicht. Die Ehe ist meiner Meinung nach mehr Verpflichtung als Bereicherung.«
Wenn ich es doch nur auch so nüchtern sehen könnte wie er. Das würde alles einfacher machen. »Beneidenswert. Ich habe die Vorstellung, dass es irgendwo da draußen den perfekten Mann für mich gibt. Aber ich stelle meistens ganz schnell fest, dass die, die ich kennenlerne, meinen Ansprüchen nicht genügen. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich nach so was wie dem Heiligen Gral suchen.«
»Du solltest es mal mit meiner Methode probieren.«
»Und wie sieht die aus?«
»One-Night-Stands.« Er grinst einladend.
Ich bin froh, dass es so dunkel ist, weil mein Gesicht garantiert in Flammen steht. »Ich könnte nie mit jemandem schlafen, den ich überhaupt nicht kenne«, sage ich, merke aber, dass meine Stimme nicht besonders überzeugend klingt.
Er seufzt und lehnt sich zurück. »Nein, die Art von Mädchen bist du nicht«, sagt er in einem Tonfall, als fände er das schade.
Und aus irgendeinem Grund finde ich es plötzlich auch schade. Vielleicht würde ich mich ja sogar auf ihn einlassen, wenn er noch einen Vorstoß machen würde, aber jetzt habe ich ihn wahrscheinlich für alle Zeiten abgeschreckt.
Ryle dreht den Kopf und mustert mich. »Du hast gesagt, dass du mit jemandem, den du nicht kennst, nicht schlafen würdest …«, sagt er langsam. »Heißt das, du wärst bereit, andere Dinge mit demjenigen zu machen? Und wenn ja, welche?«
Sein Blick ist so durchdringend, dass mich ein heißer Schauer durchläuft. Möglicherweise muss ich meine Einstellung zu One-Night-Stands ja noch einmal überdenken. Ich glaube nicht, dass ich grundsätzlich dagegen bin. Vielleicht habe ich mich nur deswegen noch nie darauf eingelassen, weil mir bis jetzt noch nie jemand ein solches Angebot gemacht hat, den ich auch nur im Entferntesten interessant gefunden hätte. Hat mir überhaupt schon mal jemand einen One-Night-Stand vorgeschlagen? Gott, Flirten ist noch nie meine Stärke gewesen.
Auf einmal beugt Ryle sich vor, greift nach meinem Liegestuhl und zieht ihn mühelos an seinen heran.
Ich erstarre. Er ist mir jetzt so nahe, dass ich in der kühlen Nachtluft die Wärme seines Atems auf meiner Wange spüre. Wenn ich ihm das Gesicht zuwenden würde, wären unsere Lippen nur Zentimeter voneinander entfernt. Das tue ich aber nicht, weil er mich dann vermutlich küssen würde, und das will ich nicht. Schließlich weiß ich – von ein paar nackten Wahrheiten abgesehen – nichts über ihn. Wobei das keine Rolle mehr zu spielen scheint, als er mir im nächsten Moment die Hand leicht auf die Hüfte legt.
»Wie weit würdest du gehen, Lily?« Seine Stimme ist verführerisch. Weich und tief. Ich spüre sie bis in die Zehen hinunter.
»Ich weiß es nicht«, flüstere ich heiser.
Seine Finger wandern zum Saum meines Tops. Er schiebt es ein Stück nach oben und legt einen schmalen Streifen Haut frei.
Ich atme scharf ein, als ich spüre, wie seine Finger meinen nackten Bauch hinaufgleiten. Entgegen jeder Vernunft wende ich ihm jetzt doch das Gesicht zu und der Blick seiner dunklen Augen nimmt mich vollkommen gefangen. Er sieht erwartungsvoll aus, hungrig und ungeheuer selbstsicher. Langsam bewegt er die Hand unter meinem Shirt höher. Sicher spürt er, dass sich mein Herz gegen meine Rippen wirft wie ein gefangenes Tier. Verdammt, wahrscheinlich kann er es sogar hören.
»Gehe ich damit schon zu weit?«, fragt er rau.
Ich kann mir selbst nicht erklären, woher diese verwegene Seite in mir plötzlich kommt, aber ich schüttle den Kopf und sage: »Noch nicht mal annähernd.«
Um seine Mundwinkel spielt ein zufriedenes Lächeln, als er zart über die Unterseite meines BHs streicht, worauf sich mein gesamter Körper mit Gänsehaut überzieht.
In dem Moment, in dem ich die Augen schließe, lässt ein schriller Klingelton mich zusammenzucken. Ryle hält in der Berührung inne, und mir wird klar, dass es ein Handy ist, das da klingelt. Sein Handy.
Er drückt die Stirn an meine Schulter. »Verflucht.«
Ich verspüre einen Stich des Bedauerns, als er aufsteht, das Handy aus der Jeanstasche zieht und ein paar Schritte geht, um den Anruf entgegenzunehmen.
»Dr. Kincaid«, meldet er sich und massiert sich den Nacken, während er zuhört. »Verstehe, aber was ist mit Roberts? Ich habe heute keine Bereitschaft.« Stille. Dann: »Na gut. Gib mir zehn Minuten. Ich bin schon unterwegs.«
Er beendet das Gespräch und schiebt das Handy zurück in die Jeans. Als er sich zu mir umdreht, sieht er enttäuscht aus. Er deutet auf die Tür, die ins Treppenhaus führt. »Leider muss ich sofort …«
Ich nicke. »Da kann man nichts machen.«
Ryle betrachtet mich einen Moment, dann hebt er den Zeigefinger. »Nicht bewegen. Darf ich?« Er zieht noch einmal das Handy heraus, richtet die Kamera auf mich und geht ein paar Schritte auf mich zu, um ein Foto von mir zu machen. Obwohl ich vollständig angezogen bin, fühle ich mich aus irgendeinem Grund plötzlich nackt.
Trotzdem bleibe ich, die Arme locker über dem Kopf verschränkt, liegen, als er auf den Auslöser drückt. Ich finde es schön, dass er ein Bild von mir haben will. Dass er mich in Erinnerung behalten möchte.
Er betrachtet das Display einen Moment und lächelt. Ich überlege, ob ich von ihm auch ein Foto machen soll, verwerfe den Gedanken aber sofort wieder. Ich fände es deprimierend, ein Bild von jemandem aufzuheben, den ich nie mehr wiedersehen werde.
»Es hat mich wirklich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Lily Bloom«, sagt er. »Ich wünsche dir, dass du es schaffst, alle deine Träume zu verwirklichen.«
Ich lächle verwirrt und auch ein bisschen traurig. Ich glaube nicht, dass ich schon jemals von jemandem so fasziniert war, der so anders ist und der ein vollkommen anderes Leben führt als ich. Aber ich bin angenehm überrascht darüber, dass wir so unterschiedlich dann doch nicht sind.
Ich bin eben auch nicht frei von Vorurteilen.
Ryle bleibt einen Moment stehen, als wäre er hin- und hergerissen, ob er noch etwas sagen soll. Er hebt den Kopf und sieht mich an. Diesmal ist sein Blick ganz offen. Ich sehe das Bedauern darin, bevor er sich wortlos umdreht und zur Tür geht. Einen Moment später höre ich, wie er sie öffnet und seine Schritte im Treppenhaus verhallen. Jetzt bin ich wieder so ungestört, wie ich es mir vorhin gewünscht habe. Aber zu meiner Überraschung stelle ich fest, dass ich mich plötzlich ein bisschen einsam fühle.
2.
Meine Mitbewohnerin Lucy – ja, genau: die, die sich für eine begnadete Sängerin hält – läuft hektisch im Wohnzimmer herum und schnappt sich ihren Schlüssel, ihre Ballerinas und ihre Sonnenbrille. Ich sitze auf der Couch und bücke mich nach einem von den Schuhkartons, die ich gestern von zu Hause mitgebracht habe. Sie sind mit Erinnerungen gefüllt, in die ich heute ein bisschen eintauchen will.
»Gehst du nicht zur Arbeit?«, fragt Lucy erstaunt.
»Nein. Die haben mir Sonderurlaub bewilligt, weil mein Vater gestorben ist. Ich muss erst Montag wieder hin.«
Sie bleibt abrupt stehen. »Montag erst?«, schnaubt sie. »Hast du ein Glück.«
»Stimmt, Lucy. Ich bin auch wahnsinnig froh, dass mein Vater tot ist.« Natürlich trieft meine Stimme vor Sarkasmus, aber ich schäme mich dafür, weil es gleichzeitig irgendwie auch stimmt.
»Du weißt, dass ich das nicht so gemeint habe.« Lucy hängt sich ihre Tasche um, schlüpft in einen der Schuhe und balanciert auf einem Bein, während sie sich den anderen überstreift. »Übrigens komme ich heute Abend nicht nach Hause. Ich schlafe bei Alex.« Ich nicke, aber da ist sie schon weg und knallt die Tür hinter sich zu.
Abgesehen davon, dass wir die gleiche Kleidergröße tragen, gleich alt sind und unsere Vornamen beide mit L anfangen, mit Y enden und aus vier Buchstaben bestehen, haben wir nicht sonderlich viel gemeinsam, weshalb ich Lucy nicht unbedingt als Freundin bezeichnen würde. Trotzdem bin ich mit ihr als Mitbewohnerin ziemlich zufrieden. Okay, ihre ständigen Gesangseinlagen nerven, aber dafür ist sie ordentlich und schläft oft nicht zu Hause. Zwei der wichtigsten Eigenschaften, die Mitbewohnerinnen haben sollten.
Als ich gerade den Deckel von dem Karton genommen und neben mich gelegt habe, klingelt mein Handy, das am anderen Ende der Couch liegt. Ich beuge mich vor und werfe einen Blick darauf. Es ist meine Mutter. Bevor ich drangehe, presse ich das Gesicht ins Polster und lasse einen Schrei los.
»Hallo?«
Drei Sekunden Stille, dann: »Hallo … Lily.«
Ich setze mich auf. »Hey, Mom.« Komisch, dass sie sich meldet. Die Beerdigung war erst gestern – ihr Anruf kommt ganze 364 Tage früher als erwartet. »Wie geht es dir?«
Sie seufzt hörbar. »Ach, es geht«, sagt sie. »Deine Tante und dein Onkel sind vorhin nach Nebraska zurückgeflogen. Das wird die erste Nacht, die ich ganz allein verbringe …«
»Du schaffst das, Mom«, versuche ich ihr Mut zu machen.
In der Leitung bleibt es eine Weile still. »Ich rufe vor allem an, um dir zu sagen, dass du dich wegen dem, was gestern passiert ist, nicht schämen musst.«
Ich erwidere nichts darauf. Ich schäme mich nicht. Keine Spur.
»Es ist ganz natürlich, dass du eine Blockade hattest, als du vor all diesen Leuten standest. Schließlich ist dein Vater gerade erst gestorben. Es tut mir leid, dass ich dich so unter Druck gesetzt habe. Ich hätte stattdessen deinen Onkel bitten sollen, ein paar Worte zu sagen.«
Ich seufze lautlos. Typisch. Genau so kenne ich meine Mutter. Sie verschließt gern die Augen vor dem, was sie nicht sehen möchte, und nimmt sogar die Schuld für Dinge auf sich, die nichts mit ihr zu tun haben. Natürlich redet sie sich ein, ich hätte so etwas wie einen Blackout gehabt. Ich bin kurz davor, ihr zu gestehen, dass das ganz und gar kein Aussetzer war, sondern dass ich schlicht und einfach nichts Gutes über den Mann zu sagen hatte, den sie zu meinem Vater auserkoren hat.
Gleichzeitig komme ich mir mies vor. Sie hat gerade weiß Gott genug, womit sie fertigwerden muss, und es wäre nicht nötig gewesen, dass ich meine Verachtung für meinen Vater ausgerechnet auf seiner Beerdigung demonstriere. Statt es ihr also noch schwerer zu machen, versuche ich ihre Art, mit unangenehmen Wahrheiten umzugehen, zu akzeptieren, und spiele mit.
»Danke, Mom. Tut mir leid, dass ich es nicht hingekriegt habe.«
»Mach dir keine Gedanken deswegen, Liebes. Lass uns morgen noch mal richtig telefonieren, ja? Ich muss jetzt Schluss machen, weil ich gleich einen Termin mit dem Versicherungsberater deines Vaters habe. Rufst du mich an?«
»Mache ich«, verspreche ich. »Und, Mom …? Ich liebe dich.«
Ich lege das Handy weg, greife wieder nach dem Karton und stelle ihn mir auf den Schoß. Ganz oben liegt ein kleiner Anhänger aus Eichenholz, ein unregelmäßiges Herz mit einer Aussparung in der Mitte, dessen Bögen sich oben nicht ganz berühren. Ich streiche über die glatt geschliffene Oberfläche und denke an den Abend zurück, an dem ich es geschenkt bekommen habe. Aber sobald die Erinnerung in mir lebendig wird, lege ich es schnell beiseite. Mit der Sehnsucht nach dem, was früher einmal war, ist es eine heikle Sache.
In dem Karton liegen alte Briefe und Zeitungsausschnitte, die ich herausnehme und neben mir staple, bis ich ganz unten auf das stoße, was ich zu finden gehofft hatte … und vor dem ich mich auch ein bisschen fürchte.
Meine Ellen-Tagebücher.
Ich fahre mit dem Daumen nachdenklich über den Einband des obersten. In diesem Karton liegen nur drei Hefte, aber insgesamt müssen es acht oder neun gewesen sein. Seit meinem letzten Eintrag habe ich nie mehr einen Blick in eines davon geworfen.
Als ich mit dem Schreiben angefangen hatte, wollte ich mir nicht eingestehen, dass ich im Grunde genommen nichts anderes tat, als Tagebuch zu führen, weil das alle Mädchen machten. Stattdessen redete ich mir ein, es wären Briefe an Ellen DeGeneres. Von der Ausstrahlung ihrer allerersten täglichen Talkshow an saß ich jeden Tag nach der Schule vor dem Fernseher, um ja keine Folge zu verpassen. Ich bewunderte und liebte Ellen über alles und war überzeugt, dass wir dicke Freundinnen wären, wenn wir uns kennen würden. Bis ich sechzehn war, habe ich ihr regelmäßig geschrieben.
Natürlich wusste ich tief in meinem Inneren, dass Ellen DeGeneres sich kaum für die Gedanken und Erlebnisse irgendeines Kleinstadtmädchens interessieren würde, was vermutlich auch der Grund war, dass ich keinen der »Briefe« jemals abgeschickt habe. Heute bin ich froh darüber. Trotzdem habe ich jeden einzelnen Eintrag mit »Liebe Ellen« begonnen.
Nachdem ich alles wieder zurückgelegt habe, stelle ich den Karton auf den Boden und schaue in den zweiten, in dem sich die sechs übrigen Tagebücher befinden. Nach kurzem Blättern entdecke ich das Heft, das aus der Zeit stammt, als ich fünfzehn war, und suche nach dem Eintrag des Tages, an dem ich Atlas zum ersten Mal gesehen hatte. Bevor er in meinem Leben auftauchte, hatte ich eigentlich nie etwas Aufregendes erlebt, das es wert gewesen wäre, aufgeschrieben zu werden. Erstaunlich, dass ich es trotzdem geschafft habe, bis dahin ganze sechs Hefte zu füllen.
Ich hatte mir geschworen, sie nie mehr zu lesen, aber seit dem Tod meines Vaters denke ich viel über das nach, was gewesen ist. Vielleicht können mir die Tagebücher ja irgendwie helfen, ihm zu verzeihen. Wobei ich gleichzeitig auch Angst habe, dass dadurch alles wieder hochkommt und ich ihn womöglich noch mehr hasse.
Ins Polster zurückgelehnt, beginne ich zu lesen.
Liebe Ellen,
bevor ich dir schreibe, was passiert ist, muss ich dir unbedingt noch von einer Idee erzählen, die mir für deine Show eingefallen ist: ein Element, das man »Ellen at home« nennen könnte. Ich und bestimmt auch ganz viele andere würden nämlich total gern wissen, was für ein Mensch du bist, wenn du nicht im Studio sitzt, sondern ganz normale Sachen machst wie fernsehen oder kochen oder im Garten arbeiten. Die Produzenten deiner Show könnten Portia eine Kamera geben, und sie könnte sich manchmal an dich ranschleichen und dich aufnehmen. Portia würde dich ein paar Sekunden filmen, ohne dass du es merkst, und dann laut »Ellen at home!« rufen. Du spielst anderen ja auch gern Streiche. Ich glaube, es wäre lustig, den Spieß mal umzudrehen.
Okay, jetzt aber zu gestern. Es ist etwas passiert.
Erinnerst du dich noch an unsere Nachbarin, die hinter uns gewohnt hat, die alte Mrs Burleson, die in der Nacht gestorben ist, als es hier diesen schlimmen Schneesturm gab? Sie hatte so hohe Steuerschulden, dass ihre Tochter das Erbe mitsamt dem Haus ausgeschlagen hat. Es war aber sowieso eine Bruchbude und steht jetzt seit zwei Jahren leer. Das weiß ich deswegen, weil ich von meinem Zimmer aus den perfekten Blick darauf habe und genau sehe, dass nie jemand dort ist.
Bis gestern Abend.
Ich lag im Bett und habe gerade Spielkarten gemischt (komisches Hobby, ich weiß. Kartenspiele an sich interessieren mich gar nicht, aber das Mischen macht mir Spaß, und ich habe mir inzwischen unterschiedliche Methoden beigebracht. Es ist irgendwie beruhigend, etwas mit den Händen zu machen, und außerdem die perfekte Ablenkung, wenn meine Eltern sich mal wieder streiten), draußen war es schon dunkel, weshalb ich das Licht sofort bemerkt habe. Es war keine Lampe, sondern sah eher nach einer Kerze aus. Ich habe mir Dads Fernglas geholt, konnte aber nichts erkennen. Nach einer Weile ist das Licht dann ausgegangen.
Heute Morgen, als ich mich für die Schule fertig gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass sich im Haus etwas bewegt. Ich habe mich ans Fenster gestellt und unauffällig hinübergespäht. Kurz darauf ist die Hintertür aufgegangen, und ein Junge ist rausgekommen, der aussah, als wäre er nur ein paar Jahre älter als ich. Er hatte einen Rucksack auf und hat immer wieder über die Schulter geschaut, während er auf dem Weg zwischen unserem Garten und dem von unseren Nachbarn ganz schnell zur Bushaltestelle gelaufen ist.
Er ist vorher ganz bestimmt noch nie mit unserem Schulbus gefahren, das wäre mir aufgefallen. Ich war kurz davor, ihn anzusprechen, aber im Bus hat sich keine Gelegenheit ergeben, und dann ist er auch vor mir ausgestiegen und gleich im Schulgebäude verschwunden. Er geht also auf meine Schule.
Ich frage mich, warum er in dem abbruchreifen Haus geschlafen hat. Soweit ich weiß, ist der Strom abgeschaltet, und fließendes Wasser gibt es dort bestimmt auch nicht. Erst dachte ich, es wäre vielleicht so was wie eine Mutprobe gewesen, aber nach der Schule ist er wieder mit dem Bus gefahren und bei uns ausgestiegen. Diesmal ist er die Straße runter, als würde er woanders hingehen, aber ich bin sofort in mein Zimmer gerannt und habe beobachtet, wie er sich ein paar Minuten später wieder in das verlassene Haus geschlichen hat.
Ob ich Mom von ihm erzählen soll? Ich will nicht neugierig sein, und es geht mich ja eigentlich auch gar nichts an, aber es könnte ja sein, dass er obdachlos ist und deswegen in dem Haus Unterschlupf gesucht hat. Meine Mutter arbeitet an einer Schule, vielleicht hätte sie ja eine Idee, wie man ihm helfen kann.
Ich habe mir überlegt, dass ich noch ein bisschen abwarte, bevor ich mit ihr rede. Vielleicht ist er ja auch bloß für ein paar Tage von zu Hause abgehauen, um seine Ruhe zu haben. Ich hätte manchmal auch gern eine kleine Auszeit von meinen Eltern.
Morgen schreibe ich dir, wie es weitergegangen ist.
Deine Lily
Liebe Ellen,
ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich den Anfang von deiner Show, wenn du durch die Zuschauerreihen tanzt, immer vorspule. Früher habe ich mir die Tanzeinlagen gern angeschaut, aber inzwischen mag ich die Interviews mit den Gästen und die Comedy-Sachen lieber.
Übrigens habe ich etwas über den Jungen herausgefunden, der heute wieder mit dem Schulbus gefahren ist. Er hat jetzt schon die zweite Nacht in dem verlassenen Haus geschlafen, aber das habe ich niemandem erzählt.
Er heißt Atlas Corrigan. Katie saß heute im Bus neben mir, und ich habe sie gefragt, ob sie ihn zufälligerweise kennt. Sie hat die Augen verdreht und mir seinen Namen gesagt. »Er ist in der Zwölften, mehr weiß ich auch nicht. Aber ist dir auch aufgefallen, dass er voll stinkt?« Sie hat die Nase gerümpft. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, dass es fies ist, so was zu sagen, weil es in dem Haus, in dem er wohnt, kein Wasser gibt, aber ich habe es gelassen und bloß über die Schulter zu ihm rübergeschaut. Vielleicht ein bisschen zu auffällig, er hat nämlich plötzlich hochgeguckt.
Nach der Schule bin ich in den Garten raus, um die Radieschen auszugraben. Alles andere ist schon abgeerntet, und es fängt langsam an, kalt zu werden. Bald muss ich die Beete für den Winter vorbereiten. Ich hätte die Radieschen ruhig auch noch ein paar Tage länger in der Erde lassen können, aber vom Garten aus hat man einen perfekten Blick auf das Nachbarhaus, und ich hatte die Hoffnung, vielleicht etwas mehr über Atlas herauszufinden.
Ich habe sofort gemerkt, dass ein paar von den Radieschen fehlten, was merkwürdig war, weil meine Eltern nie an meine Beete gehen. Dann habe ich mir gedacht, dass es eigentlich nur Atlas gewesen sein kann. Er hat wahrscheinlich nicht nur keine Möglichkeit zum Duschen, sondern auch nichts zu essen.
Ich bin ins Haus zurück und habe ihm zwei Sandwiches gemacht. Dann habe ich zwei Dosen Cola aus dem Kühlschrank und eine Tüte Chips aus der Vorratskammer geholt, alles in eine Papiertüte gepackt und bin damit zu ihm rüber. Ich habe die Tüte vor die Hintertür gestellt, habe geklopft und bin schnell weg. Als ich wieder in meinem Zimmer war und zum Fenster rausgeschaut habe, hatte er die Tüte schon reingeholt. Das heißt, dass er ziemlich sicher gesehen hat, wer ihm die Sachen hingestellt hat.
Ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen. Was soll ich sagen, falls er mich morgen anspricht?
Deine Lily
Liebe Ellen,
heute war Barack Obama in deiner Sendung. Falls er die Wahl im November gewinnt, wird er unser erster schwarzer Präsident. Ich stelle es mir total schwierig vor, mit einem Politiker zu reden. Warst du vorher nicht nervös? Ich kenne mich mit Politik gar nicht aus und bewundere dich dafür, wie du es schaffst, über ernsthafte Themen zu reden und gleichzeitig witzig zu sein. Das könnte ich nicht.
Wir erleben beide gerade ganz schön aufregende Sachen, oder? Du hast mit einem Mann gesprochen, der vielleicht bald unser Land regiert, und ich versorge einen obdachlosen Jungen heimlich mit Essen.
Heute Morgen war Atlas schon an der Bushaltestelle, als ich rauskam. Obwohl wir nebeneinanderstanden, hat keiner von uns etwas gesagt, was ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm war. Als der Bus dann endlich kam, ist Atlas ein Stückchen näher an mich herangerückt und hat leise »Danke« gesagt, ohne mich anzusehen.
Ich habe es nicht geschafft, so was wie »Bitte schön« zu sagen, weil ich von seiner Stimme so eine Gänsehaut bekommen habe, dass es mir durch und durch ging.
Hast du so was schon mal erlebt, Ellen? Dass dir die Stimme von einem Jungen eine Gänsehaut macht und du sie im ganzen Körper bis zu den Zehen spürst? Oder … ach so, stimmt. Bei dir hätten wahrscheinlich eher Frauenstimmen so eine Wirkung.
Er ist an mir vorbeigegangen und hat sich ganz hinten in den Bus gesetzt. Nachmittags auf der Rückfahrt ist er als Letzter eingestiegen. Der Bus war schon ziemlich voll, aber an der Art, wie sein Blick über die Sitzreihen gewandert ist, habe ich gemerkt, dass er nicht nach einem freien Platz gesucht hat, sondern nach mir.
Als er mich gefunden hatte und auf mich zuging, bin ich rot geworden und musste schnell weggucken. Ich finde es echt schlimm, dass ich bei Jungs immer so unsicher bin. Hoffentlich bessert sich das, wenn ich erst mal sechzehn bin.
Atlas hat sich neben mich gesetzt und seinen Rucksack zwischen seinen Beinen abgestellt, und da habe ich gemerkt, was Katie gemeint hat. Er roch wirklich ein bisschen nach Schweiß, aber das fand ich nicht schlimm, weil ich ja wusste, dass er sich nicht waschen kann.
Erst hat er nichts gesagt, sondern saß bloß neben mir und hat an dem Loch im Knie seiner Jeans rumgefummelt. Man hat gesehen, dass sie nicht zerfetzt war, weil er das cool findet, sondern weil sie schon so alt und abgewetzt war. Sie war auch ein bisschen zu kurz und hat ihm obenrum wahrscheinlich nur deswegen noch gepasst, weil er so dünn ist.
Nach einer Weile hat er dann doch etwas gesagt. Ganz leise. »Hast du mit jemandem darüber geredet?«
Ich habe ihm angemerkt, dass er sich Sorgen macht. Es war das erste Mal, dass ich ihn so richtig aus der Nähe gesehen habe. Seine Haare sind dunkelbraun, aber vielleicht sehen sie nur deswegen so dunkel aus, weil er sie schon eine Weile nicht mehr gewaschen hat. Und er hat ganz besondere Augen. Eisblau und strahlend wie die von einem Husky. Wahrscheinlich sollte ich seine Augen nicht mit denen von einem Hund vergleichen, aber das war das Erste, woran ich denken musste.
Ich habe den Kopf geschüttelt und aus dem Fenster geschaut. Eigentlich dachte ich, er wäre jetzt vielleicht beruhigt und würde sich einen anderen Platz suchen, aber er ist sitzen geblieben. Und dann habe ich mich getraut, ihm auch eine Frage zu stellen. »Warum wohnst du nicht bei deinen Eltern?«, flüsterte ich.
Er hat kurz zu mir rübergeschaut, als würde er überlegen, ob er mir trauen kann. Dann hat er gesagt: »Weil sie mich zu Hause nicht mehr haben wollen«, und ist aufgestanden.
Erst dachte ich, er hätte meine Frage vielleicht zu aufdringlich gefunden, aber dann habe ich gemerkt, dass wir an unserer Haltestelle angekommen waren, und bin mit ihm ausgestiegen. Diesmal ist er nicht die Straße runter, um so zu tun, als würde er woanders hingehen, weil er ja wusste, dass ich sein Geheimnis kenne.
Vor unserem Grundstück sind wir stehen geblieben. Er hat ein Steinchen weggekickt und über meine Schulter geschaut.
»Wann kommen deine Eltern nach Hause?«
»Meistens so gegen fünf«, sagte ich. Es war Viertel vor vier.
Er nickte. Irgendwie sah er aus, als ob er noch etwas fragen wollte, aber dann hat er bloß noch mal genickt und ist losgegangen. In das Haus ohne Strom, ohne Wasser und ohne Essen.