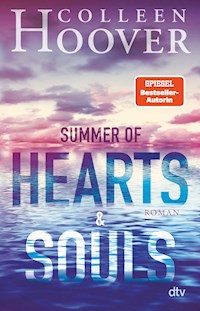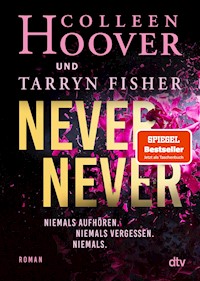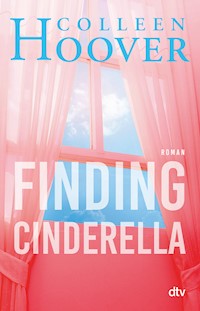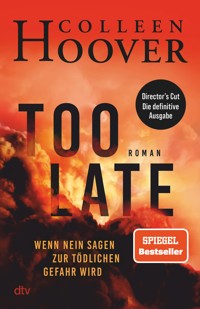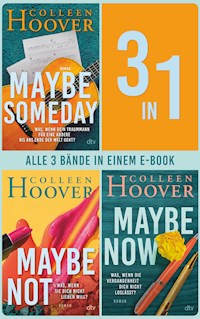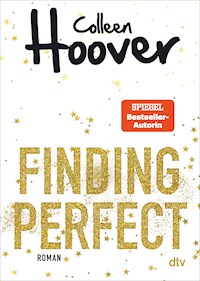9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Will & Layken-Reihe
- Sprache: Deutsch
Es ist die ganz große Liebe – doch das Leben hat andere Pläne mit ihnen Ein Liebesroman mit extremer Sogwirkung: Der Beginn der mitreißenden New-Adult-Romance um Will & Layken – eine emotionale Achterbahn der Gefühle. Nach dem Unfalltod ihres Vaters zieht die 18-jährige Layken mit ihrer Mutter und ihrem Bruder von Texas nach Michigan. Nie hätte Layken gedacht, dass sie sich dort bereits am ersten Tag Hals über Kopf verliebt. Und dass diese Liebe mit derselben Intensität erwidert wird. Es sind die ganz großen Gefühle zwischen Layken und Will. Das ganz große Glück – drei Tage lang. Denn dann stellt das Leben sich ihrer Liebe mit aller Macht in den Weg … Mehr Gefühl geht nicht: Eine der packendsten Liebesgeschichten überhaupt! Alle Bände der ›Will & Layken‹-Reihe: Band 1: Weil ich Layken liebe Band 2: Weil ich Will liebe Band 3: Weil wir uns lieben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Es ist die ganz große Liebe – doch das Leben hat andere Pläne mit ihnen
Nach dem Unfalltod ihres Vaters zieht die 18-jährige Layken mit ihrer Mutter und ihrem Bruder von Texas nach Michigan. Nie hätte Layken gedacht, dass sie sich dort bereits am ersten Tag Hals über Kopf verliebt. Und dass diese Liebe mit derselben Intensität erwidert wird. Es sind die ganz großen Gefühle zwischen Layken und Will. Das ganz große Glück – drei Tage lang. Denn dann stellt das Leben sich ihrer Liebe mit aller Macht in den Weg …
Der Beginn der mitreißenden New-Adult-Romance um Will & Layken – eine emotionale Achterbahn der Gefühle.
Von Colleen Hoover sind bei dtv außerdem lieferbar:
Weil ich Will liebe | Weil wir uns lieben
Hope Forever | Looking for Hope | Finding Cinderella
Finding Perfect
Love and Confess
Zurück ins Leben geliebt – Ugly Love
Nächstes Jahr am selben Tag – November 9
Never Never (zusammen mit Tarryn Fisher)
Maybe Someday | Maybe Not | Maybe Now
Die tausend Teile meines Herzens
Was perfekt war
Verity
Too late
All das Ungesagte zwischen uns
Layla
Für immer ein Teil von dir
Summer of Hearts and Souls
Nur noch ein einziges Mal – It ends with us
It starts with us – Nur noch einmal und für immer
Too late – Wenn Nein sagen zur tödlichen Gefahr wird
Nur noch wenige Tage – Saint & The Dress. Zwei Stories
Colleen Hoover
Weil ich Layken liebe
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katarina Ganslandt
Ich widme diesen Roman den Avett Brothers,
die mich mit ihrer Songzeile
»… decide what to be, and go be it«
dazu ermutigt haben, das zu werden,
was ich immer sein wollte.
Erster Teil
1.
I’m as nowhere as I can be, could you add some somewhere to me?
– THE AVETT BROTHERS, »SALINA«
Nachdem Kel und ich die letzten beiden Kartons in den Möbelwagen gewuchtet haben, ziehe ich mit einem Ruck die Klappe zu, lege den Riegel um und sperre damit achtzehn Jahre Erinnerungen weg, die alle auf die eine oder andere Weise mit meinem Vater verknüpft sind.
Es ist gerade mal sechs Monate her, dass er gestorben ist. Nicht besonders lang. Aber zumindest bricht mein neunjähriger Bruder Kel nicht mehr sofort in Tränen aus, sobald wir über Dad reden, und meine Mutter hat akzeptiert, dass ihr nichts anderes übrig bleibt, als die Familie allein über die Runden zu bringen. Im Moment bedeutet das für uns vor allem, dass wir es uns nicht mehr leisten können, in unserem Haus in Texas wohnen zu bleiben, das mein Zuhause war, seit ich denken kann.
»Jetzt sieh doch nicht immer alles so schwarz, Lake«, sagt meine Mutter und drückt mir den Hausschlüssel in die Hand. »Du wirst Michigan lieben, da bin ich mir sicher.«
Sie spricht mich nie mit dem Namen an, der auf meiner Geburtsurkunde steht und eine etwas ungewöhnliche Entstehungsgeschichte hat. Meine Eltern konnten sich nämlich neun Monate lang nicht auf einen Namen einigen, der ihnen beiden gefiel. Mom war für Layla, weil sie den Song von Eric Clapton so liebt, und Dad wollte mich Kennedy nennen. »Nach keinem bestimmten«, wie er sagte. »Ich finde alle Kennedys toll!«
Als ich drei Tage nach meiner Geburt immer noch namenlos war, drängte das Krankenhaus meine Eltern, sich doch bitte endlich zu entscheiden. Die beiden beschlossen, die ersten drei Buchstaben ihrer jeweiligen Favoriten zusammenzuwerfen und mich »Layken« zu taufen, auch wenn sie mich dann später nie so nannten.
»Sieh du nicht immer alles so rosa. Ich bin mir sicher, dass ich Michigan hassen werde«, sage ich zu Mom.
Meine Mutter erreicht mit einem einzigen scharfen Blick das, wozu andere Eltern stundenlange Predigten brauchen. So war es immer schon und so ist es auch jetzt.
Ich gehe die Verandastufen hinauf, um noch einen letzten Kontrollgang durchs Haus zu machen. Die leer geräumten Zimmer wirken fremd und irgendwie unheimlich. Als wäre es nicht mehr dasselbe Haus. Während der letzten sechs Monate habe ich hier einen Tornado der dunkelsten Gefühle durchlebt. Natürlich ist mir klar gewesen, dass ich irgendwann mal ausziehen würde. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass es erst nach meinem Schulabschluss so weit wäre.
In dem Raum, der nicht mehr unsere Küche ist, entdecke ich auf dem hellen Viereck am Boden, wo einmal unser Kühlschrank stand, eine lila Haarspange aus Plastik. Ich hebe sie auf und streiche mit dem Daumen darüber.
Sie wachsen wieder nach, höre ich Dad sagen.
Ich war fünf. Meine Mutter hatte die Nagelschere nicht weggeräumt und ich habe getan, was die meisten Kinder in diesem Alter in so einem Fall tun würden. Ich spielte Friseur.
Nachdem ich mir eine dicke Strähne aus meinem Pony geschnitten hatte, hockte ich eine gefühlte Stunde vor dem Spiegel und wartete darauf, dass sie wieder nachwuchs. Nichts passierte. Irgendwann sammelte ich die glatten braunen Haare vom Boden auf, hielt sie mir an die Stirn und überlegte verzweifelt, wie ich sie wieder befestigen könnte. Und dann fing ich an zu weinen.
Dad hörte mich und kam ins Bad. Als er die Bescherung sah, lachte er nur, hob mich hoch und setzte mich auf den Waschtisch.
»Hast du Angst, dass Mommy schimpft? Keine Sorge, Lake. Sie wird gar nicht mitkriegen, was passiert ist«, versprach er mir und nahm etwas aus dem Badezimmerschrank. »Schau mal hier. Ich hab was für dich.« Auf seiner Handfläche lag die lila Haarspange. »Wenn du diese Zauberspange trägst, wird Mommy überhaupt nichts merken.« Er strich den Rest meines Ponys zur Seite und befestigte ihn mit der Spange. Dann drehte er mich so, dass ich mich im Spiegel betrachten konnte. »Siehst du?«, sagte er lächelnd. »So gut wie neu!«
In diesem Moment war ich das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt. Keine meiner Freundinnen hatte von ihrem Vater jemals eine Zauberhaarspange geschenkt bekommen.
Ich lief zwei Monate lang mit der Spange herum, ohne dass Mom eine einzige Bemerkung dazu machte. Jetzt im Rückblick bin ich mir ziemlich sicher, dass Dad ihr damals alles erzählt hat, aber mit fünf glaubte ich fest an seine Zauberkräfte.
Ich sehe Mom ähnlicher als ihm. Wir sind beide weder besonders groß noch besonders klein. Auch wenn ihr nach zwei Schwangerschaften meine Jeans nicht passen, können wir uns ansonsten problemlos gegenseitig Klamotten ausleihen. Unsere braunen Haare sind je nach Wetterlage glatt oder leicht gewellt. Vielleicht gehen ihre Augen noch eine Spur mehr ins Smaragdgrüne als meine, aber das kann auch daran liegen, dass ihr hellerer Teint sie mehr zum Leuchten bringt.
Von den Äußerlichkeiten abgesehen komme ich allerdings mehr nach meinem Dad. Ich habe seinen trockenen Humor, sein Lachen und seine Liebe zur Musik geerbt. Überhaupt waren wir uns sehr nah. Dafür ist Kel mit den dunkelblonden Haaren und den weichen Gesichtszügen sein Ebenbild. Mit seinen neun Jahren ist mein Bruder zwar noch ziemlich klein, aber er macht die fehlende Körpergröße locker mit seiner Persönlichkeit wett.
Ich gehe zum Spülbecken, lasse Wasser über die Spange laufen und reibe den Staub ab, der sich die letzten dreizehn Jahre darauf angesammelt hat. Als ich mir gerade die Hände an der Jeans trocken wische, kommt Kel rückwärts in die Küche gelaufen. Er ist sehr eigen, und dafür liebe ich ihn umso mehr. Manchmal legt er »Rückwärtstage« ein, an denen er rückwärts geht, rückwärts spricht und sogar den Nachtisch vor dem Hauptgericht isst. Durch den großen Altersunterschied zwischen uns und weil wir keine weiteren Geschwister haben, muss er sich wohl sein eigenes Bespaßungsprogramm ausdenken, um sich nicht zu langweilen.
»Beeilen dich sollst du, gesagt hat Mom, Layken!«, sagt er.
Ich schiebe die Haarspange in die Hosentasche, folge ihm nach draußen und schließe zum allerletzten Mal die Haustür hinter mir ab.
In den nächsten Tagen steuern Mom und ich abwechselnd den schwergängigen Möbelwagen und meinen Jeep. Ihr eigener Kombi, in dem auch noch ein paar Kartons stehen, wird im Laufe der nächsten Woche von einem Unternehmen nach Michigan überführt. Kel fährt mal bei Mom und mal bei mir mit, am dritten Tag sitzt er neben mir im Transporter. Die ersten beiden Nächte schlafen wir in einem Motel. Die letzte anstrengende Etappe legen wir während der Nacht zurück und machen nur kurz an einer Tankstelle Halt. Als wir uns im Morgengrauen Ypsilanti nähern, wo wir von nun an wohnen werden, sinkt meine Laune auf den Nullpunkt – was ungefähr der Außentemperatur entspricht. Hier ist eindeutig schon richtig Herbst, obwohl wir erst September haben. Ich werde dringend einen Schwung neuer, wärmerer Klamotten brauchen.
Den Anweisungen meines Navis folgend, biege ich in einem Wohngebiet rechts in eine Sackgasse ein, woraufhin mir mitgeteilt wird, ich hätte mein »Ziel erreicht«.
Mein Ziel. Ja, klar. Genau hier wollte ich immer schon mal hin. Das Navi hat so was von keine Ahnung.
Die Straße ist nicht besonders lang, auf beiden Seiten stehen jeweils acht Backstein-Bungalows. Über einem der Garagentore hängt ein Basketballkorb, was mich hoffen lässt, dass Kel hier zumindest jemanden zum Spielen findet. Die Gegend wirkt ziemlich gediegen. Die Vorgärten sind gepflegt und alles sieht ordentlich aus, aber für meinen Geschmack gibt es hier zu wenig Grün. Viel, viel zu wenig Grün. Ich bekomme jetzt schon Heimweh.
Unser Vermieter hat uns Fotos vom Haus gemailt, weshalb ich es sofort erkenne. Es ist klein. Richtig klein. In Texas haben wir in einem Holzhaus im ortstypischen Ranch-Style auf einem mehrere Hektar großen Stück Land gewohnt. Das Grundstück hier besteht fast ausschließlich aus Asphalt und einer winzigen Rasenfläche mit Gartenzwergen. Die Tür geht auf, ein älterer Mann kommt heraus und winkt uns zu. Unser Vermieter.
Ich fahre ein Stück am Haus vorbei, um rückwärts in die Einfahrt einzuparken. Aber bevor ich in den Rückwärtsgang schalte, lege ich Kel, der seit Indiana geschlafen hat, einen Arm um die Schulter und rüttle ihn sanft wach.
»Hey, Kel«, flüstere ich. »Wir sind da.«
Er streckt sich gähnend und drückt dann die Stirn an die Scheibe, um unser neues Zuhause in Augenschein zu nehmen. »Guck mal, da ist ein Junge im Garten!«, ruft er aufgeregt. »Glaubst du, der wohnt auch bei uns im Haus?«
»Hoffentlich nicht«, antworte ich lachend. »Aber wahrscheinlich hier in der Straße. Du kannst ruhig schon mal aussteigen und ihm Hallo sagen.«
Nachdem ich den Möbelwagen erfolgreich in die Garageneinfahrt manövriert habe, stelle ich den Motor ab und lasse die Scheibe herunter. Mom parkt den Jeep neben mir und steigt aus, um unseren Vermieter zu begrüßen. Ich lehne mich erst mal im Sitz zurück und beobachte Kel und den anderen Jungen, die sich anscheinend auf Anhieb so gut verstehen, dass sie sich gleich einen imaginären Schwertkampf auf der Straße liefern. Ich beneide meinen kleinen Bruder darum, dass er sich mit unserem Umzug so problemlos abfindet, während ich mich wie ein wütendes, trotziges Kind fühle.
Als Mom uns vor zwei Monaten eröffnet hat, dass wir wegziehen würden, hat Kel im ersten Moment furchtbar geweint, was allerdings vor allem mit seinem Baseballteam zu tun hatte. Natürlich wird er die anderen Jungs vermissen, aber sein allerbester Freund existiert – wie bei so vielen Neunjährigen – sowieso nur in seiner Fantasie. Nachdem Mom ihm versprochen hatte, ihn beim Eishockey anzumelden, hatte er sich mit dem Gedanken, in Michigan zu wohnen, ganz schnell angefreundet. Eishockey zu spielen ist schon seit einer Ewigkeit sein Traum, der allerdings immer daran gescheitert ist, dass es im ländlichen Süden von Texas einfach so gut wie keine Eishockeyclubs gibt. Jedenfalls konnte er es von da an kaum erwarten, endlich hierherzuziehen.
Ich weiß, dass wir es uns nicht leisten konnten, in Texas zu bleiben. Mein Vater hat als Geschäftsführer eines Farbengeschäfts so viel verdient, dass wir gut davon leben konnten. Mom hat als Krankenschwester zwar hin und wieder Vertretungsdienste übernommen, sich aber ansonsten hauptsächlich um uns Kinder und den Haushalt gekümmert. Sie musste nicht arbeiten. Nach Dads Tod konnte es so natürlich nicht weitergehen. Obwohl die Trauer um ihn und die Verantwortung für uns sie wahnsinnig viel Kraft kostete, hat Mom schon einen Monat nach der Beerdigung eine Vollzeitstelle angenommen.
Ein paar Monate später hat sie uns dann beim Abendessen erklärt, dass ihr Gehalt nicht ausreicht, um für unseren Lebensunterhalt aufzukommen und die Hypothek für unser Haus abzubezahlen. Als sie unsere erschrockenen Gesichter sah, hat sie uns schnell beruhigt. Ihre alte Schulfreundin Brenda hätte ihr eine Stelle in einem Krankenhaus vermittelt, wo sie wesentlich mehr verdienen könnte. Allerdings müssten wir dafür nach Ypsilanti ziehen, die Kleinstadt in der Nähe von Detroit, in der sie aufgewachsen ist.
Ich mache ihr deswegen keinen Vorwurf. Ihr blieb gar nichts anderes übrig, als das Angebot anzunehmen. Meine Großeltern leben nicht mehr und sie hat niemanden, der ihr finanziell unter die Arme greifen könnte. Wie gesagt, ich verstehe absolut, dass sie diese Entscheidung treffen musste – aber etwas zu verstehen macht es nicht automatisch einfacher, auch damit klarzukommen.
»Jetzt bist du dran!«, brüllt Kel durchs offene Fenster und rammt mir sein unsichtbares Schwert in die Kehle. Ich weiß, dass er darauf wartet, dass ich zusammensacke, aber ich verdrehe bloß die Augen.
»Ich hab dich voll erwischt, Layken. Du musst sterben«, verlangt er.
»Glaub mir, ich bin längst tot«, murmle ich, öffne die Wagentür und steige aus.
Kel steht mit hängenden Schultern vor mir und lässt enttäuscht die Hand mit der unsichtbaren Waffe sinken. Sein neuer Freund sieht genauso geknickt aus, worauf ich prompt ein schlechtes Gewissen bekomme, weil ich meine Laune an ihnen auslasse.
»Ich bin längst tot«, wiederhole ich, diesmal aber mit röchelnder Monsterstimme, »weil ich nämlich ein … Zombie bin!«
Als ich die Arme vorstrecke, den Kopf zur Seite lege und gurgelnde Laute ausstoße, rennen die beiden kreischend davon. »Meeeenschenfleisch!«, brülle ich und folge ihnen steifbeinig um den Umzugswagen herum. »Lecker, lecker Menschenfleisch!«
Im nächsten Moment bleibe ich abrupt stehen. Auf dem Gehweg steht ein junger Typ, der meinen Bruder und den anderen Jungen am Kragen gepackt hält. »Ich hab sie!«, ruft er.
Er ist ein paar Jahre älter als ich, schwarzhaarig, ziemlich groß, und den meisten Mädchen würde bei seinem Anblick wahrscheinlich sofort das Wort »heiß« durch den Kopf schießen. Aber ich bin nicht wie die meisten Mädchen. Kel und der andere Junge versuchen sich wild zappelnd loszureißen, doch der Dunkelhaarige hält sie so fest, dass sich unter seinem langärmligen Shirt sein Bizeps deutlich abzeichnet.
Anders als bei Kel und mir sieht man den beiden auf den ersten Blick an, dass sie Geschwister sind. Abgesehen von ihrem offensichtlichen Altersunterschied könnten sie glatt als Zwillinge durchgehen. Beide haben einen ziemlich dunklen Teint, fast schwarze Haare und sogar den gleichen Kurzhaarschnitt. Plötzlich gelingt es Kel, sich loszureißen. Er zückt sofort sein »Schwert« und attackiert den Bruder seines neuen Freundes, der sich lachend zur Wehr setzt. Erst als er aufschaut und mich pantomimisch um Hilfe bittet, wird mir bewusst, dass ich immer noch in meiner Zombiepose dastehe.
Am liebsten würde ich mich in den Wagen flüchten und mich für den Rest meines Lebens unter der Fußmatte verstecken, stattdessen röchle ich noch einmal »Menschenfleisch!«, mache einen Hechtsprung vorwärts und tue so, als würde ich Kels neuen Freund in den Nacken beißen. Anschließend packe ich ihn und Kel und kitzle die beiden durch, bis sie um Gnade winselnd in der Einfahrt zusammenbrechen.
Als ich mich wieder aufrichte, streckt mir der Dunkelhaarige die Hand hin. »Hallo. Ich heiße Will. Wir wohnen da drüben.« Er deutet mit dem Kinn auf die andere Straßenseite.
»Hi«, sage ich und ergreife seine Hand. »Ich bin Layken. Dann sind wir ab sofort Nachbarn. Wir ziehen nämlich gerade hier ein.« Ich nicke über die Schulter in Richtung unseres Hauses.
Er lächelt. Wir halten uns immer noch an den Händen und wissen offenbar beide nicht, was wir sagen sollen. Ich hasse solche Momente.
»Tja dann«, sagt er schließlich. »Willkommen in Ypsilanti.« Er lässt meine Hand los und schiebt seine in die Jackentasche. »Wo habt ihr vorher gewohnt?«
»In Texas?«, antworte ich. Ich habe keine Ahnung, warum sich das wie eine Frage anhört. Ich weiß auch nicht, weshalb ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, warum es sich wie eine Frage anhört. Oder weshalb ich mir Gedanken darüber mache, dass ich mir Gedanken darüber mache, warum es sich … Verdammt, ich bin total verwirrt. Das kann nur an dem Schlafdefizit liegen, das ich im Verlauf der letzten drei Tage angesammelt habe.
»Texas, echt?«, sagt er und wippt auf den Fersen.
Die ganze Situation wird nur noch peinlicher, als ich darauf nichts antworte. Aber was denn auch? Will wirft einen Blick auf seinen immer noch am Boden liegenden Bruder, bückt sich und packt ihn an den Handgelenken. »So. Zeit, den kleinen Racker hier zur Schule zu bringen«, sagt er, zieht ihn hoch und wirft ihn sich schwungvoll über die Schulter. »Heute Abend soll es übrigens noch mal deutlich kälter werden, an eurer Stelle würde ich versuchen, heute schon so viel wie möglich auszuladen. Falls ihr Hilfe braucht, kann ich nachher gern rüberkommen. Wir sind so gegen vier wieder zurück.«
»Das ist nett, danke«, sage ich. Will nickt mir noch mal zu, dann dreht er sich um und trägt seinen Bruder über die Straße. Ich schaue den beiden immer noch hinterher, als Kel mir plötzlich den Zeigefinger ins Kreuz bohrt und ruft: »Ich hab dich, Monster!«
Ich sinke in die Knie und lasse mich mit auf den Bauch gepressten Händen nach vorn fallen, worauf Kel auf meinen Rücken klettert und mir den Todesstoß versetzt. Während mein Zombie-Ich den letzten Atem aushaucht, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie Will auf der anderen Straßenseite seinen Bruder in den Wagen setzt und dabei immer wieder zu uns rüberschaut. Dann schlägt er die Tür zu, geht um das Auto herum zur Fahrerseite und winkt noch mal, bevor er sich hinters Steuer setzt und losfährt.
Wir verbringen den größten Teil des restlichen Tages damit, Umzugskisten und Möbel ins Haus zu schleppen, und nehmen dankbar das Angebot unseres Vermieters an, uns mit den schweren Sachen zu helfen. Als der Möbelwagen endlich ausgeräumt ist, sind wir so erschöpft, dass wir beschließen, uns die Kartons im Jeep für den nächsten Tag aufzuheben. Während ich die Klappe zuziehe, stelle ich fest, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, jetzt keinen Vorwand mehr zu haben, unseren Nachbarn um Hilfe zu bitten.
Nachdem ich mein Bett zusammengebaut habe, suche ich unter den im Flur aufgestapelten Kartons nach denen mit meinem Namen und trage sie in mein Zimmer. Ich schaffe es sogar, einige davon auszupacken und mein Bett zu beziehen, als mir plötzlich auffällt, dass es im Zimmer ziemlich dunkel geworden ist. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Entweder sind die Tage hier kürzer oder ich habe jegliches Zeitgefühl verloren.
In der Küche hilft Kel Mom, unser Geschirr in die Schränke zu räumen. Ich setze mich auf einen der sechs Barhocker an der Theke, die gleichzeitig unser Esstisch sein wird, weil es hier kein eigenes Esszimmer gibt. Das Haus ist wirklich sehr klein. Durch die Eingangstür kommt man in einen schmalen Vorraum, von dem es rechts ins Wohnzimmer und links in die Küche geht; geradeaus kommt man über einen kurzen Flur zu unseren Schlafzimmern. Das Wohnzimmer ist mit einem cremefarbenen Teppich ausgelegt, der Rest des Hauses hat Holzboden.
»Unglaublich. Ich hatte ganz vergessen, dass es in Michigan so wenig Insekten gibt«, sagt Mom, während sie eine Auflaufform in den Hängeschrank stellt. »Hier ist alles so sauber. Ich habe noch nicht einmal irgendwo ein Silberfischchen entdeckt.«
In Texas wimmelt es nur so von Ungeziefer. Wenn man nicht gerade die Fliegenklatsche schwingt, ist man damit beschäftigt, Termitenfallen aufzustellen.
»Das ist wahrscheinlich das einzig Gute an Michigan«, sage ich, klappe den Karton mit der Pizza auf, die wir uns haben liefern lassen, und begutachte die einzelnen Stücke.
»Das einzig Gute?« Mom zwinkert mir zu, lehnt sich über die Theke und nimmt sich eines mit Salami. »Ich würde sagen, da gibt es mindestens noch ein anderes Gutes.«
»Hm?« Ich tue so, als wüsste ich nicht, worauf sie anspielt, und entscheide mich für ein Stück mit Tomaten und Mozzarella.
»Ich habe gesehen, wie du dich heute Morgen mit dem Jungen von gegenüber unterhalten hast«, sagt sie lächelnd.
»Mom. Bitte«, seufze ich betont gelangweilt. »Ja, ich habe mit einem Jungen geredet. Stell dir vor, die gibt es hier auch. Hast du etwa gedacht, Texas wäre der einzige Bundesstaat, der männlichen Exemplaren unserer Spezies als Biotop dient?« Ich gehe zum Kühlschrank und hole mir etwas zu trinken.
»Was ist ein Biotopf?«, will Kel wissen.
»Biotop«, korrigiere ich ihn mit vollem Mund. »Als Biotop bezeichnet man einen Lebensraum, in dem sich eine bestimmte Tier- oder Pflanzenart ansiedelt.« Hat sich das Lernen für den Biokurs letztes Jahr doch gelohnt.
»Dann ist Ypsilanti also unser neuer Biotopf?«, fragt Kel.
»Unser neues Biotop«, verbessere ich ihn noch mal. »Und ja, so ungefähr. Wobei ich mir noch nicht so sicher bin, was ich von diesem Lebensraum halten soll.« Ich schiebe mir den letzten Rest meines Pizzastücks in den Mund und trinke noch einen Schluck. »Ich bin total fertig, Leute. Ich geh ins Bett.«
»Du meinst, in dein Lieblings-Biotop?«, fragt Kel.
»Schnell du lernst, kleiner Jedi.« Ich bücke mich, drücke ihm einen Kuss auf die Stirn und ziehe mich dann in mein Zimmer zurück.
Es fühlt sich unglaublich gut an, unter die Decke zu schlüpfen. Wenigstens etwas Vertrautes. Ich schließe die Augen und versuche mir vorzustellen, ich würde in meinem alten Zimmer liegen. In meinem alten, warmen Zimmer. Hier ist es so eiskalt, dass ich mir die Decke bis über den Kopf ziehe und mich darunter so klein wie möglich zusammenrolle. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist, dass ich morgen als Erstes den Thermostat für die Heizung finden und höher drehen muss.
Am nächsten Morgen krieche ich aus dem Bett, spüre den kalten Holzboden unter meinen Füßen und erinnere mich sofort wieder an mein Vorhaben. Bibbernd krame ich meine wärmste Sweatshirtjacke aus dem Schrank, ziehe sie über den Schlafanzug und durchwühle die Kartons nach dicken Socken. Ein paar Minuten später gebe ich fluchend auf und beschließe, dass ich erst mal einen Kaffee brauche, bevor ich mich weiter durch das Kistenchaos arbeite. Auf Zehenspitzen schleiche ich den Flur entlang. Allerdings tue ich das nicht nur aus Rücksicht auf Mom und Kel, die noch schlafen, sondern auch, um so wenig nackte Fußsohle wie möglich auf den eisigen Boden zu setzen. Als ich an Kels Zimmer vorbeikomme, fällt mein Blick auf seine Darth-Vader-Hausschuhe – genau das, was ich jetzt brauche. Ich hole sie mir leise, schlüpfe hinein und gehe danach schon wesentlich entspannter Richtung Küche.
Keine Kaffeemaschine. Ratlos schaue ich mich um, bis mir einfällt, dass sie in einem der Kartons im Jeep ist – und damit draußen. Draußen in dieser geradezu absurden Kälte.
Jacken sind natürlich auch nirgends zu finden. Die stecken wahrscheinlich noch ganz unten in einer der unausgepackten Kisten. Klar, in Texas braucht man sie im September auch nicht. Na gut, dann muss ich mich eben beeilen. Als ich die Haustür öffne, stelle ich überrascht fest, dass der Rasen vor dem Haus von einem seltsamen weißen Pulver überzogen ist. Es dauert tatsächlich einen Moment, bis ich begreife, was das ist. Schnee! Im September? Ich bücke mich, scharre mit beiden Händen etwas davon zusammen und betrachte ihn aus der Nähe. In Texas schneit es sehr selten und wenn, dann niemals diese Art von Schnee. Texanischer Schnee ähnelt eher winzig kleinen, harten Hagelkörnern, wohingegen der Schnee in Michigan genau so aussieht, wie ich mir echten Schnee immer vorgestellt habe – weich, flauschig und kalt! Ich lasse ihn schnell wieder fallen und trockne mir die Hände an meiner Sweatshirtjacke ab, während ich zum Jeep laufe. Oder besser gesagt: laufen will. Besonders weit komme ich nämlich nicht. Sobald die Sohlen der mir viel zu kleinen Darth-Vader-Hausschuhe die verschneiten Betonplatten berühren, sehe ich nicht mehr meinen Wagen vor mir, sondern nur noch wolkenlosen blauen Himmel. Ich lande flach auf dem Rücken und spüre einen stechenden Schmerz in der Schulter. Als ich unter mich taste, bekomme ich etwas Scharfkantiges zu fassen und ziehe es stöhnend hervor. Es ist die zerbrochene Mütze eines Gartenzwergs. Der Rest des Zwergs liegt daneben und grinst mich so frech an, dass ich ihn zur Strafe am liebsten gegen die Hauswand schleudern würde. Als ich den unverletzten Arm hebe, um mein Vorhaben in die Tat umzusetzen, höre ich jemanden rufen.
»Das ist keine gute Idee!«
Ich erkenne Wills Stimme sofort. Sie ist weich und dunkel wie die von meinem Vater, gleichzeitig schwingt eine gewisse Autorität mit. Ich stemme mich auf die Ellbogen und sehe, wie er die Tür seines Wagens zuschlägt und zu mir rübergelaufen kommt.
»Alles okay?«, fragt er lachend, als er bei mir ist. »Geht es dir gut?«
»Mir würde es besser gehen, wenn ich dieses verdammte Ding zerschmettern dürfte«, stöhne ich und mache einen halbherzigen Versuch, auf die Beine zu kommen.
»Verschone ihn. Gartenzwerge bringen Glück«, behauptet Will, nimmt ihn mir ab und stellt ihn behutsam ins schneebedeckte Gras.
»Wirklich?« Ich schaue zu meiner Schulter, wo sich auf dem Sweatshirtstoff langsam ein roter Fleck ausbreitet. »Scheint bei mir nicht zu wirken.«
Sobald er das Blut sieht, wird Will ernst. »Oh, das tut mir leid. Ich hätte niemals gelacht, wenn ich gewusst hätte, dass du dich verletzt hast. Komm, ich helfe dir hoch.« Er beugt sich vor, nimmt mich am Handgelenk des unverletzten Arms und zieht mich vorsichtig auf die Füße. »Die Wunde muss auf jeden Fall versorgt werden. Habt ihr Verbandszeug?«
»Theoretisch schon. Wenn ich nur wüsste, wo ich es hingepackt habe …« Ich denke mit Grauen an den Berg der im Flur aufgetürmten Umzugskartons.
»Dann komm schnell zu uns rüber.«
Er zieht seine Jacke aus, hängt sie mir über die Schultern und legt mir einen Arm um die Taille. Ich komme mir ziemlich albern vor, mich von ihm über die Straße führen zu lassen.
Das Haus liegt ganz still und dunkel da, weshalb ich annehme, dass Wills Familie noch schläft. Wohnzimmer und Küche gehen ineinander über, der Grundriss ist viel großzügiger angelegt als bei uns und es gibt ein Erkerfenster mit einer gemütlich gepolsterten Sitznische, von der aus man in den Garten hinausblicken kann.
Eine Wand ist liebevoll mit Familienfotos dekoriert, von denen die meisten Will und seinen Bruder zeigen, aber ich entdecke auch einige, auf denen die Eltern der beiden zu sehen sind. Während Will Verbandszeug sucht, lege ich seine Jacke über die Sofalehne und schaue mir die Bilder genauer an. Offenbar haben sich bei beiden Söhnen die väterlichen Gene durchgesetzt. Auf dem neuesten Foto – das aber auch schon ein paar Jahre alt zu sein scheint – sind die drei zusammen zu sehen. Rechts und links die beiden Jungen, der stolz lächelnde Vater in der Mitte. Er hat einen dichten Schnurrbart und in seinen tiefschwarzen Haaren schimmern erste graue Strähnen. Will sieht ihm unglaublich ähnlich. Beide haben ein strahlendes, warmes Lächeln und perfekte weiße Zähne.
Wills Mutter hat lange blonde Haare und ist eine richtige Schönheit. Den Fotos nach zu urteilen, scheint sie ziemlich groß zu sein, allerdings kann ich keinerlei Ähnlichkeit zwischen ihr und den Jungs feststellen. Vielleicht ist es so wie bei mir und meinem Vater und Will hat vor allem sein Wesen von ihr geerbt. Während ich die Bilder betrachte, wird mir klar, was der größte Unterschied zwischen diesem Haus und unserem ist: Das hier ist ein Zuhause.
Ich setze mich auf einen der Barhocker an der Küchentheke. »Erst mal muss die Wunde gesäubert werden«, sagt Will. Er geht zum Spülbecken, krempelt die Ärmel seines Hemds hoch, dreht den Hahn auf und hält kurz ein Stück Küchenpapier unter den Wasserstrahl. Ich ertappe mich dabei, wie ich seinen muskulösen Rücken und die schmalen Hüften bewundere. Er ist nicht nur mindestens dreißig Zentimeter größer als ich, sondern auch ziemlich durchtrainiert. Als er sich umdreht, schaue ich hastig weg. Ohne ihn anzusehen, nehme ich das feuchte Küchenpapier entgegen und spüre, wie ich rot werde. Es ist mir peinlich, ihn so angestarrt zu haben.
»Schon okay«, sage ich, als er mir helfen will, meine geöffnete Sweatshirtjacke ein Stück über die verletzte Schulter herunterzuziehen. »Das schaffe ich alleine.«
Will schneidet ein Pflaster zurecht und zieht die Folie ab, während ich behutsam den Schnitt abtupfe, der zum Glück nicht besonders tief ist.
»Wieso warst du eigentlich so früh morgens im Schlafanzug draußen?«, fragt er. »Müsst ihr noch Sachen ausladen?«
Ich schüttle den Kopf, zerknülle das Tuch und werfe es in den Mülleimer. »Kaffee.«
»Verstehe. Du bist also kein Morgenmensch«, versucht Will meine Wortkargheit zu deuten.
Als er sich über mich beugt, um das Pflaster auf die Wunde zu kleben, spüre ich seinen warmen Atem am Hals und bekomme sofort eine Gänsehaut. Er streicht noch einmal die Ränder glatt, damit das Pflaster besser hält, und stemmt dann zufrieden die Hände in die Hüften. »Siehst du? Alles wieder gut.«
»Vielen Dank. Und übrigens bin ich sehr wohl ein Morgenmensch«, sage ich und rutsche vom Hocker. »Sobald ich meinen ersten Kaffee getrunken habe.« Ich betrachte meine Schulter und tue so, als würde ich den Sitz des Pflasters überprüfen, während ich darüber nachdenke, ob ich jetzt wieder gehen soll oder ob er das womöglich als unhöflich empfinden würde, nachdem er mir gerade so nett geholfen hat. Aber was, wenn er eilig irgendwo hinmuss und selbst zu höflich ist, um mich einfach rauszuschmeißen? Gott, ich verstehe nicht, warum mir in seiner Gegenwart die simpelsten Dinge, über die ich mir normalerweise nie Gedanken machen würde, plötzlich total kompliziert vorkommen. Schließlich ist er nichts weiter als ein zufälliger Bewohner meines neuen Biotops!
Als ich mich wieder zu ihm umdrehe, hat er mir den Rücken zugekehrt und schenkt Kaffee ein. »Bitte schön.« Er stellt den Becher vor mich hin. »Milch oder Zucker?«
»Schwarz ist perfekt. Danke.«
Will stützt die Ellbogen auf die Theke und beobachtet mich, während ich den Kaffee trinke. Seine Augen sind genauso grün wie die seiner Mutter auf den Fotos. Also hat er doch auch etwas von ihr geerbt. Er lächelt mich an und wirft dann plötzlich einen Blick auf seine Armbanduhr.
»Oh. Ich muss los!«, sagt er. »Mein Bruder wartet im Auto. Er muss zur Schule und ich komme sonst auch zu spät. Ich bring dich noch schnell rüber. Nimm den Kaffee ruhig mit.«
Erst als ich nach dem Becher greife, bemerke ich den in fetten Lettern aufgedruckten Spruch: Weltbester Dad. Wir haben meinem Vater vor ein paar Jahren genau den gleichen geschenkt. »Du musst mich nicht rüberbringen«, sage ich auf dem Weg zur Tür. »Ich glaube, das mit dem aufrechten Gang hab ich inzwischen drauf.«
Er schnappt sich seine Jacke vom Sofa, bevor er mir die Haustür aufhält. »Dann nimm wenigstens die mit. Nicht dass du unterwegs erfrierst.«
Ich lege sie mir über die Schultern, bedanke mich noch mal für die Erste Hilfe und gehe dann zu uns rüber.
»Hey, Layken«, ruft er, als ich gerade die Haustür aufschließe. Ich drehe mich um und er steigt in den Wagen.
»Möge die Macht mit dir sein!« Er winkt mir lachend zu. Ich stehe einen Moment lang verdattert da, dann fällt mein Blick auf die Hausschuhe.
Na toll.
Der Kaffee hilft. Ich finde den Thermostat und bis zum Mittag hat sich das Haus endlich einigermaßen aufgewärmt. Mom ist mit Kel in die Stadt gefahren, um Strom und Wasser auf ihren Namen umzumelden und ein paar andere Sachen zu erledigen, während ich mich daranmache, die restlichen Kartons auszupacken. Nach ein paar Stunden beschließe ich, dass ich jetzt genug geschuftet und mir eine heiße Dusche verdient habe.
Als ich danach vor dem Badezimmerspiegel stehe und mir die Haare föhne, fällt mir auf, dass meine Texasbräune bereits zu verblassen beginnt. Aber vermutlich muss ich mich hier in Michigan sowieso an einen etwas helleren Teint gewöhnen.
Nach dem Föhnen binde ich mir die Haare zu einem Pferdeschwanz, trage eine Schicht Lipgloss auf und tusche mir die Wimpern. Auf Rouge kann ich getrost verzichten. Die Kälte und die Begegnungen mit Will werden vermutlich dafür sorgen, dass meine Wangen permanent gerötet bleiben.
Als ich fertig angezogen in die Küche komme, stelle ich fest, dass Mom und Kel in der Zwischenzeit kurz zu Hause gewesen sein müssen, aber offenbar schon wieder weg sind. Auf der Theke liegt eine Nachricht von Mom, in der sie schreibt, dass sie und Kel den Möbelwagen zum Autoverleih bringen und später von ihrer Freundin Brenda dort abgeholt werden. Neben meinem Autoschlüssel liegen drei Zwanzigdollarscheine und eine Einkaufsliste. Ich stecke das Geld und den Zettel ein und gehe über die vereiste Einfahrt vorsichtig zum Jeep, den ich diesmal unverletzt erreiche.
Erst als ich im Wagen sitze und den Rückwärtsgang einlege, wird mir klar, dass ich mich hier ja noch überhaupt nicht auskenne und nicht die geringste Ahnung habe, wo der nächste Supermarkt ist. Zum Glück steht Wills kleiner Bruder vor dem Haus, also halte ich neben ihm und lasse die Scheibe herunter.
»Hallo«, rufe ich. »Kann ich dich vielleicht kurz mal was fragen?«
Er sieht zu mir rüber und zögert – vielleicht hat er ja Angst, dass ich gleich wieder zum Zombie mutiere –, dann kommt er doch langsam auf den Wagen zu, bleibt aber in sicherer Entfernung stehen.
»Kannst du mir sagen, wo hier in der Nähe ein Supermarkt ist?«, frage ich.
Er sieht mich völlig entgeistert an. »Woher soll ich denn so was wissen? Ich bin doch erst neun.«
Nicht besonders hilfsbereit. Die Ähnlichkeit zwischen Will und ihm beschränkt sich anscheinend auf das Äußere.
»Okay, dann eben nicht«, sage ich. »Wie heißt du eigentlich?«
Er überlegt kurz, dann lacht er, ruft »Darth Vader!« und rennt weg.
Darth Vader? Erst mit einer Sekunde Verspätung begreife ich, dass er sich über die Hausschuhe lustig macht, die ich heute Morgen anhatte. Ob er und Will sich auf der Fahrt zur Schule über mich unterhalten haben? Ich würde zu gern wissen, was Will von mir denkt. Falls er überhaupt etwas über mich denkt. Ich jedenfalls denke – aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe – mehr über ihn nach, als mir lieb ist. Ich frage mich, wie alt er wohl ist, was er studiert … und ob er eine Freundin hat.
Zum Glück musste ich niemanden in Texas zurücklassen, sonst wäre der Umzug noch härter für mich geworden. Ich habe schon seit fast einem Jahr keinen Freund mehr. Neben der Schule, dem Job, mit dem ich mein Taschengeld aufgebessert habe, und Kel, um den ich mich in den letzten Monaten verstärkt gekümmert habe, war einfach keine Zeit für Jungs. Das wird vermutlich hier die größte Umstellung für mich. Früher wusste ich manchmal nicht, wo mir der Kopf steht vor lauter Stress, und hier werde ich bald so viel Zeit haben, dass ich wahrscheinlich nicht weiß, was ich damit anfangen soll.
Ich klappe das Handschuhfach auf und hole das Navi heraus.
»Das ist keine gute Idee«, höre ich eine Stimme, die mir mittlerweile schon vertraut ist.
Als ich aufschaue, sehe ich Will grinsend neben dem Jeep stehen. Ich versuche, mein Lächeln zu unterdrücken. »Was ist keine gute Idee?«, frage ich betont lässig, während ich das Navi in die Halterung einrasten lasse und anschalte.
Er verschränkt die Arme und bückt sich zu mir runter. »Hier in der Gegend wird zurzeit ganz schön viel gebaut. Mit dem Ding verfährst du dich garantiert.«
Ich will gerade etwas antworten, als ein Wagen neben mir hält. Am Steuer sitzt Brenda, die das Fenster herunterlässt. Meine Mutter beugt sich vom Beifahrersitz rüber. »Denkst du bitte auch an Waschmittel? Ich weiß nicht mehr, ob ich das auf die Liste geschrieben habe«, ruft sie. »Und Halsbonbons. Ich glaube, ich kriege eine Erkältung.«
Kel springt hinten aus dem Wagen, läuft auf seinen neuen Freund zu und fragt ihn aufgeregt, ob er sich unser Haus anschauen will.
Der Kleine sieht seinen großen Bruder an. »Darf ich?«
»Klar, Caulder. Kein Problem.« Will öffnet meine Beifahrertür und steigt ein. »Ich bin gleich wieder zurück. Ich zeige Layken nur schnell, wo der Supermarkt ist.«
Ach? Ich sehe ihn mit hochgezogenen Brauen an, während er sich anschnallt.
»Ich bin leider ein ganz mieser Wegbeschreiber«, erklärt er. »Hast du was dagegen, wenn ich einfach mitfahre?«
Lachend schüttle ich den Kopf.
Ich hupe Mom und Brenda, die schon in der Einfahrt stehen, zum Abschied kurz zu und folge dann Wills Anweisungen, mit denen er mich aus dem Wohngebiet lotst.
»Dein kleiner Bruder heißt also Caulder, ja?«, frage ich, um ein bisschen Small Talk zu machen.
»Ja, genau. Meine Eltern haben nach mir jahrelang versucht, noch mal ein Kind zu bekommen. Caulder wurde erst geboren, als Namen wie Will schon nicht mehr in Mode waren.«
»Mir gefällt dein Name«, sage ich und bereue es sofort, weil das wie ein lahmer Flirtversuch klingt.
Er lacht. Sein Lachen gefällt mir auch.
Als Will mir plötzlich die Haare zur Seite streicht und meinen Nacken berührt, zucke ich zusammen. »Darf ich?« Er schiebt die Finger unter den Ausschnitt meines T-Shirts und streift es über die Schulter ein Stück nach unten. »Oh. Das Pflaster ist nass geworden. Du brauchst bald ein neues.« Er zieht seine Hand wieder zurück und seine Berührung hinterlässt ein heißes Prickeln auf meiner Haut.
»Du kannst mich ja gleich daran erinnern, welche zu besorgen«, sage ich und versuche so gleichgültig zu wirken, als hätten seine Gegenwart und das, was er tut, keinerlei Wirkung auf mich.
»Okay, Layken …« Er wirft einen Blick auf die Kartons, die sich auf dem Rücksitz stapeln. »Dann erzähl mir doch mal was über dich.«
»Och, da gibt es nicht besonders viel zu erzählen«, weiche ich aus.
Er lacht. »Na gut. Dann mache ich mir eben selbst ein Bild von dir.« Er beugt sich vor und drückt auf die Ausgabetaste des CD-Players. Seine Bewegungen sind unglaublich fließend und geschmeidig. Ich beneide ihn darum. Anmut gehört nicht gerade zu meinen herausragenden Merkmalen.
»Der Musikgeschmack verrät normalerweise schon viel über einen Menschen.« Er nimmt die CD heraus und liest vor, was ich mit Marker draufgeschrieben habe. »Laykens Shit?«, fragt er grinsend. »Bezieht sich das auf die Qualität der Musik?«
»Es bezieht sich darauf, dass das meine CD ist und Kel gefälligst die Pfoten davon lassen soll.« Ich nehme sie ihm aus der Hand, lege sie wieder in den CD-Player und drücke auf Start.
Sobald das Banjo mit voller Lautstärke loslegt, werde ich verlegen. Ich komme zwar aus Texas, aber ich will auf keinen Fall, dass Will denkt, ich würde Country hören. Wenn es etwas gibt, das ich an Texas garantiert nicht vermissen werde, dann ist das Countrymusic. Als ich mich vorbeuge und die Lautstärke herunterdrehe, greift er nach meiner Hand und hält sie fest.
»Nein, mach wieder lauter. Den Song kenne ich«, sagt er, ohne mich loszulassen.
Meine Finger liegen immer noch auf dem Regler, also drehe ich lauter, obwohl ich mir sicher bin, dass Will blufft – er kann den Song nicht kennen. Ist das etwa ein Versuch, mit mir zu flirten?
»Ach ja?«, sage ich herausfordernd. »Wie heißt die Band denn?«
»Das sind die Avett Brothers«, antwortet er wie aus der Pistole geschossen. »Ich nenne den Song immer ›Gabriella‹, aber ich glaube, es ist einer aus ihrer ›Pretty Girl‹-Serie und er heißt in Wirklichkeit anders. Am krassesten ist der Schluss, wenn sie die E-Gitarren rausholen und so richtig abgehen.«
»Findest du die Avett Brothers denn gut?«, frage ich und bin völlig baff, dass er den Song tatsächlich kennt.
»Gut? Das sind verdammte Genies. Letztes Jahr haben sie in Detroit gespielt. Das war eines der besten Konzerte meines Lebens.«
Ich schaue auf seine Hand, die immer noch auf meiner liegt, und spüre, wie Adrenalin durch meinen Körper pulsiert. Das Gefühl ist toll und trotzdem wehre ich mich dagegen. Es ist nicht so, als hätte ich noch nie wegen eines Jungen Schmetterlinge im Bauch gehabt, aber normalerweise habe ich mich besser unter Kontrolle und reagiere nicht so heftig auf eine eigentlich unverfängliche Berührung.
Will bemerkt meinen Blick, nimmt seine Hand weg und reibt sich über den Oberschenkel. Ist das Nervosität? Ist er gerade genauso verwirrt wie ich?
Ich stehe nicht auf die übliche Mainstream-Musik und treffe dadurch selten auf Leute, die auch nur einen Bruchteil der Bands, die ich höre, überhaupt dem Namen nach kennen. Dass Will meine Lieblingsband kennt und sogar auf einem Konzert von ihnen war, haut mich ziemlich um.
Dad und ich sind früher oft lange wach geblieben und haben ihre Songs nachgesungen, während er versucht hat, die passenden Akkorde auf der Gitarre zu spielen. »Eine wirklich gute Band, Lake«, hat er mal gesagt, »erkennt man daran, dass es gerade das Unperfekte ist, was ihre Musik so perfekt macht.«
Der Spruch klang toll, aber was er bedeutet, habe ich erst verstanden, als ich anfing, den Avett Brothers richtig zuzuhören. Gerissene Banjo-Saiten, plötzliche Brüche in der Harmonie, Stimmen, die erst weich klingen, dann rauer werden und schließlich nur noch brüllen – das alles verleiht ihrer Musik Ausdruck, Tiefe und Glaubwürdigkeit.
Kurz nach Dads Tod hat Mom mir einen Umschlag mit zwei Karten für ein Konzert der Band gegeben. Dad hatte sie als vorgezogenes Geschenk zu meinem achtzehnten Geburtstag besorgt, sie mir aber nicht mehr selbst geben können. Als ich sie in den Händen hielt, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich genau wusste, wie sehr er sich darauf gefreut hatte, sie mir zu schenken. Er hätte bestimmt gewollt, dass ich trotzdem auf das Konzert gehe, aber das habe ich nicht über mich gebracht. Nicht ohne ihn.
»Die Avett Brothers sind meine absolute Lieblingsband«, sage ich und merke, dass meine Stimme dabei leicht zittert.
»Hast du sie schon mal live gesehen?«, fragt Will.
Es gibt manchmal diese einfachen Fragen, die man mit einem klaren Ja oder Nein beantworten könnte, aber stattdessen bricht plötzlich die ganze Geschichte aus einem heraus. Will hört aufmerksam zu und unterbricht mich nur, um mir zu sagen, wann ich abbiegen muss. Ich erzähle ihm von der Leidenschaft für Musik, die ich mit meinem Vater geteilt habe. Von seinem plötzlichen Herzinfarkt. Dass er mir die Karten hatte schenken wollen, ich es aber nicht geschafft habe, ohne ihn auf das Konzert zu gehen. Ich weiß selbst nicht, warum ich ihm mein Herz ausschütte. Normalerweise bin ich eher vorsichtig mit dem, was ich von mir preisgebe, besonders Leuten gegenüber, die ich kaum kenne. Besonders Jungs gegenüber, die ich kaum kenne. Ich rede immer noch, als ich bemerke, dass ich gerade auf den Parkplatz eines Supermarktes eingebogen bin.
Mein Blick fällt auf die Uhr – wir sind fast zwanzig Minuten unterwegs gewesen. »Puh«, sage ich. »Der nächste Supermarkt ist aber ganz schön weit weg.«
Will zwinkert mir zu und öffnet die Wagentür. »Es gibt auch noch einen schnelleren Weg.«
Okay, das ist definitiv ein Flirtversuch. Und ich habe definitiv Schmetterlinge im Bauch.
Mittlerweile hat es wieder angefangen zu schneien und wir rennen über den Parkplatz auf den Eingang zu, wobei Will nach meiner Hand greift, als wäre es das Normalste auf der Welt.
Als wir kurz darauf außer Atem und lachend im Supermarkt stehen und ich meine Jacke ausziehe, um den Schnee abzuschütteln, beugt Will sich vor und streicht mir eine feuchte Haarsträhne aus dem Gesicht. Seine Finger sind eisig, aber sobald ich sie auf meiner Haut spüre, durchflutet mich wohlige Wärme und ich vergesse die Kälte draußen. Wir sehen uns in die Augen und sein Blick wird plötzlich ernst. Wieder wundere ich mich darüber, dass selbst die winzigste Berührung von ihm eine so heftige Reaktion in mir hervorruft.
Ich räuspere mich, reiße den Blick von ihm los und greife nach einem herrenlosen Einkaufswagen. »Ist es eigentlich normal, dass es hier schon im September schneit?«, frage ich, darum bemüht, mir nicht anmerken zu lassen, wie durcheinander ich bin.
»Nein, aber der Schnee bleibt sicher nur ein paar Tage liegen. Normalerweise schneit es frühestens Ende Oktober«, antwortet er. »Du hast also Glück.«
»Glück?«
»Na ja. So ein früher Kälteeinbruch ist ziemlich selten. Ihr seid gerade zur richtigen Zeit hergezogen.«
»Ich hätte eigentlich gedacht, ihr hasst den Schnee, weil es hier so viel davon gibt. Schneit es bei euch nicht fast das ganze Jahr über?«
Er lacht.
»Was denn?«
»Nichts«, sagt er. »Ich finde es nur süß, was du für Vorstellungen von Michigan hast. Genau wie deinen Scarlett-O’Hara-Akzent. Du bist die erste leibhaftige Südstaatenschönheit, die ich kennenlerne.«
»Hört man mir wirklich so deutlich an, woher ich komme? Falls ja, werde ich mir in Zukunft Mühe geben, wie ein waschechter Yankee zu reden.«
Will schüttelt mit gespieltem Entsetzen den Kopf. »Bloß nicht. Ich finde deinen Akzent umwerfend.«
Ich schmelze förmlich dahin und kann gleichzeitig nicht fassen, dass ich mich tatsächlich in ein Mädchen verwandelt habe, das einen Typen anschmachtet, der ihr ein Kompliment nach dem anderen macht. Um mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, betrachte ich Will noch einmal genauer und versuche, irgendetwas an ihm zu entdecken, das mir nicht gefällt. Vergeblich. Soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, ist alles an ihm perfekt. Verdammt.
Will liest mir die Einkaufsliste vor, während wir an den Regalreihen vorbeigehen und ich die Sachen in den Wagen lege. Später an der Kasse besteht er – ganz Gentleman – darauf, die Waren aufs Band zu legen, sodass mir nichts anderes übrig bleibt, als untätig neben ihm zu stehen und ihm zuzusehen. Zuletzt nimmt er eine Schachtel Heftpflaster aus dem Wagen, von der ich gar nicht mitbekommen habe, dass er sie hineingetan hat.
Nachdem wir alle Tüten hinten im Jeep verstaut haben, dirigiert mich Will ganz anders, als wir vorhin hergekommen sind. Zwei Straßen weiter bekomme ich die Anweisung, rechts abzubiegen, und finde mich plötzlich in der Sackgasse wieder, die zu unserem Haus führt. Die Fahrt, für die wir vorhin fast zwanzig Minuten gebraucht haben, hat auf dem Rückweg gerade mal zwei Minuten gedauert.
»Das ging … schnell«, sage ich, als ich in unserer Einfahrt parke. Jetzt besteht wirklich gar kein Zweifel mehr daran, dass er mit mir flirtet.
Will grinst, steigt aus und geht um den Wagen herum. Ich drücke den Knopf, der die Heckklappe öffnet. Als ich kurz darauf zu ihm nach hinten komme, hat er die Klappe zwar aufgemacht, aber noch keine der Tüten herausgeholt.
Ich überspiele meine Verlegenheit mit einem Witz. »Ich bin Ihnen unendlich dankbar für Ihre großzügige Hilfe, Mister«, sage ich mit total übertriebenem Südstaatenakzent, lege eine Hand aufs Herz und reiße die Augen weit auf. »Ohne Sie hätte ich mich hier in der großen Stadt hoffnungslos verirrt und den Supermarkt niemals gefunden.«
Als er nicht lacht, sondern mich einfach nur ansieht, werde ich nervös.
»Was ist denn?«, frage ich.
Will tritt einen Schritt auf mich zu, legt den Zeigefinger unter mein Kinn und hebt meinen Kopf leicht an. Ich stehe einfach nur da und lasse es geschehen. Er betrachtet mich ein paar Sekunden lang forschend, während mein Herz wie wild gegen meine Rippen hämmert. Kann es sein, dass er mich jetzt gleich küsst?
Ich sehe zu ihm auf und versuche, ruhig zu atmen. Plötzlich lässt er seine Hand in meinen Nacken gleiten, zieht mich ein Stück zu sich heran und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Dann lässt er mich wieder los und tritt einen Schritt zurück.
»Sorry, das musste sein«, sagt er, obwohl er nicht so aussieht, als würde ihm irgendetwas leidtun. »Du bist einfach zu süß.« Damit dreht er sich um, greift beherzt vier Tüten auf einmal, geht auf unser Haus zu und stellt sie vor dem Eingang ab.
Ich stehe da wie gelähmt und versuche zu begreifen, was in den letzten fünfzehn Sekunden passiert ist und warum ich es zugelassen habe. Hätte ich nicht irgendetwas tun sollen? Aber trotz meiner Bedenken wird mir plötzlich klar, dass ich soeben den leidenschaftlichsten Kuss meines Lebens bekommen habe – auf die Stirn!
Will ist gerade zurück am Auto, um die nächste Fuhre auszuladen, da geht die Tür auf und Kel und Caulder stürmen an meiner Mutter vorbei nach draußen.
»Ich zeige Kel schnell mein Zimmer, okay?«, ruft Caulder uns zu.
»Geht klar«, sagt Will, dann streckt er meiner Mutter, die zu uns an den Wagen kommt, die Hand entgegen. »Sie müssen die Mutter von Layken und Kel sein. Ich heiße Will Cooper. Wir wohnen gegenüber.«
»Julia Cohen«, stellt sie sich vor. »Dann sind Sie also Caulders älterer Bruder?«
»Genau«, antwortet Will. »Zwölf Jahre älter.«
»Das heißt, Sie sind … einundzwanzig?« Sie zwinkert mir verstohlen zu. Weil ich hinter Will stehe und er mich nicht sehen kann, nutze ich die Gelegenheit, ihr einen der scharfen Blicke zuzuwerfen, die normalerweise ihre Spezialität sind. Aber sie lächelt bloß und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf Will. »Freut mich, dass Kel und Lake hier so schnell Anschluss gefunden haben«, sagt sie.
»Mich auch«, antwortet er.
Bevor Mom ins Haus zurückkehrt, nimmt sie eine Tüte aus dem Jeep und rempelt mich wie zufällig mit der Hüfte an, als sie an mir vorbeigeht. Auch wenn sie kein Wort sagt, weiß ich genau, was das bedeutet. Sie findet ihn nett.
»Lake. Das klingt schön.« Will holt die letzten beiden Tüten heraus, reicht sie mir und schlägt die Klappe zu.
Dann lehnt er sich gegen den Wagen und verschränkt die Arme vor der Brust. »Was ich dich fragen wollte, Lake … Caulder und ich müssen am Freitag nach Detroit und kommen erst Sonntagabend wieder zurück. Verwandtenbesuch.« Er zuckt mit den Achseln. »Falls du morgen Abend noch nichts vorhast, könnten wir vielleicht was zusammen machen.«
Es ist das erste Mal, dass mich jemand außerhalb meiner Familie »Lake« genannt hat. Und es gefällt mir. Ich lehne mich neben Will gegen den Wagen und sehe ihn an. Obwohl mein Inneres vor Aufregung vibriert, versuche ich cool zu bleiben.
»Willst du mich wirklich zwingen zuzugeben, dass ich hier noch keinen Menschen kenne und deswegen morgen Abend auch noch nichts vorhabe?«, frage ich grinsend.
»Perfekt! Dann haben wir also ein Date. Ich hol dich um halb acht ab.« Erst als er schon fast bei sich drüben angekommen ist, fällt mir plötzlich auf, dass er mich gar nicht gefragt hat, ob ich überhaupt Lust habe.
2.
It won’t take long for me to tell you who I am. Well you hear this voice right now, well that’s pretty much all I am.
– THE AVETT BROTHERS, »GIMMEAKISS«
Als ich am nächsten Nachmittag überlege, was ich anziehen soll, gerate ich kurz in Panik, weil ich nichts finde, das frisch gewaschen und dem Wetter angemessen ist. Ich besitze nun mal nicht viele wintertaugliche Oberteile und die wenigen, die ich habe, hatte ich auf der Fahrt alle schon an. Schließlich entdecke ich doch noch ein violettes langärmliges Shirt und sprühe ein paar Spritzer meines Lieblingsparfüms darauf. Anschließend putze ich mir die Zähne, schminke mich, putze mir noch mal die Zähne, ziehe das Gummi aus meinem Pferdeschwanz und sorge mithilfe des Glätteisens dafür, dass mir meine Haare seidig glänzend auf die Schulter fallen. Als ich gerade meine silbernen Kreolen aus dem Schmuckkästchen nehme, klopft es an der Badezimmertür.
Mom kommt mit einem Stapel Handtücher herein und verstaut sie im Schrank neben der Dusche.
»Gehst du heute noch irgendwohin?«, fragt sie und setzt sich auf den Badewannenrand.
»Das trifft es ziemlich auf den Punkt«, antworte ich und muss mich beherrschen, nicht zu breit zu grinsen, während ich eine der Kreolen in meinem rechten Ohrläppchen befestige. »Ich habe nämlich nicht die geringste Ahnung, wohin wir gehen. Um genau zu sein, habe ich diesem Date offiziell noch nicht mal zugestimmt, weil ich gar nicht richtig gefragt wurde. Es wurde sozusagen über meinen Kopf hinweg entschieden.«
Mom steht auf, geht zur Tür und lehnt sich gegen den Rahmen. Sie betrachtet mich im Spiegel und mir fällt wieder einmal auf, wie sie in der kurzen Zeit seit Dads Tod gealtert ist. Mit ihren hellgrünen Augen, den dunklen Haaren und dem Porzellanteint ist sie zwar immer noch eine schöne Frau, aber der Kummer und die Sorgen des letzten halben Jahres haben sie ihr Strahlen gekostet. Ihr Gesicht wirkt hagerer und sie hat dunkle Ringe unter den Augen. Sie sieht wahnsinnig müde aus. Und traurig.