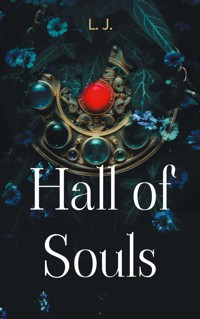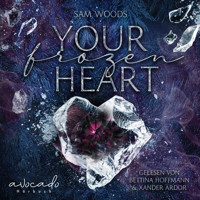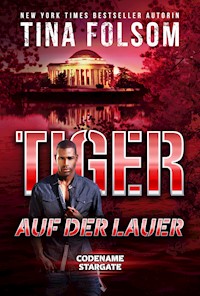0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das hatte Sevy sich anders vorgestellt! Leider hat der Vorbesitzer der einsam gelegenen Musen-Villa vergessen zu erwähnen, dass das von Sevy gekaufte Anwesen seit Jahren als Gefängnis für ein Sammelsurium an Zwergen, Pixies, Kobolden und anderen Wesen dient. Geisterwesen, welche es sich augenblicklich zur Lebensaufgabe machen, Sevy fürchterlich auf die Nerven zu gehen. Dabei hat er wesentlich drängendere Probleme, unter anderem in Form des hautlosen Pferdes Nuchelavee, welches nicht nur ihn, sondern auch die anderen Bewohner des Hauses bedroht.
-----
Ein in sich abgeschlossener, phantastischer Roman (Funtasy / Magischer Realismus) für Jugendliche und (jugendlich gebliebene) Erwachsene mit Freude an Phantastik, Folklore, Abenteuern und verschrobenen Fantasy-Wesen. Sechste, überarbeitete Auflage (2021).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die unglaublichen Erlebnisse des Sevy Lemmots
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitelseite
Die unglaublichen Erlebnisse des Sevy Lemmots
Yves Gorat Stommel
Danksagung
an Melanie, Noelle, Barbara und Klaus
für die (meist) konstruktive Kritik, die zu einem besseren Buch beigetragen hat.
Impressum
Die unglaublichen Erlebnisse des Sevy Lemmots
© Yves Gorat Stommel
2014
Vollständig überarbeitete Version 2022
ISBN-13 (Druckversion): 978-1505209501
Lektorat:
Anja Koda
Coverabbildung:
Daniel Lieske
Web:
www.yvesgoratstommel.com
Facebook:
www.facebook.com/yvesgoratstommelautor
Email:
Postanschrift:
Kibbelstraße 14, 45127 Essen, Deutschland
Lageplan
Kapitel 1: Die Villa
Heute war ein guter Tag!
Sevy Lemmots stieg aus seinem alten Chevrolet und nahm seinen Kauf in Augenschein. Sein Grinsen reichte von Ohr zu Ohr.
Vor ihm stand sein neues Zuhause. Eine Villa aus dem letzten Jahrhundert, umgeben von Feldern. Idyllisch. Ruhe ausstrahlend. Perfekt.
Sevy legte den Kopf schräg und schürzte die Lippen.
Nun gut, nicht wirklich perfekt. Um einige Ausbesserungsarbeiten würde er wohl nicht herumkommen. Unter anderem gab es eine größere Menge an Löchern zu stopfen. Fünfundneunzig, wenn er ganz genau war. Denn so viele Kugeln hatte der Vorbesitzer während einer Episode geistiger Umnachtung in die Wände geschossen. Glücklicherweise war Aldamor Frick allein gewesen, als er sein Haus unter Zuhilfenahme eines Gewehrs umdekorierte. Trotz der Abgeschiedenheit der Villa war seine Tat nicht unbemerkt geblieben, und kurz darauf musste Aldamor ausziehen. Die Regierung spendierte ihm eine weiße Zwangsjacke, freie Kost und Logis und ließ ihn sogar gratis abholen.
Aldamor Frick … Sevy konnte es kaum fassen, dass er vor dem ehemaligen Domizil des berühmten Mannes stand. Der Name war ein fester Begriff in der Kunstwelt. Ein Kunsttitan! Auch wenn er nun in der Irrenanstalt vermutlich mit Wasserfarben und Papier, anstatt mit Öl und Leinwand hantierte. Ein wahrhaft bemerkenswerter Verlauf eines kurzzeitig so erstaunlichen Lebens. Innerhalb weniger Monate war Frick zum neuen Star der Szene avanciert, innerhalb weniger Tage – so schien es – hatte er dann den Verstand verloren, was schließlich in der gebäudeweiten Lüftung resultierte.
Abschrecken konnte diese Vergangenheit des Hauses Sevy nicht.
»Ein Unikat!«, freute er sich, verriegelte dann die Fahrertür seines 82er-Chevrolets und ging auf das Haus zu.
Links, rechts und hinter der Villa breiteten sich Felder aus, in größerer Entfernung hier und da unterbrochen von kleinen Kiefer- und Pappel-Ansammlungen. Die vereinsamte Landstraße lag auch jetzt komplett verlassen da. Wenn am Tag zwanzig Autos hier vorbeifuhren, wies das bereits auf Umgehungsverkehr infolge eines Unfalls auf der Hauptstraße hin.
Sevy zögerte den Moment des ersten Betretens hinaus und schlenderte stattdessen gemächlich auf das Haus zu. Es war eigentlich viel zu groß für einen einzigen Bewohner. Aber schon seit der Errichtung des neo-gotisch angehauchten Prunkstücks durch einen gewissen Alfons Herder hatte nie mehr als eine Person hier gelebt.
Von einem nahezu quadratischen Grundriss aus erhob sich das Gebäude etwa neun Meter bis zum Dachfirst. Auf den ersten Blick handelte es sich um einen düsteren, unheimlichen Bau. Doch Sevy sah die Villa mit ganz anderen Augen.
»Die Musen-Villa«, murmelte er. »Meine Musen-Villa.«
Der Spitzname haftete dem Bauwerk seit Jahren an. Der Makler dagegen hatte von einer geschichtsträchtigen und soliden Investition gesprochen. Aber Sevy war natürlich das unter der Hand weitergegebene Versprechen an die Bewohner der Musen-Villa nicht unbekannt. Ein Versprechen, das auf eine strahlende Zukunft hoffen ließ. Man mochte dem Aberglauben zusprechen oder auch nicht, aber es war unbestritten, dass gleich drei Künstler kurz nach ihrem Einzug in das Haus zu Weltruhm gelangten.
Nur wenige Wochen ohne Bewohner hatten gereicht, um dem Haus das Aussehen einer Geistervilla zu verleihen. Der Rasen wucherte wild und das über die Haustür geklebte rot-weiße Polizeiband flatterte unheimlich im Wind. Und dann war da noch die Stille. Diese unheimliche Stille. Nicht einmal Vögel hielten sich in der Nähe der Villa auf. Es gab einfach keine Bäume, auf denen sie sich hätten niederlassen können.
Sevy sah hinauf zu dem schwarz geschindelten Dach. Auch dieses wurde von den Vögeln verschmäht.
Hinter dem Anwesen passierte er einen kleinen Bau. Nie vervollständigt, schauten aus dem grauen Kubus eine Vielzahl verrosteter Armierungsstangen hervor. Am besten, er würde den unfertigen Schuppen abreißen lassen.
Zurück auf der Vorderseite näherte Sevy sich nun der mittig angebrachten, schweren Eichenholztür. Es knarzte laut, als sie widerwillig den Weg in das Hausinnere frei gab. Für Sevy war es das erste Mal, dass er die Villa betrat. Er hatte das Anwesen gekauft, ohne je einen Fuß hineingesetzt zu haben. Das Gebäude war viel zu berühmt, als dass er nach dem Lesen der Zeitungsanzeige nicht sofort nach dem Telefon gegriffen hätte. Eine solche Chance hatte er nicht durch Zögern ungenutzt verstreichen lassen können.
Die kleine Eingangshalle war im Großen und Ganzen leer. Einzig eine einfache Kommode hatte die Umzugsfirma übersehen – oder absichtlich vergessen? Staub lag fingerdick überall dort, wo … nun, fast überall. Lediglich einige freigetretene Pfade zogen sich von dem Eingang zu dem Treppenhaus, beziehungsweise zu den insgesamt drei abgehenden Türen.
Nein, es waren vier, stellte er direkt darauf fest. Die letzte lag rechts von ihm unter der Treppe. Diese nahm ihren Ursprung mittig im Haus und führte dann zur Vorderfront des Hauses hin in das Obergeschoss. Der darunter liegende Durchgang führte in den Keller, wie Sevy mit einem kurzen Blick feststellte. Er würde ihn später inspizieren. Auch das Obergeschoss hob er sich für später auf. Allerdings warf er schon jetzt einen neugierigen Blick die steile Treppe hinauf, die von einem Geländer aus dunklem Holz flankiert wurde. Überhaupt schien so gut wie alles im Eingangsbereich aus Holz gefertigt oder, im Falle der Wände, zumindest damit vertäfelt zu sein.
Sevy legte die Schlüssel auf der Kommode ab, erste Fingerabdrücke in der unbefleckten Staubschicht hinterlassend. Dann begab er sich auf eine Erkundungstour des Erdgeschosses.
Die rechte Tür führte in das Wohnzimmer, das ohne Möbel einen eher ungemütlichen Eindruck machte. Wie der Makler ihm erzählt hatte, war das Erdgeschoss zu Aldamor Fricks Zeit mehr oder weniger ungenutzt gewesen. Der Künstler hatte sich in das Obergeschoss zurückgezogen. Lediglich die im Erdgeschoss gelegene Küche wurde hin und wieder benutzt.
Sevy machte sich auf den Weg zu eben jener Küche. Wie das Wohnzimmer lag sie in der vorderen Hälfte des Hauses und war über die linke Tür des Flurs erreichbar.
Sevy kreuzte die Finger. Hoffentlich funktionierten die wesentlichen Küchengeräte nach der Schießerei noch, denn Geld für größere Ersatzkäufe blieb ihm nicht.
Er hatte den Flur bereits fast durchquert, als er innehielt. Verwundert schaute er zu der Kommode und klopfte seine Hosentaschen ab. Schon wollte er in das Wohnzimmer zurückkehren, zögerte aber. Er war sich sicher: Seine Schlüssel hatte er auf die Kommode gelegt. Nur, dass sie dort nicht mehr waren.
Er warf einen Blick unter das Möbelstück. Nichts. Mal abgesehen von Staub.
Aufgrund seiner Größe war der Schlüsselbund eigentlich kaum zu übersehen. Das damit verbundene Gewicht war gleichzeitig der Grund dafür, dass Sevy ihn ungerne mit sich herum trug.
Einen Moment lang ging Sevy in sich, rekonstruierte gedanklich die letzten paar Minuten. Zugegebenermaßen war er oft etwas vergesslich und nicht ganz bei der Sache. Hatte er sie vielleicht doch …? Auf das Gründlichste durchsuchte er seine Taschen, öffnete aus purer Verzweiflung sogar die einzige Schublade der Kommode – und riss die Augen auf.
Da waren sie!
Kopfschüttelnd nahm er den Bund heraus.
»Weniger Haus der Musen, sondern eher Haus der Vergesslichkeit«, murmelte er. Er beschloss, die Zweifel an seiner geistigen Verfassung zu ignorieren, genoss dafür den kurzen Schub der Erleichterung und trat in die Küche.
Der Raum war hell: Fenster in den zwei Außenmauern ließen Licht herein. In direkter Nähe zur Tür, durch die er die Küche betreten hatte, führte eine weitere, um neunzig Grad versetzt, in den letzten Raum des Erdgeschosses. Er zog sich über die gesamte Rückseite des Hauses und war wie das Wohnzimmer vollkommen leer: der sogenannte Salon.
»So viel Platz«, sagte er in die Stille hinein und kehrte beunruhigt, da seine Gedanken zu der winterlichen Heizrechnung wanderten, in die Küche zurück.
Auch hier befanden sich kaum Möbel. Außer einem Tisch und zwei Stühlen stellte lediglich der gelbe Kochtrakt einen Blickfang dar; er wurde durch eine Trennwand auf Brusthöhe (ihm drängte sich das Wort Bar auf) von dem Rest des Raumes abgetrennt.
Die Anzahl der Einschusslöcher war hier an einer Hand abzuzählen. Insgesamt schienen der Raum und dessen Inventar in guter Verfassung zu sein. Der Kühlschrank summte leise vor sich hin, die Mikrowelle zeigte die (falsche) Zeit an. Sevy legte die Schlüssel auf den Tisch und öffnete dann die Schränke. Sie waren allesamt leer.
Zufrieden sah er sich um. Er konnte es kaum erwarten, einzuziehen. Einige kleinere Leinwände, ein paar Tuben Ölfarbe, eine Matratze mit Bettzeug und einen Koffer mit Kleidung hatte er bereits mitgebracht. Theoretisch konnte er gleich anfangen zu malen und die legendäre, stimulierende Wirkung des Hauses testen, wäre da nicht das Verpflegungsproblem. Am besten war es sicherlich, er fuhr kurz in die Stadt, um sich mit einigen Nahrungseinkäufen schon heute notdürftig in seinem neuen Zuhause und Atelier einrichten zu können.
Voller Vorfreude warf Sevy einen letzten Blick aus dem Fenster, wandte sich zum Gehen – und stockte.
»Hey!«
Über die Trennwand hinweg sah er direkt auf den kleinen Esstisch, auf dem er seine Schlüssel abgelegt hatte. Sie schwebten nun einige Zentimeter über der Tischplatte – gehalten von einer schmalen, knochigen Hand. Mehr war von der diebischen Person nicht zu sehen.
Schnell ging Sevy um den Tisch herum und näherte sich dem Eindringling, der erst jetzt vollständig ins Blickfeld rückte.
Mitten in der Bewegung hatte die kleine Gestalt innegehalten. Langsam wandte sie Sevy den Kopf zu, ein schuldbewusstes Lächeln auf den spröden Lippen. Der Körper war schmal und in ein weites, braunes Gewand gekleidet, das an der Taille mit einer Kordel zusammengehalten wurde. Im Vergleich zu der Statur – das Wesen mochte höchstens einen Meter groß sein – wirkte der Kopf geradezu riesig. Dessen Form war darüber hinaus mehr breit als hoch, und die flache Stirn sowie das fliehende Kinn gaben dem Wesen ein eher kindliches Aussehen. In der Tat mochte man den verhinderten Dieb auf den ersten Blick für einen Drei- oder Vierjährigen halten, doch schon der zweite belehrte einen eines Besseren: Kinder waren in aller Regel nicht kahl und verfügten außerdem nicht über eine derart gedeihende Nasenhaarpracht.
Das ungewohnte Äußere verunsicherte Sevy, doch die Verärgerung über den versuchten Diebstahl gewann die Oberhand.
»Was soll denn das werden?«
»Uhm … Schlüssel?« Die Tonlage der Stimme passte zu einem zehnjährigen Jungen, aber die Intonation deutete eher auf einen Erwachsenen. Noch immer verharrte das Wesen in seiner Stellung, dabei das Bündel in der Hand über dem Kopf haltend.
»Meine Schlüssel«, spezifizierte Sevy. »Hast du sie vorhin auch schon genommen? In der Vorhalle?«
Stolz nickte das Wesen.
»Super-Leistung«, höhnte Sevy.
»Danke.« Das Wesen entspannte sich angesichts des vermeintlichen Lobes und steckte den Schlüsselbund ein.
»Hey! Die hätte ich gerne wieder!«
Mit großen Augen sah die Gestalt ihn an. »Was?«
»Die Schlüssel.«
»Welche Schlüssel?«
»Die in deiner Tasche!« Allmählich verlor er die Geduld.
»Welche Tasche?«
»Die Tasche in deinem …«
Das Wesen lachte, hielt sich prustend die Hand vor den Mund. Die langgliedrigen Finger verdeckten fast die Hälfte des Gesichtes. »War nur ein Scherz!«
Sevy biss die Zähne aufeinander. »Was willst du überhaupt damit?«
Die fröhliche Miene fiel in sich zusammen. »Womit?«
Entnervt schloss der Künstler einen Moment lang die Augen. »Mit … meinen … Schüsseln.«
Die Frage schien kompliziert. Ein Ausdruck der Verwunderung schlich sich auf das Gesicht des Wesens, nachdenklich schaute es auf den wieder hervorgeholten Bund. »Nun …«, meinte es, sich auf die Lippen beißend. »Nun …« Es sah sich um und die Augen wanderten zu den beiden Türen. Offensichtlich suchte es nach einem Fluchtweg. »Uhm … Tja …« Langsam tat es einen Schritt nach hinten, fort von Sevy.
»Her mit den Schlüsseln!«, befahl Sevy und riss den Bund aus den schmalen Fingern.
»Nicht fair!«, beklagte sich die Gestalt. »Das war nicht nett!«
»… beschwerte sich der Dieb«, murmelte Sevy und steckte die Schlüssel tief in seine Hosentasche. Als Demonstration seiner Überlegenheit schlug er zweimal von draußen darauf und schenkte dem Kleinwüchsigen ein überlegenes Grinsen.
Dann widmete er sich der Tatsache, dass ihm sowohl die Anwesenheit als auch die Gestalt seines Besuchers zu denken geben sollten.
»Wer bist du überhaupt?«
»Laval.«
Mitleidig verzog Sevy den Mund. »Alternative Eltern, was? Flower-Power-Einstellung? Jeder ist einzigartig und solch ähnliches Gedankengut?«
»Äh …«
»Vergiss es«, ersparte er Laval die Antwort. »Was tust du hier? Und wie bist du hereingekommen?«
»Also …« Laval hob die linke Hand und griff mit der rechten nach seinem Zeigefinger. »Ich bin hier, um deine Schlüssel zu verlegen.« Nachdenklich streckte er einen zweiten Finger – und Sevy stellte verwundert fest, dass Laval nur drei davon hatte.
»Und ich komme aus dem Wohnzimmer. Zu Fuß.«
Stolz auf seine Ausführungen sah er auf und zeigte an Sevy vorbei. »Das ist dort!«
»Das war ja erstaunlich informationsfrei«, erwiderte Sevy. Er sah Laval forschend an. »Machst du das eigentlich absichtlich?«
»Was?«
»Überflüssige Fragen stellen und inhaltslose Antworten geben. Mich damit in den Wahnsinn treiben.«
»Du bist wahnsinnig?« Alarmiert wich Laval ein Schritt zurück.
»Nein, bin ich nicht.« Sevy seufzte. »Also, versuchen wir es noch mal: Wie bist du in dieses Haus gekommen?« Er fügte hinzu: »Und damit meine ich nicht durch die Haustür.«
Ein quietschendes Geräusch ließ Sevy herumfahren, Laval damit mehr Bedenkzeit verschaffend. Ein schmaler Streifen Licht fiel aus dem Kühlschrank, der sich etwa einen Zentimeter weit geöffnet hatte. Schon hatte Sevy ihn erreicht, schloss ihn und rüttelte ein-, zweimal daran, um sicher zu stellen, dass er wirklich geschlossen war.
»Nun«, wandte er sich wieder an Laval, »Du wolltest mir …«
Mit Wucht schlug Sevy gegen die Kühlschranktür, als diese sich erneut öffnete. »Memo an mich …«, murmelte er, »Tesafilm kaufen.«
Dann bemerkte er den Druck, der von der Kühlschranktür ausging – und er hörte die wütenden Schreie, die durch die Isolierung drangen.
Erstaunt wich er zurück, als die Tür aufschwang. Der Kühlschrank war leer – bis auf eine verschrobene Gestalt. Sie war noch etwas kleiner als Laval, doch von genauso merkwürdigem Aussehen. Böse funkelte das Wesen Sevy an, auch wenn es dafür den Kopf schmerzhaft verdrehen musste. Aus irgendeinem Grund hatte es sich zwischen dem mittleren und dem oberen der Roste gezwängt. Die in einer schmutzigen Hose aus Jute steckenden Beine waren unnatürlich angewinkelt.
»Was soll das?«, wollte das Wesen wissen. »Soll ich erfrieren? Mir ist kalt!«
Sevy brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, bis er sich gefangen hatte: »Dann ist ein Kühlschrank wohl kaum der richtige Aufenthaltsort für dich. Raus da!«
»Wie kannst du es wagen …«, begann die Gestalt, hob dann erstaunt die Augenbrauen. »Hey … rauskommen! Gar nicht mal so dumm …« Einen Moment lang schien das Wesen den Vorschlag ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dann schüttelte es den Kopf und meinte: »Mein Fehler: War doch eine blöde Idee.« Wie selbstverständlich lehnte es sich wieder zurück und fing zufrieden an zu summen.
Sevy sah sich verdutzt nach Laval um. »Also … bei dir war ich mir schon nicht so sicher, aber der da …«
»Knut«, unterbrach ihn Laval.
»Von mir aus …« Er zögerte. »Knut ist kein Kind, oder?«
Laval schüttelte den Kopf. »Schon seit knapp dreihundert Jahren nicht mehr.«
»Richtig«, murmelte Sevy. »Natürlich. Denn ihr seid …?«
»Kobolde?«, erwiderte Laval unsicher. Die Frage schien ihn zu überfordern.
»Kobolde …« Sevy blähte die Wangen auf, ließ die Luft laut entweichen. »Kein Wunder, dass die Villa so billig war. Schon nach fünf Minuten gibt das Hirn nach. Ob es hier irgendwelche giftigen Dämpfe gibt?«
Er öffnete die Fenster, atmete tief die frische Luft ein, alldieweil interessiert von Laval beobachtet. Knut pfiff inzwischen weiter vor sich hin. Sevy glaubte Marmor, Stein und Eisen bricht zu erkennen.
Schließlich schüttelte der neue Hausbesitzer den Kopf.
»Nein, daran scheint’s nicht zu liegen. Bleiben die Möglichkeiten Traum, Schlaganfall … oder ihr seid tatsächlich echt.«
Der letzte Teil des Satzes war an Laval gerichtet, der angesichts Sevys abwartendem Blick nun verunsichert an sich herunterschaute. »Echt?«, schlug er dann zweifelnd vor.
»Echt …« Sevy dachte an den mittlerweile in einer Irrenanstalt lebenden Vorbesitzer des Hauses. Ob es einen Zusammenhang zwischen seinem Nervenzusammenbruch und den Kobolden gab?
»Kennt ihr Aldamor Frick?«
»Hm«, bejahte Laval. »Unangenehmer Typ. Hat nie seine Schlüssel abgelegt.«
Konnte es sein? War dies eines der Dinge, welche die Villa besonders machten? Waren die beiden Kobolde tatsächlich echt? Oder ging seine Fantasie mit ihm durch? Es wäre nicht das erste Mal … In seiner Jugend hatte er imaginäre Freunde gehabt, später wurden daraus imaginäre Freundinnen (traurig, aber wahr). Außerdem schwor Sevy jedem, der es hören wollte, hoch und heilig, dass er tatsächlich einst ein Gespräch mit seinem Hamster geführt hatte (allerdings hatte er damals recht viel getrunken (Sevy, nicht der Hamster)).
Er schüttelte den Kopf. Die genaue Herkunft seiner Besucher spielte momentan keine Rolle. Fantasiegebilde, Irre, hässliche Kinder, Kleinwüchsige oder tatsächlich Kobolde: Er würde damit fertig werden.
Unvermittelt schlug er sich forsch auf die Hosentasche.
Beleidigt zog Laval die Hand zurück. »Aua!«
»Meine Schlüssel«, betonte Sevy. »Und wo wir schon dabei sind: mein Haus! Ich fahre jetzt in die Stadt, und wenn ich zurückkomme, will ich stark hoffen, dass ihr verschwunden seid. Sonst muss ich andere Saiten aufziehen!«
Laval nickte. »Sicher, kein Problem. Dein Haus, deine Schlüssel.« Er schien geknickt, doch dann leuchtete sein Gesicht auf. »Ich kümmere mich um Knut!«
Mit einem kritischen Blick auf den Kühlschrank verließ Sevy sein neues Zuhause und fuhr in die Stadt.
Kapitel 2: Das Gefängnis
Bereits aus über einem Kilometer Entfernung ließen die offenen Felder hin und wieder einen ungehinderten Blick auf die Villa zu: ein isolierter, dem langsamen Verfall ausgelieferter Bau. Tatsächlich konnte Sevy bei diesem Anblick nachvollziehen, weswegen es keinen Biete-Wettkampf um das Anwesen gegeben hatte. Der Makler hatte fast erleichtert gewirkt, als Sevy sich bei ihm meldete.
Dreißig Kilometer von der nächsten Stadt entfernt und zwanzig bis zum nächsten Nachbarn – Einsamkeit war nicht jedermanns Sache. Doch für ihn als Künstler gab es kaum einen besseren Ort, um sich schaffend zu betätigen. Dies hatte die Musen-Villa längst bewiesen. Drei Besitzer hatte sie in den letzten vier Jahren beherbergt: Drei renommierte Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Den Anfang hatte der Filmmusik-Komponist Ludovico Ernst gemacht. Sein Nachfolger war der begnadete Autor Machius Schrift gewesen. Und bis vor Kurzem hatte natürlich Aldamor Frick, der europaweit bekannte Maler, in dem Anwesen gelebt. Wobei der geistige Absturz des Malers seinem Ruhm nicht abträglich gewesen war. Genialität und Wahnsinn waren in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit bekanntlich zwei Seiten derselben Medaille, und so konnte der mentale Ausraster mit dem notwendigen Wohlwollen als ein Ausbruch der Inspiration ausgelegt werden. Außerdem würden in absehbarer Zeit keine neuen Bilder von ihm auf den Markt kommen, was wiederum die Preise anheizen würde. Im übertragenen Sinne galt dies übrigens auch für die beiden anderen Vorbesitzer: Ihre schaffende Lebensphase schien mit dem Auszug ebenso abgeschlossen. Ludovico Ernst hatte das Haus eines Tages einfach verlassen und sich auf der Couch seines Psychiaters einquartiert. Er war dort sehr, sehr lange geblieben. Machius Schrift neigte, wie Aldamor Frick, mehr zur radikalen Variante und hatte versucht, die Villa niederzubrennen. Erstaunlicherweise war ihm dies nicht gelungen, da nach seiner verwirrten Aussage alle seine Streichhölzer nass, und sämtliche Feuerzeuge leer gewesen waren. Als Schrift sich in der Stadt einen Flammenwerfer zulegen wollte, hatte die Polizei ihn schließlich verhaftet. Wo der Schriftsteller heute weilte, wusste Sevy nicht.
Die Sonne berührte bereits den Horizont, als Sevy das Auto parkte und mit den Armen voller Lebensmittel auf die Villa zuging. Er hatte nicht abgeschlossen, um Laval und Knut einen ungestörten Abzug zu ermöglichen, und so stieß er die Tür mit dem Fuß auf.
Im ersten Moment übersah er die roten Flecken, die im Flur die dunklen Dielen schmückten. Auch ignorierte er anfänglich die arg roten Lippen Lavals, als dieser ihm aufgeregt aus der Küche entgegenkam.
»Habe ich nicht gesagt …«, begann Sevy, bevor sich seine Augen weiteten. »Ist das …? Nein!«
»Was?«, fragte Laval, doch Sevy drängte sich bereits an ihm vorbei in die Küche und sah seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt.
Der Küchentisch schien das Opfer einer Farbenexplosion geworden zu sein. Jede einzelne seiner Farbtuben war geöffnet worden, und in großen, grünen Lettern ließ sich Knut und Laval waren hier! auf den Fliesen lesen.
»Schmeckt irgendwie komisch«, meinte Laval, auf seine angemalten Lippen deutend. Er war Sevy gefolgt und erkannte die Anzeichen eines drohenden Wutausbruchs anscheinend noch nicht.
»Vermutlich, weil es kein Lippenstift ist«, presste Sevy zwischen den Zähnen hervor.
»Ach so?« Der Kobold produzierte einige schmatzende Laute, fragte dann: »Sicher?«
»Was genau hast du nicht verstanden, als ich sagte: Verschwindet aus meinem Haus?«
Verbissen arbeitete Sevy daran, seinen rasenden Puls unter Kontrolle zu bekommen. Er presste die Hände zu Fäusten, in einem Versuch, die Aggressivität zu kanalisieren.
»Uhm … alles?« Als sich Sevys Miene tatsächlich noch weiter verfinsterte, korrigierte Laval sich schnell: »Nichts?«
»Raus!«, fuhr Sevy ihn an.
»Raus aus der Küche?«
»Raus aus meinem Haus!«
Zum ersten Mal zeigte sich Entschlossenheit in Lavals breitem Gesicht. »Geht nicht.«
»Sicher geht das!«, widersprach Sevy. »Knut! Du auch!«
Die Kühlschranktür wurde aufgestoßen und Knut schaute ihn mit einem breiten Grinsen an. Seine Zähne waren weiß. Strahlend weiß.
Ein Blick auf den Boden bestätigte Sevys Vermutung: Dort lag die nur noch halb volle Tube mit weißer Ölfarbe.
»Raus hier, beide!«, wiederholte Sevy.
Widerwillig gehorchten die Kobolde dieses Mal und folgten ihm in den Flur – dort blieben sie jedoch stehen. Laval verharrte wenige Meter von der Haustür entfernt, während Knut sich im Hintergrund hielt und alle paar Sekunden mit dem Finger testete, ob die Farbe auf seinen Zähnen schon ausgehärtet war.
»Seid froh, dass ich keinen Schadensersatz von euch verlange!«, drohte Sevy. »Ich will euch hier nie wieder sehen, verstanden?«
Schweigend sahen die beiden Kobolde ihn aus großen, grünen Augen an.
»Was wollt ihr noch?«
»Wir können nicht raus«, meinte Laval ernst. »Wir wissen nicht, wie.«
»Was ist daran so schwer?« Ungestüm öffnete Sevy die Tür und tat zwei Schritte hinaus. »Hier, so einfach! Draußen …« Er trat wieder hinein. »Drinnen. Ihr draußen, ich drinnen!«
Laval tippte nachdenklich mit einem Finger an sein Kinn, die ultimative Denkerpose einnehmend. Er ging einen Schritt vor. Noch etwa ein Meter trennte ihn von der Schwelle. »Wie war das? Noch ein letztes Mal, bitte.«
»Mein Gott!«, murmelte Sevy, um geistigen Halt ringend. Er machte einen großen Sprung vor die Tür. »Draußen … und …«
Laval schloss die Tür und schob den Riegel vor.
Etwa fünfzehn Minuten hatte Sevy gebraucht, um sich einigermaßen zu beruhigen. Den Kopf aufgestützt, saß er auf der Schwelle seines Hauses und beobachtete mit finsterer Miene den Sonnenuntergang. Eine Strähne seines fast schwarzen Haares fiel ihm in die Augen und ein Dreitagebart umrahmte sein Gesicht – so, wie es sich für jeden ernsthaften Künstler gehörte.
Verdutzt hatte er auf die Tür gestarrt, als diese ins Schloss gefallen war. Die Verwirrung war schnell der Wut gewichen: Lauthals hatte er seinem Ärger Luft gemacht. Doch sowohl Laval als auch Knut hatten kein einziges Wort mehr an ihn gerichtet. Erst als Sevy feststellte, dass er seine Stimmbänder sinnlos belastete, hatte er sein Geschrei eingestellt.
»Und?«, fragte nun eine Stimme durch den Briefkastenschlitz.
»Und was?«
»Willst du wieder rein?«
»Nein, ich verbringe bevorzugt die Nacht draußen. Vor allem, wenn ich von Eindringlingen aus meinem eigenen Haus ausgesperrt werde.«
»Draußen schlafen ist aber keine gute Idee«, gab Laval zu bedenken.
»Sag bloß.«
Beide verstummten.
»Wenn du mir zuhörst, dann lasse ich dich danach rein«, schlug Laval vor.
Zuerst wollte Sevy sich weigern, doch was hatte er zu verlieren? Tatsächlich wurde es langsam kühl, und er konnte nicht mal zurück in die Stadt fahren, da sich sein Schlüsselbund zusammen mit seinen Einkäufen in der Küche befand. Vermutlich hatte Laval sie längst ‚verlegt‘. Missmutig schüttelte Sevy den Kopf über seine eigene Dummheit.
»Erzähle.«
Laval räusperte sich. »Für uns Geisterwesen ist die Villa wie ein Gefängnis. Wir können das Haus nicht verlassen, können nicht durch die Tür hinaus.«
»Dann springt aus dem Fenster«, schlug Sevy vor.
»Darf ich weitererzählen?«, empörte sich Laval. »Danke. Also, wir können nicht raus. Egal, ob Kobold, Pixie, Leprechaun, Zwerg oder Heinzelmännchen: Kein Geisterwesen, das erst mal in der Villa ist, kann wieder hinaus.«
»Tatsächlich?«, fragte Sevy, dabei darauf achtend, dass pures Desinteresse im Tonfall mitschwang.
»Ja!«, erwiderte Laval, der die Rückfrage als ehrliche Anteilnahme fehlinterpretierte. »Der Grund ist, dass vor etwa achtzig Jahren der persönliche Schutzgeist von Alfons Herder vor einer Troll-Übermacht fliehen musste.«
»Aha.«
»Das sind böse Geisterwesen, weißt du.«
»Hm.«
»Und Alfons Herder hat das Haus gebaut.«
»Interessant.«
»Nun, nicht selbst natürlich, aber er hat es bezahlt.«
»Klar.« Mit einem größeren Stein zeichnete Sevy eine kleine Gestalt, nicht unähnlich einem gewissen Kobold, in den Kies. Er versah den Hals mit einer Schlinge und fügte auch das weitere Zubehör eines Galgens hinzu. Seine Stimmung besserte sich schlagartig, und er kicherte leise.
»Also: Irving, der Schutzgeist von Alfons Herder, hatte die Intelligenz eine Gruppe von Trollen beleidigt«, fuhr Laval fort. »Und zwar so ungeschickt, dass die Trolle die Beleidigung auch mitbekamen. Daher wollten sie ihm eine Abreibung verpassen, was Irving wohl nicht toll fand. Und da er gegen so viele Trolle kaum anstinken konnte, sprach er eine Beschwörung aus, sobald er durch die Haustür gerannt war. Damit wurde das Haus undurchlässig für böse Geisterwesen. Sie konnten nicht hinein. Und Irving war sicher.«
»Solange er nicht aus dem Haus ging«, gab Sevy zu bedenken.
»Genau da liegt das Problem«, erwiderte Laval. »Denn leider war er nicht sehr gut in Zaubersprüchen.«
»Warum bin ich nicht überrascht?«, murmelte Sevy.
»Zwar können die bösen Geisterwesen nun nicht mehr herein – außer der Hausbesitzer lädt sie explizit dazu ein –, aber dafür können …«
»Moment«, unterbrach Sevy den Kobold. »Mit Einladung können die bösen Geisterwesen trotzdem herein?«
»Das habe ich doch gerade gesagt«, erklärte Laval ungeduldig. »Du musst mir schon zuhören!«
»Aber nur, wenn ich sie einlade?«
»Ja-ha! Aber so dumm wirst du ja wohl nicht sein. Oder?« Er pausierte, doch Sevy sprang nicht auf die implizite Herausforderung an. »Wobei das gar nicht das eigentliche Problem ist. Viel schlimmer ist, dass gute Geisterwesen, die einmal die Villa betreten haben, sie nicht mehr verlassen können. Sie sind hier gefangen. Ich bin hier gefangen. Wir, also die guten Geisterweisen, können einfach hinein und brauchen keine Einladung.«
»Du willst mir nicht ernsthaft erzählen, dass du zu den als ‚gut‘ eingestuften Exemplaren eurer Sippe gehörst«, warf Sevy ein. »Du klaust dauernd meine Sachen, sperrst mich aus und machst einen Sauhaufen aus meinem Haus.«
»Das ist mein Job«, erwiderte Laval gekränkt. »Ich bin dafür verantwortlich! Das machen wir Schlüsselgeister halt so: Wir verlegen die Schlüssel. Die Menschen verzweifeln dann und wundern sich über ihre eigene Dummheit.«
»Toller Job. Leider hast du zwei Dinge übersehen.«
»Was?« Wirkliches Interesse sprach aus Lavals Tonfall.
Sevy drehte sich um und sah die großen, grünen Augen durch den Briefschlitz schielen. »Erstens sollte man dich nicht bemerken, wenn du die Schlüssel stiehlst! Da hat bei dir wohl die Ausbildung versagt.«
Laval verengte die Augen.
»Zweitens verlegt kein Mensch innerhalb von fünfzehn Minuten dreimal seinen Schlüssel! Bei dem Thema Intelligenz solltest du nicht von dir auf andere schließen.«
Einen kurzen Moment lang verharrte Laval noch, dann schloss sich der Briefkastenschlitz. Beleidigt vor sich hin schimpfend, verklangen die Schritte des Kobolds auf dem Weg tiefer in das Hausinnere.
»Na, super«, murmelte Sevy. Dann wandte er sich wieder den nach und nach aufleuchtenden Sternen zu.
»Nicht alle Menschen können uns sehen – normalerweise«, erklärte Laval, als er Sevy nach weiteren zehn Minuten hineinließ. »Aber die Menschenleere hier vereinfacht das Ganze. Naturnähe und so …« Er wedelte unbestimmt mit den Händen. »Keine Ahnung wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall werden Menschen dann offener und sehen uns leichter. Außerdem wohnen wir hier auf ewig, da geben wir uns nicht mehr ganz so viel Mühe mit dem Nicht-Auffallen.«
»Ach so! Und ich dachte, deine Unfähigkeit diesbezüglich sei einfach nur auf dein mangelndes Talent zurückzuführen«, erwiderte Sevy, die Tür hinter sich schließend.
»Und dass ich so oft versucht habe, deinen Schlüssel zu verlegen, liegt einfach daran, dass ich einen Soll zu erfüllen habe«, überhörte Laval den Einwand.
»Einen Soll?«
Laval nickte. »Ich muss im Schnitt jede Woche einmal die Schlüssel verlegen.«
»Aber …?«, dehnte Sevy seine Frage. »Du hast es öfter gemacht, weil du ein verkappter Streber bist?«
»Ich hatte halt ein paarmal nachzuholen«, schmollte der Kobold.
Als sie die Küche betraten, öffnete Knut den Kühlschrank ein Stück weiter und zeigte grinsend seine immer noch weißen Zähne.
»Sehr schön«, kommentierte Sevy.
»Wenn wir unseren benötigten Schnitt über längere Zeit nicht schaffen, werden wir bestraft«, erklärte Laval, und ein Schaudern wanderte sein Rückgrat entlang. Sein Gewand erzitterte, und er zog den Kopf ein, sodass sich zum ersten Mal etwas bildete, das einem Kinn ähnlich sah. »Es ist wie eine Krankheit, die uns dann befällt.«
»Interessant«, erwiderte Sevy mit erwachtem Interesse. »Hört sich nach einer Art Entzugserscheinung an. Da ich die einzigen Schlüssel hier habe, könnte ich dich also in arge Probleme bringen, wenn ich sie nicht mehr aus den Augen lasse?«
Wahre Panik zeichnete sich in Lavals Zügen ab und Sevy beruhigte ihn schnell: »Keine Sorge, das werde ich nicht tun. Du wirst deine Chancen zum Begehen weiterer krimineller Taten schon bekommen.«
»Ich kann doch nichts dafür«, beklagte sich Laval, vor Schock den Tränen nahe. »Ich muss. Wie Knut.«
»Was ist denn Knuts Problem? Außer, dass er Farbe anstatt Zahncreme benutzt.«
»Seine Aufgabe ist es, ab und zu den Kühlschrank aufzumachen. Damit die Menschen sich über ihre eigene Vergesslichkeit ärgern.«
»Ab und zu?«
Laval zuckte die Schultern.
»Darf ich mal!«
Eine ungeduldige Stimme ließ Sevy hinter sich schauen, nur um erschrocken vor dem dort stehenden Wesen zurückzuweichen. »Mein Gott! Wer hat denn dich so zugerichtet?«