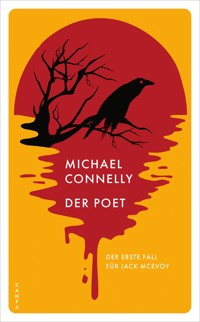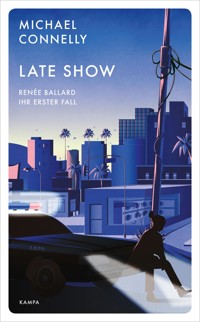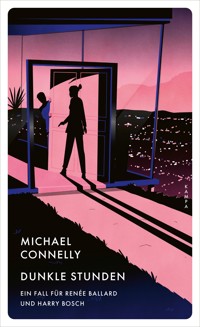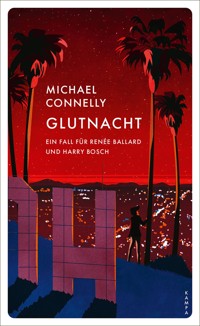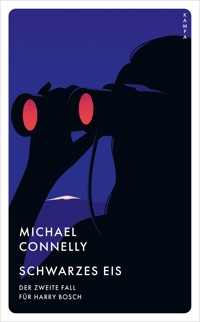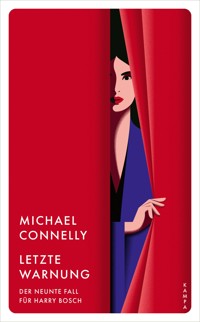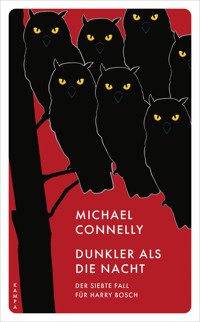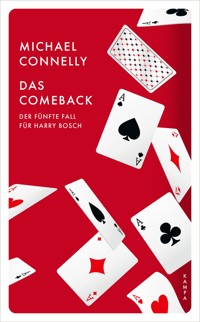9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Harry-Bosch-Serie
- Sprache: Deutsch
Don't mess with Harry – Ermittler-Legende Harry Boschs 21. Fall: Im neuen Teil der Harry-Bosch-Serie des amerikanischen Thriller-Autors Michael Connelly geht es um eine millionenschwere Erbschaft mit folgenschweren Konsequenzen. Harry Bosch, mittlerweile als Privatermittler tätig, soll den Erben des Milliardärs Whitney Vance finden: Der alte Mann hatte als Student ein Verhältnis mit einer Mexikanerin, die er auf Druck seines Vaters verließ, als die junge Frau schwanger wurde. Ein Leben lang hat Vance sich dafür geschämt, nun will er Wiedergutmachung leisten. Es versteht sich, dass kaum einer in seinem Umfeld von dieser Entwicklung begeistert ist. Harry Bosch ist klar, dass er mit äußerster Vorsicht vorgehen muss. Doch kaum hat er erste Erfolge erzielt, erfährt er vom plötzlichen Tod seines Auftraggebers. Für den Privatermittler bedeutet das nur eines: Jetzt erst recht! »Bosch at his best.« New York Times Was geschah vor »Die Verlorene«? Entdecken Sie auch diese Thriller von Michael Connelly rund um den Privatermittler Harry Bosch und seinen Halbbruder, den Anwalt Mickey Haller: Neun Drachen Spur der toten Mädchen Der fünfte Zeuge Der Widersacher Götter der Schuld Black Box Scharfschuss Ehrensache
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michael Connelly
Die Verlorene
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Don’t mess with Harry – Ermittlerlegende Harry Boschs 21. Fall: eine millionenschwere Erbschaft
Harry Bosch, mittlerweile als Privatermittler tätig, soll den Erben des Milliardärs Whitney Vance finden: Der alte Mann hatte als Student ein Verhältnis mit einer Mexikanerin, die er auf Druck seines Vaters verließ, als die junge Frau schwanger wurde. Ein Leben lang hat Vance sich dafür geschämt, nun will er Wiedergutmachung leisten. Es versteht sich, dass kaum einer in seinem Umfeld von dieser Entwicklung begeistert ist. Bosch ist klar, dass er mit äußerster Vorsicht vorgehen muss. Doch kaum hat er erste Erfolge erzielt, erfährt er vom plötzlichen Tod seines Auftraggebers. Für Harry Bosch bedeutet das nur eines: Jetzt erst recht!
»Bosch at his best.« New York Times
Inhaltsübersicht
Widmung
Sie stürmten aus dem [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Es war an einem [...]
Danksagung
Für Vin Scully
Mit herzlichem Dank
Sie stürmten aus dem Schutz des Elefantengrases auf die Landezone zu. Die fünf Männer näherten sich dem Huey von beiden Seiten, und einer von ihnen brüllte: »Los! Los! Los!« – als ob sie eigens angetrieben und daran erinnert werden müssten, dass das die gefährlichsten Momente ihres Lebens waren.
Der Downwash des Rotors drückte das Gras zu Boden und wehte den Markierungsrauch in alle Richtungen. Die Turbine beschleunigte unter ohrenbetäubendem Lärm, die Doorgunner zogen die Männer an ihren Rucksackgurten hoch, und schon hatte der Hubschrauber wieder abgehoben. Er hatte nicht länger aufgesetzt als eine Libelle auf dem Wasser.
Als der Hubschrauber stieg und abzudrehen begann, war durch die Backbordtür die Baumlinie zu sehen. Und dann kamen die Mündungsblitze aus den Banyanbäumen. Jemand brüllte: »Heckenschützen!« – als wüsste der Doorgunner nicht, womit er es zu tun hatte.
Ein Hinterhalt. Das Feuer kam von drei verschiedenen Stellen. Drei Heckenschützen. Sie hatten gewartet, bis der Hubschrauber in der Luft war, wo er aus zweihundert Meter Entfernung ein hervorragendes Ziel abgab.
Der Bordschütze schoss mit seinem M60 die Baumkronen in Fetzen. Aber das Feuer der Heckenschützen ließ nicht nach. Der Huey hatte keine Panzerung, eine Entscheidung, die dreizehntausend Kilometer entfernt von hier getroffen worden war, um Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit gegenüber Gewicht und Schutz den Vorrang zu geben.
Ein Schuss traf mit einem dumpfen Knall die Turbinenhaube, ein Geräusch, das einen der hilflosen Männer an Bord an einen verirrten Baseball erinnerte, der die Motorhaube eines Autos auf dem Parkplatz vor dem Stadion traf. Es folgte das Zerbersten von Glas, als das nächste Geschoss die Kanzel durchschlug. Es war ein absoluter Glückstreffer, der sowohl Pilot als auch Copilot außer Gefecht setzte. Der Pilot war auf der Stelle tot, der Copilot riss automatisch, aber vergeblich die Hände an seinen Hals, um das Blut am Entweichen zu hindern. Der Hubschrauber gierte, begann zu kreiseln und trudelte vollkommen außer Kontrolle von den Bäumen fort über die Reisfelder. Die Männer hinten begannen hilflos zu schreien. Der Mann, der gerade die Baseballassoziation gehabt hatte, versuchte sich zu orientieren. Die Welt außerhalb des Hubschraubers drehte sich. Er hielt den Blick auf ein Wort an der Trennwand zwischen Cockpit und Laderaum gerichtet. Der Querbalken des Buchstabens A dieses Worts – ADVANCE, Vorstoß – war ein nach vorn zeigender Pfeil.
Er wandte den Blick auch dann nicht von diesem einen Wort ab, als die Schreie panischer wurden und der Hubschrauber an Höhe verlor. Sieben Monate taktische Aufklärung und jetzt Kurzzeit. Er wusste, er würde es nicht zurück schaffen. Das war das Ende.
Das Letzte, was er noch mitbekam, war, dass jemand »Festhalten!« brüllte – als ob irgendjemand an Bord auch nur die leiseste Chance hätte, den Aufprall zu überleben, gar nicht erst zu reden von dem darauf folgenden Beschuss. Und dann noch die Vietcong, die mit Macheten anrücken würden.
Während die anderen verzweifelt schrien, flüsterte er einen Namen.
»Vibiana …«
Er wusste, er würde sie nie wiedersehen.
»Vibiana …«
Der Hubschrauber krachte in einen der Reisfeldgräben und explodierte in eine Million Metallteile. Im selben Moment fing der auslaufende Treibstoff Feuer und fraß sich brennend durch das Wrack. Gleichzeitig breiteten sich die Flammen über das Wasser des Reisfelds aus. Schwarzer Rauch stieg auf und markierte das Wrack wie eine Landezonenmarkierung.
Die Scharfschützen luden nach und warteten auf die Rettungshubschrauber.
1
Bosch machte das Warten nichts aus. Die Aussicht war überwältigend. Er setzte sich nicht auf die Couch des Wartezimmers, sondern stellte sich ganz dicht an die Glasscheibe und genoss den Blick über die Dächer von Downtown Los Angeles zum Pazifik. Er war im neunundfünfzigsten Stock des U. S. Bank Tower, und Creighton ließ ihn warten, weil er das aus Prinzip tat. Das war schon so gewesen, als er noch im Parker Center war. Damals hatte man allerdings im Wartezimmer nur von ziemlich weit unten auf die Rückseite der City Hall geschaut. Seit seiner Zeit beim Los Angeles Police Department war Creighton zwar nur fünf Straßen weiter gezogen, aber nach oben war er erheblich weiter aufgestiegen, bis in die luftigen Höhen, in denen die Finanzgötter der Stadt zu Hause waren.
Trotz des Blicks verstand Bosch nicht, wie jemand sein Büro im Tower behalten konnte. Als höchstes Gebäude westlich des Mississippi war er schon das Ziel zweier vereitelter Terroranschläge gewesen. Bosch konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Umstand nicht jedem, der Morgen für Morgen durch die Glastüren trat, neben dem berufsbedingten Stress zusätzliches Unbehagen bereitete. Eine gewisse Abhilfe schaffte da höchstens der verglaste Turm des Wilshire Grand Center, der ein paar Straßen weiter in den Himmel ragte. Nach seiner Fertigstellung würde ihm die Auszeichnung »höchstes Gebäude westlich des Mississippi« zufallen – und vermutlich auch die damit einhergehende Funktion als Zielscheibe.
Bosch freute sich über jede Gelegenheit, seine Stadt von hoch oben zu betrachten. Als junger Detective hatte er oft Extraschichten als Beobachter in einem der Überwachungshubschrauber des LAPD übernommen – einfach nur, um über Los Angeles fliegen zu können und an seine scheinbare Endlosigkeit erinnert zu werden.
Jetzt blickte er auf den Freeway 110 hinab und sah, dass sich der Verkehr darauf bis hinunter nach South Central staute. Auch die Anzahl der Hubschrauberlandeplätze auf den Dächern unter ihm fiel ihm auf. Der Hubschrauber war das Pendlerfortbewegungsmittel der Elite geworden. Angeblich flogen sogar einige der Basketballstars der Lakers und Clippers mit dem Hubschrauber zum Training ins Staples Center.
Das Glas war dick genug, um von draußen kein Geräusch hereindringen zu lassen. Die Stadt lag vollkommen lautlos unter ihm. Das Einzige, was Bosch hörte, war die Empfangsdame, die sich immer wieder mit dem gleichen Spruch am Telefon meldete: »Trident Security, was kann ich für Sie tun?«
Bosch bemerkte einen Streifenwagen, der auf der Figueroa Street mit hohem Tempo in Richtung L. A. Live District fuhr. Die großen Ziffern 01 auf dem Kofferraumdeckel verrieten ihm, dass der Wagen von der Central Division war. Ihm folgte in kurzem Abstand ein LAPD-Hubschrauber, der tiefer flog als die Etage, auf der Bosch sich befand. In diesem Moment wurde er von einer Stimme hinter ihm abgelenkt.
»Mr Bosch?«
Er drehte sich zu einer Frau um, die in der Mitte des Wartebereichs stand. Es war nicht die Empfangsdame.
»Ich bin Gloria«, stellte sie sich vor. »Wir haben bereits am Telefon miteinander gesprochen.«
»Ach ja, stimmt«, sagte Bosch. »Mr Creightons Assistentin.«
»Ja, freut mich, Sie kennenzulernen. Sie können jetzt nach hinten kommen.«
»Gut. Noch etwas länger, und ich wäre gesprungen.«
Sie lächelte nicht. Sie führte Bosch durch eine Tür in einen Flur. Die Aquarelle an den Wänden waren alle im exakt gleichen Abstand gehängt.
»Das Glas ist bruchfest«, sagte sie. »Es hält einem Hurrikan der Stärke fünf stand.«
»Das beruhigt mich aber«, sagte Bosch. »Sollte außerdem nur ein Witz sein. In seiner Zeit als Deputy Chief bei der Polizei war Ihr Chef bekannt dafür, die Leute warten zu lassen.«
»Tatsächlich? Hier ist mir das aber noch nicht aufgefallen.«
Das ließ Bosch stutzen. Immerhin hatte sie ihn gerade fünfzehn Minuten nach dem vereinbarten Termin im Wartezimmer abgeholt.
»Das hat er damals vermutlich in einem Ratgeber für Führungskräfte gelesen«, fügte Bosch hinzu. »Sie wissen schon, lass sie warten, auch wenn sie pünktlich sind. Versetzt einen automatisch in die stärkere Position, wenn sie endlich vorgelassen werden. Damit sie merken, dass man viel zu tun hat.«
»Diese Geschäftsphilosophie ist mir neu.«
»Ist ja wahrscheinlich auch eher eine Polizeiphilosophie.«
Sie betraten eine Bürosuite. Im Vorzimmer standen zwei Schreibtische. An einem saß ein Mann von ungefähr Mitte zwanzig in einem Anzug. Der andere war nicht besetzt, und Bosch nahm an, dass er Gloria gehörte. Sie gingen zwischen den Schreibtischen hindurch zu einer Tür. Gloria öffnete sie und trat dann zur Seite.
»Bitte sehr. Darf ich Ihnen eine Flasche Wasser bringen?«
»Nein danke«, sagte Bosch. »Nicht nötig.«
Bosch betrat einen noch größeren Raum mit einem Schreibtisch auf der linken Seite. Auf der rechten befand sich eine Sitzgruppe aus zwei einander gegenüberstehenden Sofas und einem gläsernen Couchtisch dazwischen. Creighton saß an seinem Schreibtisch, ein Zeichen dafür, dass der Termin mit Bosch förmlichen Charakter hatte.
Es war über zehn Jahre her, dass Bosch Creighton persönlich begegnet war. Er wusste nicht mehr, bei welcher Gelegenheit das gewesen war, aber vermutlich war es bei einer Besprechung seiner Einheit gewesen, zu der Creighton erschienen war, um etwas über das Überstundenbudget oder die Reisekostenverordnung des LAPD zu sagen. Damals war Creighton der Cheferbsenzähler gewesen – neben seinen anderen Verwaltungsaufgaben auch zuständig für die Haushaltsplanung der Polizei. Er war bekannt dafür gewesen, dass er es mit der Genehmigung von Überstunden sehr genau nahm und auf ausführlichen schriftlichen Begründungen bestand, die auf grünen Formularen eingereicht werden mussten. Da die Genehmigung – oder Ablehnung – normalerweise erst erfolgte, wenn die Überstunden bereits abgeleistet waren, wurde diese neue Regelung als Maßnahme betrachtet, Polizisten davon abzubringen, Überstunden zu machen, oder sie, noch schlimmer, Überstunden einlegen zu lassen und diese dann nicht zu genehmigen oder mittels Freizeitausgleich abzugelten. Es war in dieser Phase seiner Polizeilaufbahn, dass Creighton bei der Truppe den Spitznamen »Kretin« bekam.
Obwohl Creighton schon bald danach in die Privatwirtschaft gewechselt war, blieben die »Greenies«, wie die grünen Formulare genannt wurden, weiter in Gebrauch. Bei der Polizei erinnerte man sich nicht wegen eines spektakulären Rettungseinsatzes oder Schusswechsels oder wegen der Festnahme eines besonders gefährlichen Kriminellen an Creighton, sondern wegen der grünen Überstundenformulare.
»Kommen Sie rein, Harry«, sagte Creighton. »Nehmen Sie Platz.«
Bosch ging zum Schreibtisch. Creighton war ein paar Jahre älter als er, aber noch in guter körperlicher Verfassung. Er stand hinter seinem Schreibtisch und hielt ihm die Hand entgegen. In seinem maßgeschneiderten grauen Anzug sah er nach Geld aus. Bosch schüttelte ihm die Hand und nahm vor dem Schreibtisch Platz. Er hatte sich für den Termin nicht in Schale geworfen, sondern trug Bluejeans, ein blaues Jeanshemd und ein dunkelgraues Sakko, das schon mindestens zwölf Jahre alt war. Neuerdings hingen Boschs Anzüge aus seiner Zeit bei der Polizei in Plastikschutzhüllen im Schrank. Sie bloß für einen Termin beim Kretin herauszunehmen, hatte er nicht für nötig befunden.
»Wie geht’s, Chief?«, fragte er.
»Die Chief-Zeiten sind längst vorbei«, sagte Creighton lachend. »Ab jetzt einfach John.«
»Dann also John.«
»Sorry, dass ich Sie habe warten lassen, Harry. Ich hatte einen Kunden am Telefon, und, na ja, Sie kennen das ja, der Kunde hat immer Vorrang.«
»Klar, kein Problem. Einen tollen Blick haben Sie hier.«
Das Fenster hinter Creighton ging in die andere Richtung, nach Nordosten über das Civic Center hinweg bis zu den schneebedeckten Gipfeln von San Bernardino. Bosch vermutete aber, dass sich Creighton nicht wegen der Berge für dieses Büro entschieden hatte, sondern wegen des Civic Center. Denn so konnte er von seinem Schreibtisch auf den Turm der City Hall, das Police Administration Building und das Los Angeles Times Building hinabschauen. Hier thronte er über ihnen allen.
»Die Welt von hier oben zu sehen hat schon was«, sagte Creighton.
Bosch nickte und kam zur Sache.
»Also, was kann ich für Sie tun … John?«
»Zuerst möchte ich Ihnen danken, dass Sie hergekommen sind, ohne zu wissen, was ich von Ihnen will. Gloria hat gesagt, es wäre nicht ganz einfach gewesen, Sie dazu zu bewegen.«
»Ja schon, tut mir leid. Aber wie ich ihr bereits am Telefon gesagt habe, bin ich nicht interessiert, wenn es dabei um einen Job geht. Ich habe nämlich bereits einen.«
»Ich weiß. In San Fernando. Aber wahrscheinlich nur Teilzeit, oder?«
Bei dem leicht spöttischen Unterton, in dem Creighton das sagte, musste Bosch an einen Spruch aus einem Film denken, den er mal gesehen hatte: »Wenn du kein Cop bist, bist du der letzte Arsch.« Und man war sogar dann der letzte Arsch, wenn man nur für ein kleines Police Department arbeitete.
»Ich habe dort so viel zu tun, wie ich zu tun haben möchte«, sagte er. »Außerdem habe ich eine Lizenz und übernehme den einen oder anderen privaten Auftrag.«
»Die Sie alle auf Empfehlung bekommen, richtig?«
Bosch sah Creighton kurz an.
»Soll ich mich jetzt etwa beeindruckt zeigen, dass Sie Erkundigungen über mich eingezogen haben?«, fragte er schließlich. »Ich habe kein Interesse daran, hier zu arbeiten. Egal, wie viel Sie zahlen, und egal, was es für Fälle sind.«
»Na schön, dann würde ich Sie trotzdem gern was fragen, Harry. Wissen Sie, was wir hier machen?«
Bosch schaute über Creightons Schulter auf die Berge hinaus, bevor er antwortete.
»Ich weiß, dass Sie eine exklusive Sicherheitsfirma für Leute sind, die sich Ihre Dienste leisten können.«
»Ganz richtig«, sagte Creighton und reckte drei Finger seiner rechten Hand in die Höhe.
Vermutlich wollte er damit einen Dreizack symbolisieren, denn prompt fügte er hinzu: »Trident Security, spezialisiert auf finanziellen, technologischen und persönlichen Schutz. Ich habe vor zehn Jahren den kalifornischen Zweig der Firma aufgebaut. Außer dieser Filiale hier haben wir noch Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Miami, London und Frankfurt. In Istanbul wird demnächst eine weitere eröffnet. Wir sind ein sehr großes Unternehmen mit Tausenden von Kunden und noch mehr Beziehungen auf unseren Spezialgebieten.«
»Schön für Sie«, sagte Bosch.
Er hatte sich auf seinem Laptop etwa zehn Minuten über Trident kundig gemacht, bevor er hergekommen war. Das exklusive Sicherheitsunternehmen war 1996 in New York von einem Großreeder namens Dennis Laughton gegründet worden, der auf den Philippinen entführt und gegen Zahlung eines Lösegelds wieder freigelassen worden war. Als Erstes hatte Laughton einen ehemaligen NYPD-Commissioner als Aushängeschild angestellt, und nach diesem Prinzip verfuhr er auch in jeder anderen Stadt, in der er eine Zweigstelle eröffnete. Um sich der nötigen Aufmerksamkeit der Medien und der unerlässlichen Unterstützung der lokalen Polizeibehörden zu versichern, gewann er einen lokalen Polizeichef oder sonst einen hochrangigen Polizeibeamten für die Leitung einer neuen Niederlassung. Angeblich hatte Laughton vor zehn Jahren versucht, den damaligen Polizeichef von L. A. abzuwerben, und sich, als dieser ablehnte, für Creighton entschieden.
»Ich habe Ihrer Assistentin erklärt, dass ich kein Interesse an einem Job bei Trident habe«, sagte Bosch. »Sie meinte, darum ginge es auch nicht. Warum sagen Sie mir nicht einfach, was Sie von mir wollen, damit wir hier nicht länger unsere Zeit vergeuden.«
»Ich kann Ihnen versichern, dass ich Ihnen keine Stelle bei Trident anbieten möchte«, sagte Creighton. »Schließlich sind wir auf die uneingeschränkte Kooperation und Duldung des LAPD angewiesen, um tun zu können, was wir hier tun, und die heiklen Angelegenheiten zu regeln, in die unsere Kunden und die Polizei verwickelt sind. Und wenn wir Sie als Trident-Mitarbeiter einsetzen würden, könnte das Probleme geben.«
»Sie meinen, wegen meines Gerichtsverfahrens.«
»Richtig.«
Fast das ganze vergangene Jahr war Bosch in einen langwierigen Prozess gegen das LAPD verwickelt gewesen, für das er über dreißig Jahre gearbeitet hatte. Er hatte die Behörde verklagt, weil er der Ansicht war, gesetzwidrig in den Ruhestand versetzt worden zu sein. Mit diesem Verfahren hatte Bosch bei der Polizei für viel böses Blut gesorgt, und dabei schien auch keine Rolle zu spielen, dass er im Lauf seiner Dienstzeit über hundert Mörder überführt hatte. Das Gerichtsverfahren wurde beigelegt, aber die Anfeindungen seitens einiger LAPD-Angehöriger, vorwiegend aus der Führungsriege, dauerten an.
»Es wäre also nicht gut für Ihre Beziehungen zum LAPD, wenn Sie mich bei Trident anstellen würden«, sagte Bosch. »Das ist mir so weit klar. Aber für irgendwas wollen Sie mich doch haben. Wofür?«
Creighton nickte. Es wurde Zeit, zur Sache zu kommen.
»Sagt Ihnen der Name Whitney Vance etwas?«
Bosch nickte. »Natürlich.«
»Er ist einer unserer Kunden«, fuhr Creighton fort. »Und das gilt auch für seine Firma, Advance Engineering.«
»Whitney Vance muss inzwischen an die achtzig sein.«
»Fünfundachtzig, um genau zu sein. Und …«
Creighton zog die mittlere Schublade seines Schreibtischs heraus, entnahm ihr ein Schriftstück und legte es auf den Schreibtisch. Bosch konnte sehen, dass es ein bereits ausgefertigter Scheck mit einem Kontrollabschnitt war. Weil er seine Brille nicht aufhatte, konnte er weder den darauf eingetragenen Betrag noch sonst etwas erkennen.
»… er möchte mit Ihnen reden«, brachte Creighton den Satz zu Ende.
»Worüber?«, fragte Bosch.
»Das weiß ich nicht. Er hat gesagt, es handelt sich um eine Privatangelegenheit, und er hat ausdrücklich nach Ihnen verlangt. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass er nur mit Ihnen darüber sprechen will, und er hat diesen Scheck über zehntausend Dollar für Sie hinterlegt. Er gehört Ihnen, wenn Sie sich mit ihm treffen, unabhängig davon, ob Sie danach für ihn tätig werden oder nicht.«
Bosch wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Im Moment hatte er wegen des gewonnenen Prozesses relativ viel Geld, aber das meiste davon hatte er langfristig angelegt, um sich einen angenehmen Ruhestand zu ermöglichen und etwas für seine Tochter in Reserve zu haben. Zurzeit hatte sie noch über zwei Jahre College vor sich, und danach standen die Studiengebühren für die Graduate School an. Sie bekam zwar verschiedene Stipendien, aber ihre Ausbildungskosten stellten trotzdem eine erhebliche finanzielle Belastung für Bosch dar. In seiner momentanen Situation konnte er zehntausend Dollar gut gebrauchen.
»Wo und wann soll dieses Treffen stattfinden?«, fragte er schließlich.
»Morgen um neun in Mr Vance’ Haus in Pasadena«, sagte Creighton. »Die Adresse steht auf dem Scheck. Und es könnte vielleicht nicht schaden, wenn Sie sich etwas besser anziehen.«
Bosch ignorierte die Spitze. Er fischte seine Brille aus einer Innentasche seines Sakkos. Er setzte sie auf, langte über den Schreibtisch und griff nach dem Scheck. Er war auf seinen offiziellen Namen ausgestellt. Hieronymus Bosch.
Auf einem perforierten Abschnitt am unteren Rand des Schecks standen Adresse und Zeitpunkt des Treffens sowie der Hinweis: »Bringen Sie keine Schusswaffe mit.« Bosch faltete den Scheck entlang der perforierten Linie und sah Creighton an, als er ihn einsteckte.
»Ich gehe gleich auf die Bank und lasse den Betrag auf mein Konto buchen. Und wenn mit dem Scheck alles in Ordnung ist, komme ich morgen zu dem Termin.«
Creighton grinste.
»Er ist bestimmt gedeckt.«
Bosch nickte.
»Das war’s dann wohl.«
Er stand auf, um zu gehen.
Doch Creighton sagte: »Noch eine Sache, Bosch.«
Bosch entging nicht, dass er anredemäßig binnen zehn Minuten von Vornamen wieder zu Nachnamen zurückgekehrt war.
»Ja?«
»Ich habe keine Ahnung, was der alte Herr von Ihnen will, aber ich fühle mich in hohem Maß für ihn verantwortlich. Er ist mehr als ein Kunde für mich, und ich möchte nicht, dass er in dieser Phase seines Lebens verschaukelt wird. Egal, was Sie für ihn erledigen sollen, möchte ich auf dem Laufenden gehalten werden.«
»Sie fürchten, er könnte verschaukelt werden? Wenn ich das recht verstanden habe, Creighton, haben Sie mich angerufen. Wenn hier jemand verschaukelt werden kann, dann ich. Egal, wie viel er mir zahlt.«
»Seien Sie versichert, dass das nicht der Fall sein wird. Alles, was Sie für die zehntausend Dollar tun müssen, die Sie gerade erhalten haben, ist, nach Pasadena rauszufahren.«
Bosch nickte.
»Na schön, ich nehme Sie beim Wort. Ich werde den alten Herrn morgen aufsuchen und sehen, was er von mir will. Wenn er aber mein Klient wird, geht diese Angelegenheit, egal, worum es sich dabei handelt, nur ihn und mich was an. Sie haben dabei nichts verloren, außer Vance dringt ausdrücklich darauf, Sie in die Sache einzubeziehen. Das sind meine Bedingungen. Egal, wer der Klient ist.«
Bosch wandte sich zum Gehen. An der Tür schaute er zu Creighton zurück.
»Danke für den fantastischen Blick.«
Damit ging er und schloss die Tür hinter sich.
Auf dem Weg nach draußen ließ er sich am Schreibtisch der Empfangsdame seinen Parkschein abstempeln. Er wollte die zwanzig Dollar dafür unbedingt Creighton aufbrummen. Und die Autowäsche, zu der er sich bereit erklärt hatte, als er den Wagen abgegeben hatte, gleich mit dazu.
2
Die Vance-Villa lag nicht weit vom Annandale Golf Club an der San Rafael Avenue. In dieser Gegend war der Geldadel zu Hause. Villen und große Grundstücke, von Generation zu Generation weitergegeben, von hohen Steinmauern und schwarzen Eisenzäunen geschützt. Ganz anders als die Hollywood Hills, in die es die Neureichen zog und wo die Mülltonnen die ganze Woche am Straßenrand standen. Hier sah man keine »Zu verkaufen«-Schilder. Um sich hier einzukaufen, musste man jemanden kennen, im Idealfall mit ihm verwandt sein.
Bosch parkte etwa hundert Meter von der Einfahrt des Vance-Anwesens entfernt am Straßenrand. Den oberen Rand des Eingangstors zierten als Blumen getarnte Stacheln. Die Straße dahinter wand sich zwischen zwei sanft gewellten grünen Hügeln hindurch und verschwand. Ein Gebäude war nirgendwo zu sehen, nicht einmal eine Garage. Das Wohnhaus war offensichtlich weit von der Straße zurückversetzt, abgeschirmt dank Topografie, Eisen und Security. Bosch war jedoch klar, dass irgendwo hinter diesen geldgeprägten Hügeln Whitney Vance mit seinen fünfundachtzig Jahren mit etwas Belastendem auf ihn wartete. Mit etwas, für das jemand von der anderen Seite des spitzenbewehrten Tors benötigt wurde.
Bosch war zwanzig Minuten zu früh eingetroffen und beschloss, die Zeit zu nutzen, um über die Meldungen nachzudenken, die er am Morgen im Internet gefunden und auf seinen Laptop heruntergeladen hatte.
In groben Zügen war ihm Whitney Vance’ Leben ebenso geläufig, wie es das wahrscheinlich den meisten Kaliforniern war. In einigen Punkten fand er es jedoch insofern interessant und sogar bewundernswert, als Vance einer der seltenen Erben eines großen Vermögens war, die dieses noch einmal deutlich vergrößert hatten. Er gehörte der vierten Generation einer Familie von Minenbesitzern an, die bis in die Zeit des Goldrausches zurückreichte. Die Suche nach Gold war zwar das, was Vance’ Urgroßvater in den Westen geführt hatte, aber nicht das, worauf sich der Reichtum der Familie gründete. Enttäuscht von der Goldsuche, hatte der Urgroßvater das erste Tagebauunternehmen des Bundesstaats gegründet und Tonnen von Eisenerz aus der Erde von San Bernardino County geschürft. Vance’ Großvater folgte ihm mit einem zweiten Tagebauunternehmen in Imperial County weiter südlich, und sein Vater baute diesen Erfolg mit der Gründung einer Stahlfabrik und einer Fertigungsanlage aus, die beide die aufkeimende Luftfahrtindustrie belieferten. Howard Hughes, der damals das Gesicht dieses Industriezweigs war, arbeitete mit Nelson Vance zunächst als Subunternehmer und dann bei zahlreichen Luftfahrtprojekten als gleichberechtigtem Partner zusammen. Hughes wurde Pate von Nelson Vance’ einzigem Kind.
Whitney Vance wurde 1931 geboren und setzte es sich als junger Mann anscheinend zum Ziel, seinen eigenen Weg zu gehen und sich selbst einen Namen zu machen. Zunächst begann er an der University of Southern California ein Filmstudium, kehrte dann aber in den Schoß der Familie zurück und wechselte auf das California Institute of Technology in Pasadena, wo auch »Onkel Howard« studiert hatte. Es war Hughes, der den jungen Whitney dazu gedrängt hatte, sich am Caltech für Luftfahrttechnik einzuschreiben.
Und als Vance schließlich das Familienerbe antrat, erschloss auch er, wie schon seine Vorfahren, neue und Erfolg versprechende Wirtschaftszweige für das Unternehmen, ohne jedoch jemals die Verbindung zum ursprünglichen Produkt der Familie zu kappen: dem Stahl. Er erhielt zahlreiche staatliche Aufträge für die Herstellung von Flugzeugteilen und gründete Advance Engineering, das für viele davon die Patente hielt. Die für die sichere Betankung von Flugzeugen verwendeten Muffen wurden im familieneigenen Stahlwerk perfektioniert und waren heute noch auf jedem Flughafen der Welt in Gebrauch. Bei den frühesten Versuchen, Flugzeuge zu bauen, die sich der Radarortung entzogen, kam Ferrit zum Einsatz, das aus dem Eisenerz der Tagebauunternehmen des Vance-Konzerns gewonnen wurde. Alle diese Verfahren, die von Vance umfassend patentiert und geschützt wurden, garantierten seinen Unternehmen die jahrzehntelange Beteiligung an der Entwicklung von Tarnkappentechnologien. Vance’ Konzern war Teil des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes, und entsprechend stieg dessen Wert während des Vietnamkriegs exponentiell. Im gesamten Kriegsverlauf gab es in Südostasien keine Mission, bei der nicht Produkte von Advance Engineering zum Einsatz gekommen waren. Bosch erinnerte sich, dass das Firmenlogo – ein A mit einem Pfeil als Querbalken – auf den Stahlwänden jedes Hubschraubers zu sehen gewesen war, in dem er in Vietnam geflogen war.
Ein lautes Klopfen am Seitenfenster seines Wagens riss ihn aus seinen Gedanken. Er blickte in das Gesicht eines uniformierten Polizisten, und im Rückspiegel war ein schwarz-weißer Streifenwagen zu erkennen. Er war so in seine Lektüre vertieft gewesen, dass er nicht mitbekommen hatte, wie das Polizeiauto hinter ihm angehalten hatte.
Um das Fenster herunterlassen zu können, musste Bosch erst die Zündung des Cherokee einschalten. Ihm war nur zu deutlich bewusst, dass ein zweiundzwanzig Jahre altes und dringend lackierungsbedürftiges Fahrzeug Verdacht erregte, wenn es vor dem Anwesen einer Familie stand, die maßgeblich am Aufbau Kaliforniens beteiligt war. Da half es auch nicht, dass das Auto frisch gewaschen war und sein Fahrer einen aus einem Plastikkleidersack requirierten Anzug samt Krawatte trug. Es hatte keine fünfzehn Minuten gedauert, bis die Polizei auf sein Erscheinen reagierte.
»Ich weiß, wonach das alles aussieht, Officer«, begann Bosch. »Aber ich habe in fünf Minuten einen Termin auf der anderen Straßenseite und wollte gerade …«
»Trotzdem«, antwortete der Cop. »Würden Sie bitte aus Ihrem Fahrzeug steigen.«
Bosch sah den Mann kurz an. Auf dem Namensschild über seiner Brusttasche stand Cooper.
»Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst?«
»Doch, Sir, ist es sehr wohl«, sagte Cooper. »Steigen Sie bitte aus.«
Bosch holte tief Luft, öffnete die Tür und kam der Aufforderung nach. Er hob die Hände auf Schulterhöhe und sagte: »Ich bin Polizeibeamter.«
Wie erwartet zuckte Cooper zusammen.
»Ich bin nicht bewaffnet«, fügte Bosch rasch hinzu. »Meine Waffe ist im Handschuhfach.«
In diesem Moment war er froh, dass auf dem Kontrollabschnitt des Schecks gestanden hatte, unbewaffnet zu dem Termin bei Vance zu erscheinen.
»Würden Sie sich bitte ausweisen«, verlangte Cooper.
Vorsichtig griff Bosch in eine Innentasche seiner Anzugjacke und zog sein Dienstmarkenetui heraus. Cooper betrachtete die Dienstmarke und dann den Ausweis.
»Hier steht, Sie sind Officer der Reserve.«
»Ja«, sagte Bosch. »Teilzeit.«
»Etwa fünfzehn Meilen außerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs. Was machen Sie hier, Detective Bosch?« Cooper gab Bosch das Etui zurück.
Bosch steckte es ein.
»Das wollte ich Ihnen gerade erklären. Ich habe einen Termin – zu dem ich mich Ihretwegen verspäten werde –, und zwar mit Mr Vance, der, wie Sie sicher wissen, gleich dort drüben wohnt.«
Bosch deutete auf das schwarze Tor.
»Handelt es sich dabei um eine Polizeiangelegenheit?«, fragte Cooper.
»Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht«, antwortete Bosch.
Die beiden Männer starrten sich eine Weile finster an, ohne dass einer von ihnen blinzelte. Schließlich brach Bosch das Schweigen.
»Mr Vance wartet auf mich. Ein Mann wie er wird vermutlich wissen wollen, warum ich zu spät komme, und deswegen wahrscheinlich entsprechende Schritte einleiten. Haben Sie einen Vornamen, Cooper?«
Cooper blinzelte.
»Ja, ›Leck mich‹. Einen schönen Tag noch.«
Damit drehte er sich um und ging zu seinem Streifenwagen zurück.
»Danke, Officer«, rief ihm Bosch hinterher.
Bosch stieg wieder ein und fuhr sofort los. Hätte die alte Kiste noch ausreichend Kraft gehabt, hätte er es mit durchdrehenden Reifen getan. Aber alles, was er Cooper zeigen konnte, war eine dicke Rauchwolke aus seinem alten Auspuff.
Er bog in den Einfahrtsbereich vor dem Tor des Vance-Anwesens und hielt an einer Sprechanlage mit Kamera. Fast sofort wurde er von einer Stimme begrüßt.
»Ja?«
Sie war männlich, jung und gelangweilt arrogant. Bosch beugte sich aus dem Fenster, und obwohl er wusste, dass das vermutlich nicht erforderlich war, sagte er betont laut:
»Harry Bosch. Ich habe einen Termin bei Mr Vance.«
Kurz darauf ging das Tor vor ihm auf.
»Folgen Sie der Einfahrt bis zum Parkplatz hinter dem Kontrollposten«, forderte ihn die Stimme auf. »Dort wird Sie Mr Sloan am Metalldetektor abholen. Lassen Sie alle Waffen und Aufnahmegeräte im Handschuhfach Ihres Fahrzeugs.«
»Alles klar«, sagte Bosch.
»Fahren Sie jetzt los«, sagte die Stimme.
Inzwischen war das Tor ganz offen, und Bosch fuhr hindurch. Er folgte der gepflasterten Straße durch eine penibel gepflegte Parklandschaft, bis er zu einer zweiten Umzäunung mit einem Wachhäuschen kam. Die zweifache Einzäunung erinnerte ihn an die Sicherheitsvorkehrungen der meisten Gefängnisse, die er aufgesucht hatte – nur dass sie hier dazu diente, die Leute draußen zu halten und nicht drinnen.
Das zweite Tor glitt auf, und aus dem Häuschen kam ein uniformierter Wachmann. Er winkte Bosch durch und deutete auf den Parkplatz. Bosch grüßte im Vorbeifahren und bemerkte das Trident-Security-Abzeichen auf der marineblauen Uniform des Wachmannes.
Nachdem er den Wagen geparkt hatte, wurde er aufgefordert, Schlüssel, Telefon, Uhr und Gürtel in eine Plastikwanne zu legen und dann unter den Augen zweier weiterer Trident-Leute durch einen Metalldetektor, wie man sie von Flughäfen kennt, zu gehen. Sie gaben ihm alles zurück bis auf das Handy, das sie, versicherten sie ihm, ins Handschuhfach seines Autos legen würden.
»Ist sich dieser Ironie eigentlich sonst noch jemand bewusst?«, fragte er, als er den Gürtel durch die Schlaufen am Bund seiner Hose fädelte. »Da hat die Familie ihr ganzes Geld mit Metall gemacht – und jetzt muss man durch einen Metalldetektor, um ins Haus zu kommen.«
Keiner der Wachmänner erwiderte etwas.
»Dann ist es wohl nur mir aufgefallen«, sagte Bosch.
Sobald er seinen Gürtel zugemacht hatte, wurde er ans nächste Security-Level weitergereicht, einen Anzugträger mit dem obligatorischen Kopfhörer im Ohr, einem Handgelenksmikro und dem dazugehörigen starren Secret-Service-Blick. Um das einschüchternde Erscheinungsbild perfekt zu machen, hatte er den Schädel spiegelblank rasiert. Er stellte sich zwar nicht vor, aber Bosch nahm an, dass er der über die Sprechanlage erwähnte Sloan sein musste. Der Glatzkopf begleitete Bosch wortlos durch den Lieferanteneingang eines hochherrschaftlichen grauen Natursteinbaus, der einer Du-Pont- oder Vanderbilt-Residenz vermutlich in nichts nachstand. Wikipedia zufolge bekäme es Bosch gleich mit sechs Milliarden Dollar zu tun. Viel näher konnte man amerikanischem Adel vermutlich kaum kommen.
An einer Wand des mit dunklem Holz vertäfelten Raums, in den Bosch geführt wurde, hingen vier Reihen mit Dutzenden von Fotos im Format achtzehn mal vierundzwanzig. Es gab mehrere Sofas und am hinteren Ende eine Bar. Der Glatzkopf deutete auf eines der Sofas.
»Wenn Sie bitte Platz nehmen würden, Sir. Sobald Mr Vance Zeit für Sie hat, wird Sie seine Sekretärin holen kommen.«
Bosch setzte sich auf das Sofa, das gegenüber der Wand mit den Fotos stand.
»Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?«, fragte der Glatzkopf.
»Nein danke«, sagte Bosch.
Daraufhin postierte sich der Glatzkopf neben der Tür, durch die sie gekommen waren, und legte seine rechte Hand um das linke Handgelenk. Seine Haltung signalisierte, dass er auf der Hut und auf alles gefasst war.
Bosch nutzte die Wartezeit, um sich die Fotos anzusehen. Sie resümierten Whitney Vance’ Leben und die Menschen, denen er in dessen Verlauf begegnet war. Auf dem ersten Foto waren Howard Hughes und ein Teenager zu sehen, von dem Bosch annahm, dass es Vance war. Sie lehnten an der unlackierten Metallhülle eines Flugzeugs. Allem Anschein nach waren die Fotos von links nach rechts in chronologischer Reihenfolge angeordnet. Sie zeigten Vance mit zahlreichen bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Bosch konnte nicht jeden der mit Vance Fotografierten namentlich benennen, aber im Fall der meisten, von Lyndon B. Johnson bis Larry King, wusste er, wer sie waren. Vance hatte auf allen Fotos das gleiche Halblächeln aufgesetzt, bei dem die linke Mundhälfte leicht nach oben gezogen war, als wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass es nicht seine Idee gewesen war, für ein Foto zu posieren. Auch wenn die Gesichtszüge von Bild zu Bild älter und die Lider schwerer wurden, blieb das Lächeln immer gleich.
Es gab zwei Fotos von Vance mit Larry King, der lange Zeit Prominente und Schlagzeilenlieferanten für CNN interviewt hatte. Auf dem ersten saßen sich Vance und King in dem Studio gegenüber, in dem King mehr als zwanzig Jahre seine Gäste interviewt hatte. Auf dem Tisch zwischen ihnen stand aufrecht ein Buch. Auf dem zweiten Foto signierte Vance dieses Buch mit einem goldenen Füllhalter. Bosch stand auf und ging zu der Wand. Um den Titel des Buchs lesen zu können, das Vance in der Sendung vorgestellt hatte, setzte er seine Brille auf und beugte sich zu dem Foto vor.
TARNKAPPENTECHNIK:
Die Entwicklung des unsichtbaren Flugzeugs
Von Whitney P. Vance
Der Titel weckte bei Bosch Erinnerungen an eine von Whitney Vance verfasste Familiengeschichte, die von der Kritik weniger wegen dem bemängelt wurde, was sie enthielt, als wegen dem, was ausgelassen worden war. Sein Vater, Nelson Vance, war ein skrupelloser Unternehmer gewesen, der auf äußerst umstrittene Weise in das politische Geschehen seiner Zeit einzugreifen versucht hatte. Auch wenn es nie nachgewiesen werden konnte, wurde ihm nachgesagt, an einer Kampagne reicher Industrieller beteiligt gewesen zu sein, die sich für Eugenik starkmachten. Diese sogenannte Wissenschaft hatte es sich zum Ziel gesetzt, zur Optimierung der menschlichen Rasse unerwünschte Eigenschaften durch kontrollierte Züchtung auszumerzen. Da die Nazis ihrem Genozid im Zweiten Weltkrieg eine ähnliche pervertierte Ideologie zugrunde gelegt hatten, vermieden es Leute wie Nelson Vance tunlichst, ihre diesbezüglichen Ansichten und Bestrebungen an die Öffentlichkeit dringen zu lassen.
Das Buch seines Sohnes belief sich auf wenig mehr als eitle Selbstbeweihräucherung und ging auf negative Aspekte so gut wie gar nicht ein. Im späteren Verlauf seines Lebens hatte sich Whitney Vance so stark zurückgezogen, dass sein Buch zum Anlass genommen wurde, ihn ins Licht der Öffentlichkeit zu zerren und über die von ihm verschwiegenen Dinge zu befragen.
»Mr Bosch?«
Bosch wandte sich von den Fotos einer Frau zu, die auf der anderen Seite des Raums im Zugang eines Flurs stand. Sie schien schon an die siebzig zu sein und hatte ihr graues Haar zu einem strengen Knoten hochgesteckt.
»Ich bin Mr Vance’ Sekretärin Ida«, sagte sie. »Er hat jetzt Zeit für Sie.«
Bosch folgte der Frau in den Flur, und die Strecke, die sie dort zurücklegten, erschien ihm so lang wie ein ganzer Häuserblock. Schließlich stiegen sie eine kurze Treppe zu einem weiteren Gang hinauf, der durch einen Flügel des Hauses führte, der auf einem höheren Teil des Hügels lag.
»Entschuldigen Sie bitte, dass Sie warten mussten«, sagte Ida.
»Kein Problem«, sagte Bosch. »Ich habe mir währenddessen die Fotos angeschaut.«
»Es steckt viel Geschichte in ihnen.«
»Allerdings.«
»Mr Vance freut sich auf Ihren Besuch.«
»Umso besser. Ich habe noch nie einen Milliardär kennengelernt.«
Seine wenig charmante Bemerkung beendete die Unterhaltung abrupt, gerade so, als wäre es in höchstem Maße unfein und unhöflich, in einem Haus, das für nichts anderes stand als Geld, das Thema Geld anzuschneiden.
Schließlich erreichten sie eine Flügeltür, und Ida winkte Bosch in Whitney Vance’ Büro.
Der Mann, dessentwegen Bosch hergekommen war, saß an einem Schreibtisch, hinter sich einen leeren Kamin, der groß genug war, um dort bei einem Tornado Unterschlupf zu suchen. Mit einer schmalen Hand, so weiß, als steckte sie in einem Latexhandschuh, winkte er Bosch zu sich.
Bosch ging zum Schreibtisch, und Vance deutete auf den Ledersessel davor. Er machte keine Anstalten, Bosch die Hand zu reichen. Als Bosch sich setzte, sah er, dass Vance in einem Rollstuhl mit einem elektronischen Steuergerät an der linken Armstütze saß. Bis auf ein weißes Blatt Papier, das entweder leer oder auf seiner Rückseite beschriftet war, lag auf der dunklen Holzplatte des Schreibtischs nichts, was mit Arbeit zu tun zu haben schien.
»Mr Vance«, sagte Bosch. »Wie geht es Ihnen?«
»Ich bin alt – das ist, wie es mir geht«, entgegnete Vance. »Ich habe gekämpft wie ein Löwe, um das Alter zu besiegen, aber gegen manche Dinge ist man einfach machtlos. Das ist für einen Mann in meiner Stellung schwer zu akzeptieren, aber ich habe mich damit abgefunden, Mr Bosch.«
Er machte mit seiner knochigen weißen Hand wieder eine Geste, und diesmal bezog sie sich auf den Raum, in dem sie sich befanden.
»Bald wird das alles bedeutungslos sein«, fuhr Vance fort.
Für den Fall, dass Vance ihn auf etwas Bestimmtes aufmerksam machen wollte, blickte Bosch sich um. Rechts war eine Sitzgruppe mit einer langen weißen Couch und dazu passenden Sesseln. Es gab eine Bar, hinter die sich ein Gastgeber bei Bedarf zurückziehen konnte. Die Gemälde, die an zwei Wänden hingen, waren reine Farborgien.
Als Bosch sich wieder Vance zuwandte, bedachte ihn dieser mit dem schiefen Lächeln, das er bereits von den Fotos im Wartezimmer kannte: den nach oben gezogenen linken Mundwinkel. Ein vollständiges Lächeln brachte Vance anscheinend nicht zustande. Den Fotos im Wartezimmer nach zu schließen, hatte er das noch nie gekonnt.
Bosch wusste nicht recht, wie er auf die Bemerkung reagieren sollte, die sein Gastgeber über Tod und Vergänglichkeit gemacht hatte. Deshalb griff er auf die einleitenden Worte zurück, die er sich nach dem Treffen mit Creighton zurechtgelegt hatte.
»Man hat mir zu verstehen gegeben, dass Sie mich zu sprechen wünschen, Mr Vance, und Sie haben mich für mein Erscheinen großzügig entlohnt. Für Sie mag es vielleicht nicht viel Geld sein, aber für mich schon. Was kann ich für Sie tun, Sir?«
Diesmal sparte sich Vance das Lächeln und nickte nur.
»Ein Mann, der gleich zur Sache kommt. Das gefällt mir.«
Er griff nach der Steuerung des Rollstuhls und fuhr näher an den Schreibtisch heran.
»Ich habe in der Zeitung von Ihnen gelesen«, fuhr er fort. »Letztes Jahr, glaube ich. Die Geschichte mit diesem Arzt und der Schießerei. Daraus habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie jemand sind, der sich zu behaupten weiß, Mr Bosch. Es wurde enormer Druck auf Sie ausgeübt, aber Sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Das imponiert mir. So jemanden brauche ich. So jemanden findet man heutzutage nicht mehr allzu oft.«
»Was soll ich für Sie tun?«, fragte Bosch noch einmal.
»Ich möchte, dass Sie jemanden für mich finden«, sagte Vance. »Jemanden, der möglicherweise nie existiert hat.«
3
Nachdem er Boschs Interesse geweckt hatte, drehte er mit seiner zittrigen linken Hand das Blatt Papier auf seinem Schreibtisch um und erklärte Bosch, dass er dieses Dokument unterschreiben müsse, bevor sie weiterreden könnten.
»Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung«, erklärte er. »Mein Anwalt sagt, sie ist lückenlos und unanfechtbar. Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie den Inhalt unseres Gesprächs und Ihrer daraus resultierenden Nachforschungen niemandem außer mir enthüllen werden. Auch nicht einem meiner Angestellten oder sonst jemandem, der von sich behauptet, in meinem Auftrag an Sie heranzutreten. Nur mir, Mr Bosch. Wenn Sie dieses Dokument unterschreiben, sind Sie nur mir verpflichtet. Sie setzen einzig und allein mich über die Ergebnisse Ihrer Nachforschungen in Kenntnis. Ist das klar?«
»Ja, das ist mir klar«, sagte Bosch. »Ich habe kein Problem damit, es zu unterschreiben.«
»Umso besser. Hier ist ein Stift.«
Vance schob Bosch das Schriftstück zu und nahm einen Füller aus einem goldenen Halter auf seinem Schreibtisch. Der Füllfederhalter lag schwer in Boschs Hand, denn er war dick und allem Anschein nach aus echtem Gold. Er erinnerte ihn an den Füller, mit dem Vance auf dem Foto mit Larry King sein Buch signiert hatte.
Er überflog das Dokument kurz und unterzeichnete es. Dann legte er den Füllhalter darauf und schob beides wieder Vance zu. Der alte Mann legte den Vertrag in die Schreibtischschublade und schloss sie. Dann hob er den Füllhalter hoch, damit Bosch ihn sehen konnte.
»Dieser Füllfederhalter wurde aus Gold hergestellt, das mein Urgroßvater 1852 in der Sierra Nevada geschürft hat«, erklärte er dazu. »Das war, bevor ihn der Konkurrenzkampf dort oben zwang, nach Süden auszuweichen – und bevor er merkte, dass mit Eisen mehr zu verdienen war als mit Gold.«
Er drehte den Füller in der Hand.
»Er wurde von Generation zu Generation weitergegeben«, fuhr er fort. »Ich habe ihn bekommen, als ich zu Hause ausgezogen bin, um aufs College zu gehen.«
Vance betrachtete den Füller, als sähe er ihn zum ersten Mal. Bosch sagte nichts. Er fragte sich, ob Vance altersbedingt an geistigen Einschränkungen litt und ob sein Wunsch, jemanden zu finden, der möglicherweise gar nicht existierte, ein Hinweis auf seine nachlassenden Geisteskräfte war.
»Mr Vance?«, sagte er deshalb.
Der alte Mann steckte den Stift in seinen Halter zurück und sah Bosch an.
»Ich habe niemanden, dem ich ihn vermachen kann«, sagte er. »Niemanden, dem ich das alles hier vermachen kann.«
Es stimmte. Den biografischen Daten zufolge, die Bosch recherchiert hatte, war Vance nie verheiratet gewesen und kinderlos. In einigen der Kurzdarstellungen, die er gelesen hatte, wurde vage angedeutet, dass er homosexuell war, aber konkrete Beweise gab es dafür nicht. Andere biografische Vermerke legten den Schluss nahe, dass er so sehr in seiner Arbeit aufgegangen war, dass ihm keine Zeit und Energie für eine feste Beziehung blieben, geschweige denn für die Gründung einer Familie. Ein paar kurze Amouren – vorwiegend mit Hollywoodstarlets – hatte es wohl gegeben, aber möglicherweise hatten sie nur dem Zweck gedient, Gerüchte über seine Homosexualität zu zerstreuen. Über sein Liebesleben in den letzten vierzig Jahren hatte Bosch überhaupt nichts mehr finden können.
»Haben Sie Kinder, Mr Bosch?«, fragte Vance.
»Eine Tochter.«
»Wo?«
»Sie studiert noch. An der Chapman University, unten in Orange County.«
»Gute Universität. Was studiert sie? Film?«
»Nein, Psychologie.«
Vance lehnte sich zurück und versank in die Betrachtung der Vergangenheit.
»Ich wollte in meiner Jugend auf die Filmhochschule«, sagte er nach einer Weile. »Jugendträume …«
Er führte den Gedanken nicht zu Ende. Bosch wurde zunehmend deutlicher bewusst, dass er das Geld zurückgeben musste. Das war alles nur ein Hirngespinst, und es gab keinen Auftrag. Er konnte von diesem Mann kein Geld annehmen, selbst wenn es nur ein verschwindend kleiner Tropfen aus Vance’ riesigem Eimer war. Er nahm kein Geld von unzurechnungsfähigen Menschen, egal, wie reich sie waren.
Vance riss sich von seinem Blick aus dem Abgrund seiner Erinnerungen los und sah Bosch an. Er nickte, als könnte er Boschs Gedanken lesen. Dann packte er mit der linken Hand die Armstütze des Rollstuhls und beugte sich vor.
»Langsam muss ich Ihnen, glaube ich, erzählen, worum es sich hier dreht.«
Bosch nickte.
»Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht.«
Vance nickte seinerseits und setzte wieder dieses schiefe Grinsen auf. Er senkte kurz den Blick, dann schaute er wieder zu Bosch auf. Seine tief liegenden Augen glänzten hinter der randlosen Brille.
»Vor langer Zeit habe ich einen Fehler gemacht«, begann er schließlich. »Ich habe ihn nie ausgebügelt, mir auch nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt möchte ich wissen, ob ich ein Kind habe. Ein Kind, dem ich meinen goldenen Füllfederhalter vermachen kann.«
In der Hoffnung, Vance möchte fortfahren, sah Bosch ihn lange an. Doch als der alte Mann das schließlich tat, schien er einen anderen Erinnerungsstrang aufzugreifen.
»Mit achtzehn wollte ich nichts mit der Firma meines Vaters zu tun haben. Ich wollte eher so etwas wie der nächste Orson Welles werden. Ich wollte Filme machen, keine Flugzeugteile. Ich war sehr von mir überzeugt, wie das junge Männer in diesem Alter häufig sind.«
Bosch dachte daran zurück, wie er selbst mit achtzehn gewesen war. Der Wunsch, seinen eigenen Weg zu gehen, hatte ihn in die unterirdischen Gänge Vietnams gebracht.
»Ich habe darauf bestanden, auf die Filmhochschule zu gehen«, fuhr Vance fort, »und habe mich 1949 an der USC eingeschrieben.«
Bosch nickte. Von seinen Recherchen wusste er, dass Vance nur ein Jahr an der USC gewesen war, bevor er ans Caltech wechselte und die Familientradition fortsetzte. Eine Erklärung dafür hatte er bei seiner Internetsuche nicht gefunden. Inzwischen glaubte Bosch, dass er den Grund dafür gleich erfahren würde.
»Ich habe ein Mädchen kennengelernt«, sagte Vance prompt. »Eine Mexikanerin. Wenig später wurde sie schwanger. Das war das Zweitschlimmste, was mir je passiert ist. Das Schlimmste war, es meinem Vater zu erzählen.«
Vance verstummte und senkte den Blick auf die Schreibtischplatte. Es war nicht schwer, die leeren Stellen auszufüllen, doch Bosch wollte, dass ihm Vance selbst so viel wie möglich von der Geschichte erzählte.
»Und wie ging es dann weiter?«, fragte er deshalb.
»Er hat ein paar seiner Leute zu ihr geschickt«, sagte Vance. »Sie sollten sie überreden, das Kind nicht zu bekommen, und sie dann nach Mexiko bringen und alles regeln.«
»Ist sie denn nach Mexiko gefahren?«
»Wenn ja, dann nicht mit den Leuten meines Vaters. Sie ist spurlos verschwunden, und ich habe sie nie mehr gesehen. Ich war zu feige, um nach ihr zu suchen. Ich hatte meinem Vater alles in die Hände gespielt, was er brauchte, um mir vorschreiben zu können, was ich tun sollte: die Blamage und die Schande. Weil sie minderjährig war, hätte die Sache sogar strafrechtliche Konsequenzen haben können. Deshalb tat ich, was er wollte. Ich wechselte aufs Caltech, und damit hatte sich die Sache.«
Vance nickte, als bestätigte er sich damit selbst etwas.
»Das waren damals noch andere Zeiten … für mich und für sie.«
Erst jetzt blickte Vance wieder auf und schaute Bosch lange in die Augen, bevor er fortfuhr:
»Aber nun will ich es wissen. Wenn das Ende näher rückt, will man zurückkehren …«
Ein paar Herzschläge vergingen, bevor er weitersprach.
»Können Sie mir helfen, Mr Bosch?«
Bosch nickte. Er glaubte, der Schmerz in Vance’ Augen war echt.
»Das ist zwar alles schon lange her, Mr Vance, aber versuchen kann ich es. Ist es Ihnen recht, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle und mir Notizen mache?«
»Selbstverständlich«, sagte Vance. »Aber ich weise Sie noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass alles, was hier gesprochen wird, streng vertraulich gehandhabt werden muss. Sonst könnte das Leben anderer Menschen gefährdet werden. Egal, was Sie in dieser Angelegenheit unternehmen: Sie müssen mit äußerster Vorsicht vorgehen. Ich bin ganz sicher, dass man herauszufinden versuchen wird, weshalb ich Sie hergebeten habe und was Sie für mich tun sollen. Aus diesem Grund habe ich bereits einen Scheinauftrag für Sie vorbereitet, aber dazu später. Stellen Sie erst einmal Ihre Fragen.«
Das Leben anderer Menschen könnte gefährdet werden. Diese Worte hallten in Boschs Kopf nach, als er ein kleines Notizbuch aus der Innentasche seiner Anzugjacke nahm. Er zückte einen Füller. Er war aus Plastik, nicht aus Gold, und er hatte ihn in einem Drugstore gekauft.
»Sie haben gesagt, das Leben anderer Menschen könnte gefährdet werden. Wessen Leben? Und warum?«
»Ich bitte Sie, Mr Bosch. Sie haben doch sicher ein Mindestmaß an Recherchen zu meiner Person angestellt, bevor Sie hergekommen sind. Ich habe keine Erben – zumindest keine bekannten. Wenn ich sterbe, fällt die Kontrolle über Advance Engineering an den Firmenvorstand, dessen Mitglieder dank lukrativer staatlicher Aufträge weiterhin Millionen scheffeln werden. Ein leiblicher Erbe könnte dem allen ein Ende setzen. Hier geht es um Milliardenbeträge. Glauben Sie, das wäre für Einzelpersonen oder Körperschaften kein Grund zu töten?«
»Die Erfahrung hat mich gelehrt«, sagte Bosch, »dass Menschen aus jedem nur erdenklichen Grund töten und auch ohne jeden Grund. Wenn ich herausfinde, dass Sie Erben haben, möchten Sie sie dann wirklich zu Zielscheiben möglicher Anschläge auf ihr Leben machen?«
»Diese Entscheidung würde ich ihnen überlassen«, sagte Vance. »Das wäre ich ihnen, glaube ich, auch schuldig. Und ich würde sie mit allen Mitteln zu schützen versuchen.«
»Wie hieß sie? Das Mädchen, das von Ihnen schwanger wurde?«
»Vibiana Duarte.«
Bosch notierte sich den Namen.
»Wissen Sie zufällig ihr Geburtsdatum?«
»Nein, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.«
»Hat sie an der USC studiert?«
»Nein, ich habe sie in der EVK kennengelernt. Dort hat sie gearbeitet.«
»In der EVK?«
»Die Cafeteria in der Mensa hieß Everybody’s Kitchen, kurz EVK.«
Bosch wurde sofort klar, dass somit keine Aussicht bestand, Vibiana Duarte mithilfe der Universitätsunterlagen ausfindig zu machen, die sonst meistens sehr hilfreich waren, weil die meisten Bildungseinrichtungen den weiteren Lebensweg ihrer Alumni aufmerksam verfolgten. Das machte die Suche nach der Frau schwieriger und die Erfolgsaussichten deutlich geringer.
»Sie sagen, sie war Mexikanerin«, fuhr Bosch fort. »Eine Latina also? War sie amerikanische Staatsbürgerin?«
»Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, eher nicht. Mein Vater …«
Er sprach nicht weiter.
»Was war mit Ihrem Vater?«, hakte Bosch nach.
»Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mein Vater meinte, sie hätte es von Anfang an darauf angelegt, von mir schwanger zu werden, damit ich sie heiraten müsste und sie eingebürgert würde. Aber mein Vater hat mir viel erzählt, was nicht gestimmt hat, und er hat vieles geglaubt, was … ziemlich abseitig war. Deshalb kann ich dazu nichts sagen.«
Bosch dachte an das, was er über Nelson Vance und dessen eugenische Ambitionen gelesen hatte.
»Haben Sie zufällig ein Foto von Vibiana«, fragte er.
»Nein. Aber Sie machen sich keine Vorstellung, wie oft ich mir schon gewünscht habe, ein Foto von ihr zu haben. Damit ich sie noch einmal sehen könnte.«
»Wo hat sie gewohnt?«
»In der Nähe der Uni. Nur ein paar Straßen weiter. Sie konnte zu Fuß zur Arbeit gehen.«
»Wissen Sie die Adresse noch? Oder zumindest die Straße?«
»Nein, daran erinnere ich mich nicht mehr. Das alles ist sehr lange her, und ich habe viele Jahre lang versucht, die ganze Geschichte zu vergessen. Tatsache ist allerdings, dass ich nach ihr nie mehr jemanden wirklich geliebt habe.«
Es war das erste Mal, dass Vance das Wort Liebe in den Mund nahm und zu erkennen gab, wie innig sein Verhältnis zu dieser Frau gewesen war. Bosch hatte die Erfahrung gemacht, dass man alles wie durch ein Vergrößerungsglas sah, wenn man sein Leben rückblickend betrachtete. Dann wirkte alles größer und intensiver. Da konnte ein harmloses Collegetechtelmechtel in der Erinnerung schnell zur großen Liebe werden. Trotzdem schien Vance’ Schmerz auch nach all den Jahren noch echt zu sein. Bosch glaubte ihm.
»Wie lang waren Sie mit ihr zusammen, als es zur Trennung kam?«
»Acht Monate zwischen dem ersten und letzten Mal, dass ich sie gesehen habe«, antwortete Vance. »Acht Monate.«
»Wissen Sie noch, wann sie Ihnen gesagt hat, dass sie schwanger ist? Damit meine ich, in welchem Monat oder in welcher Jahreszeit?«
»Es war kurz nach Beginn des Sommersemesters. Ich hatte mich nur deshalb eingeschrieben, weil ich wusste, dass ich sie sehen würde. Es muss also Ende Juni 1950 gewesen sein. Vielleicht auch Anfang Juli.«
»Und acht Monate davor haben Sie sie kennengelernt?«
»Angefangen hat alles im September des Jahres davor. Sie hatte es mir sofort angetan, als ich sie in der EVK sah. Aber ich brachte erst nach ein paar Monaten den Mut auf, sie anzusprechen.«
Der alte Mann senkte den Blick auf den Schreibtisch.
»Woran erinnern Sie sich sonst noch?«, hakte Bosch nach. »Haben Sie ihre Familie kennengelernt? Erinnern Sie sich an irgendwelche Namen?«
»Nein. Sie hat mir nur erzählt, dass ihr Vater sehr streng und ihre Familie katholisch sei, was ich nicht war. In gewisser Weise waren wir wie Romeo und Julia. Ich habe ihre Familie nie kennengelernt und sie die meine auch nicht.«
Bosch stürzte sich auf die Information in Vance’ Antwort, die ihn vielleicht bei seinen Nachforschungen voranbrachte.
»Wissen Sie, in welche Kirche sie ging?«
Vance blickte auf und sah Bosch scharf an.
»Sie hat mir erzählt, dass sie nach der Kirche genannt wurde, in der sie getauft wurde. St. Vibiana.«
Bosch nickte. Ursprünglich war St. Vibiana in Downtown gewesen, nicht weit vom LAPD-Präsidium, wo er gearbeitet hatte. Beim Erdbeben von 1994 wurde die über hundert Jahre alte Kirche jedoch schwer beschädigt, woraufhin ganz in der Nähe eine neue Kirche gebaut und der alte Bau der Stadt gespendet und restauriert wurde. Bosch glaubte, dass er inzwischen einen Veranstaltungssaal und eine Bibliothek beherbergte. Jedenfalls war es eine vielversprechende Verbindung zu Vibiana Duarte. Katholische Kirchen führten Geburts- und Taufregister. Insofern machte diese hilfreiche Information wett, dass Vibiana nicht an der USC studiert hatte. Es ließ auch vermuten, dass sie unabhängig davon, ob das auch auf ihre Eltern zutraf, amerikanische Staatsbürgerin war. Und das hieß, dass sie sich mithilfe amtlicher Unterlagen leichter ausfindig machen ließe.
»Wann wäre das Kind geboren worden, wenn die Entbindung zum regulären Zeitpunkt erfolgt wäre?«, fragte Bosch.
Das war eine heikle Frage, aber er wollte das Zeitfenster bei der Durchsicht der Geburtsregister möglichst weit einengen.
»Ich glaube, sie war schon mindestens zwei Monate schwanger, als sie es mir erzählt hat«, sagte Vance. »Deshalb müsste sie im Januar des folgenden Jahres entbunden haben. Vielleicht auch erst im Februar.«
Das notierte sich Bosch.
»Wie alt war sie, als Sie mit ihr zusammen waren?«
»Sie war sechzehn, als ich sie kennengelernt habe. Ich achtzehn.«
Das war eine weitere Erklärung für die Reaktion von Vance’ Vater. Vibiana war minderjährig gewesen. Eine Sechzehnjährige zu schwängern hätte für Whitney Vance 1950 nicht sonderlich schwerwiegende, aber doch peinliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.
»Hat sie eine Highschool besucht?«, fragte Bosch.
Er kannte die Gegend um die USC. Die Highschool wäre die Manual Arts gewesen. Auch dort hätte es noch Unterlagen geben können.
»Sie hat die Schule frühzeitig abgebrochen, um zu arbeiten. Die Familie war auf das Geld angewiesen.«
»Hat sie Ihnen erzählt, was ihr Vater beruflich gemacht hat?«
»Daran erinnere ich mich nicht mehr.«
»Dann noch mal zu ihrem Geburtstag. Sie können sich nicht mehr an das Datum erinnern, aber wissen Sie noch, ob Sie ihn in den acht Monaten, in denen Sie mit ihr zusammen waren, gefeiert haben?«
Vance dachte eine Weile nach, dann schüttelte er den Kopf.
»Nein, ich kann mich nicht erinnern, ihren Geburtstag gefeiert zu haben.«
»Wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie von Ende Oktober bis Ende Juni oder Anfang Juli zusammen. Demnach müsste ihr Geburtstag in die Zeit zwischen Juli und Ende Oktober fallen. Grob.«
Vance nickte. Den Zeitraum auf vier Monate einengen zu können stellte vielleicht eine gewisse Erleichterung dar, wenn Bosch die Archive durchforstete. Ein wichtiger erster Schritt bestand darin, den Namen Vibiana Duarte mit einem Geburtsdatum in Verbindung bringen zu können. Er notierte sich die dafür infrage kommenden Monate und das mutmaßliche Geburtsjahr: 1933. Dann blickte er wieder zu Vance auf.
»Glauben Sie, Ihr Vater hat ihr oder ihrer Familie eine finanzielle Entschädigung gezahlt? Damit sie Stillschweigen bewahrten und keinen Ärger machten?«
»Wenn dem so gewesen sein sollte, hat er es mir nicht erzählt«, sagte Vance. »Ich war derjenige, der sich damals von ihr zurückgezogen hat. Diese Feigheit habe ich immer bereut.«
»Haben Sie vorher schon einmal nach ihr gesucht? Oder jemanden damit beauftragt?«
»Nein, leider nicht. Ob es jemand anders getan hat, kann ich allerdings nicht sagen.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Es ist durchaus möglich, dass solche Nachforschungen in Erwartung meines Ablebens von anderen angestellt worden sind.«
Darüber dachte Bosch eine Weile nach. Dann überflog er seine Notizen. Er glaubte, vorerst genug Informationen zu haben.
»Sie sagten, Sie hätten zur Tarnung einen Scheinauftrag für mich?«
»Ja, James Franklin Aldridge. Notieren Sie sich den Namen.«
»Wer ist das?«
»Mein erster Zimmergenosse an der USC. Er wurde im ersten Semester geschasst.«
»Wegen seiner schlechten Leistungen?«
»Nein, aus einem anderen Grund. Ihr Scheinauftrag besteht darin, meinen damaligen Zimmergenossen ausfindig zu machen, um etwas wiedergutzumachen, was wir zwar beide getan haben, wofür aber nur er die Schuld auf sich genommen hat. Deshalb wird sich niemand etwas dabei denken, wenn Sie die Archive nach Unterlagen aus dieser Zeit durchstöbern.«
Bosch nickte.
»Das hört sich durchaus glaubhaft an. Stimmt diese Geschichte?«
»Ja.«
»Dann sollte ich besser wissen, was Sie beide angestellt haben.«
»Um ihn zu finden, müssen Sie das nicht wissen.«
Bosch wartete eine Weile, aber mehr rückte Vance zu diesem Thema nicht mehr heraus. Bosch ließ sich den Namen von Vance buchstabieren, bevor er ihn sich notierte, dann klappte er sein Notizbuch zu.
»Eine letzte Frage. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Vibiana Duarte inzwischen tot ist. Aber was ist, wenn sie das Kind bekommen hat und wenn ich Erben finde, die noch am Leben sind? Was soll ich in diesem Fall tun? Soll ich mich mit ihnen in Verbindung setzen?«
»Nein, auf keinen Fall. Sie kontaktieren sie nicht, bevor Sie mich nicht darüber in Kenntnis gesetzt haben. Ich will ihre Abstammung zuverlässig bestätigt haben, bevor ich an sie herantrete.«
»Durch einen Vaterschaftstest?«
Vance nickte und sah Bosch eine Weile prüfend an, bevor er die Schreibtischschublade erneut öffnete. Diesmal entnahm er ihr einen unbeschrifteten gepolsterten Umschlag, den er Bosch zuschob.
»Ich vertraue Ihnen, Mr Bosch. Mittlerweile habe ich Ihnen alles anvertraut, was Sie wissen müssten, um einen alten Mann austricksen zu können, wenn Sie wollten. Aber ich vertraue Ihnen, dass Sie das nicht tun werden.«
Bosch griff nach dem weißen Umschlag. Er war nicht verschlossen. Er schaute hinein und sah ein Glasröhrchen mit einem Tupfer, wie man es für Speichelproben verwendet. Es war Vance’ DNA-Probe.
»Das ist etwas, womit Sie mich hereinlegen könnten, Mr Vance.«
»Inwiefern?«
»Es wäre besser, wenn ich diese Probe selbst genommen hätte.«
»Sie haben mein Wort.«
»Und Sie haben meins.«
Vance nickte, und danach schien es nichts mehr zu sagen zu geben.
»Ich glaube, ich habe vorerst alles, was ich brauche.«
»Dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Mr Bosch.«
»Ja?«
»Ich bin nur neugierig, weil es in den Zeitungsmeldungen über Sie keine Erwähnung fand. Aber von Ihrem Alter her müsste es hinkommen. Was haben Sie während des Vietnamkriegs gemacht?«
Bosch ließ sich mit seiner Antwort Zeit.
»Ich war in Vietnam«, sagte er schließlich. »Zweimal. Wahrscheinlich bin ich öfter in Hubschraubern geflogen, an deren Bau Sie beteiligt waren, als Sie selbst.«
Vance nickte.
»Das kann durchaus sein.«
Bosch stand auf.
»Wie kann ich Sie erreichen, wenn ich weitere Fragen habe oder Ihnen mitteilen möchte, was ich herausgefunden habe?«
»Natürlich.«
Vance öffnete die Schreibtischschublade und nahm eine Visitenkarte heraus. Er reichte sie Bosch mit zitternder Hand. Es war nur eine Telefonnummer daraufgedruckt. Sonst nichts.
»Wenn Sie unter dieser Nummer anrufen, werden Sie mich dranbekommen. Sollte sich eine andere Person melden, stimmt etwas nicht. Vertrauen Sie ihr nicht, nur mir.«
Bosch schaute von der Nummer auf der Karte zu Vance, der in seinem Rollstuhl saß. Seine pergamentene Haut und sein flaumiges Haar waren so brüchig wie trockenes Laub. Beruhte die Vorsicht des alten Mannes auf purer Paranoia, oder waren die Informationen, die er für ihn beschaffen sollte, tatsächlich so brisant?
»Droht Ihnen denn Gefahr, Mr Vance?«, fragte er deshalb.
»Ein Mann in meiner Position befindet sich immer in Gefahr«, erwiderte Vance.
Bosch fuhr mit dem Daumen über die Kante der Visitenkarte. »Sie werden von mir hören.«
»Wir haben noch nicht über Ihr Honorar gesprochen«, sagte Vance.
»Fürs Erste haben Sie mir genug gezahlt. Warten wir erst mal ab, wie sich die Sache weiter entwickelt.«
»Dieser Scheck ist nur dafür, dass Sie hergekommen sind.«
»Ich weiß, aber es ist mehr als genug, Mr Vance. Ist es okay, wenn ich allein rausgehe? Oder löse ich dann einen Alarm aus?«
»Sobald Sie dieses Zimmer verlassen, wissen sie Bescheid und kommen Sie holen.«
Als Vance Boschs verständnislosen Blick bemerkte, fügte er hinzu:
»Das ist der einzige Raum im ganzen Haus, der nicht mit Kameras überwacht wird. Sogar in meinem Schlafzimmer sind Kameras. Aber hier wollte ich meine Privatsphäre gewahrt haben. Sobald Sie hier rausgehen, werden sie kommen.«
Bosch nickte.
»Verstehe. Sie hören von mir.«
Damit verließ er das Zimmer und begann, den Gang hinunterzugehen. Schon nach wenigen Schritten tauchte der Glatzkopf auf und begleitete ihn wortlos durch das Haus und zu seinem Wagen hinaus.
4
Die Bearbeitung kalter Fälle hatte Bosch zu einem Experten für Zeitreisen gemacht. Er wusste, wie man sich in die Vergangenheit begab, um Leute aufzuspüren. In das Jahr 1951 zurückzukehren würde der längste und vermutlich schwierigste Ausflug dieser Art, den er je unternommen hatte, aber er fühlte sich der Aufgabe gewachsen und freute sich auf die Herausforderung.
Als Erstes musste er Vibiana Duartes Geburtsdatum herausfinden. Wie er das am besten anstellte, wusste er. Anstatt nach dem Treffen mit Vance nach Hause zu fahren, machte er sich auf dem Freeway 210 am Nordrand des Valleys entlang auf den Weg nach San Fernando.