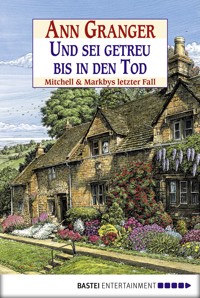4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Um sich über Wasser zu halten, jobbt Fran Varady in einem kleinen Eckladen in London. Eines Tages stürmt ein aufgeregter Kunde in den Shop und bittet sie, die Toilette benutzen zu dürfen. Stunden später wird der Mann dort tot aufgefunden - ermordet. Er hat eine mysteriöse Filmrolle bei sich und eine kurze Notiz mit der Bitte um ein Treffen mit Fran. Diese beginnt wieder einmal auf eigene Faust zu ermitteln und gerät schon bald in Teufels Küche ...
Für Leser gemütlicher Wohlfühlkrimis und Fans von Cherringham.
Beste Krimi-Unterhaltung - die Fran-Varady-Serie von Bestseller-Autorin Ann Granger bei beTHRILLED:
Band 1: Nur der Tod ist ohne Makel. Band 2: Denn umsonst ist nur der Tod. Band 3: Die wahren Bilder seiner Furcht. Band 4: Dass sie stets Böses muss gebären. Band 5: Und hüte dich vor deinen Feinden. Band 6: Denn mit Morden spielt man nicht. Band 7: Und das ewige Licht leuchte ihr.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der Autorin bei beTHRILLEDÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED
Die Cosy-Krimireihe mit Fran Varady:
Band 1: Nur der Tod ist ohne Makel
Band 2: Denn umsonst ist nur der Tod
Band 3: Die wahren Bilder seiner Furcht
Band 4: Dass sie stets Böses muss gebären
Band 6: Denn mit Morden spielt man nicht
Band 7: Und das ewige Licht leuchte ihr
Außerdem sind von Ann Granger folgende Krimireihen bei Bastei Lübbe lieferbar:
Mitchell & Markby
Martin & Ross
Jessica Campbell
Über dieses Buch
Um sich über Wasser zu halten, jobbt Fran Varady in einem kleinen Eckladen in London. Eines Tages stürmt ein aufgeregter Kunde in den Shop und bittet sie, die Toilette benutzen zu dürfen. Stunden später wird der Mann dort tot aufgefunden – ermordet. Er hat eine mysteriöse Filmrolle bei sich und eine kurze Notiz mit der Bitte um ein Treffen mit Fran. Diese beginnt wieder einmal auf eigene Faust zu ermitteln und gerät schon bald in Teufels Küche …
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit ihrer Mitchell-und-Markby-Reihe. Daneben gibt es von Ann Granger noch folgende weitere Reihen: Die Fran-Varady-Reihe, die Jessica-Campbell-Reihe und Kriminalromane im viktorianischen England mit Lizzie Martin und Benjamin Ross.
ANN GRANGER
DIE WAHREN BILDER SEINER FURCHT
FRAN VARADYS DRITTER FALL
Aus dem britischen Englisch von Axel Merz
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1998 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »Running scared«
Originalverlag: Headline Book Publishing, a division of Hodder Headline PLC, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2005/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Gerhard Arth/Stefan Bauer
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7563-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Meinem Sohn Tim, der seine Freizeit geopfert hat,um mir bei meinen Recherchen zu helfen.Danke.
Kapitel 1
Ich gehöre nicht zu der Sorte von Leuten, die alles Mögliche unternehmen, um sich in Schwierigkeiten zu stürzen. Es ist eher so, dass die Schwierigkeiten sich auf mich zu stürzen scheinen. Ich versuche lediglich, von einem zum nächsten Tag zu überleben und Problemen aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, warum es nie funktioniert. Es ist unfair, ganz besonders, wenn die Weihnachtszeit vor der Tür steht und sich alle auf die Feiertage freuen. Aber wie es nun mal so ist mit meinem Glück, genau um diese Zeit rannte ich in den nächsten Berg von Problemen. Wenn man nämlich irgendetwas mit Sicherheit sagen kann auf dieser Welt, dann ist es das, dass man nie sicher sein kann, welchen Knüppel einem das Leben als Nächstes zwischen die Beine wirft.
Es war ein kalter, verregneter Morgen, und ich half meinem Freund Ganesh im Zeitungskiosk seines Onkels, als das Unglück seinen Lauf nahm.
Ganesh arbeitet nicht nur für seinen Onkel Hari, sondern er wohnt auch bei ihm, über dem Laden. Ich weiß nicht, ob Hari ein richtiger Onkel von Ganesh ist oder nur irgendein Verwandter, aber jeder nennt ihn Onkel, selbst ich. Hari ist ein netter Mann, aber nervös und zappelig, und das macht Ganesh zu schaffen. Und so tanzte Ganesh fast vor Freude, als Onkel Hari eines Tages verkündete, dass er einen ausgedehnten Familienbesuch in Indien zu unternehmen gedachte und Ganesh in der Zwischenzeit den Laden alleine führen sollte.
Ich freute mich für Ganesh, weil es allerhöchste Zeit für ihn wurde, dass er eine Chance bekam, etwas zu tun, ohne dass sich die Familie ständig einmischte. Sein ganzes Leben lang hatte er in irgendwelchen Läden ausgeholfen, die von irgendwelchen Verwandten geführt wurden. Er hatte seinen Eltern in deren Gemüseladen in Rotherhithe ausgeholfen, bis das Haus von der Stadtverwaltung enteignet worden war, weil die ganze Gegend abgerissen werden sollte, um modernen Neubauten zu weichen. Jetzt haben sie ein Obst- und Gemüsegeschäft außerhalb der Stadt in High Wycombe. Es ist ein sehr kleines Geschäft, und sie brauchen Ganesh nicht und haben auch keinen Platz für ihn, deshalb wohnt und arbeitet er zurzeit bei Onkel Hari. Manchmal frage ich ihn, warum er sich das gefallen lässt, so in der Familie herumgeschubst zu werden, immer dorthin, wo er gerade gebraucht wird, aber er antwortet immer nur, das würde ich nicht verstehen. Ganz richtig, sage ich dann, das verstehe ich nicht. Erklär es mir doch. Und er meint nur, welchen Sinn würde es machen?
Er ist wirklich fähig, und wenn er endlich seine eigene Wohnung hätte, würde er prima zurechtkommen. Ich wünschte nur, er würde seinen Traum von einer eigenen chemischen Reinigung aufgeben. Er hat die verrückte Idee, dass er und ich irgendwie gemeinsam so was machen könnten. Keine Chance, sage ich ihm immer wieder. Ich hab keine Lust, mein Leben damit zu verbringen, die dreckigen Klamotten anderer Leute anzunehmen, und ich hasse diesen chemischen Geruch und den Dampf in diesen Läden.
Allerdings hatte ich nichts dagegen, Ganesh in dem kleinen Zeitungsladen ein wenig zur Hand zu gehen, während sein Onkel Hari in Indien war, besonders morgens, wenn es am meisten zu tun gab. Und da Weihnachten vor der Tür stand, würde es wohl bald den lieben langen Tag hektisch werden. Hari hatte Ganesh erlaubt, mich als Teilzeitkraft einzustellen, und ich brauchte das Geld. An dieser Stelle möchte ich klarstellen, dass ich eines Tages Schauspielerin sein werde – fast hätte ich schon einen Abschluss in Schauspielkunst gehabt –, doch in der Zwischenzeit nehme ich jede anständige Arbeit an, die sich mir bietet, einschließlich inoffizieller Ermittlungen.
Und so fuhr Onkel Hari davon und hinterließ Ganesh drei Seiten Papier, vollgeschrieben mit minutiösen Instruktionen in geschwungener Schreibschrift, und ich tauchte an meinem ersten Arbeitstag frisch und munter Punkt acht Uhr auf. Ganesh war schon seit sechs Uhr dort, aber ich habe meine Grenzen. Alles lief reibungslos, jedenfalls zunächst, und ich genoss das Gefühl, endlich wieder eine richtige Arbeit zu haben. Es war eine ziemlich interessante Arbeit in Onkel Haris Laden, und am Ende der ersten Woche bekam ich meine Lohntüte und fühlte mich endlich als richtiges Mitglied der Gesellschaft. Nur, dass es nicht anhalten sollte. Ich hätte es wissen müssen.
Es war am darauf folgenden Dienstag, als die Dinge anfingen, aus dem Ruder zu laufen. Die Woche hatte gut angefangen. Ganesh und ich hatten den Sonntag damit verbracht, im Laden Weihnachtsdekorationen aufzuhängen. Ganeshs Vorstellung davon, wie eine Dekoration auszusehen hat, besteht aus Rot, massenweise Rot, und Gold, womöglich noch mehr Gold, aufgelockert durch ein gelegentliches leuchtendes Rosa oder strahlendes Türkis. Als wir mit dem Dekorieren fertig waren, sah der Laden fantastisch aus – wahrscheinlich mehr nach Diwali als nach Weihnachten, aber Ganesh und ich waren vollauf zufrieden mit unserem Werk.
Den ganzen Montag heimsten wir Komplimente von der Kundschaft ein und sonnten uns darin. Dann, am Dienstag, kam eine Postkarte vom Taj Mahal. Onkel Hari hatte geschrieben, und die Stimmung änderte sich. Ganesh summte nicht mehr munter vor sich hin, sondern lief mit gesenktem Kopf unter den Girlanden aus rotem Krepp hindurch. Er hatte die Postkarte an das mit goldenen Troddeln geschmückte Zigarettenregal hinter der Ladentheke geklemmt und warf immer wieder verstohlene Blicke auf das Bild.
Ich hatte mir bereits gedacht, dass Ganesh etwas ausheckte, weil er im Verlauf der letzten Woche eine Reihe verstohlener Anrufe getätigt hatte und zufrieden mit sich und der Welt aussah. Ich wusste, dass es nicht allein die bevorstehenden Weihnachtstage sein konnten und die Aussicht auf den zu erwartenden guten Umsatz. Ich sah ihm an, dass er darauf brannte, es mir zu erzählen, ganz besonders im Verlauf des Sonntags, während wir die Dekoration anbrachten, doch ich zeigte ihm nicht, wie unglaublich groß meine Neugier war. Mit dem Eintreffen der Postkarte war es mit Ganeshs zufriedener Selbstsicherheit vorbei, und er sah immer sorgenvoller aus. Schließlich rückte er mit der Sprache heraus.
Wir machten gerade Frühstückspause. Der morgendliche Stoßbetrieb hatte nachgelassen, und im Augenblick war niemand außer uns im Laden. Der leere, regennasse Bürgersteig draußen ließ vermuten, dass es tagsüber ruhig bleiben würde, bevor das Abendgeschäft wieder einsetzte. Wir mussten nicht extra nach oben in die Wohnung gehen, um uns Kaffee zu machen, da wir unten im Laden einen elektrischen Wasserkocher hatten, den ich im Waschraum mit Wasser füllte.
Das Gebäude war alt und vor langer Zeit umgebaut worden. Früher einmal war es sicher ein sehr hübsches Haus gewesen. Es gibt zwei Treppen nach oben in die Wohnung, eine vom Laden aus, die ehemalige Hintertreppe, und eine durch einen separaten Eingang von der Straße her. Der Waschraum war nachträglich an der Rückseite des Hauses angebaut worden, ein Museum aus freiliegenden Bleirohren und Armaturen, damals wahrscheinlich der Gipfel des Modernen. Es war alles so sauber, wie es angesichts des allgemeinen Zustands nur möglich war, doch das war auch schon alles. Das Waschbecken hing schief an der Wand, der Wasserhahn tropfte. Die Fliesen an den Wänden waren gesprungen, und zwischen den Bodenfliesen gab es breite Spalten. Der Lüftungsventilator war mit Staub und toten Fliegen verstopft. Der Wasserbehälter des Klos hing hoch oben an der Decke, und die Spülung wurde mit einer Kette ausgelöst. Der Kasten gab jedes Mal ein lautes Klacken von sich, wenn man an der Kette zog, und der Deckel saß locker und drohte einem auf den Kopf zu fallen, wenn man nicht Acht gab. Das Klo selbst war ein pièce de résistance. Ein Original, kein Witz, über und über mit einem Muster aus blauen Vergissmeinnicht verziert. Die Brille war aus Holz und besaß einen Riss, der einen in den Hintern zwickte. Ich kann Ihnen sagen, dieser Waschraum war nur auf eigene Gefahr benutzbar. Ich nannte ihn die »Kammer des Schreckens«.
Um fair zu sein, auch Ganesh hatte mit Onkel Hari wegen des Zustands des Waschraums geschimpft, seit er bei ihm eingezogen war. Doch wann immer er Hari angesprochen hatte, die Antwort hatte stets gleich gelautet: Hari war kein reicher Mann, der es sich leisten konnte, Dinge einfach so gegen neue zu ersetzen. »Außerdem«, hatte er erklärt, »sieh dir doch nur diese wunderbare Kloschüssel an! Wo sollte ich so eine Antiquität wohl wieder herbekommen?«
Er versprach üblicherweise, einen neuen Wasserhahn zu besorgen, doch selbst das wurde immer wieder aufs Neue verschoben.
An diesem Morgen jedenfalls steuerte ich mit je einem Becher Kaffee in der Hand die Ladentheke an und sagte unwirsch: »Du könntest ja wenigstens diesen tropfenden Wasserhahn reparieren, Ganesh, während Onkel Hari im Urlaub ist.«
Bei meinen Worten hellte sich Ganeshs düstere Miene sichtlich auf. Er kicherte, trommelte mit den Knöcheln auf die Theke, und gerade als ich dachte, jetzt sei er völlig übergeschnappt, rückte er mit seinem Geheimnis heraus.
»Ich kann noch etwas viel Besseres, Fran. Ich werde das ganze Ding renovieren lassen, während Onkel Hari nicht da ist. Raus mit dem alten Mist und alles brandneu!«
Er strahlte mich an. Ich stand da, verschüttete vor Schreck fast meinen Kaffee und starrte ihn mit offenem Mund an. Ich hatte nur an einen neuen Wasserhahn gedacht. Ganesh musste eine Ausgabe von Homes and Gardens aus dem Regal genommen und darin gelesen haben. Offensichtlich waren ihm die schönen Bilder zu Kopf gestiegen.
»Hari wird sicher nicht damit einverstanden sein!«, sagte ich.
»Onkel Hari weiß nichts davon, nicht bevor er zurückkommt, und dann ist es bereits zu spät, ein Fait accompli, wie man so etwas wohl nennt.«
»Man nennt so etwas einen hysterischen Anfall«, entgegnete ich. »Das wird Onkel Hari nämlich bekommen, wenn er die Rechnung sieht.«
Ganesh nahm mir einen Becher Kaffee aus der Hand und sah mich nicht mehr ganz so selbstgefällig an. »Onkel Hari hat mir die Leitung des Geschäfts überlassen, richtig?«, sagte er halsstarrig. »Ich bin befugt, Schecks zu unterschreiben, richtig? Also werde ich den Anbau renovieren lassen, und er kann überhaupt nichts dagegen tun, auch wenn es ihm nicht passt. Was soll er denn machen? Mich rauswerfen? Ich gehöre zur Familie, er kann mich nicht rauswerfen. Außerdem kenne ich den alten Geizkragen. Er sträubt sich ständig, für irgendetwas Geld auszugeben, aber wenn es erst einmal ausgegeben ist, dann findet er sich damit ab. Wenn er erst sieht, wie schön es geworden ist und dass die Kosten im Rahmen geblieben sind, dann kommt er darüber hinweg. Es wertet das Haus auf. Das ist etwas Gutes. Und wenn er immer noch zetert, dann sage ich ihm einfach, der alte Waschraum hätte gegen die Vorschriften über Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz verstoßen, was wahrscheinlich nicht einmal gelogen ist.«
Ich spielte den Advocatus Diaboli. Irgendjemand musste es tun. Ganesh war einfach zu überzeugt von seiner Idee. »Es wird ein Vermögen kosten!«, sagte ich.
»Nein, wird es nicht. Ich habe einen vernünftigen Kostenvoranschlag. Absolut preiswert. Der Typ kann am Freitag mit der Arbeit anfangen und ist Ende nächster Woche fertig, ganz bestimmt.«
Ich setzte mich auf den Hocker hinter der Theke und nippte an meinem Kaffee. Alles klang irgendwie viel zu einfach. »Wieso ist es so billig?«, fragte ich. »Sämtliche Armaturen müssen rausgerissen und neue eingebaut werden. Der Ventilator hat meines Wissens noch nie funktioniert und muss ebenfalls ersetzt werden. Die Leitungen sind alt. Die Wände müssen gestrichen werden, die Fliesen neu verlegt …«
»Alles berücksichtigt«, sagte Ganesh unbekümmert. »Und er übernimmt die Entsorgung der alten Armaturen und des restlichen Schutts.«
»Wer?«, fragte ich misstrauisch.
Ganeshs Aura der Zuversicht schwand ein klein wenig. »Hitch«, sagte er.
Ich prustete in meinen Kaffee. »Hitch? Bist du wahnsinnig?«
»Hitch leistet gute Arbeit«, entgegnete Ganesh halsstarrig. »Und er ist preiswert.«
»Er ist nur deshalb so preiswert«, entgegnete ich, »weil das ganze Material, das er verwendet, von irgendeinem Bauhof geklaut wurde.«
»Nein, wurde es nicht! Oder jedenfalls diesmal nicht. Das war das Erste, was ich mit ihm abgeklärt habe. Glaubst du, ich bin blöde? Es ist alles vollkommen legal. Er hat mir die Namen seiner Lieferanten genannt. Ich kann bei ihnen anrufen, wenn ich will – und das werde ich auch tun, bevor Hitch anfängt. Ich bin nicht blöde, Fran!«
Ich hätte widersprechen können, und vielleicht hätte ich es tun sollen, doch letzten Endes ging es mich nichts an. Ich zweifelte nicht daran, dass Hitch ihm die Telefonnummer eines »Lieferanten« gegeben hatte. Doch ich war bereit zu wetten, dass sich am anderen Ende der Leitung irgendein Kumpan von Hitch verbarg, der in irgendeiner Garage saß, die bis unter die Decke mit gestohlenem Baumaterial voll gestopft war. Ganesh ist eigensinnig und weiß alles immer besser als andere. Er hätte nicht auf mich gehört. Warum also ließ ich ihn nicht einfach machen? Ein neuer Waschraum wäre schließlich ganz hübsch. Doch die Tatsache, dass von allen Leuten ausgerechnet Ganesh sich so benahm, erschreckte mich ein wenig. Er war für gewöhnlich so sensibel und untersuchte die Dinge stets von allen Seiten. Er handelte niemals unbesonnen, spielte nie und tat nichts, das seiner Familie Sorgen machen könnte (außer, dass er mit mir befreundet war, heißt das, worüber sie sich zu Tode sorgten).
Ich beließ es also dabei und konzentrierte mich auf meinen Kaffee. Ganesh war offensichtlich der Meinung, er hätte die Auseinandersetzung gewonnen, und so kehrte seine gute Laune zurück. Im Laden herrschte eine Atmosphäre von Waffenstillstand.
In diesem Augenblick wurde die Ladentür geöffnet. Zuerst spürte ich lediglich einen kalten Luftzug, der die Illustrierten in den Regalen und die Kreppgirlanden rascheln ließ. Eine Girlande aus ineinander verschlungenem rotem und türkisfarbenem Krepp fiel herab. Ein Schwall Regen prasselte auf die Fliesen. Weiterer Flitter fiel von den Regalen. Ganesh und ich sahen auf.
In der Tür war die Silhouette eines Mannes zu erkennen. Er blieb nur kurz dort stehen, stützte sich mit einer Hand am Türrahmen ab, dann stolperte er zur Ladentheke und packte sie, um sich festzuhalten. Ganesh streckte die Hand nach dem Brecheisen aus, das er zum Öffnen von Kisten und zum Verjagen von Betrunkenen unter der Ladentheke aufbewahrte. Ich stand wie angewurzelt da, fasziniert und entsetzt zugleich.
Ich starrte in eine Halloweenmaske – weit aufgerissener Mund, hervorquellende Augen, blutverschmiertes Gesicht und eine klaffende Wunde über der Augenbraue. Noch mehr Blut lief aus beiden Nasenlöchern. Ich wusste, dass ich etwas unternehmen musste, doch ich konnte mich nicht bewegen. Die Finger krallten sich in die Ladentheke, und aus dem Mund des Mannes kamen unartikulierte Laute. Mit einem letzten kehligen Gurgeln brach er zusammen und sackte vor der Theke zu Boden. Silbernes Lametta segelte hinter ihm her.
Wir erwachten aus unserer Erstarrung und rannten um die Theke herum. Der Fremde saß mit dem Rücken an die Theke gelehnt auf dem Boden, die Beine weit von sich gestreckt, der blutige Kopf grotesk geschmückt mit Lamettafäden.
»Jesses!«, rief Ganesh. »Hol ein Handtuch, Fran!« Er rannte zur Tür, blickte die Straße hinauf und hinunter, drehte das Schild an der Tür auf »GESCHLOSSEN« und sperrte die Tür ab. Wer auch immer den Fremden so zugerichtet hatte, wir wollten nicht, dass er uns einen Besuch abstattete.
Wir befreiten den Verwundeten von seinem Lamettaschmuck, halfen ihm auf die Beine und schoben ihn ins Lager. Er stolperte ächzend zwischen uns her, anscheinend unverwundet bis auf das schlimm zugerichtete Gesicht.
Wir setzten ihn auf einen Stuhl, und ich riss eine Packung Kleenex auf, um das Blut abzuwischen.
»Hast du nichts anderes?«, zischte Ganesh, der selbst in einem Augenblick wie diesem nicht vergaß, dass er diese Packung nun als nicht verkauft abschreiben musste. »Hättest du denn kein Toilettenpapier nehmen können?«
»Mach einen heißen Tee!«, schnappte ich statt einer Antwort.
Unser Patient stieß ein Röcheln aus, dann schien er allmählich wieder zu klarem Verstand zu kommen. Seine Nase hörte nicht auf zu bluten, also stopfte ich ihm zusammengeknüllte Pfropfen aus Kleenex in die Nasenlöcher und sagte ihm, er solle durch den Mund atmen.
Ganesh kehrte mit einem Becher Tee zurück.
»Da’ke sehr«, murmelte der fremde Mann.
»Was ist denn passiert, Kumpel?«, fragte Ganesh. »Wurden Sie überfallen? Möchten Sie, dass ich die Polizei rufe?«
»’ein!«, rief der andere erschrocken und verschüttete beinahe seinen Tee.
»Bleiben Sie ruhig!«, befahl ich. »Sie fangen sonst wieder an zu bluten! Vielleicht sollten wir ihn ins Krankenhaus bringen, Gan. Er hat sich möglicherweise die Nase gebrochen.«
»’ein! ’ein! Ich will ’icht i’s Kra’ke’haus!« Der Fremde sah ein, dass mit den beiden Pfropfen in der Nase keine vernünftige Unterhaltung möglich war, also entfernte er die blutgetränkten Kleenexbällchen und warf sie in den Papierkorb. Ich wartete auf einen neuerlichen roten Wasserfall, doch er kam nicht. Meine erste Hilfe hatte funktioniert.
»Keine Polizei«, sagte er entschlossen. »Kein Krankenhaus. Mir geht es schon wieder besser.«
»Wie Sie meinen, Kumpel«, sagte Ganesh einigermaßen erleichtert. Er wollte nicht, dass die Polizei in seinen Laden kam. So etwas schreckte die Kundschaft ab. Genauso wenig, wie er den Mann zum nächsten Krankenhaus fahren wollte. »Wenn Sie meinen, alles wäre in Ordnung, dann ist es wohl so, Kumpel. Sie hatten einfach Pech, wie? Normalerweise ist die Gegend hier am helllichten Tag sicher.«
Das Opfer murmelte Zustimmung. »Ja. Ich hatte wohl einfach Pech.«
Ich fragte mich, ob er uns Einzelheiten verraten würde, doch offensichtlich hatte er das nicht vor. Er klopfte die Innentasche seines Mantels ab und anschließend die Seitentaschen. Schließlich fand er ein Taschentuch, mit dem er vorsichtig über sein geschwollenes Gesicht rieb. Als er es wieder wegnahm, war es blutig. Er betrachtete das Blut interessiert.
Ganesh wurde unruhig. »Hören Sie, Kumpel, ich muss den Laden wieder aufmachen. Ich kann nicht noch länger warten. Ich büße Umsatz ein. Sie können hier sitzen, solange Sie wollen, okay? Lassen Sie sich ruhig Zeit.«
»Es tut mir wirklich Leid.« Unser Besucher sah uns gramvoll an. Er steckte sein Taschentuch wieder ein und kramte erneut in der Innentasche seines Mantels. »Ich sehe ein, dass Sie Umsatz eingebüßt haben. Warten Sie, ich möchte es wieder gutmachen.«
Bis zu diesem Augenblick hatten weder Ganesh noch ich daran gezweifelt, dass der Fremde überfallen worden war. Deswegen waren wir beide ein wenig überrascht, als er eine Brieftasche zückte und dieser einen Zehner entnahm. Er hatte nicht allein in der Brieftasche gesteckt, sondern in reichlich viel Gesellschaft – soweit ich erkennen konnte, befanden sich wenigstens noch ein Zwanziger und ein paar Fünfer darin.
Ich warf Ganesh einen fragenden Blick zu. Er dachte das Gleiche wie ich. Der Fremde war nicht überfallen und beraubt worden. Wenn Räuber Zeit genug fanden, ein Opfer so zuzurichten wie den Fremden, dann hatten sie auch genug Zeit, um ihn von oben bis unten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Abgesehen von der Brieftasche hatte er auch noch seine Armbanduhr am Handgelenk sowie einen goldenen Siegelring am Finger. Ich konnte die Initialen nicht erkennen. Leider. Sie waren ineinander verschlungen und verschnörkelt, aber ich meine, ein »C« wäre darunter gewesen.
Unser Besucher sah uns beunruhigt an. Er hatte unseren Blickwechsel missverstanden. »Ist es nicht genug?«, fragte er.
»Nein. Ich meine ja, selbstverständlich reicht es!« Ganesh nahm den Zehner entgegen. Wir hatten schließlich den Laden für eine Weile schließen müssen.
Ich musterte unseren Gast ein wenig genauer. Plötzlich erschien er mir höchst interessant. Er war Mitte dreißig, groß gewachsen und trug unter dem dunkelgrauen Mantel einen dunklen Anzug. Das weiße Hemd war blutbesudelt, und die Krawatte saß schief. Sein verletztes Auge war inzwischen zugeschwollen. Er sah immer noch nicht wieder fit aus, doch selbst in diesem Zustand war er ein attraktiver Bursche. Andererseits glaubte ich etwas zu erkennen, das nicht so recht ins Bild passte. Er war angezogen wie ein Geschäftsmann, doch er sah nicht danach aus, als würde er tagaus, tagein in einem Büro arbeiten. Ein schwacher Geruch nach Nikotin verriet mir, dass er ein starker Raucher sein musste, und Büros waren heutzutage eher rauchfreie Zonen. Man kann die Vertriebenen überall sehen, wie sie sich unten auf der Straße unglücklich vor den Eingängen herumdrücken und an ihren Glimmstängeln ziehen, während sie gleichzeitig Schutz vor dem Regen suchen.
Andererseits sah er auch nicht aus wie jemand, der sein Leben im Freien verbrachte, auch wenn seine Haut eine frische Bräune aufwies. Vielleicht war er im Urlaub gewesen. Es war nicht fair, unter den gegebenen Umständen ein Urteil zu fällen, doch in meinen Augen passten sein Anzug und sein Mantel nicht so recht ins Bild. Sie wirkten zu neu und zu wenig unmodisch, die Sorte Kleidung, die man im Schrank behielt für die seltene Gelegenheit, bei der man Eindruck erwecken wollte, und die man längst nicht Tag für Tag trug. Seine Hose wurde nicht von einem dieser schicken Gürtel mit schicker Schnalle gehalten, sondern von einem dicken Ledergürtel mit einer Messingschließe, die definitiv nach Freizeitkleidung aussah.
Verstehen Sie nun, warum ich mich selbst für eine ziemlich gute Detektivin halte? Mir fallen Dinge wie diese auf. Sie kennen meine Methoden, Watson. Hier, so schlussfolgerte ich, hatten wir einen relativ jungen Mann vor uns, der normalerweise in Freizeitkleidung herumlief und heute ausnahmsweise geschäftsmäßig ausstaffiert das Haus verlassen hatte. Warum? Um jemanden zu beeindrucken. Keine Frau. Nicht in diesem Mantel. Nein, einen Kerl, und zwar von der Sorte, die in schicken Anzügen rumlief und wenig beeindruckt war von Khakihosen und Lederjacke. Er war also losgegangen, um ein Geschäft abzuschließen, doch wem auch immer er begegnet war, die Sache war schief gelaufen. Wahrscheinlich waren es mehrere gewesen, denn unser Freund hier sah aus, als wäre er durchaus imstande, sich eines einzelnen Angreifers zu erwehren. Ich war bereit zu wetten, dass er sich mit irgendeinem halbseidenen Typen getroffen hatte, vielleicht sogar mit jemandem, der einen Gorilla bei sich hatte. Die Sache war nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Er hätte nicht alleine gehen sollen. Es sei denn natürlich, er hatte einen guten Grund, sein Geschäft geheim zu halten.
»Ich will keinen Ärger«, sagte Ganesh in diesem Augenblick. »Wer auch immer hinter Ihnen her ist, glauben Sie, sie lauern noch draußen und suchen nach Ihnen? Könnte es sein, dass sie hereinkommen?« Bevor der Fremde antworten konnte, fügte er hinzu: »Hören Sie, ich will ja nicht neugierig sein, aber Sie wurden nicht überfallen, habe ich Recht?«
»Ein Räuber hätte Sie niedergeschlagen, während der andere Ihre Wertsachen an sich genommen hätte«, gab ich meinen Senf dazu. »Wir wollen Folgendes damit sagen: Wenn Sie eine private Auseinandersetzung hatten, dann ist das Ihre Angelegenheit. Wir wollen nicht, dass der Laden zu Schaden kommt.«
»Ich glaube nicht, dass die Versicherung in diesem Fall zahlen würde«, fügte Ganesh hinzu, »schon allein deswegen, weil wir die Polizei nicht gerufen haben.«
Der Fremde nahm sich Zeit, bevor er antwortete, und ich konnte es ihm nicht verdenken. »Ich verstehe Ihren Standpunkt«, sagte er schließlich. »Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob draußen jemand auf mich wartet oder nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass mich niemand gesehen hat, als ich hier hereingekommen bin. Aber vielleicht suchen sie noch nach mir.«
Er machte Anstalten, sich von seinem Stuhl zu erheben. »Machen Sie sich keine Gedanken wegen mir«, sagte er. »Ich gehe das Risiko ein.«
Er klang tapfer und verzweifelt, wie der arme Kerl, der mit Scott zusammen in die Antarktis gefahren und nach draußen in den Schnee gegangen war, als die Vorräte zur Neige gingen. Die ganze Situation schien eine Reaktion von unserer Seite geradezu herauszufordern. Nicht zum ersten Mal machte ich den Mund auf, wo ich besser geschwiegen hätte.
»Ich sage Ihnen, was wir machen«, sagte ich. »Ich schlüpfe durch die Hintertür nach draußen und komme vorne herum wieder rein, als wäre ich ein gewöhnlicher Kunde, während ich mich umsehe, ob draußen jemand lauert.«
»Pass aber auf«, mahnte Ganesh besorgt.
Ich hatte noch eine Frage an den Fremden. »Nach wem soll ich Ausschau halten?«
»Sie sitzen in einem Wagen«, sagte er. »Einem silbergrauen Mercedes. Sie haben an der Ampel am Ende des Blocks gehalten. Ich konnte die Tür aufstoßen und mich auf die Straße rollen.«
»Sie« sind wohl zu sorglos gewesen, dachte ich, und haben ihren Mann verloren. Wer auch immer sie bezahlte, er war bestimmt nicht erfreut. Sie würden Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihren Mann wiederzufinden.
»Ich wäre fast von einem verdammten Bus überfahren worden!«, sagte unser mitgenommener Besucher aufgebracht.
»Haben Sie sich die blutige Nase beim Rausspringen geholt?«, fragte Ganesh.
»Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Schauen Sie, wenn Sie einen Wagen sehen mit zwei Typen drin, einer groß mit einem Pferdeschwanz, der andere klein, das sind die Kerle. Ich schätze, sie haben nicht gesehen, wie ich in Ihr Geschäft gerannt bin. Ich schätze, als sie eingesehen haben, dass ich ihnen entkommen bin, haben sie gemacht, dass sie von hier wegkommen.« Er wurde richtiggehend munter. In mir keimte der Verdacht, dass unser Gast nicht zum ersten Mal in so einer Situation gewesen war, aus der er sich um Haaresbreite befreit hatte. Das Ganze wurde von Minute zu Minute merkwürdiger.
»Warum haben sie es getan?«, hörte ich mich fragen.
»Ein Missverständnis«, entgegnete er, und ich merkte sofort, dass er nicht bereit war, mehr zu verraten. Ich hatte allerdings auch nicht mehr erwartet.
»Pass auf dich auf«, murmelte Ganesh einmal mehr.
»Keine Sorge, Ihnen passiert schon nichts«, sagte unser Gast wenig galant. »Die Kerle rechnen nämlich nicht mit einer Frau.«
Ich hoffte inbrünstig, dass er Recht hatte, während ich mich aus der Hintertür stahl, den Kragen meiner fleecegefütterten Baumwolljacke hochschlug, um den Regen abzuhalten und mein Gesicht zu verbergen, und mich die an der Rückseite des Hauses verlaufende Gasse entlang in Bewegung setzte. Ich gelangte in die Seitenstraße und von dort zurück zur Hauptstraße.
Dort gab es eine Bushaltestelle, wo ich mich ein wenig herumdrückte, als wartete ich auf den Bus, während ich den Verkehr beobachtete. Es herrschte ziemlich viel Betrieb auf der Straße – Taxis, Lieferwagen, Limousinen, ein oder zwei Motorräder. Kein Mercedes. Eine doppelte gelbe Linie verbot auf der ganzen Länge das Parken, und das einzige Fahrzeug, das am Straßenrand stand, war ein roter Lieferwagen der Post.
Ich wandte mich ab und lehnte mich lässig an den Metallpfosten. Die Leute auf dem Bürgersteig waren der ganz gewöhnliche Mob, hauptsächlich Frauen um diese Tageszeit, manche mit kleinen Kindern. Ein oder zwei heruntergekommen aussehende Gestalten kamen vorbei, aber keiner von ihnen sah aus wie ein Schläger, und keiner besaß einen Pferdeschwanz. Es war eine offene Bushaltestelle ohne Dach, und ich wurde allmählich nass. Ich hob die Hand, um mir das Wasser aus den Haaren zu streichen. Einen Sekundenbruchteil später hörte ich hinter mir dumpfes Reifenquietschen. Ich hatte so angestrengt die Straße entlang gesehen, dass ich die Ankunft des Doppeldeckerbusses völlig überhört hatte. Eine Frau stieg aus. Der Fahrer spielte erwartungsvoll mit dem Gaspedal, und ich begriff, dass er mich zum Einsteigen aufforderte.
»Kommen Sie jetzt oder nicht?«, rief er mir entgegen. Ich winkte ab. »Sie haben mich aber rangewinkt!«, schnauzte er.
»Nein, habe ich nicht!«, schnauzte ich zurück.
»Haben Sie verdammt noch mal wohl! Sie haben die Hand ausgestreckt!«
»Nein, habe ich nicht. Ich hab mir den Kopf gerieben.«
»Ich muss meinen Fahrplan einhalten, wissen Sie?«, informierte er mich.
»Nun, dann fahren Sie doch weiter, und halten Sie ihn ein!« Ich hatte genug von diesem Geschwätz.
Er bedachte mich mit einem gemeinen Blick und beschleunigte den schweren Bus. Er gehörte offensichtlich zu jenen, die den Geist der Weihnacht einfach nicht begriffen hatten.
Falls uns jemand beobachtet hatte, war meine Tarnung aufgeflogen, also konnte ich genauso gut in den Laden zurückkehren und melden, dass die Luft, soweit ich es beurteilen konnte, wieder rein war.
Ich schlenderte zum Laden. Ganesh stand hinter der Glastür, eingerahmt in Gold, und spähte zwischen einem Sticker mit Mars-Reklame und einem zweiten mit Werbung für Rizla-Zigarettenpapier hindurch. Auf mein Nicken hin drehte er das »GESCHLOSSEN«-Schild um und sperrte die Tür wieder auf.
»Ich konnte niemanden sehen«, sagte ich und wischte mir die herablaufenden Regentropfen aus dem Gesicht. »Ich hatte einen Streit mit einem Busfahrer, weiter nichts. Wo steckt unser Freund?«
»Er macht sich im Waschraum sauber.«
»Hoffentlich verschmiert er nicht alles mit seinem Blut. Wenn Hitch erst mit dem Renovieren fertig ist, bist du bestimmt wählerischer, wen du dort hineinlässt. Hast du unseren Besucher wegen dem losen Deckel auf dem Wasserkasten gewarnt? Wäre eine Schande, wenn er sich in dem Waschraum noch schlimmere Verletzungen zuziehen würde, als er ohnehin schon hat. Er könnte dich verklagen. Er könnte seinen Zehner zurückverlangen.«
»Ich habe ihn gewarnt«, erwiderte Ganesh gereizt.
Die Spülung wurde lautstark betätigt, und dann kam der Fremde wieder heraus. Er hatte sich alles Blut abgewaschen, seinen Mantel abgerieben, und abgesehen von den Schwellungen war auf den ersten flüchtigen Blick nicht mehr zu erkennen, dass er erst kurze Zeit zuvor in ernsten Schwierigkeiten gesteckt hatte. Ich sagte ihm, dass ich draußen weder einen Mercedes noch einen Schläger mit Pferdeschwanz gesehen hätte.
»Dann ist ja alles in Ordnung«, sagte er. »Ich dachte mir schon, dass sie verschwunden sind. Sie haben nicht gesehen, wie ich den Laden betreten habe. Die ganze Aufregung war umsonst.«
Er hatte sein Selbstvertrauen völlig zurückgewonnen und war durchaus imstande, allein mit seinen Problemen fertig zu werden. Ich wünschte trotzdem, ich hätte gewusst, was das für Probleme waren.
»Ich danke Ihnen vielmals«, sagte er freundlich. »Ich weiß zu schätzen, was Sie für mich getan haben.«
Mit diesen Worten öffnete er die Tür und schlüpfte nach draußen. Hastig sah er sich in beide Richtungen um, dann ging er rasch davon.
Eine weitere Papiergirlande segelte herab.
»So viel dazu«, sagte Ganesh. »Ein wenig Abwechslung am frühen Morgen, würde ich sagen.«
»Ich wünschte nur, ich wüsste, was das alles zu bedeuten hat«, sagte ich versonnen und erzählte Ganesh, was ich von unserem Besucher dachte. »Es ist alles nur geraten und Vermutungen«, fügte ich hinzu, »aber man weiß eben immer gerne, ob man richtig gelegen hat.«
»Du wüsstest es gerne«, entgegnete er. »Lass mich außen vor. Ich bin sicher, es ist besser, wenn wir es nicht wissen.« Ganesh öffnete die Kasse, nahm zwei Fünfer heraus, legte den Zehner hinein und schloss die Lade wieder. Er reichte mir einen Fünfer und steckte den anderen in seine Jackentasche.
»Das haben wir uns verdient«, sagte er.
Wir? Soweit ich mich erinnern konnte, war ich diejenige, die nach draußen in den Regen gegangen war und sich möglicherweise zu einer Zielscheibe für Ärger gemacht hatte. Ganesh war im warmen Laden geblieben und hatte Tee gekocht. Aber man sollte nie mit dem Mann streiten, der das Geld in den Fingern hält.
»Vermutlich werden wir es nie erfahren«, sagte ich und steckte meinen Fünfer ein.
Doch ich sollte mich irren, und Ganesh sollte wie üblich Recht behalten. Wir würden herausfinden, was das alles zu bedeuten gehabt hatte – und es wäre besser gewesen, wenn wir es nicht erfahren hätten.
Kapitel 2
Um ein Uhr mittags verließ ich den Laden. Es war ruhig geblieben, nachdem unser Besucher gegangen war; der Regen hielt die Kundschaft entweder im Haus oder ließ sie vorbeihasten auf dem Weg zum nächsten trockenen Fleck. Während wir die heruntergefallene Weihnachtsdekoration wieder befestigt hatten, waren Ganesh und ich das morgendliche Hauptereignis noch einmal durchgegangen. Die Sache blieb ein Rätsel, und weil wir es nicht lösen konnten, redeten wir über Onkel Hari, dessen Postkarte uns anklagend von ihrem Platz im Regal zu beobachten schien. Wir stritten über den Waschraum und Onkel Haris bevorstehende Rückkehr und ein halbes Dutzend andere Dinge. Gerade als ich gehen wollte, schenkte Ganesh mir einen Riegel Mars. Vielleicht dachte er, er schuldete mir einen Bonus, weil ich nach draußen in den Regen gegangen und die Gegend um den Laden herum ausgekundschaftet hatte, oder vielleicht hatte er Schuldgefühle, weil er zugelassen hatte, dass ich gegangen war. Ich steckte den Riegel jedenfalls ein.
Auf dem Weg kam ich an einem Supermarkt vorbei. Ich ging hinein und kaufte von meinem Fünfer eine Packung Tee, Nudeln und ein Glas Pesto. Die Erinnerungen an den morgendlichen Zwischenfall begannen zu verblassen. Es war einfach eine Reihe hektischer Momente gewesen, wie sie sich von Zeit zu Zeit ereigneten. Wie ein Stein, der in einem Teich landete, rührten sie für eine Weile die Oberfläche auf, erzeugten Wellen, und danach beruhigte sich alles wieder.
»Haben Sie vielleicht ein wenig Kleingeld?«
Ich hörte die Frage, obwohl sie nicht an mich gerichtet war. Sie kam von einem Hauseingang ein kleines Stück weiter vorn. Sie war an einen wohlhabend aussehenden älteren Herrn gerichtet.
»Haben Sie ein wenig Kleingeld, Sir?« Sie betonte das letzte Wort. Sie klang herzergreifend. Der ältere Herr schwankte, wollte an seinen Prinzipien festhalten und weitergehen, doch er konnte nicht, nicht angesichts dieser kindlichen, verzweifelten Stimme, die in seinen Ohren widerhallte, der Stimme einer jungen Frau in Not. Wäre es ein Mann gewesen, hätte er ihm gesagt, er solle sich gefälligst eine Arbeit suchen. Doch stattdessen griff er in seine Tasche und gab ihr, genau wie ich es mir gedacht hatte, zu viel. Eine kleine blaue Banknote wechselte den Besitzer.
Der ältere Herr schnaufte ein wenig und sagte dann: »Wissen Sie, meine Liebe, Sie sollten wirklich nicht …« Doch er beendete seinen Satz nicht, weil er keine Ahnung hatte, was er sagen sollte. Er wandte sich ab und eilte weiter, unglücklich und voll aufkeimenden Ärgers, weil er sich so bereitwillig von seiner Fünf-Pfund-Note getrennt hatte.
Ich näherte mich vorsichtig dem Eingang. Irgendetwas an der Stimme hatte eine Erinnerung in mir geweckt. Ich spähte hinein.
Sie war nass, fror und sah erbärmlich aus, abgemagert bis auf die Knochen. Kein Wunder, dass der alte Bursche sich erbarmt hatte. Der Regen hatte ihr blondes Haar durchnässt, sodass es am Kopf klebte. Ihre Augen waren riesig und tragisch in einem Gesicht, dessen bleicher, matter Teint die Heroinsucht verriet.
»Hallo Tig«, sagte ich. Ich hätte sie wohl kaum wiedererkannt, wenn ich nicht zuerst ihre Stimme gehört hätte, so sehr hatte sie sich seit unserer letzten Begegnung verändert.
Sie zuckte zusammen, und ihre Augen blitzten in den verwahrlosten Gesichtszügen. Ich befürchtete schon, sie würde sich jeden Moment auf mich stürzen.
»Ganz ruhig!«, sagte ich hastig. Gerade die zerbrechlich Aussehenden können einem manchmal ziemlich zusetzen. »Ich bin es, Fran, erinnerst du dich nicht?«
Ich hatte sie fast ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Sie hatte kurz bei uns in der Jubilee Street gewohnt, als wir das Haus dort besetzt gehalten hatten. Ich hatte sie so gut kennen gelernt, wie das in einer solchen Umgebung eben möglich ist, was so viel heißt wie, ich hatte nicht mehr über sie erfahren, als sie freiwillig mitgeteilt hatte. Sie war nicht lange geblieben, eine Woche, vielleicht zwei, und hatte keine Probleme gemacht. Eine fröhliche, pummelige, unbekümmerte Fünfzehnjährige, die noch nicht lange in London war. Sie stammte von irgendwo aus den Midlands. Sie war, wie sie erzählt hatte, wegen irgendeines Familienstreits von zu Hause weggegangen, die alte Geschichte. Wir hatten sie vermisst, als sie weitergezogen war, andererseits hatte ich nicht erwartet, dass sie länger bleiben würde. Damals hatte ich das Gefühl gehabt, sie wollte ihren Eltern einen Schrecken einjagen, ihnen irgendein tatsächliches oder eingebildetes Unrecht heimzahlen. Sobald sie der Meinung war, ihr Ziel erreicht zu haben, würde sie wieder nach Hause zurückkehren. Hätte man mich gefragt, ich würde gesagt haben, dass sie inzwischen wahrscheinlich längst wieder in den Schoß ihrer Familie zurückgekehrt wäre, nachdem Kälte, Hunger und Gewalt auf den Straßen nicht länger nach Abenteuer klangen und stattdessen real und beängstigend waren.
Doch ich hatte mich eindeutig getäuscht. Ihre Veränderung schockierte mich zutiefst, auch wenn ich schon früher Mädchen wie Tig begegnet war. Sie kamen von außerhalb in die Stadt, voller Optimismus, obwohl mir beim besten Willen kein Grund dafür einfallen wollte. Was glaubten sie eigentlich, was sie in London finden würden? Außer einer riesigen Ansammlung von Leuten wie sie selbst, die kein Zuhause mehr hatten und nicht wussten wohin, und ganzen Rudeln von Haien, die nur darauf warteten, sich auf sie zu stürzen? Wenn sie Glück hatten, lernten sie ihre Lektion schnell und vergaßen sie nicht wieder. Wenn nicht, bekamen sie es zu spüren.
Eine Sache an Tig war mir aus der Zeit in der Jubilee Street wirklich in Erinnerung geblieben: Sie hatte sich nach jeder Mahlzeit die Zähne geputzt, selbst wenn sie keine Zahnpasta hatte. Es gibt eine Menge Leute, die glauben, Obdachlosigkeit wäre gleichbedeutend mit Schmutzigsein. Doch das stimmt nicht. Ganz gleich, wie groß die tatsächlichen Schwierigkeiten auch sein mögen, Obdachlose bemühen sich um Sauberkeit. Sauberkeit bedeutete, dass man noch immer kämpfte, dass man sich noch nicht in sein Schicksal gefügt hatte. Man achtete noch immer auf sein Äußeres, selbst wenn andere einen abgeschrieben hatten. Wenn eine Katze aufhört sich zu lecken, dann weiß man, dass sie krank ist. Bei Menschen ist das nicht anders. Auch bei ihnen ist Verwahrlosung ein Anzeichen von Krankheit, entweder körperlicher oder seelischer. Die seelische Krankheit ist von beiden die schwieriger zu behandelnde. Während ich nun Tig vor mir sah, fragte ich mich, an welcher Krankheit sie wohl litt.
In unserem besetzten Haus in der Jubilee Street hatten wir eine Regel gehabt: keine Drogen, und wenn sie es damals schon gemacht hatte, dann hatte sie es sehr gut verborgen. Doch ich war nicht sicher, ob dies der Fall war. So clever konnte sie gar nicht gewesen sein. Ich schätzte eher, dass sie erst seit kurzer Zeit süchtig war. Ein wenig verspätet fiel mir ein, dass sie tatsächlich nicht zu den Cleveren gehört hatte. Naiv vielleicht und ein wenig unterbelichtet, so war sie mir erschienen.
»Ja, Fran«, sagte sie schließlich. Ihre Augen glitten zur Seite, an mir vorbei. Ich erinnerte mich an ihre Augen, wie sie gewesen waren, hell, voll Gutmütigkeit. Jetzt waren ihre Blicke stumpf und hart. »Haben Sie vielleicht ein wenig Kleingeld, Ma’am?«, bettelte sie eine mütterliche Frau mit einer voll gestopften Plastiktüte an. Die Frau betrachtete Tig besorgt und gab ihr zwanzig Pence. Tig steckte die Münzen in die Tasche.
»Wie geht’s denn so?«, fragte ich. Sie schien ganz gut im Betteln zu sein, doch sie war von einer Aura stiller Verzweiflung umgeben, die mich misstrauisch machte, denn wenn sie dieses Stadium erst erreicht haben, ist es bis zum endgültigen Ausflippen nicht mehr weit.
»Ganz gut«, antwortete sie. Ihr Blick ging erneut an mir vorbei, nervös diesmal.
Ich hatte noch zwei Pfund von meinem Fünfer übrig, und ich gab ihr eines davon. Sie blickte mich zuerst überrascht, dann misstrauisch an.
»Keine Sorge«, sagte ich. »Ich hatte ein wenig Glück.«
Bei diesen Worten wallte Elend in ihren Gesichtszügen auf, nur um sogleich wieder zu verschwinden. Das Glück hatte sie schon lange verlassen. Sie erwartete keines mehr. Doch auf der Straße verbarg man seine Gefühle. Sie machten einen verwundbar, und Gott weiß, man war schon verwundbar genug ohne den Feind da draußen.
»Schön für dich«, sagte sie gehässig und steckte die Pfundmünze zu dem anderen Geld in ihrer Tasche.
Ich blieb nichtsdestotrotz hartnäckig – die Erinnerung an die alte Tig brachte mich dazu. »Hast du gehört, was mit unserem Haus in der Jubilee Street passiert ist? Sie haben es abgerissen.«
»Ja, hab ich gehört. Es wäre sowieso früher oder später eingestürzt.«
Das tat weh. Ich hatte dieses Haus gemocht, und es hatte nicht nur mir, sondern auch ihr für eine Zeit lang Schutz geboten. Sie sollte nicht so über dieses Haus reden.
»Es war ein gutes Haus!«, sagte ich grob.
»Hör zu«, sagte Tig, »du bist hier wirklich im Weg, weißt du? Wie soll ich die Leute um ihr verdammtes Kleingeld anhauen, während du hier rumstehst und mich die ganze Zeit mit irgendwelchem Mist voll quatschst?« Ihre Stimme klang aggressiv, doch ihre Augen zuckten erneut nervös an mir vorbei. »Verschwinde endlich, Fran. Verpiss dich!«
Ich verstand. »Hier«, sagte ich und gab ihr meinen Mars-Riegel. Sie hatte ihn dringender nötig als ich.
Sie riss mir den Riegel förmlich aus der Hand, und ich ging davon, ohne mich noch einmal umzusehen. Ich war zu beschäftigt, nach jemand anderem Ausschau zu halten, und tatsächlich, ich entdeckte ihn fast augenblicklich. Es war ein großer, bärtiger Kerl, Mitte zwanzig, und er trug eine karierte Wolljacke, Jeans und einen Filzhut. Er lungerte in einer Ecke, die von einem vorspringenden Haus gebildet wurde, im Schutz eines überhängenden Balkons im ersten Stock. Dort war er im Trocknen und vor Zugluft geschützt. Die kleine Ecke war in der Nacht bestimmt ein herrlicher Platz für einen Räuber, und ich hätte ihn nicht gesehen, hätte ich nicht nach ihm Ausschau gehalten. Er war kein Räuber, ganz bestimmt nicht. Er war unter anderem Tigs Beschützer.
Ich kannte diese Straßenpartnerschaften von früheren Begebenheiten, und soweit es mich betraf, waren die Frauen in ihnen kaum besser dran als ohne sie. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich kenne ein paar richtig gute Partnerschaften, die auf der Straße angefangen haben, aber sie halten nur selten für längere Zeit, selbst die guten. Tatsache ist, man darf sich nicht von jemandem abhängig machen da draußen. Man muss für sich alleine stehen, in der Lage sein, auf sich aufzupassen und seine Probleme selbst zu lösen. Die Straße ist in gewisser Weise wie eine Familie, aber eine Familie aus Einzelgängern. Sobald man sich nicht mehr selbst behaupten kann, hat man verloren.
Trotzdem bilden sich immer wieder Paare, trennen sich, finden neue Partner, genau wie in der Welt der ganz normalen Berufstätigen. Es gibt ganz gewöhnliche Mann/Frau-Partnerschaften, aber es gibt auch die rein praktische Seite. Tigs Kerl mochte ein Taugenichts sein, der sich in einer warmen Ecke herumdrückte, während sie draußen im kalten Wind stand, doch er war zur Stelle, wenn es rau wurde, entweder während sie bettelte oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Wahrscheinlich nahm er auch den größten Teil des Geldes an sich, wenn nicht sogar alles. Er würde dafür sorgen, dass ihr genug blieb, um ihre Drogensucht zu finanzieren, denn während sie auf Drogen war, musste sie betteln, stehlen, ihren Körper verkaufen, was auch immer nötig war, um das notwendige Geld heranzuschaffen. Vielleicht war er es sogar gewesen, der sie überhaupt erst abhängig von diesem Zeug gemacht hatte. Er betrachtete es wahrscheinlich als geschäftliche Investition. Die Leute würden ihr viel bereitwilliger Geld geben als ihm, falls er sich in eine Tür stellte und die Hand ausstreckte. Nach dem kurzen Blick zu urteilen, den ich auf ihn hatte werfen können, sah er nicht aus, als hätte er in letzter Zeit hungern müssen. Im Gegensatz zu Tig, die aussah, als hätte sie seit Tagen keine anständige Mahlzeit mehr gehabt. Andererseits – je schlimmer sie aussah, desto mehr Geld bekam sie. Er konnte überhaupt nicht verlieren.
Ich spürte einen Anflug von Hass auf den Kerl in mir aufwallen, wer auch immer er war. Ich selbst hatte mich niemals so benutzen lassen, doch vielleicht war Tigs Lage so schlimm gewesen, dass er ihr, ganz gleich, wie er sonst noch war, zu der Zeit wie eine gute Idee erschienen sein mochte.
Ich war inzwischen richtiggehend wütend. Man kann nur eine gewisse Menge an Ärger an einem einzelnen Morgen ertragen. Ich stapfte nach Hause, bereit, mich mit dem nächstbesten Fremden anzulegen, der mir in den Weg geriet. Glücklicherweise kam es nicht dazu, wenigstens nicht, bis ich angekommen war, und die sich anschließende Begegnung besserte meine Laune eher auf, als dass sie mich Feuer und Flammen spucken ließ.
Ich wohnte zu jener Zeit in einer Souterrainwohnung im Haus einer pensionierten Bibliothekarin namens Daphne Knowles. Ich war durch Vermittlung eines älteren Gentlemans mit Namen Alastair Monkton an die Wohnung gekommen, dem ich einmal geholfen hatte. Die Wohnung hatte mir mehr Sicherheit verschafft, als ich in den Jahren zuvor gehabt hatte. Ich war seit meinem sechzehnten Lebensjahr auf mich alleine gestellt, und inzwischen war ich einundzwanzig. Das Dumme mit der Sicherheit ist, dass man nicht wirklich an sie glaubt, wenn man nicht an sie gewöhnt ist. Irgendwie wusste ich, dass ich nicht für immer in dieser Wohnung würde bleiben können, doch ich hatte vor, es so lange zu tun wie nur irgend möglich. So viel Glück würde ich nie wieder haben, das stand fest.
Als ich in die Straße einbog, wo ich wohnte, hatte der Regen aufgehört, und eine schwache Sonne war hinter den Wolken hervorgekommen. Die Bürgersteige sahen sauber aus, wie gewaschen. Als ich am Geländer des Nachbarhauses vorbeiging, bot sich mir ein Anblick, der mich grinsen ließ.
Sie waren zu zweit und glichen sich wie ein Ei dem anderen. Sie gingen im Gleichschritt nebeneinander her. Beide waren klein, rundlich, im mittleren Alter und blickten selbstgefällig drein. Der linke von beiden trug eine grüne Tweedjacke, der rechte eine braune. Beide steckten in hellbraunen Hosen und hatten polierte derbe Straßenschuhe an. Der mit der grünen Jacke hatte einen Blumenstrauß in der Hand, der mit der braunen eine in Papier eingeschlagene Flasche. Tweedledee und Tweedledum, dachte ich bei mir, während ich mich fragte, wer die beiden wohl waren, wohin sie gingen und was um alles in der Welt sie vorhatten, sobald sie dort angekommen waren. Mit ihren Geschenken im Arm sahen sie aus, als wären sie auf altmodischen Freiersfüßen. Ich hatte sie noch nie zuvor in unserer Gegend gesehen.
Vielleicht stellten sie sich die gleichen Fragen, was mich betraf, denn sie steckten die Köpfe zusammen, während sie mich unablässig beobachteten, und tuschelten. Wir kamen gleichzeitig bei den Stufen zu Daphnes Haustür an und blieben wie auf ein geheimes Zeichen hin stehen.
»Nun, nun«, sagte der mit der grünen Jacke. »Was haben wir denn da, eh?« Er schenkte mir ein joviales Lächeln, das so falsch war, dass ich es ihm vom Gesicht hätte reißen können wie eine Latexmaske.
Ich hätte eine Reihe von markigen Antworten geben können, doch mein Instinkt riet mir, dieser Begegnung auszuweichen.
»Entschuldigung«, sagte ich und wollte an den beiden vorbei, um die Treppe zu meinem Kellergeschoss hinunterzusteigen.
Doch so leicht wollten sie mich nicht davonkommen lassen. »Ja, wen haben wir denn da? Sie sind bestimmt die junge Frau, die in Tante Daphnes Souterrain wohnt, eh?«, gab der mit der braunen Tweedjacke seinen Senf dazu. Er schüttelte einen Wurstfinger in meine Richtung und sah mich selbstzufrieden an.
Tante Daphne? Gehörten diese beiden fetten Widerlinge etwa zu Daphnes Familie? Ich empfand Mitleid mit ihr und war nicht zum ersten Mal erleichtert, dass ich niemanden hatte. Meine Mutter lebte vermutlich noch irgendwo, doch da sie Dad und mich im Stich gelassen hatte, als ich sieben gewesen war, hatte ich sie seit langem aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ich wuchs bei meinem Vater und meiner ungarischen Großmutter Varady auf, doch sie waren inzwischen beide tot. Niemand konnte sie ersetzen.
»Ja«, sagte ich und musterte die beiden düster. Ich hatte sie noch nie bei Daphne zu Besuch gesehen, doch das bedeutete nicht, dass sie noch nie im Haus gewesen waren. Die Souterrainwohnung besaß einen eigenen Eingang. Daphne wusste nicht, wer mich besuchte, und ich wusste nicht, wen sie zum Besuch empfing – es sei denn, man begegnete sich auf dem Bürgersteig, so wie jetzt.
»Unsere junge Freundin ist ein wenig farouche, Bertie«, sagte der mit der braunen Jacke. »Ein Produkt unserer unruhigen Gesellschaft.«
Damit bettelte er geradezu um einen Schlag auf die Nase, und vielleicht hätte ich ihm den Gefallen getan, wären wir nicht unterbrochen worden.
Daphne schien hinter einem Fenster auf die Ankunft ihres Besuchs gewartet zu haben, denn nun öffnete sich die Haustür, und sie stand im Eingang und sah auf die kleine Gruppe hinunter. Sie trug wie üblich eine Jogginghose und handgestrickte Färöer-Socken mit Ledersohlen. Doch ihr Pullover war neu, und sie war offensichtlich beim Friseur gewesen. Ihr graues Haar war zurechtgemacht und lag in neuen Wellen, und hinter zwei Locken an den Koteletten baumelten Ohrringe. Daphne hatte sich herausgeputzt.
Meine Vermieterin war in den Siebzigern, doch sie ist noch immer wacher als viele jüngere Leute. Ich hatte sie im Lauf der Zeit recht gut kennen gelernt und hatte fürsorgliche Gefühle für sie entwickelt. Nicht, dass sie es nötig gehabt hätte. Daphne konnte gut auf sich selbst aufpassen. Doch im Augenblick wirkte sie alles andere als selbstsicher, eher elend und verwirrt, als wüsste sie nicht so recht, was sie in dieser Situation tun sollte.
»Oh, Bertie – Charlie …«, sagte sie ohne wirkliche Begeisterung. »Welch eine Überraschung … Hallo Fran, meine Liebe.« Ihre Miene hellte sich auf, als sie mich begrüßte.
Bertie und Charlie stiegen die Stufen hinauf, als wären sie an der Hüfte zusammengewachsen, und streckten die freien (äußeren) Arme zu einer gemeinsamen Umarmung ihrer Tante aus, Bertie (mit der grünen Jacke) den linken, Charlie (mit der braunen) den rechten. Zur gleichen Zeit drückten sie ihre Geschenke mit der jeweils anderen Hand an die jeweilige Brust. »Tante Daphne!«, kreischten sie. Bertie schob ihr die Blumen hin, und Charlie in genau dem gleichen Augenblick die Flasche Wein. Man hätte glauben können, dass sie es vorher einstudiert hatten.
»Wie nett von euch«, sagte Daphne gequält. »Kommt doch rein, Jungs.«
Jungs? Aber vielleicht war der Ausdruck gar nicht so unpassend. An den beiden war etwas, das einen akuten Fall von verzögerter Entwicklung nahe legte. Vermutlich ist es ganz nett, Zwillingsbabys in die gleichen Sachen zu stecken. Bei Kleinkindern geht es gerade noch. Doch Männer in mittlerem Alter sollten eigentlich aus dem Bedürfnis herausgewachsen sein, sich genauso wie jemand anderes anzuziehen. Wenn man sein Aussehen schon nicht verändern konnte, beispielsweise, weil man ein eineiiger Zwilling war, dann konnte man doch wenigstens einen individuellen Kleidungsstil entwickeln. Doch über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Ich zuckte die Schultern und ging nach unten in meine Kellerwohnung.
Ich hatte mich immer noch nicht daran gewöhnt, nach Hause zu kommen und mich in meiner eigenen, ganz privaten Wohnung wiederzufinden, die ich mit niemandem teilen und die ich nicht gegen Eindringlinge verteidigen musste, die sie mir streitig machten, oder gegen die Stadtverwaltung, die sämtliche Bewohner auf die Straße setzen wollte. Es war früher Nachmittag, und ich hatte noch nichts zu Mittag gegessen. Ich stellte einen Topf mit Wasser für die Nudeln auf, und als es kochte, bevor ich das Salz hineingab, schüttete ich genug davon ab, um mir einen Kaffee zu machen.
Mit meinem Kaffee ging ich ins Wohnzimmer und setzte mich auf mein altes blaues Ripssofa. Meine Gedanken kehrten zu dem Mann zurück, der am frühen Morgen in Onkel Haris Laden gekommen war. Ich hasse Rätsel, die ich nicht lösen kann, und diesmal hatte ich das merkwürdige Gefühl, dass wir den Fremden nicht zum letzten Mal gesehen hatten.
Die Nudeln waren fertig. Ich schüttete das Wasser ab, rührte das Glas Pesto hinein und setzte mich mit meiner Mahlzeit vor meinen alten, flackernden Fernseher. Das geisterhafte Bild vermittelte dem Betrachter ein Gefühl von doppeltem Blick, und ich fühlte mich unwillkürlich an Daphnes »Jungs« erinnert.
Es kam nichts Vernünftiges, keiner der alten Filme, die ich so gerne sah, und irgendwann musste ich eingedöst sein. Ich erwachte plötzlich vom Lärm von Stimmen und dem Trappeln von Füßen auf der Vordertreppe über meinem Kopf. Draußen war es bereits dunkel, und das bläuliche Flimmern der Mattscheibe war die einzige Beleuchtung im Zimmer.
Ich rannte zum Fenster und spähte nach oben. Gerade rechtzeitig. Draußen hatte ein Taxi gehalten, und die Schritte, die mich aus dem Schlaf gerissen hatten, waren von dem Fahrer gewesen, der zur Vordertür von Daphne hinaufgestiegen war. Nun kehrte er zurück, mit zwei Paar hellbraunen Hosenbeinen im Schlepptau sowie einem Paar sehr dünner weiblicher Beine unter einem langen, schlaff herabhängenden Rock, alles erhellt von gelblichem Laternenlicht. Ich hatte Daphne noch nie in etwas anderem als Jogginghosen gesehen, doch offensichtlich ging sie nun mit den beiden »Jungs« aus, und zwar an einen Ort, für den man sich schick machte. Ich wünschte, ich hätte mich für Daphne freuen können, weil sie endlich einmal aus dem Haus kam, doch es gelang mir nicht. Wohin auch immer sie ging, ich war sicher, dass sie eigentlich gar nicht wollte – zumindest nicht in dieser Gesellschaft.
Ich kehrte zu meinem Sofa zurück und wünschte, ich wüsste, wohin die beiden Daphne ausgeführt hatten. Ich erinnerte mich lebhaft an den unglücklichen Gesichtsausdruck beim Eintreffen des Besuchs. Es beunruhigte mich und steigerte meine Vorbehalte gegen das braun-grüne Paar. Kein anständiges Restaurant hätte mich eingelassen, noch hätte ich mir das Essen dort leisten können, doch ich hätte draußen herumlungern und ein Auge auf die Dinge halten können. Erneut ging ich zum Fenster und sah nach draußen. Der Regen hatte wieder eingesetzt und trommelte auf das Pflaster. Ich hatte für den heutigen Tag genug von schlechtem Wetter. Daphne war mit ihrer Verwandtschaft zusammen, und wenn man der eigenen Familie nicht vertrauen konnte … Seien wir doch ehrlich, unterbrach ich meinen Gedankengang. Man kann einfach niemandem trauen, das ist eine Tatsache.