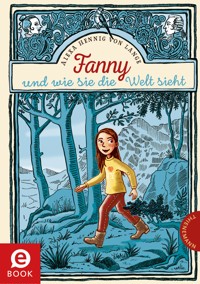8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist Weihnachten und nacheinander trudeln die Geschwister Tamara, Ingmar und Elisabeth mit ihren Kindern und Partnern im Haus ihrer Eltern ein. Schneeflocken fallen sanft vom Himmel und wie jedes Jahr weckt das vertraute Heim für einen Moment die Hoffnung auf ein besinnliches Fest. Doch sobald alle an einem Tisch sitzen, ist es mit dem Frieden vorbei: Tamara ist neidisch auf Elisabeth, die nicht nur beruflich erfolgreicher ist, sondern jetzt auch noch diesen attraktiven neuen Freund mitgebracht hat. Ingmar ärgert sich über Tamaras mangelndes Interesse an ihren Mitmenschen und dem Klimawandel. Elisabeth versucht wie immer, zu allen nett zu sein, und macht es dadurch nur noch schlimmer. Nach einer Nacht im Hotel kommen die drei Geschwister an Heiligabend wieder am Elternhaus zusammen. Aber zu ihrer großen Überraschung öffnet ihnen niemand die Tür. Wo sind die Eltern? Um das Rätsel zu lösen, begeben sich Tamara, Elisabeth und Ingmar auf eine Spurensuche zurück in ihre glückliche Kindheit. Und finden eine magische Botschaft für ihre Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Es ist Weihnachten und nacheinander trudeln die Geschwister Tamara, Ingmar und Elisabeth mit ihren Kindern und Partnern im Haus ihrer Eltern ein. Schneeflocken fallen sanft vom Himmel und wie jedes Jahr weckt das vertraute Heim für einen Moment die Hoffnung auf ein besinnliches Fest. Doch sobald alle an einem Tisch sitzen, ist es mit dem Frieden vorbei: Tamara ist neidisch auf Elisabeth, die nicht nur beruflich erfolgreicher ist, sondern jetzt auch noch diesen attraktiven neuen Freund mitgebracht hat. Ingmar ärgert sich über Tamaras mangelndes Interesse an ihren Mitmenschen und dem Klimawandel. Elisabeth versucht wie immer, zu allen nett zu sein, und macht es dadurch nur noch schlimmer.
Nach einer Nacht im Hotel kommen die drei Geschwister an Heiligabend wieder am Elternhaus zusammen. Aber zu ihrer großen Überraschung öffnet ihnen niemand die Tür. Wo sind die Eltern? Um das Rätsel zu lösen, begeben sich Tamara, Elisabeth und Ingmar auf eine Spurensuche zurück in ihre glückliche Kindheit. Und finden eine magische Botschaft für ihre Zukunft.
© Marie Haefner
Alexa Henning von Lange, geboren 1973, wurde mit ihrem Debütroman ›Relax‹ 1997 zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Es folgten zahlreiche weitere Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Jugendbücher. 2002 wurde Alexa Hennig von Lange mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Bei DuMont erschienen die Romane ›Risiko‹ (2007), ›Peace‹ (2009) und ›Kampfsterne‹ (2018). Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Berlin.
Alexa Hennig von Lange
DIE WEIHNACHTS- GESCHWISTER
Von Alexa Hennig von Lange sind bei DuMont außerdem erschienen: Peace Relax Kampfsterne
eBook 2019 Copyright © 2019 Alexa Hennig von Lange Copyright Originalausgabe © 2019 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagillustration: © Michael Meissner Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-8474-2
www.dumont-buchverlag.de
Wir sind Geschwister.
1
ES SCHNEITE. Dicke, wattige Schneeflocken. Unendlich viele weiße, zarte Fladen kamen geradewegs aus dem milchigblauen Himmel heruntergesegelt. Fröhlich. Unabhängig. Heiter. Frei. So frei, dass Tamara am liebsten angefangen hätte zu weinen. Diese Schneeflocken, die direkt vor ihr auf der Windschutzscheibe landeten und neugierig zu ihr ins Innere des Autos sahen, erinnerten sie an früher, als sie noch hier in dieser Straße gewohnt hatte und ein vergnügtes Mädchen gewesen war.
Die Schneeflocken legten sich ganz und gar auf die Windschutzscheibe, so, als würden sie mit ihrer gesamten Fläche zu Tamara und ihrer Familie ins geparkte Auto gucken wollen. Als würden die Schneeflocken genau wissen wollen, wie so eine erledigte Familie kurz vor Weihnachten aussah.
Tamara saß auf der Beifahrerseite. Unfreiwillig. Normalerweise saß sie am Steuer und fuhr ihre beiden Jungs nach der Schule herum. Zum Klavierunterricht, zu Klassenkameraden, zu ihren Yu-Gi-Oh!-Wettkämpfen. Es fühlte sich gut an, das Lenkrad mit beiden Händen zu umfassen, die Gangschaltung mit Kraft zu betätigen, wenn sie in ihrem Wohnviertel ein wenig zu schnell unterwegs war, wenn sie manchmal rote Ampeln überfuhr, dicht an Radfahrern vorbei. Sie liebte diesen ganz leichten Thrill, etwas Gefährliches zu tun. Das waren die Momente des Tages, zwischen Schule und Fußballtraining, zwischen Sportplatz und Supermarkt, die wirklich rauschhaft waren. Aber heute hatte ihr Mann die lange Strecke übernehmen wollen. Also stauten sich um Tamaras Beine die Taschen mit dem Proviant, der während der Fahrt nicht mal zum Teil aufgegessen worden war. Ihre Jungs hatten ihr die angebissenen Brote sofort wieder nach vorne gereicht: »Können wir bitte bei McDonald’s anhalten?«
All ihre Lebenszeit, die ins Butterbrotemachen floss. Wofür? Damit ihre Kinder etwas Vernünftiges aßen. Damit sich die Jungs geliebt und versorgt fühlten. Und dann bissen sie nicht einmal richtig davon ab. Von ihrer Lebenszeit. Sondern reichten sie zurück nach vorne. Was sollte Tamara jetzt damit machen? Die Brote selbst aufessen? Oder wegschmeißen? Weil Tamara keine Lust hatte, ihre Kinder kurz vor Weihnachten zu mehr Respekt zu erziehen, und auch keine Energie mehr hatte, ihnen zu erklären, dass sie nicht ihre Bedienstete war, packte sie die Brote einfach mit einem Seufzer zurück in die Dosen. Das hatte sie die ganzen letzten Jahre über auch schon getan. Lebenszeit in Tupperdosen packen. Jetzt war ihr Mann mal dran, die Fahne des Respekts hochzuhalten, aber der ging offenbar ebenfalls gerne kurz vor Heiligabend zu McDonald’s, weil er das ganze Jahr über nicht dazu kam. Er saß ja nur im Büro.
Tamara zog ihre Winterjacke vorne zu, obwohl von unten gerade noch ihre Sitzheizung wärmte. Es war mehr so eine reflexhafte Geste, als würde sie sich panzern müssen. Gegen das Außen. Gegen all die ständigen kleinen Herausforderungen, die das Leben so mit sich brachte. Ganz im Allgemeinen. Gleich würden sie aussteigen und an der Tür ihrer Eltern klingeln. Gleich. Noch nicht jetzt. Erst einmal kurz durchatmen und sich vorstellen, sie sei eine der vielen zarten Schneeflocken auf der Windschutzscheibe, um wieder zu etwas mehr Leichtigkeit zu kommen. Sie fühlte sich so schwer. So träge. So ausgelaugt.
Neben ihr, hinterm Lenkrad saß Quirin, ihr Mann. Total überarbeitet, mit immer weniger Haaren, Augenringen und Bauchansatz. Jedenfalls nicht der Mann, den sie damals beim Karate im weißen Kampfanzug kennengelernt hatte. Beide mit dem symbolträchtigen blauen Gürtel der Entfaltung ausgestattet. Sie machten schon seit Ewigkeiten keinen Sport mehr. Im Auto war es still. Ihr Mann sah ebenfalls kurz die Schneeflocken an, so, als würde auch er sich mehr Leichtigkeit wünschen, dann suchte er etwas neben sich in der Seitentasche. Sein Handy. »Ich muss nur noch mal kurz …« Er lächelte entschuldigend und tippte auf dem Gerät herum. Wahrscheinlich irgendetwas mit der Arbeit. Quirin schaffte es nie, abzuschalten. Die ganze Zeit hatte er seine Tabellen und Zahlen im Kopf. Und diesen Druck »von oben«. Tamara hatte es aufgegeben, mit ihm ein vernünftiges Gespräch zu führen. Auch, wenn er körperlich anwesend war – der Rest von ihm war es nicht. Nach hinten auf die Rückbank brauchte Tamara erst gar nicht zu sehen. Sie wusste, was ihre Jungs taten. Das, was sie bereits seit knapp vier Stunden taten: Handyspiele spielen.
Inzwischen war die Windschutzscheibe beinahe von einer dünnen Schneeflockenschicht bedeckt. Schneeflocke für Schneeflocke war genau an ihren Platz gefallen. In der Gesamtheit ergaben sie eine wunderschöne Decke. Gerade als Tamara sich ganz und gar in diesem reinen Weiß verlieren wollte, schaltete ihr Mann den Scheibenwischer ein. Rusch. Mit einer einzigen Bewegung hatte der schwarze Plastikarm die Schneeflöckchen weggeräumt und vor ihr tauchte wieder ihr Elternhaus auf. Vorgarten. Vier Fenster, blaue Haustür, spitzes Dach. Dahinter die schlanke, schneebedeckte Kiefer. Sie starrte Quirin von der Seite an: »Wieso hast du das gemacht?«
»Was?« Er sah sie irritiert an und steckte sein Handy in die Jackentasche.
»Na, den Scheibenwischer angeschaltet?«
»Weil die ganze Scheibe voller Schnee war.«
»Ja, aber, wir fahren doch gar nicht.«
»Ich wollte aber etwas sehen.«
Tamara seufzte und stieß die Wagentür auf. Genau das war der Grund für ihre Frustration. Genau das. Ihr Mann und sie. Kein bisschen gemeinsamer Sinn fürs Schöne. Für Romantik. Sie knallte die Tür zu und lief in ihren Stiefeln, die sie zu Hause in aller Eile angezogen hatte, ohne den Reißverschluss zu schließen, an den beiden kugelförmigen Buchsbäumen vorbei zur Haustür ihrer Eltern. Auch, wenn sich ein gewisser Widerwille gegen das, was da drinnen gleich vonstattengehen würde, in ihr breitmachte – jedes Jahr eskalierte es zu Weihnachten –, spürte sie doch eine große Dankbarkeit, dass es dieses Zuhause für sie gab. Dieses Zuhause mit der blauen Haustür. In dem alles seine Ordnung hatte – solange ihre Geschwister nicht da waren. Klare Prinzipien. Klare Festlegungen. Wenn doch ihr Leben auch so in Ordnung wäre wie das gut eingerichtete Haus ihrer Eltern. Seit Tamaras Kindheit hatten ihre Eltern so viel Mühe investiert, damit möglichst wenig schieflief. Sie investierte doch auch. Warum funktionierte es dann bei ihr nicht? Tamara drückte auf die Klingel und wollte nur noch rein. Zu Mama und Papa.
Aber drinnen rührte sich nichts. Hinter ihr fielen die Schneeflocken auf den gepflasterten Weg, auf die graubraunen Vorgartenpflanzen, in die trockenen Rosenbüsche. Um ihre Beine zog die eisige Winterluft. Sie drückte noch einmal auf die Klingel. Auf keinen Fall wollte sie jetzt irgendwelchen weihnachtlich gestimmten Nachbarn begegnen, die ihr ein begeistertes Gespräch über das märchenhafte Wetter und darüber, wie lange man sich nicht mehr gesehen hatte, aufs Auge drückten. Dazu war sie absolut nicht in der Verfassung. Schon gar nicht dazu, zu erzählen, »was sie jetzt machte«. Nämlich gar nichts. Sie war Hausfrau. Das ging hier niemanden etwas an. Tamara drückte noch einmal auf die Klingel. Und als drinnen noch immer keine Schritte zu hören waren, haute sie mit der Faust gegen die Tür. Endlich hörte sie, dass sich von drinnen jemand näherte.
Gerade als die Tür aufging und sie ihrem Papa in die Arme fallen wollte, fragte Quirin von hinten: »Soll ich schon mal die Taschen mit den Geschenken reintragen?«
Was für eine dumme Frage. Tamara verdrehte die Augen. Außerhalb des Büros konnte ihr Mann keine selbstständigen Entscheidungen treffen. Wie ein Kleinkind. Hatte sie nicht schon genug mit ihren beiden Jungs zu tun? Sie wollte nicht die einzig Erwachsene in ihrer Ehe sein. Außerdem war ihr die Hilflosigkeit ihres Mannes vor ihrem Vater peinlich. Der hatte immer gewusst, was zu tun war. Warum konnte Quirin nicht ein bisschen so sein wie ihr Vater? Sie lächelte ihn an: »Hallo, Papsi.«
Sie umarmte diesen Mann, der plötzlich kleiner geworden war. Ihr Vater sah gar nicht mehr so aus, wie sie ihn in Erinnerung hatte. In ihrer Vorstellung war er noch immer der Anfang vierzigjährige Anwalt, kräftig, stabil, nicht kleinzukriegen. Mit Hang zur Ungeduld und zur Dominanz. Eben ein richtiger Mann, immer auf der Höhe seiner Potenz. Ihr kleiner Vater lächelte, wobei sein Kopf leicht nickte. »Da seid ihr ja.« Auch seine Stimme war dünner, als Tamara sie im Ohr hatte. Ihr Vater machte in seinen Filzpantoffeln einen Schritt zur Seite, um seinen Schwiegersohn mit den großen Geschenketaschen vorbeizulassen. »Stell sie einfach um die Ecke ins Arbeitszimmer.«
Tamara zog sich die Stiefel aus und stellte sie ordentlich in die Garderobe. So, wie sie es als Kind gelernt hatte. Dann nahm ihr Vater ihr den Wintermantel ab und hängte ihn umständlich auf einen Bügel. Alles hatte hier seine Ordnung. Und das war gut so. Tamara war das Kind ihrer Eltern und sie liebte diese Ordnung, die ihr immer Sicherheit gegeben hatte. Diese klare Struktur, wo was hingehörte. Jedes Ding hatte seinen Platz. Seine Funktion. Seine Aufgabe. Routinen, mit denen man leicht durchs Leben kommen sollte. Nur bei sich zu Hause schaffte Tamara es kaum, diese Routinen einzuhalten, weil ihre Jungs und ihr Mann da überhaupt nicht mitmachten. Besonders Quirin hatte einfach kein Gefühl für klare Strukturen. Zumindest außerhalb seines geschäftlichen Aufgabenfeldes. Ständig ließ er seine Büroschuhe mitten im Flur liegen. Seine Jacke warf er über die Sofalehne. Seine Müslischüssel blieb verlässlich auf dem Küchentisch stehen. Die Liste war endlos. Und die Jungs machten es ihm nach.
Tamara gab ihrem Vater noch einen Kuss auf die durchscheinende Wange mit den feinen roten Äderchen und während Quirin noch die letzten Taschen aus dem Kofferraum holte, rief sie nach draußen Richtung Auto: »Jungs, aussteigen!«
Nichts passierte. Nur ihr Mann schlug die Kofferraumklappe zu und kam zurück ins Haus. Gerade als er die Taschen abgesetzt und seinen Schwiegervater zur Begrüßung umarmen wollte, meinte Tamara: »Und die Jungs bleiben im Auto oder was?«
Quirin zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht.«
»Hast du ihnen nicht gesagt, dass sie aussteigen sollen?«
»Das wissen sie doch.«
»Ja, aber sie steigen trotzdem nicht aus. Das ist jetzt mal deine Aufgabe, sie da rauszuholen.« Tamara wusste, dass ihre Stimme unerbittlich klang. Sie wusste es und sie hatte auch jedes Recht dazu. Sie hatte keine Lust mehr, all diese Menschen ununterbrochen anzutreiben, die nicht fähig waren, ohne sie klarzukommen. Ihr Vater lächelte schon wieder, seine Stimme klang dünn und ein bisschen wackelig: »Gut, dann werde ich mal zu Mama in die Küche gehen. Ihr kommt dann einfach nach, wenn ihr fertig seid.«
»Sind die anderen schon da?«, fragte Tamara. Die anderen. Das waren ihre Geschwister. Ihre jüngere Schwester und ihr kleiner Bruder. Mit seiner Frau, die Tamara nicht leiden konnte, und seinen verweichlichten Zwillingen. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester mit ihrer zerbombten Familie war für Tamara schon aushaltbarer, solange Elisabeth nicht von ihrer »Arbeit« anfing. Es war ein Wunder, wie sie es trotz ihrer mangelhaften Bildung geschafft hatte, so weit zu kommen.
»Sie bringen gerade ihr Gepäck ins Hotel. Sie wollten eigentlich gleich wieder hier sein.« Ihr Vater schlurfte in Richtung Küche, vorbei an der Kommode mit den aufgestellten Familienfotos in Silberrahmen. Seine graue Strickjacke hing an ihm herunter. Er ging gebeugter als sonst. In Tamaras Erinnerung schleuderte er sie immer noch in Badehosen und mit muskulösem Oberkörper am Strand im Kreis herum. Ihr starker Vater. In seinen Armen war sie so federleicht gewesen wie eine Elfe. Als kleines Mädchen war er ihr wie Spartakus vorgekommen. Total unbesiegbar.
Da Tamara es nicht mit ansehen wollte, wie Quirin hilflos versuchte, ihre handysüchtigen Söhne aus dem Auto zu holen, drehte sie sich einfach um und ging hinter ihrem Vater her. Durch den Flur in die Küche. Im sonnigen Gegenlicht, das durchs Sprossenfenster kam, stand ihre Mutter am Herd und rührte in einem großen Topf. So wie immer, wenn man in die Küche kam. Mit ihren weißgrauen, in schwungvolle Wellen gelegten Haaren, umgebundener Schürze und einem Lächeln.
»Na, Mammchen. Warst du beim Friseur?« Tamara gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange und wusch sich dann die Hände über der Spüle. Ihre Mutter trug ihre Perlenkette, ihren Ehering und den Ring mit dem großen hellrosa Turmalin, den sie von Papa zur silbernen Hochzeit bekommen hatte. Eine hübsche Bluse mit einer feinen Strickjacke darüber. Alles an ihrer Mutter war hübsch. Und im Gegensatz zu ihrem Vater schien ihre Mutter kaum zu altern. Sie hatte nach wie vor diese unerschütterliche Jugendlichkeit an sich. Und sie duftete so wie immer. Nach ihrem Mama-Parfüm. Sie legte den Deckel auf den Topf und strich Tamara über die Schulter. »Na, mein Kind. Seid ihr gut hergekommen?«
Tamara stellte das Wasser aus. »Essen wir jetzt etwa alle zusammen Mittag?«
»Dachte ich eigentlich?« Ihre Mutter räumte einen Stapel Suppenteller aus dem Hängeschrank. »Ich habe ein paar Dosen aufgemacht. Ich wollte heute nicht für alle Kartoffeln schälen.«
Ein paar Dosen aufgemacht? Das hatte es noch nie gegeben. Ihre Mutter hatte immer alles selbst gemacht, alles Fertige abgelehnt, weswegen Tamara ja im Grunde genommen nicht arbeitete, um auch alles frisch für ihre Familie zubereiten zu können. Ihre Mutter war ihr Vorbild in Sachen perfekter Haushaltsführung und jetzt machte sie zu Weihnachten einfach Dosen auf?
Vorne klingelte es. Ihr Vater schlurfte wieder aus der Küche, um die Haustür zu öffnen. Tamaras Pupillen wanderten genervt nach rechts oben. Jetzt musste ihr armer Papa noch mal zurück durch den Flur, um die Haustür aufzumachen, weil Quirin es nicht gebacken kriegte, die Kinder reinzuholen, bevor die Tür zufiel. Gleichzeitig ging hinten das Gartentor auf und eine Traube von Leuten drängte durch das trockene Gestrüpp der verblühten Hortensien über die dünne Schneedecke, die den Rasen bedeckte. Tamara sah ihren Geschwistern mit all den Kindern durchs Küchenfenster entgegen. Gerade war dieser Schneeteppich noch unberührt gewesen. Jetzt walzte die Meute in bunten Mützen und Fäustlingen darüber hinweg und der matschige Untergrund kam durch. Hinter ihr bemerkte ihre Mutter fröhlich: »Na, da bin ich ja mit dem Essen genau rechtzeitig fertig geworden.«
Sie trug die Suppenteller an Tamara vorbei ins Wohnzimmer und verteilte sie dort auf dem ausgezogenen Tisch, in dessen Mitte der Adventskranz mit den Bienenwachskerzen und den kleinen geschnitzten Engeln stand. Ihre Schwester mit den wilden, blonden Locken winkte Tamara freudestrahlend durchs Fenster zu. Hatte Elisabeth schon wieder eine neue Winterjacke an? Wieso sah ihre kleine Schwester so frisch aus? Ging sie ständig zur Kosmetik? Wie viel gab sie eigentlich für ihre Cremes aus? Sonderlich anstrengend konnte ihr Tagesablauf ja nicht sein. Ihre beiden Kinder – sieben und zwölf Jahre alt – drängten zur Terrassentür herein. Ein Mädchen und ein Junge, je von einem anderen Vater. Auch in neuen Winterjacken. Elisabeth war bereits zweimal geschieden und lachte noch immer. Kein Wunder. Sie traf ihre Entscheidungen – ohne Rücksicht auf Verluste – und zog sie durch. Eine schlechte Entscheidung. Dann eine gute. Dann wieder eine schlechte. Dann wieder eine gute. Es ging immer hin und her. Mit schier unverwüstlichem Selbstvertrauen. Jetzt hatte Elisabeth diesen neuen Freund, den Tamara sich gleich mal genauer anguckte, als er über die Schwelle ins Wohnzimmer trat.
Mein Gott, er sah aus wie ihr Ex-Freund Stefan, den sie in der Oberstufe gehabt hatte! Groß, schlank, sportlich, breites Grinsen und dieses blonde, volle Haar und rote Wangen. Der Holzfäller-Typ. Absolut der Holzfäller-Typ. Tatsächlich hatte er auch noch abgetragene Jeans und ein Holzfällerhemd an. Wow! Woher hatte Elisabeth den? Dieser Mann passte doch gar nicht zu ihrer kleinen Schwester! Sondern zu ihr! Zu Tamara-Katharina Schwedthelm. Er gehörte in das ursprünglich für sie vorgesehene Leben, das leider recht früh eine falsche Abzweigung genommen hatte und seitdem parallel zu ihrem tatsächlichen Leben verlief, ohne dass Tamara dabei war! Warum konnte sie nicht einfach hinüberwechseln auf die richtige Spur und endlich ihr echtes, einzig passgenaues Leben führen? So, wie ihre kleine Schwester das immer machte, wenn sie merkte, dass das gerade nicht mehr »ihr Leben« war? Sie wechselte einfach die Spur.
Plötzlich hörte Tamara sich laut auflachen, während sie sich mit leicht frivolem Unterton in der Stimme der Terrassentür näherte. »Hallo, wen haben wir denn da?«
Sie umarmte diesen großen Mann, der – im Gegensatz zu ihrem Mann – überhaupt nicht müde aussah. Alles an diesem Mann war knackig. So knackig und heiß, wie sie sich eigentlich noch immer in ihrem tiefsten Inneren fühlte. Heiß. Ein Gefühl, das viel zu selten abgefragt wurde, mal abgesehen von den paar Momenten am Morgen, kurz nachdem die Jungs und Quirin aus dem Haus waren und der Nachbar Jörg von gegenüber – ebenfalls Familienvater – kurz mal bei ihr reinguckte. Aber der war kein Vergleich zu Elisabeths neuem Freund, der – wirklich! – gar nicht Elisabeths Typ war! Ihre kleine Schwester hatte doch sonst eher notorische Chaoten oder pathologische Narzissten. Was wollte sie von diesem Mann hier? Dem war sie intellektuell doch gar nicht gewachsen. Das sah Tamara auf den ersten Blick. Wieder so eine seltsame Entscheidung ihrer kleinen Schwester. Mister Holzfäller sah aus, als bräuchte er eine willensstarke, gebildete Frau neben sich. Nicht ihre wankelmütige Schwester, die durch pures Glück beruflich so erfolgreich war. Was natürlich auch nur eine Phase war! Der Mann umarmte sie nun ebenfalls und sagte, als sie sich wieder losgelassen hatten: »Ich bin Holger.«
Er hieß tatsächlich Holger! Auch so ein Name aus der Vergangenheit. »Ein jugendlicher, dynamischer Name«, bemerkte Tamara und lachte schon wieder laut auf, wobei ihr gleich ein paar Tränen in die Augen schossen. In ihr war so viel Hunger.
Dann musste sie für ihre nachdrängenden Geschwister und deren Kinder auf dem Fußabtreter Platz machen. Als Erstes erntete Tamara einen ernüchternden Blick ihres kleinen Bruders Ingmar, der offenbar jetzt schon die Faxen dicke hatte, dass Tamara sich nicht beherrschen konnte. Tamara kannte diesen Ausdruck in seinen Augen gut. Ihr kleiner, gönnerhafter Bruder mit seinem Weltverbesserer-Zopf … Sie umarmte ihn gar nicht erst, sondern begrüßte gleich seine Zwillinge, indem sie ihnen distanziert zuwinkte. Ein Junge, ein Mädchen. Beide komisch. Und seine humorlose Frau mit diesem kinnlangen Bob verzog auch keine Miene, sondern bemerkte nur wohlerzogen: »Schön, dich zu sehen, Tamara.« Wobei sie sich nicht einmal Mühe gab, dass es irgendwie glaubhaft klang.
Die Einzige, die sofort die Arme ausbreitete, um Tamara zu drücken, war Elisabeth. Sie schloss ihre Arme in der neuen, daunengefüllten Winterjacke fest um ihre große Schwester und gab ihr einen dicken Kuss auf die Wange. »Na, Tamaratschi?« So hatte Elisabeth sie schon vor mehr als zwanzig Jahren genannt. »Tamaratschi.« Auf diese Wortschöpfung war sie damals gekommen, als alle mit diesen Tamagotchi-Fieps-Dingern in der Schule gespielt hatten. Diese hirnlosen Plastik-Küken aus Japan, in hellrosa oder blau, die man heimlich im Unterricht per Knopfdruck hatte füttern müssen. Tamara hatte sich nie für diesen Müll interessiert, aber Elisabeth war ganz verrückt nach den winzigen Dingern gewesen und hatte sich eins von ihrem Taschengeld gekauft. Und mit solch einem total abhängigen, digitalen Zivilisationsschrott verglich Elisabeth also Tamara. Na ja, was sollte sie machen? Irgendwie zeigte sich darin ja auch Elisabeths Zuneigung. Sie strahlte Tamara an und meinte: »Wie schön, dass wir uns endlich wiedersehen!«
Und es klang so echt und rein, total unbelastet, als ob Elisabeth gar nicht wüsste, was sie da eigentlich redete. Als hätte sie über die letzten beiden Jahrzehnte gar nicht mitbekommen, dass sie und Tamara durchaus ein problematisches Verhältnis zueinander hatten. Jetzt umarmten Elisabeths Kinder sie auch noch. Und sie waren die einzigen von all ihren Verwandten, die Tamara wirklich uneingeschränkt liebte. Sie küsste die hellblond gelockten Kinder – und diesen beiden galt tatsächlich ihre ganze Sorge. Dass es ihnen gut ging. Dass sie die Trennungen ihrer Mutter von ihren jeweiligen Vätern gut verkrafteten, dass sie jeden Tag pünktlich zur Schule kamen, dass sie vernünftiges Essen aßen und dass sie psychisch keinen Knacks erlitten oder unbeaufsichtigt irgendwo herumstreunten. Elisabeth war in vielerlei Hinsicht komplett sorglos. Sie erlaubte ihren Kindern Sachen, die Tamara niemals erlaubt hätte. Manchmal gingen diese beiden Kinder sogar abends mit ins Restaurant oder fuhren allein mit dem Zug zu Oma und Opa. Außerdem kam öfter eine Babysitterin, wenn Elisabeth wieder irgendwo unterwegs war. In Ausstellungen ging oder ins Kino. Elisabeth kannte eine Menge Leute, oberflächliche, eingebildete Leute aus der Kulturszene. Möchtegern-Akademiker. Früher hatte ihre kleine Schwester sie manchmal mitgenommen zu irgendwelchen »Events« – wenn Tamara schon dieses Wort hörte, drehte sich ihr der Magen um. »Event« – ein Synonym für hohlen Käse.
»Na, wie läuft’s in der Schule?«, fragte Tamara ihre zwölfjährige Nichte, deren Patentante sie war.
»Gut«, sagte Marie und rückte sich ihre rote Mädchenbrille zurecht.
»Ja? Weil du nie da bist?« Schon wieder bog sich Tamara vor Lachen. Sie konnte nichts gegen diesen plötzlich aufflammenden Energieschub tun. Jetzt war sie in Scherzlaune. Dieser Holzfäller-Typ war schuld daran. Er löste in ihr alle Sicherungen. Er ließ Tamara durch seine bloße Anwesenheit diese unsagbare Lebendigkeit spüren. Diese Freude, einfach draufloszureden, zu lachen, fröhlich und auch ein bisschen haltlos zu sein. So, wie sie es früher gewesen war. Als junges Mädchen, als sie noch ihrem richtigen Leben auf der Spur war.