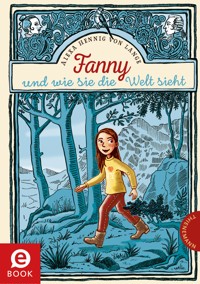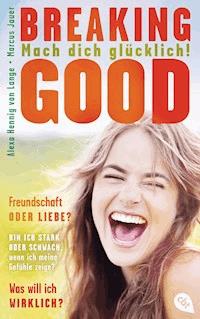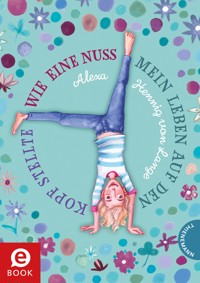9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1985 – Es ist ein verrückter, heißer Sommer, in dem Boris Becker Wimbledon gewinnt, vier Passagierflugzeuge innerhalb eines Monats abstürzen, alle großen Rockstars bei Life Aid für das hungernde Afrika singen und in einer Siedlung am Rand der Stadt drei Familien zu zerbrechen drohen. Ulla und Rainer. Rita und Georg. Ella und Bernhard. Drei Paare. Mütter und Väter. Sie wohnen in dänischem Design, fahren nach Südfrankreich in den Urlaub, schicken ihre Kinder zum Cello-Unterricht und zum Intelligenztest. Sie versuchen, sich als aufgeklärte und interessierte Menschen zu beweisen, die das richtige Leben führen. Wo wäre das leichter als in den sorgenfreien Achtzigerjahren der Bundesrepublik? Und warum funktioniert es trotzdem nicht? Alexa Hennig von Lange erzählt die Geschichte einer Generation von Eltern, die ein freieres Miteinander wollten. Der Ideologien, denen sie folgten. Der Liebe, die sie verband. Der Ängste, die sie hatten. Der Kindheit, die sie sich für ihre Söhne und Töchter wünschten. Der Fehler, die sie machten. Der Entschlüsse, die ihre Kinder deshalb fassten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
1985 – Es ist ein verrückter, heißer Sommer, in dem Boris Becker Wimbledon gewinnt, vier Passagierflugzeuge innerhalb eines Monats abstürzen, alle großen Rockstars bei Life Aid für das hungernde Afrika singen und in einer Siedlung am Rand der Stadt drei Familien zu zerbrechen drohen.
Ulla und Rainer. Rita und Georg. Ella und Bernhard. Drei Paare. Mütter und Väter. Sie wohnen in dänischem Design, fahren nach Südfrankreich in den Urlaub, schicken ihre Kinder zum Cello-Unterricht und zum Intelligenztest. Sie versuchen, sich als aufgeklärte und interessierte Menschen zu beweisen, die das richtige Leben führen. Wo wäre das leichter als in den sorgenfreien Achtzigerjahren der Bundesrepublik? Und warum funktioniert es trotzdem nicht?
Alexa Hennig von Lange erzählt die Geschichte einer Generation von Eltern, die ein freieres Miteinander wollten. Der Ideologien, denen sie folgten. Der Liebe, die sie verband. Der Ängste, die sie hatten. Der Kindheit, die sie sich für ihre Söhne und Töchter wünschten. Der Fehler, die sie machten. Der Entschlüsse, die ihre Kinder deshalb fassten.
© Marie Haefner
ALEXA HENNIG VON LANGE, geboren 1973, wurde mit ihrem Debütroman ›Relax‹ 1997 zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Es folgten zahlreiche weitere Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Jugendbücher. Bei DuMont erschienen die Romane ›Risiko‹ (2007) und ›Peace‹ (2009). 2002 wurde Alexa Hennig von Lange mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Berlin.
Alexa Hennig von Lange
KAMPFSTERNE
eBook 2019 Copyright © 2018 Alexa Hennig von Lange Copyright Originalausgabe © 2018 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-8426-1
www.dumont-buchverlag.de
Für meine Eltern, die uns Kindern gezeigt haben,
RITA
Ich stehe mit dem Rücken zur weißen Schrankwand. Hinter mir die Cognacflaschen, der Schallplattenspieler. Unsere Bücher. Das Köln Concert. Da-da-da-da-da. Ich sehe hinaus in unseren mit hohen Backsteinmauern umgebenen Garten. Alle Gärten in dieser Bungalowsiedlung sind klein. Wie Handtücher. Also kein Neid. Zumindest nicht, was den Garten anbelangt. Ansonsten könnte ich hier in der Siedlung auf alles neidisch sein. Zum Beispiel auf dieses Kind da draußen zwischen unseren Bambus-Sträuchern. Dieses kleine Mädchen in seinem dunkelblauen Faltenröckchen und niedlicher Puffärmelbluse. Mit den feuerroten Troll-Haaren, seinem sommersprossigen Puppengesicht, süßen Marzipanärmchen, in die ich am liebsten hineinbeißen würde. Lexchens grundlose Fröhlichkeit bringt mich um den Verstand. Geduckt wieselt sie durchs Gebüsch. Kurz darauf streicht sie mit großen, begeisterten Augen über die glänzenden Samenhülsen unserer knorzligen Magnolie, als wären es Wunderwerke der Natur. Sie breitet die Arme aus und ruft: »Oh, wie wunder-wunderschön!«
Ich könnte durchdrehen beim Anblick dieses kleinen Mädchens, das nicht meine Tochter ist. Sondern die von meiner Freundin Ulla. Mit ihrer Familie wohnt sie auf der anderen Seite der Siedlung. Und obwohl ein paar Häuserreihen zwischen uns liegen, spüre ich Ulla hinter jeder Mauerecke. Hinter jedem spinnennetzverhangenen Wacholder. Jederzeit könnte sie hinter einem von Bienen umflorten, gelb blühenden Ginster hervortreten. In ihren Männerstiefeln, abgetragenen Jeans und einem ihrer Karohemden. Mit hochgekrempelten Ärmeln, als wäre sie ein kanadischer Holzfäller. Fehlt bloß noch die Axt über der Schulter. Ihr Mann steht auf diese Männerverkleidung. Vermutlich, damit niemand etwas von Ullas sonnengebräunter Sexualität mitbekommt. Lächerlich. Als könnte Ulla die irgendwie unter einem karierten Männerhemd verstecken.
Ich mag es nicht, wenn Lexchen mit meiner Tochter Klara im Garten spielt. Weil ich die beiden dann ständig miteinander vergleiche und Klara dabei grundsätzlich schlechter abschneidet. Obwohl Lexchen drei Jahre jünger ist als sie und schon seit einiger Zeit nicht mehr wächst. Falls das mal jemandem aufgefallen ist!?
Mein Mann nennt unsere Tochter stolz »Käthchen«. Wie »Käthchen von Heilbronn«. Aber dieses kleine, rothaarige Mädchen, dieses wahre Wunderwerk der Natur, nennt meine Tochter nicht »Käthchen«, sondern »Käuzchen«! Weil sie »Käthchen-von-verschissen-Heilbronn« nicht kennt. Als wäre Klara ein hässliches Käuzchen mit Krächzestimme. Und damit trifft Lexchen den Nagel auf den Kopf. Aus Klara wird leider niemals ein anmutiges Singvögelchen werden. Was Lexchen überhaupt nicht stört. Sie findet einfach alles schön. Mit ihren winzigen braunen Sandalen springt sie im Pferdchen-Galopp durch die Siedlung, pflückt Gänseblumensträußchen, streichelt Magnolienknospen, sammelt Gras und sagt zu allem: »Oh, wie wunder-wunderschön!« Sogar zu meiner Klara. Dabei ist sie das genaue Gegenteil von Oh-wie-wunder-wunderschön. An ihr stimmt gar nichts. Nicht mal ihre Stimme. Und das liegt an meinem Mann. An dem stimmt auch nichts. Total verknorzelter Typ. Wie unsere Magnolie. Wenigstens verdeckt er sein fliehendes Kinn mit seinem Vollbart. Aber sein Vollbart kann nicht verdecken, dass er sich in seinen beigen Cordanzügen linkisch bewegt, dass er asthmakrank ist, dass er keine Kraft hat.
Im Gegensatz zu Ullas Mann, vor dem man als Frau richtig Angst haben könnte. Aber vor meinem Mann hat niemand Angst. Nur, dass er einem ein langweiliges Gespräch über seine Jugend aufdrücken könnte. Und wie er beim Reden immer wieder die Gläser seiner Brille poliert! Ich halte diesen Anblick nicht aus. Ich halte mein fehlgeleitetes Leben nicht aus. Genau wie ich den Anblick von diesem Lexchen nicht aushalte. Ich habe es Ulla schon ein paarmal gesagt: »Pass auf deine Tochter auf.«
Tja.
Ich gieße mir einen Schluck Rum ein, bleibe hinten im Wohnzimmer an der Schrankwand stehen. Inzwischen ist Klara wieder aus dem Schuppen aufgetaucht. Sie und Lexchen rupfen Löcher in unseren Rasen und stopfen das Gras durch den Maschendraht vom Kaninchenstall. Ich will dieses kleine Mädchen nicht mehr hier haben. Ich will mich in meinem Zuhause wieder frei bewegen, mich gut fühlen können. Nicht immer diesen unerträglichen Vergleichen ausgesetzt sein zwischen Ullas kleinem Mädchen und meiner Tochter.
Klara spielt Geige. Jeden Nachmittag klemmt sie sich das Instrument in ihrem Zimmer unters Kinn und übt Vivaldi. Mit ausreichend Disziplin kann sie die zweite Anne-Sophie Mutter werden. Vielleicht nicht ganz so virtuos. Im Übrigen komponiert sie schon kleine Sonaten. Das können nicht viele Kinder. Lexchen kann es in jedem Fall nicht. Dafür hat sie diese süße Stimme, mit der sie die ganze Zeit die größten Hits der Goldenen Dreißiger singt, seitdem sie von ihrer Tante diese Nazi-Schallplatte geschenkt bekommen hat. Trällert fröhlich vor sich hin, als wäre sie die große Lilian Harvey höchstpersönlich, und tanzt feierlich dazu herum. So wie ein Wunder fällt auf uns nieder vom Paradies ein gold’ner Schein.
Und dieser verdammte goldene Schein fällt vor allem auf Lexchen nieder. Jeder, der Böses im Sinn hat, wird geradezu auf dieses kleine Mädchen hingelenkt. Es kreiselt im Lichtkegel und irgendwann wird es ganz plötzlich ins Dunkle gezerrt werden und für immer verschwinden. Weg. Unauffindbar! Doch zuallererst wird dieses Kind aus dem Licht unseres Gartens, unseres kleinen Paradieses mit dem Kaninchenstall, der Magnolie, dem Rasen und meinem eigenen Komposthaufen verschwinden. Dafür werde ich sorgen.
Ich nippe am Glas. Der letzte übrig gebliebene Geschmack meines intellektuellen Lebens. Johannes, mein sechzehnjähriger Sohn, frickelt in seinem Zimmer herum. Mit irgendwelchem Technikkram. Hier ein Schräubchen, da ein Schräubchen. Er ist ein entsetzlicher Frickler. Aber auch er wird seinen Weg machen. Mit seinen dicken Brillengläsern. Als Konstrukteur. Wie Werner von Siemens. Das ist klar. Meine Kinder sind beide sonderbegabt. Und das macht vor allem Lexchens große Schwester Constanze rasend. Sie hasst es, wenn jemand besser ist als sie. Doch noch mehr hasst sie es, wenn jemand mehr gefördert wird als sie. Vor der muss man sich in Acht nehmen. Die ist gefährlich. Um ein Hundertfaches unberechenbarer und gefährlicher als ihr Vater. Sie ist wie ein fliegender Kampfstern.
Barfuß mache ich einen Schritt über unseren hellen Teppichboden. Ins Licht hinein. Ich stehe im Schutz der spiegelnden Fensterscheibe. Von draußen dürften mich die beiden Mädchen nicht bemerken. Nur, wenn sie sehr genau durchs Glas sehen. Aber sie sind in ihr Spiel vertieft und ich sollte langsam anfangen, den Marmorkuchen für Klaras elften Geburtstag zu backen. Ganz ehrlich: Man sollte lesbisch sein, wie Susan Sontag! Da kommst du gar nicht in die Verlegenheit, hauptberuflich Kinder großzuziehen, den Haushalt zu schmeißen oder deinen Ehemann auf Abstand zu halten. Du verliebst dich in eine unabhängige, intellektuelle Frau, bist mit ihr zusammen. Du bist in Frieden, mit deinen Gedanken, deinen Beobachtungen, Rückschlüssen und feinsinnigen Analysen. Alles kein Problem. Alles übersichtlich.
Als hätte Susan Sontag je einen Marmorkuchen gebacken!
Für eine Nicht-Lesbe hat Ulla das beste Leben überhaupt. Halbtags arbeitet sie im Büro ihres Mannes als Architektin. Sie hat diese beiden hübschen Töchter, diesen größenwahnsinnigen Mann. Sie hat Sex. Sie hat ein schönes Zuhause. Sie hat einen Schrebergarten und sie hat Kraft. Unglaubliche Kraft, derer sie sich gar nicht bewusst ist. Ulla ahnt gar nicht, dass sie fähig wäre, einen Lkw anzuheben, wenn eins ihrer Kinder darunter liegen würde. Sie ist so erbärmlich in ihrer ganzen eingebildeten Hilflosigkeit. Dabei ist sie es, die mit Sicherheit einen Atomschlag überstehen würde. Sie und ihre haltbare Familie, in der keiner unter einer Tierhaarallergie leidet, Asthmatiker ist oder eine Brille trägt.
Aber Ulla erkennt ihr Glück nicht. Sie erkennt einfach nicht, was sie hat. Diese mental schwache, schwache Person. Wäre ich ihr Mann, hätte ich sie schon längst geohrfeigt und geschüttelt. Das macht er natürlich auch. Und dann kommt Ulla in ihren Männerstiefeln und Blessuren zu mir gerannt und weint sich bei mir aus. Oben, in meinem Zimmer. Auf meiner peruanischen Bettüberdecke. Wie ein schluchzender kanadischer Holzfäller. Mein ganzes Zimmer ist voll von ihrer Traurigkeit. Ihrem Schluchzen. Und unten im Garten spielen die Kinder. Ulla weigert sich, erwachsen zu werden. Dabei ist sie so eine schöne Frau. Sehr weiblich. Sehr schöne Rundungen. Langes, schwarzes Haar, das ihr leicht indianisches Gesicht rahmt, ein bisschen wie die weibliche Form von Patti Smith, und ich sage so oft: »Ich weiß gar nicht, was du hast! Du bist so hübsch …« Und dabei stelle ich mir vor, wie ich sie endlich küsse.
Aber sie sagt nur: »Ich kenne keine Patti Smith!«
Weil sie sich in ihrem Unglück zu Hause fühlt. In ihrem blöden, eingebildeten Unglück. Als Gefangene ihres Mannes, als Gefangene unserer Siedlung, als hätte man sie in dieses Leben entführt! Zwischen all diese perlenkettenbehängten Frauen, die nicht arbeiten, sondern nur den Haushalt machen, ihre Kinder aufziehen und nichts zu erzählen haben, mal abgesehen vom Tratsch und ihren verpimpelten Südfrankreichurlauben. Warum macht Ulla nicht den gottverdammten Führerschein, damit wir uns mal ab und zu eine Ausstellung ansehen können? Niemand hat solch ein tiefgreifendes Kunstverständnis wie sie. Aber Ulla befürchtet, dass sie gegen die nächste Häuserwand fährt. Dann soll sie die Augen aufmachen und sehen, dass sie eine Wahl hat! Aber auch davor hat sie zu viel Angst. Angst. Angst. Angst.
LEXCHEN
Meine große Schwester Cotsch und ich sitzen mit meinen Puppen auf dem Wohnzimmerteppich und flechten ihnen Zöpfe. Hinter der großen Fensterscheibe mäht Papa im Garten unseren Rasen. Er hat seine abgeschnittenen Jeans an und obenrum ist er nackt. Mit seinen ganzen Muskeln stemmt er sich gegen den Rasenmäher. Ruschsch! Ruschsch! Ru-hu-huschsch! Das war eine kleine Unebenheit. Ruschsch! Mama backt so lange in der Küche einen Apfelkuchen. Es ist Sonntag und ziemlich heiß zwischen den Häusern. Cotsch und ich waren vorhin kurz mal draußen auf der Straße. Über dem Asphalt flimmerte die Luft, der Himmel war ohne Wolken und der Boden so aufgeheizt, dass wir wieder reingerannt sind. Dicht neben mir atmet meine Schwester mit ihren dunklen, geflochtenen Zöpfen. Ich sehe ihre langen schwarzen Wimpern. Ich sehe ihre gebräunten Hände, die meiner Puppe eine neue weiße Spitzenbluse anziehen, und ich sehe, wie Papa plötzlich die Terrassentür mit Wucht aufstößt und das runde Tablett mit dem aufgemalten Blumenmuster ins Wohnzimmer schleudert und brüllt: »Wer lässt das im Garten liegen?«
Dabei ist klar, dass Mama das war. Meine Schwester und ich heben augenblicklich unsere Köpfe. Ich sehe das Gesicht meiner Schwester, sonnengebräunt, und ihre angespannten Lippen, als würde sie in Gedanken gerade jemanden aufschlitzen. Ich sehe, wie sie ihre Zähne aufeinanderbeißt, und ich sehe die Funken in ihren Augen. Ich höre ihren leisen, scharfen Atem und gleich ist alles wieder vorbei. Wir antworten Papa nicht. Mama kommt eilig aus der Küche. In ihrem blau-rot karierten Hemd. Sie wird einfach das Tablett aufheben und in die Küche tragen, damit es keinen Ärger gibt. Mamas grüner Blick streift uns. Papa verschwindet wieder in den Garten, zu seinen Elefantengräsern und Tränenden Herzen. Ich atme ganz vorsichtig. Ich halte meine Puppe im Schoß. Ich fühle mein Herz schlagen. Mama hebt das Tablett vom Teppich auf. Aber als ihr langes, dunkles Haar über ihr Gesicht rutscht, lächelt sie nicht wie sonst. Zum Zeichen, dass wir Papa nicht so ernst nehmen sollen. Dass alles nicht so schlimm ist. Sie hebt einfach das Tablett auf, geht damit zur offenen Terrassentür und schleudert das Tablett wie eine Frisbeescheibe quer durch den Garten, direkt vor den Rasenmäher. Sie ruft: »Hier drinnen kann ich das auch nicht gebrauchen.«
Cotsch und ich atmen nicht mehr. Unsere Augen sind riesig. Wir gucken und gucken und sehen, wie Papa mit wildem Blick ins Wohnzimmer stürmt. Wie ein nicht zu bremsender Krieger. Mama, meine Mama, meine Mama, Mama! Ihr Kopf wird an den Haaren nach hinten gerissen. Neben uns wird sie in die Knie auf den flauschigen Teppich gezwungen.
»Runter mit dir!« Mit seiner ganzen Kraft zwingt Papa sie in die Knie. Er drückt Mama richtig nach unten und mit seiner anderen Hand holt er aus und …
Unsere Mama fleht: »Rainer! Bitte nicht!«
Ich sehe, wie Papas Hand niedersaust und auf meine kniende Mutter eindrischt. In ihrem Karohemd, in ihren Jeans. Ihr dunkles, langes Haar fliegt. Mit ihren Armen versucht sie, ihren Kopf zu schützen. Direkt neben meiner Schwester und mir.
Ich höre meine Mutter flehen: »Rainer! Nicht vor den Kindern!«
Mein Vater lässt sie los, ihr nackter Fuß berührt meinen Oberschenkel – und ein paar Sekunden später mäht Papa wieder draußen den Rasen. Mama keucht und steht wankend von unserem Teppich auf, als wäre nichts passiert. Sie lächelt uns an. Wir halten meine Puppen fest. Aus ihrer Nase blutet es. Unsere Mama streicht uns mit zitternder Hand über die Köpfe und sagt fröhlich: »Der Apfelkuchen müsste gleich fertig sein.«
Mama taumelt zurück in die Küche. Ich sehe meine Schwester an. Sie fasst mit ihrer zarten Hand fest um mein sommersprossiges Handgelenk. Ganz fest.
COTSCH
Meine Mutter eignet sich überhaupt nicht als Vorbild. Sie lässt sich von meinem Vater verprügeln. Und das schon, seitdem ich denken kann. Als hätte sie keine andere Wahl. Sie akzeptiert, dass er ihr kein Geld gibt, obwohl sie für ihn im Büro arbeitet. Sie trägt keinen Lippenstift, weil er das künstlich findet. Sie zieht sich an wie ein Mann. Angeblich findet Papa das visionär. Meine Mutter hat Männerklamotten an! Karierte Hemden und Jeans! Als wäre sie der Cowboy Jim aus Texas. Keine gottverdammte Frau in dieser ganzen verschissenen Siedlung trägt karierte Hemden und Jeans. Hier sind Röcke mit gebügelten Blusen angesagt. Perlenohrringe. Schicke Frisuren. Was man eben so macht, wenn man in der modernen Gesellschaft eine angemessene Rolle spielen will. Mama hat nicht mal einen Führerschein. Kein Auto. Mama muss alles mit ihrem bekloppten Rad erledigen und behauptet auch noch, es macht ihr Spaß. Für die Familie einkaufen, mit Jutetaschen rechts und links am Lenker. Einem Pappkarton auf dem Gepäckträger. Weil Papa ihr nur ein bisschen Haushaltsgeld gibt, näht sie für uns diese Vorkriegs-Kleider. Wie die Amish People laufen meine kleine Schwester und ich herum. In blau-weiß karierten Hängerchen. Fehlt bloß noch die weiße Haube auf dem Kopf! Was es für mich in der Schule echt speziell macht. Die Jungs denken, ich bin keusch oder so. Warum sollte ich? Unser Fernseher steht im Keller. Da muss ich mir die Zeit anders vertreiben.
Außerdem hat Mama es nicht auf die Reihe gekriegt, mich in die Stadt zum Intelligenztest zu bringen. Die Kinder von Rita waren selbstverständlich dort und den beiden Hirnis wurde gleich mal eine ordentliche Sonderbegabung attestiert. Alle Kinder in dieser verfickten Siedlung sind angeblich sonderbegabt und werden von ihren ehrgeizigen Eltern gefördert, obwohl sie im Grunde genommen alle behinderte Arschlöcher sind. Ich muss mir die ganze Scheiße alleine aneignen, die diese Schwachkopfkinder in den Arsch geschoben kriegen.
Aus lauter Not stricke ich mir neuerdings schon sexy Oberteile, die ich demnächst gegen die Amish-People-Kleider eintauschen werde. Beim Frauenarzt, wo ich mir selbstständig die Pille besorgt habe, habe ich Strickmuster aus der Brigitte rausgerissen. Anders komme ich ja nicht an das Material ran. Ich kann super stricken, aber interessiert keine Sau. Ich bin die Beste in der Jazz-Dance-AG, interessiert keine Sau. Ich bin Klassenbeste, scheißegal. Ich kriege nicht mal Taschengeld. Wenn ich was brauche, muss ich es leider aus Mamas Haushaltskasse entwenden. Im Umkreis von hundert Kilometern habe ich mit Abstand die knackigste Figur, sieht nur niemand unter meinen Kartoffelsackkleidern. Ist vermutlich Absicht. Meine Mutter hat nämlich Schiss, dass mir draußen in der bösen Welt was passiert. Ständig telefoniert sie mir hinterher. Gerade mal fünf Minuten bin ich aus dem Haus, schon muss sie bei meinen Klassenkameradinnen anrufen, ob ich auch wirklich angekommen bin, oder sie heizt auf dem Rad durch die Gegend, um mich aufzuspüren. Ich habe überhaupt keine Privatsphäre. Mama behauptet, ich sei haltlos. Dabei ist sie es! Sie macht echt richtig schlimme Dinge.
Besonders mit dieser Rita. Ständig rennt sie zu der rüber. Mit ihrer Anti-Atomkraft-Jutetasche, in der eine Pulle Rum liegt. Den säuft sie mit dieser gewissenlosen Rita. Weil Mama meint, das sei wenigstens eine intellektuelle Frau, mit der sie differenzierte Gespräche führen kann. Aber in Wahrheit hört sich Mama nur an, wie toll Ritas Kinder sind. Wie sonderbegabt und so weiter. Dabei sind es richtige Waschlappen, die nicht einen Fuß vor den anderen setzen können. Was sich diese Rita schon alles geleistet hat! Hat Mama nicht mal zu ihrem Geburtstag eingeladen, weil sie meinte, Mama passt nicht zu den anderen Siedlungsfrauen in ihren schicken Klamotten. Was ja auch stimmt! Aber trotzdem war Mama echt fertig deswegen und wer musste sie aufbauen? Moi! Und neulich hat Rita einfach Lexchens Ballettanzug verkauft, den sie Klara freundlicherweise ausgeliehen hatte. So was bringt Rita ständig. Nutzt Mama aus, wo es nur geht. Als Mama den Anzug schließlich wiederholen wollte, hat Rita ganz cool gemeint: »Den habe ich in den Secondhandladen gebracht.«
Und was macht Mama? Nichts! Sagt nur: »Oh, schön!« Um die Freundschaft nicht zu gefährden!
Und meine kleine Schwester hat keinen Ballettanzug mehr und kann nicht zum Ballett gehen. Dabei tanzt sie so gerne. Und nach all diesen Geschichten wundert sich meine Mutter, dass ich den Leuten heimleuchte, wenn sie mir blöd kommen? Macht ja sonst keiner!
Unseren Nachbarsjungen Trinus habe ich zum Beispiel neulich verdroschen, als der mir draußen auf dem Hof einen von seinen Dartpfeilen in die Wade geschossen hat. Damit stochert der sich ansonsten gerne mal zwischen den Zähnen herum. Ich habe ihn mir geschnappt, in seinen blauen kurzen Hosen und seinem eleganten Kurzarmhemd, und habe ihm mit dem Springseilgriff eins übergezogen. Will ich Tollwut kriegen?
JOSCHI
Ich liege auf unserem Sofa im Wohnzimmer und kraule unsere Siamkatze Esmeralda. Überall an den Wänden hängen Aktzeichnungen, die alle meine Mama gemacht hat. Einmal die Woche geht sie in die Volkshochschule zum Aktzeichenkurs. Die Leute, die sich da zum Abzeichnen zur Verfügung stellen, sind alle richtig fett. Die haben gigantische Speckrollen. Aber Mama meint: »Solche Körper sind dankbar zum Zeichnen.« Am liebsten benutzt sie orangefarbige Buntstifte. Und damit das alles schön plastisch wirkt, arbeitet sie noch mit einem weißen Stift die ganzen Wölbungen heraus. Ich dachte, ich gewöhne mich an die Bilder, aber es ist echt nicht leicht.
Es klingelt vorne an der Tür und Mama ruft von oben runter: »Joschi, gehst du mal?« Schätze, sie töpfert gerade wieder irgendwas und hat die Hände voller Pampe. Meine Mutter ist total versessen auf Kunsthandwerk. Unser ganzes Haus ist voll von ihren Kreationen. Selbstgetöpferte Vasen. Patchwork-Kissen und ihre Aktzeichnungen. Als würde sie hoffen, dass mal irgendjemand kommt und einen Bildband über unser kreatives und inspirierendes Zuhause macht.
Ich mache die Tür auf. Lexchen steht davor und sieht total begeistert aus. »He, Joschi! Hast du Zeit?«
Jeden Nachmittag kommt sie her, außer ich bin mit Klara beim Ballett. Kein Urteil! Alle Kinder aus der Siedlung gehen hier zum Ballett. Das gehört zur klassisch-künstlerischen Ausbildung. Als Lebensbasis, meint Klaras Mutter. Die ist voll besessen von der klassisch-künstlerischen Ausbildung. Nur Lexchen geht jetzt nicht mehr hin, weil Klaras Mutter neulich ihren Ballettanzug im Secondhandladen verkauft hat. Keine Ahnung, warum. Meiner Mutter ist es egal, ob ich zum Ballett gehe. Findet sie nicht dringend notwendig für einen Jungen. Aber Klaras Mutter will, dass ich eine Freizeitbeschäftigung mit Klara teile. Ebenfalls keine Ahnung, warum.
Jedenfalls steht Lexchen in ihrem karierten Kleid vor mir, als würde sie bei Unsere kleine Farm mitmachen. Dieser Familienserie, die im Wilden Westen spielt. Gucke ich mir immer mit Mama an, bevor sie für Papa Abendessen macht. Ich trete zur Seite und Lexchen zwängt sich an mir vorbei in unseren dämmrigen Flur, die Treppe runter in unser Wohnzimmer und lässt sich da auf unseren riesigen Sitzsack fallen. Lexchen liebt unseren Sitzsack. »Bist du alleine zu Hause?«
»Nee, meine Mutter töpfert oben.«
Lexchen schaukelt auf dem Sitzsack ein bisschen hin und her wie in einem riesigen Schwimmring, sodass die Styroporkügelchen darin rascheln. Dann springt sie wieder auf und spaziert raus in unseren Garten. Neben unserem Teich unter den Büschen bleibt sie stehen. Blau schimmernde Libellen sirren um ihren Kopf, die Sonne fällt auf ihr rotes Haar, als hätte sie einen Heiligenschein. Von da ruft sie wie eine kleine Fee: »Joschi, wollen wir was spielen?«
Ich komme auch raus in die Sonne, ein paar gelbe Zitronenfalter kreisen um ihre Schultern, und ich frage: »Was denn?« Ich gebe zu, ich hab es nicht so mit Ideen. Mir ist irgendwie alles recht.
Lexchen zuckt mit den Schultern. »Wir können in den Wald gehen und uns einen Unterschlupf bauen. Als würden wir im Wald leben wie Die Höhlenkinder und den ganzen Tag nur Beeren essen.«
»Von mir aus.« Ich ziehe mir meine Turnschuhe an, Esmeralda streift um meine Beine, und dann gehen Lexchen und ich in der heißen Nachmittagssonne die Straße runter, an den geparkten Autos, den ganzen Vorgärten mit ihren Rosenbüschen und Lavendelstauden vorbei, in den Wald, wo es ziemlich flirrt und grün ist und die Vögel in den Zweigen zwitschern. Immer tiefer hinein, ins Unterholz. Zum »Heimlichen Grund«. Es knackt unter unseren Füßen. Ich sehe Lexchens Sandalen, und immer, wenn Lexchen und ich über die Wurzeln steigen, muss ich an diese Geschichte denken, die neulich in der Zeitung stand. Über ein kleines totes Mädchen im Wald.
RITA
Was soll ich jetzt dazu sagen? Georg und ich haben schon längst getrennte Schlafzimmer. Um ehrlich zu sein, haben wir nie wirklich zusammen in einem Bett gelegen. Wenn, dann nur, um unsere Kinder zu zeugen. Ich habe im ersten Stock mein Zimmer. Mit Schreibtisch und schmalem Bett, sodass Georg gar nicht erst auf die Idee kommen kann, sich zu mir zu legen. Ich habe so eine bunte peruanische Wolldecke drübergeworfen. Auf der sitzt Ulla jetzt und ist – wie immer – unglücklich. Dabei lächelt sie. Das ist Ullas große Spezialität: lächeln und dabei unglücklich sein. Nebenan übt Klara quietschend ihren Vivaldi. Fiedel, fiedel, quietsch. Was mir richtig an die Substanz geht. Und Ulla sitzt einfach im sanft einfallenden Licht, das sich durch den halb zugezogenen Vorhang drängt, sodass sich ein heller Balken über ihr hübsches Gesicht mit dem violetten Hämatom legt und ihre Augen glänzen. Sie sieht mich abwartend an und ich denke: Wie die junge Patti Smith. Nur noch viel schöner. Und genau das ertrage ich nicht. Diese Schönheit, gepaart mit Schwachheit. Ich halte das im Grunde genommen für blanke Koketterie. Guckt Ulla eigentlich nie in den Spiegel? Vermutlich nicht! Denn dann müsste ihr längst aufgefallen sein, dass sie definitiv die besseren Karten hat als ihr Mann. Er hat Angst, dass sie abhaut! Das sieht doch ein Blinder! Ich verschränke meine Arme vor der Brust und frage mit unterdrückter Wut: »Was ist jetzt schon wieder los?«
Sie lächelt: »Er hat mich vor den Mädchen geschlagen.«
»Warum das denn?«
»Weil ich eine Dummheit begangen habe. Ich habe das Tablett wieder raus in den Garten geworfen.«
»Wieso?« Ich verstehe überhaupt nichts. Wieso wirft sie ein Tablett in den Garten?
Sie zuckt mit den Schultern und lächelt noch ein bisschen mehr: »Ich weiß es nicht. Weil …«
Und plötzlich sieht sie mich flehend an, als hätte ich die Macht, sie aus ihrer ganz persönlichen Hölle zu retten. Ihre Augen sind rot und sie wäre so glücklich, wenn ich sie in den Arm nehmen würde. Und sie mein kleines Mädchen sein könnte. Aber ich habe keine Lust darauf, ihre Mutter zu spielen. Da ist sie bei mir an der falschen Adresse. An so einer Art von Freundschaft bin ich nicht interessiert. Im Übrigen würde ich sie dann küssen und mich in meiner ganz persönlichen Schwachheit offenbaren. Weil natürlich jeder im Grunde seines Herzens schwach ist, und vermutlich nehme ich deswegen allen ihre Schwachheit so übel, weil sie mich an meine eigene erinnert. Wer möchte schon gerne schwach sein? Ich nicke und gieße uns den Rum ein, den Ulla in ihrer Jutetasche mitgebracht hat. Ich reiche ihr eins von den Schnapsgläsern und unsere Finger berühren sich und die Zeit verlangsamt sich für diesen flüchtigen, kostbaren Moment. Wir trinken das Zeug und Ulla fragt allen Ernstes: »Warum ist Rainer nur so voller Wut?«
Weil er hilflos ist. Weil er nur diese eine Art der Kommunikation zur Verfügung hat. Unterwerfung. Immer Unterwerfung. Sehr männliches Verhaltensmuster. Ich sehe ihre Lippen. Ihr kariertes Männerhemd, dessen oberste Knöpfe aufgesprungen sind. Ich sehe ihre gebräunten Hände. Ihren schweren Ehering und sie legt ihren Kopf ein wenig schief und lächelt ihr mädchenhaftes Lächeln. Hinter ihr an der Wand hängen die feinen indianischen Perlenketten, die ich alle während der Poetik-Vorlesungen im Studium aufgezogen habe. Als hätte ich damals schon von Ulla gewusst. Wie schön die vielen kleinen roten Perlen auf ihrer nackten, gebräunten Haut aussehen würden. Annie Leibovitz würde sich die Finger danach lecken. Würde Ulla ganz nackt ausziehen, nur mit all den indianischen Ketten behängt, und sie links an der Kamera vorbeiblicken lassen.
Ich lehne mich gegen meinen Schreibtisch, und als Klara nebenan ihr Gefiedel kurz unterbricht, flüstere ich in den sommerlichen Dämmer, in das Amselgezwitscher hinein: »Du bist selbst schuld, wenn du dir das von deinem Mann gefallen lässt.«
Mit großen Augen sieht mich Ulla an. Erschrocken, dass so etwas Hässliches aus mir herauskommen kann, wo doch auf ihrer linken Wange ein violetter Bluterguss zu sehen ist. Aber es ist nur die Spitze des Eisberges, von dem, was ich in Wahrheit denke. Da ist noch viel Hässlicheres in mir. Ich will all diese Dinge besser gar nicht sagen, aber wenn ich sie nicht sage, vergiften sie mich. Und ich weiß, dass ich recht habe. Es ist die Wahrheit. Ulla sollte endlich kapieren, dass es zwischen uns beiden nicht mehr um Höflichkeit und Trost geht, sondern um das Akzeptieren der Realität. Der Realität zwischen uns. Zwei erwachsenen Frauen. Zwei hungrigen, erwachsenen Frauen. Die Realität ist, dass sich Ulla wehren muss. Dass sie sich fragen muss, was sie wirklich will. Dass wir beide uns sehr gut verstehen. Und dass wir in dieser Siedlung sehr eng beieinander wohnen und alle Erwachsene sind. Dass wir alle versuchen, ein glückliches Leben zu führen. Und dass ich frustriert bin.
»Was soll ich denn machen?«, flüstert sie zurück. »Ich will nicht mehr geschlagen werden.«
Ich zucke mit den Achseln. »Dich trennen?«
Der Sommerduft vom blühenden Ginster kommt durchs gekippte Fenster.
»Ich habe kein Geld.« Ulla reibt mit ihren Händen über ihre Knie in den abgetragenen Jeans. Ihr Ehering glänzt schwer und golden.
Ich räuspere mich. »Er muss dir etwas zahlen, wenn ihr euch trennt.«
»Aber ich liebe ihn.« Ullas Unterkiefer zittert.
Es reicht. Ich stoße mich vom Schreibtisch ab, ziehe sie von meiner Bettkante hoch und schiebe sie aus meinem Zimmer. »Dann ist doch alles gut.«
Diesen Quatsch mit »Aber ich liebe ihn« will ich mir nicht mehr anhören. Es tut mir weh. Es verletzt mich. Es ist nicht das erste Mal, dass wir dieses Gespräch führen. Wir haben es schon sehr oft geführt, auch schon viel ausführlicher. Aber wie das so ist, wenn Menschen ihr Unglück nicht ändern wollen: Sie finden tausend Gründe, warum sie das immer gleiche Gespräch wieder und wieder führen müssen. Ihre Zwangslage wird zunehmend ausgefeilter, je mehr Vorschläge man ihnen zur Änderung macht. Darum sage ich jetzt nichts mehr. Ulla weiß, wie ich zu der Sache stehe. Sie kann nicht ihren Mann behalten und meine Zärtlichkeit bekommen.
Sie steigt vor mir die Treppe hinunter, an den schwarz-weißen Fotografien vorbei, die Georg von den Kindern im Garten unterm Rasensprenger gemacht hat. Damals, als wir zumindest noch ein bisschen eine Familie waren. Ich folge Ulla und schiebe sie durch unser helles Wohnzimmer, an unseren hellen Möbeln vorbei, über den hellen Teppich, weiter in den Garten hinaus. Vor dem wehenden Bambus dreht sie sich zu mir um und lächelt ins silbrige Rascheln hinein: »Ich muss los, ich weiß gar nicht, wo meine Kinder sind.«
Als hätte ich sie hier länger als nötig festgehalten. Sie steht noch ein bisschen herum, als würde sie darauf warten, dass ich ihr tröstend über den Rücken streiche. Das wird nicht passieren, bis sie endlich schnallt, was ihr eigentliches Problem ist.
ULLA
Ich liege im Bett. Mit weit geöffneten Augen. Die Fenster sind weit geöffnet. Dahinter flirren die hellgrünen Blättchen an den ausladenden Ästen der Akazie, die wir gepflanzt haben, als wir in dieses Haus gezogen sind. An einem heißen Sommertag hat Rainer das kleine Bäumchen an einem Bahndamm ausgegraben. In seinem weißen Hemd, schwarzen Pullunder und weiten Hosen, wie ein richtiger Architekt. Mit seinem Seitenscheitel, schwer atmend, weil wir in der flimmernden Hitze schon ein ziemliches Stück mit den Rädern gefahren waren. Ich stand hinter ihm in diesem Springkraut und habe gelauscht, ob ein Zug kommt. Er mochte, dass ich kräftig und in der Lage war, kilometerweit mit dem Rad zu fahren, ohne einen Schluck Wasser zu trinken oder irgendwo ein Stück Kuchen essen zu wollen. Natürlich hat er das nie gesagt. Sowieso hat Rainer nie wirklich gesagt, dass er mich liebt, vielmehr hat er irgendwann mal zu einem Studienfreund im Modellbaukurs gesagt, dass ich lediglich ein Provisorium sei. Das hat sich in der Uni herumgesprochen und so fühle ich mich noch heute. Zwanzig Jahre später. Wie ein Provisorium. Als müsste ich dankbar sein, dass ich hier neben ihm im Bett liegen darf. In diesem Schlafzimmer. In dem die Blättchen flirrende Schatten werfen. Als wäre es ein Versehen, dass ich hier liege. Als sollte ich eigentlich woanders liegen. Aber wo? Meine Kinder schlafen nebenan, meine beiden lieben Mädchen, sind sie auch nur ein Versehen?
Wir schlafen immer mit weit geöffneten Fenstern. Über die Pergola könnte jeder, der will, bei uns einsteigen. Könnte eins der Mädchen mitnehmen. Ganz unbemerkt, bis zum nächsten Morgen. Rainer hält mich für paranoid. Niemand bei uns darf Angst haben. Rainer hasst Angst. Dabei macht er uns allen ständig Angst.
Draußen rauscht die Baumkrone. Ich höre Rainer neben mir atmen. Tief und entspannt. Ich ziehe die weiße Decke um mich. Mein Kopf im Kissen. Ich gucke gegen unseren Kleiderschrank, hinter dessen Türen ordentlich und frisch die gestapelten Handtücher liegen. Ich sehe die feine Maserung. Keine Macke darf an diesen Schrank kommen. Als ich damals mit Lexchen schwanger war, kam Cotsch nachts leise zu uns herein. Stand da in ihrem Nachthemd in der offenen Tür. Wie ein kleiner, vom Mond angestrahlter Engel. »Mama«, hat sie gewispert. »Mama, darf ich zu euch kommen?« Rainer ist über mich drübergesprungen und hat meinem Töchterchen eine Backpfeife gegeben. Einem siebenjährigen Mädchen! Eine Backpfeife! Sie wollte sich nur zu mir legen, weil sie einen Albtraum gehabt hatte. Aber Rainer kann es nicht leiden, wenn er mich teilen muss. Nicht mal mit seinen eigenen Kindern will er mich teilen. Mich Provisorium. Die Morgensonne flirrt zu uns herein. Wie schön, wenn die Amseln zwitschern. Und ich halte es nicht aus, wenn Kinder aus ihrer Unschuld vertrieben werden.
»Wie wunder-wunderschön!«, ruft Lexchen plötzlich unten im Flur.
Sofort zischt Cotschs strenge Stimme: »Nicht so laut!«
Ich will mit ihnen spielen. Ich will genauso alt sein wie sie. Ich will eine starke Mutter, die mich beschützt, die mich hier rausholt, mich und meine kleinen süßen Schwestern, die uns befreit und sagt, dass alles nur ein böser Traum war. Was mache ich neben diesem erwachsenen Mann? Warum liege ich hier? Wieso bin ich diese Mutter? Wie ist das passiert? Rainer dreht sich langsam zu mir um. Ich fühle seine Hand, die sich langsam unter meine Decke schiebt, mich an seinen nackten Körper zieht.
COTSCH
Hab ich schon gesagt, dass meine Mutter manchmal heulend auf der kleinen Treppe im Flur sitzt? Wenn mein Arschloch-Vater wieder einen auf Vergewaltiger gemacht hat. Ich hasse es, wenn meine Mutter heulend auf der Treppe sitzt wie ein Opfer und ihre Knie in der Jeans umklammert, als könnte sie nichts gegen ihr Schicksal machen. Dabei ist sie schon Feministin und hat sich die ganze entsprechende Literatur reingetankt, um ideologisch voll auf der Höhe zu sein. Ich sage nur: Virginia Woolf, Ein eigenes Zimmer. Hat alles nichts genützt. Mama hat weder besagtes eigenes Zimmer, um ungestört geistig tätig zu sein, noch hat sie Geld, um sich wie Joschis Mutter selbst zu verwirklichen.
Dafür hat sich Mamas Bild, dass du als Frau die Arschkarte gezogen hast, alle Männer emotionslose Patriarchen sind und du immer die Unterdrückte sein wirst, in den letzten zehn Jahren kontinuierlich weiter manifestiert! Dank der oberschlauen Frauenliteratur, die allen hilfesuchenden Leserinnen das Hirn wäscht, bis komplett verwirrte Salatblätter dabei rauskommen. Niemals will ich so enden. Scheiß auf Virginia Woolf, die uns Frauen mit ihrem dualistischen Denken genauso in Gefangenschaft nimmt wie mein Vater! Niemals werde ich zum Opfer von einem Mann werden. Oder von feministischer Literatur. Von beiden werde ich mir niemals sagen lassen, wie ich als Frau zu leben habe.
Mama ist so was von hörig! So, als hätte mein Vater die Macht. Dauernd sagt sie solche Sätze wie: »Papa will ständig Sex von mir.« Ja und? Ich will auch einen Privatjet! Lexchen hockt dann neben ihr auf der Treppe und versteht gar nichts, guckt Mama nur mit großen Augen an und tätschelt ihr so ein bisschen die Schulter. Sie checkt überhaupt nicht, worum es hier geht. Besonders, wenn Mama mit Begriffen wie »Tantra« oder »Kamasutra« um sich wirft.