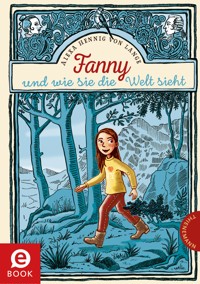9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Lauf so schnell du kannst!», sagt die Mutter zur Erzählerin, als die Flut anfängt zu steigen. Das Mädchen läuft zum Strand und rettet sich, die Mutter geht tiefer ins Watt, um ihren Mann und den kleinen Sohn zu holen. Doch nur der Vater kommt zurück. Jahre später, als Erwachsene, fährt die Erzählerin mit dem Vater zurück ins Ferienhaus ihrer Kindheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alexa Hennig von Lange
Woher ich komme
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Lauf so schnell du kannst!», sagt die Mutter zur Erzählerin, als die Flut anfängt zu steigen. Das Mädchen läuft zum Strand und rettet sich, die Mutter geht tiefer ins Watt, um ihren Mann und den kleinen Sohn zu holen. Doch nur der Vater kommt zurück. Jahre später, als Erwachsene, fährt die Erzählerin mit dem Vater zurück ins Ferienhaus ihrer Kindheit.
Über Alexa Hennig von Lange
Alexa Hennig von Lange, geboren 1973, zählt seit ihrem Debütroman «Relax» zu den erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Es folgten die Romane «Ich bin’s» und «Ich habe einfach Glück». Außerdem veröffentlichte sie Erzählungen für die Volksbühne in Berlin und das Schauspielhaus Hannover. 2002 wurde Alexa Hennig von Lange mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.
Inhaltsübersicht
«Wo ist das Kind, das ich gewesen,
ist es noch in mir oder fort?
Warum starben wir denn nicht beide,
damals, als meine Kindheit starb?»
Pablo Neruda
ES ist Anfang August. In ein paar Tagen hätte mein Bruder Geburtstag, und an seinem Geburtstag waren wir immer irgendwo am Meer. Dieses Jahr fahren wir nicht ans Meer, mein Vater will nicht ans Meer, ihn erinnert das zu sehr an meine Mutter und meinen Bruder, genau wie unser Haus, in dem er als Einziger zurückgeblieben ist. Mein Vater sitzt auf dem schmalen Bett meiner Mutter, unter ihm wirft der farbige Überwurf Falten und verrutscht. Mein Vater merkt es nicht, seine Augen werden feucht, trotzdem blinzelt er nicht, bewegt sich nicht. Er sitzt aufrecht, ich bleibe in der Tür stehen und sehe aus dem Fenster, hinaus zur Akazie, die in unserem Garten steht. Meine Eltern haben sie damals an einem heißen Sommertag an einem Bahndamm ausgegraben. In meiner Vorstellung knistert das trockene Gras, staubt der sandige Boden unter ihren Füßen, als sie gemeinsam versuchen, die Wurzeln des Bäumchens in eine Plastiktüte zu stecken. Das ist lange her, wie lange genau weiß ich nicht, auf jeden Fall war ich noch nicht geboren, meine Mutter nicht einmal schwanger, wahrscheinlich waren sie noch Studenten, mein Vater im weißen Hemd und schwarzen Pullunder. Meine Mutter, gebräunt und sommersprossig. Sie hatte viele Sommersprossen, im Gesicht und auf den Armen.
Zwischen den Blättern der Akazie sind die niedrigen Nachbarhäuser der Siedlung zu sehen. Weiter hinten die roten Hochhäuser. «Ich weiß noch, wie Mama hier oben für dich Kleidchen genäht hat!» Mein Vater schwärmt, und er vergisst den entscheidenden Punkt: Er war selten da, wenn wir da waren, und ich weiß nicht, warum meine Mutter mich damals nicht mitgenommen hat.
Ich weiß sehr vieles nicht. Ich weiß nur, woran ich mich erinnere, und das wird von Tag zu Tag mehr und jetzt, als Papa und ich den holperigen Weg zwischen den Feldern entlangfahren, das hohe Korn gegen die silbernen Seitentüren peitscht, erinnere ich mich an noch viel mehr, und ich sehe meine Mutter schräg vor mir und meinen Bruder neben mir sitzen. Seine weißen, dünnen Beinchen, seine Knie auf der Mitte des blauen Autositzes, den großen, runden Leberfleck auf seinem linken Knie, den er «Mond» nannte. Ich erinnere mich an seine kleinen Hände, an seine helle, gewölbte Stirn. Vor seiner Geburt hatten die Ärzte einmal vermutet, er könnte vielleicht einen zu großen Kopf haben, und Mama ging davon aus. Und Papa war nicht da, um mit ihr die Sorge zu teilen, also teilte ich mit ihr die Sorge, und schließlich hatte mein Bruder doch keinen Wasserkopf, und meine Mutter und ich hatten uns einen Sommer lang umsonst Sorgen gemacht. Ich, auf der Schaukel unter der Pergola, meine Mutter auf dem gelben Klappstuhl unter der Akazie, mit dickem Bauch, hochgelegten Beinen. Die rote, mit Tränenden Herzen gesäumte Gartenmauer im Blick; kurz lächelte sie mich an, gab mir ein Zeichen, ich sollte zu ihr kommen. Ich rutschte von der Schaukel, lief zu ihr, sie gab mir einen Kuss. Ich legte meinen Kopf an ihre Schulter, meine Arme um ihren Hals, als sie flüsterte: «Mein Liebling!»
Und ich sehe meine Mutter vorne im Auto neben meinem Vater sitzen und einen Apfel schälen, wie sie immer Äpfel für uns auf dem Weg in den Urlaub geschält hat, und ich erinnere mich an das glitzernde Meer links hinter meinem Fenster, die Möwen, die gelben Felder, das Abendrot, den steinigen, rauschenden Asphalt unter den Reifen. An die Gewissheit, Ferien zu haben. An die Gewissheit, jeden Morgen Milchsuppe zu bekommen.
Zu viert sitzen wir auf der Ferienhausveranda in den Dünen, essen Milchsuppe mit Marmelade und Butter, der Wind geht flüsternd durch die silbrigen Gräser, und danach wandern wir durchs Watt. Mein Vater sagt: «Macht euch keine Sorgen!» Mit meinem Bruder an der Hand geht er weiter in Richtung Meer, und der Strand ist weit weg, ist eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Mama schüttelt den Kopf, in ihrer Hand die dunkelblaue Mütze aus Bast, und ich denke an die Geschichte, die wir kurz vor den Ferien im Deutschunterricht gelesen haben: Eine Schulklasse macht eine Wattwanderung, und plötzlich füllen sich die Priele. Meine Mutter und ich sahen, wie sich der Priel mit Wasser füllte, und der Strand war nicht mehr da, und mein Vater war weit draußen, hörte unsere Rufe nicht, und der Himmel war blau. «Lauf so schnell du kannst!» Meine Mutter schubst mich in die Richtung, in der sie den Strand vermutet, und das ist die richtige Richtung, und ich renne so gut es geht, im feuchten Sand, und Mama versinkt in die andere Richtung, in Richtung meines Vaters, meines Bruders. Der war klein und wusste von nichts. Ging an Papas Hand und hatte uns zugewinkt. Die Sonne stand über uns, flirrend, keine Wolken, einfach nur Himmel und sehr viel Raum. Zwischen Mama und mir, zwischen mir und meiner Familie wurde der Abstand immer größer.
Mein Vater kam allein zurück.
Als wir mit dem Auto über den staubigen Kiesweg fahren, streifen die herunterhängenden Äste der Linden über die Windschutzscheibe, Lichtreflexe blenden uns für Sekunden, wechseln sich mit rollenden, schmalen Schatten ab, verschwinden für immer. Die zwischen den Blättern durchbrechende Sonne lässt uns wieder blinzeln. Ich habe Durst und ich sehe hinunter in meinen Schoß, auf meine Hände, ineinander verkrampft, klein, sehr klein, sehr mädchenhaft. Sie sind mit mir nicht mitgewachsen.
Mamas Hände. Oben im Nähzimmer, am Nachmittag, bei zugezogenem Vorhang, gibt sie meinem Bruder die Flasche. Mama trägt einen weißen Schwesternkittel, sehr eng geknöpft, darunter nur dünne weiße Unterwäsche. Die Haut im Ausschnitt ist von der späten Augustsonne gerötet, ihre Nase glänzt leicht, ebenso ihre Stirn. Mit meinem Bruder auf dem Schoß sitzt sie auf dem breiten Korbstuhl, der Stuhl ist niedrig, sie schlägt die nackten Beine übereinander. Über ihrer Schulter hängt eine frisch gewaschene, steife Stoffwindel. Trotz der zugezogenen Vorhänge hat sich das Zimmer aufgeheizt, es duftet nach frischer Säuglingswäsche, nach Holz, nach meinem Bruder. Ich hocke neben ihnen auf dem grauen Flusenteppich, sehr ruhig, ich darf meinen Bruder nicht vom Trinken ablenken. Meine Mutter hält die Flasche, an ihrem Daumen ist die Haut seitlich eingerissen, auf den Knöcheln etwas aufgesprungen, aber nur jetzt, im Sommer, wenn sie viel im Garten gearbeitet, Wasser gepumpt hat. In den feinen Hautrissen verlaufen noch feinere Spuren von schwarzer Erde, auch nach dem Händewaschen.
Am Abend gibt es Rote Bete und Salat. Mama steht in der Küche, über ihrem Kopf das weiße Licht der unverkleideten Neonröhre. Ich sitze auf der Fensterbank, sehe ihr beim Petersiliehacken zu. Draußen dämmert es, die Amseln zwitschern. Mein Bruder schläft oben in seinem Zimmer, im weißen Gitterbett. Wenn Mama in der Küche arbeitet, redet sie kaum. Sie muss sich konzentrieren, damit alles rechtzeitig fertig wird.
Einmal erzählt mir Mama ihren Traum. Wir waren im Zoo, ich war noch sehr klein, vielleicht fünf Jahre alt, überall war Wasser, bedeckt mit riesigen Eisschollen. Auf einer Eisscholle stand mein Schuh. «Dein kleiner Halbschuh!» Und ich war weg, Mama rief nach mir. «Ich wusste, du bist tot!»
Die Eier werden für den Salat gehackt. Dann die Tomaten. Meine Mutter hat Angst vor dem Tod. Das weiß ich. Gesagt hat sie es nie. Doch sie scheint daran zu denken, gerade wieder, als sie sich beeilt, fertig zu werden, bevor mein Vater aus dem Büro kommt. Später ärgert sie sich, weil er nicht da ist, als wir hungrig am gedeckten Tisch im Garten sitzen.
Ich bin nicht sicher, was meine Mutter mehr fürchtet: Trennung durch Kinderverschwinden, Kindertod. Oder: Trennung durch ihren eigenen Tod. In jedem Fall möchte ich meine Mutter davor schützen, lasse mich auf dem Weg zum Einkaufszentrum nicht von den Trinkern ansprechen, die in den roten Hochhäusern wohnen. In der Schule sagen die Kinder: «Die Trinker schmeißen Kinder und Katzen vom Dach!»
Wir sind da. Papa steigt aus, der Kies knirscht unter seinen Sohlen. Er schlägt die Tür zu und das Auto rollt weiter, rollt mit mir den abschüssigen Platz hinunter, in Richtung Graben. Er reißt die Fahrertür wieder auf, beugt sich über seinen Sitz und zieht die Handbremse an. «Steig aus, wir sind da!»
Langsam bewegen sich meine Beine aus dem Fußraum hinaus in das warme Licht des Nachmittags. Die Füße setzen auf dem weißen Kiesboden auf, der Rest von mir ist noch drinnen im heißen Auto. Ich weiß nicht, wie ich hochkommen soll, aus diesem tiefen, weichen Sitz. Es ist nie schön auszusteigen. Immer wieder ist es die gleiche Überwindung auszusteigen, zu stehen, sich plötzlich wieder selbst bewegen zu müssen. Nach einer Autofahrt bleibe ich lieber sitzen und warte. Worauf weiß ich nicht. Ich bin draußen, stehe neben dem Auto, in meinem Kopf rauscht es, und Papa geht schon quer über den Vorplatz, am Brunnen vorbei, in Richtung Hauptgebäude. Die Tür unter dem tief gezogenen Dach steht offen, Herr Wallbrecht kommt uns entgegen. Sein dunkelgrünes Hemd ist an den Armen hochgekrempelt, an seiner Hose hängen Holzspäne. Meine Hände sind klebrig und mir wäre es lieb, er würde mir nicht die Hand geben. Breit, gebräunt, sehr fest ist sein Händedruck, er guckt und seine Lippen sind feucht, feucht vom Lachen und Reden, und er nimmt uns ein paar Taschen ab und geht mit uns den Weg zum Kuhstall.
Rechts am Haus vorbei, am Graben entlang. Dahinter liegt die Schafweide, gelbliche Schafe grasen auf dem ansteigenden Hang. Ganz oben: Büsche, schließlich Wald. Zwischen den hellen Schafen grast ein schwarzes. Meine Augen brennen, fast ist es so, als würde ich dort grasen, grasen, alleine auf der Weide. Allein, allein, allein. Ein schöneres Wort gibt es nicht. Ich bin allein. Die grauen Gänse strecken mir ihre offenen Schnäbel, ihre steifen Zungen entgegen, krächzen, aufgeregt rutschen sie durch den Matsch am vorderen Rand der Weide.
Herr Wallbrecht geht voran, er fragt nicht, wo der Rest der Familie ist, wir waren schon früher hier, im Frühsommer, oder noch Frühling. Damals war ich dreizehn, das Unglück in Tschernobyl war passiert, und meine Mutter wollte nicht, dass mein Bruder und ich im See baden oder Gemüse aus Herrn Wallbrechts Garten essen. In diesem Urlaub sah sie ängstlich aus, und mein Bruder sollte auf keinen Fall die Wiese betreten. Mein Vater schüttelte den Kopf. «Jetzt mach nicht so ein Theater!» Gestritten haben sie. «Nicht so laut!»
Mama schließt die Fenster, draußen läuft Herr Wallbrecht in seinen grünen Gummistiefeln über die Wiese. Die Sonne malt helle Kringel auf die kühlen Tonfliesen zwischen unseren nackten Füßen. Als mein Vater auf Mama zugeht, verschwinden mein Bruder und ich im Kinderschlafzimmer. Er findet Mama lächerlich. «Du bist lächerlich!»
Am Morgen treibt Herr Wallbrecht die Schafe an meinem angekippten Fenster vorbei. Das macht er schon sehr früh, und im Halbschlaf höre ich ihn rufen: «Heute wird geschlachtet!» Ich drehe mich von der Seite auf den Rücken, und über mir drückt sich die graue Matratze vom Etagenbett durch den Rost. Mein Bruder wollte immer oben schlafen. Jetzt ist das Bett über mir frei. Drüben im Elternschlafzimmer ist neben Papa auch noch eine halbe Matratze frei, und ich frage mich, ob er manchmal aufwacht und vergessen hat, dass seine Frau fehlt.
Als mein Bruder geboren wurde, war ich sieben Jahre alt. An der Hand meines Vaters ging es durch die kühlen Krankenhausgänge ins Krankenzimmer. Da lag meine Mutter und war blass. In dem Glasbettchen neben ihr lag mein Bruder. Ich wollte ihn anfassen, ließ meinen Vater los, rannte auf das Glasbettchen zu, um meine Hand hineinzustecken. «Schneewittchen liegt da!», dachte ich. «Nicht anfassen!», sagte meine Mutter. «Das macht ihn krank!» Schnell zog ich meine Hand zurück, legte sie auf den Rand des Glasbettchens, stellte mich auf die Zehenspitzen, guckte hinein, auf meinen Bruder hinunter. Das Bett rollte. «Vorsicht!» Blinzelnd öffnete mein Bruder die Augen, dann den Mund. «Jetzt hast du ihn aufgeweckt!» Und mein Bruder schrie. Er war ganz rot im Gesicht, nur auf der Stirn hatte er einen weißen, kreisrunden Fleck. «Schneewittchen weint!», dachte ich.
Draußen schien die Augustsonne durch die Kronen der Krankenhausbäume, mein Vater war zwischen Tür und Waschbecken stehen geblieben. Die Äste streiften quietschend über die Krankenhausfenster, und ich weiß noch, dass ich einen dunkelblauen Trägerrock mit weißer Puffärmelbluse trug. Beides hatte mir Mama oben im Nähzimmer, bei zugezogenem Vorhang, genäht. So lange hatte ich draußen im Garten geschaukelt, bis sie damit über den Rasen kam, es mir vorsichtig über den Kopf zog und guckte, ob es passte. Unter den Armen stachen mich die Stecknadeln fein, sehr fein in die Seiten.