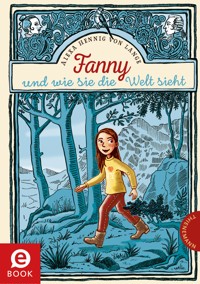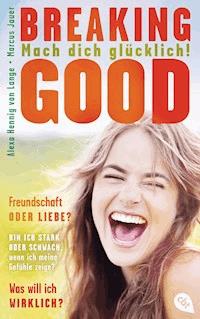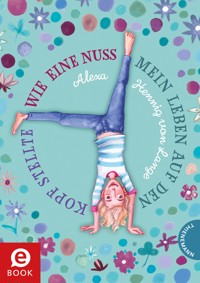9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heimkehr-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Kann es Hoffnung geben, wenn die Welt in Trümmern liegt? Mitte der Vierzigerjahre rückt die Front immer näher an Deutschland heran. Während ihr Mann in Schlesien ums Überleben kämpft, versucht Klara zwischen Bombennächten, Hunger und Angst ihren vier Kindern eine schöne Kindheit zu bereiten – doch die Schuldgefühle, das jüdische Mädchen Tolla weggegeben zu haben, wüten in ihr. Als der Krieg vorbei ist und Europa in Trümmern liegt, muss Klara sich fragen, was sie retten konnte von ihren Träumen und Hoffnungen. Über fünfzig Jahre später: Nach dem Tod ihrer Großmutter entdeckt Isabell einen Karton mit Tonbändern, auf die Klara ihre Lebenserinnerungen gesprochen hat. Mit ihrer Tochter auf dem Schoß lauscht Isabell der vertrauten Stimme und begibt sich auf eine emotionale Zeitreise. Zu spät erkennt sie, wer ihre oft unnahbar wirkende Großmutter wirklich war – und fragt sich: Was hätte ich getan, um die zu schützen, die ich liebe? Inspiriert durch ihre eigene Familiengeschichte, erzählt Alexa Hennig von Lange mitreißend, klug und empathisch von dem Versuch, menschlich zu bleiben – auch in dunkelsten Zeiten –, und davon, wie die Vergangenheit uns prägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mitte der Vierzigerjahre rückt die Front immer näher an Deutschland heran. Klara ist inzwischen Mutter von vier kleinen Kindern, während ihr Mann Gustav in Schlesien ums Überleben kämpft. Zwischen Bombennächten, Hunger, Terror und Angst versucht Klara, ihren Kindern eine halbwegs unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen – doch die Schuldgefühle, das jüdische Mädchen Tolla weggegeben zu haben, wüten in ihr. Als der Krieg vorbei ist und Europa in Trümmern liegt, muss sich Klara fragen, was sie retten konnte von ihren Träumen und Hoffnungen. Mehr als fünfzig Jahre später: Nach dem Tod ihrer Großmutter entdeckt Isabell einen Karton mit Tonbändern, auf die Klara ihre Lebenserinnerungen gesprochen hat. Mit ihrer Tochter auf dem Schoß lauscht Isabell der vertrauten Stimme und begibt sich auf eine Zeitreise. Zu spät erkennt sie, wer ihre oft unnahbar wirkende Großmutter wirklich war – und sie fragt sich: Was hätte ich getan, um die zu schützen, die ich liebe?
Alexa Hennig von Lange erzählt mitreißend, klug und einfühlsam von dem Versuch, auch in dunkelsten Zeiten menschlich zu bleiben, und davon, wie die Vergangenheit uns prägt.
›Vielleicht können wir glücklich sein‹ ist nach ›Die karierten Mädchen‹ und ›Zwischen den Sommern‹ der dritte Band der ›Heimkehr‹-Trilogie. Sie ist inspiriert von den Erinnerungen von Alexa Hennig von Langes Großmutter, die diese im hohen Alter auf mehr als 130Tonbandkassetten aufgenommen hat.
© Madlen Krippendorf
Alexa Hennig von Lange, geboren 1973, wurde mit ihrem Debütroman ›Relax‹ (1997) zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Seitdem hat sie mehr als 25Romane veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Bei DuMont erschienen die Romane ›Risiko‹ (2007), ›Peace‹ (2009), ›Kampfsterne‹ (2018), ›Die Weihnachtsgeschwister‹ (2019), ›Die Wahnsinnige‹ (2020) und ›Die karierten Mädchen‹ (2022), der erste Teil der ›Heimkehr‹-Trilogie, gefolgt von ›Zwischen den Sommern‹ (2023) und ›Vielleicht können wir glücklich sein‹ (2024). Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Berlin.
Alexa Hennigvon Lange
Vielleicht können wir glücklich sein
ROMAN
Von Alexa Hennig von Lange sind bei DuMont außerdem erschienen:
Relax
Risiko
Peace
Kampfsterne
Die Weihnachtsgeschwister
Die Wahnsinnige
Die karierten Mädchen
Zwischen den Sommern
Relaxt vegan
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
© imageBROKER.com GmbH & Co. KG/Alamy Stock Foto und © saemilee/iStockphoto
Satz: Fagott, Ffm
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1063-6
www.dumont-buchverlag.de
Wollt ihr den totalen Krieg?
Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir
ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?
Joseph Goebbels, 1897–1945 (Berlin)
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer, 1906–1945 (
1
September, 2000
Isabell blickte aufgewühlt in das Gesicht ihres Freundes. Dann reichte sie ihm den Brief, den ihr Großvater kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges an ihre Großmutter geschickt hatte. Patrick nahm den Brief und las ihn schweigend. Es dauerte einige Zeit, bis er die Sütterlinschrift entziffern konnte, die wie das Elektrokardiogramm eines aufgeregten Herzens aussah. Schließlich faltete er das dünne Papier zusammen und gab es an Isabell zurück. Stumm schauten sie hinüber zum kleinen Cäcilienpark, der in wunderschöner sommerlicher Abenddämmerung vor ihnen lag. Die blühenden Rhododendren bekamen in dem bläulichen Licht eine violette Färbung, die blätterbepackten Äste der Platanen, die die Rasenfläche umsäumten, wehten in der sachten Brise, und das leise Klackern der aneinanderstoßenden Kugeln der Boule-Spieler ließ alles so unbeschwert erscheinen. Der Himmel wechselte in ein tiefes Rotviolett, und bald breiteten sich die Schatten unter den hohen Bäumen so aus, dass die hübsche Parkanlage im Zwielicht lag. Die Straßenlaternen flackerten auf. Ein paar Insekten stießen gegen das Glas. Neben Isabell knackte das neue Babyphone, das Tante Gudi ihr vorhin bei ihrem kurzen Besuch mitgebracht hatte. Dann war es wieder still. Oben, in der Zweizimmerwohnung, schlief ihre Tochter Tilly im Gitterbettchen, während sie hier unten mit Patrick auf den Stufen der hell verputzten Gründerzeitvilla saß, in die sie im Frühsommer gezogen waren. Es war ein angenehm lauer Sommerabend, der verheißungsvoll auf das wartete, was als Nächstes in dieser wunderbaren Welt, in diesem wunderbar jungen Leben von Isabell und Patrick geschehen würde.
Doch gerade geschah gar nichts Wunderbares. Auf Isabells Knien lag ein gelbrosafarbener Brief, der sie zutiefst erschütterte und dessen Inhalt sie nicht zu begreifen imstande war. Schließlich räusperte sich Patrick und strich ihr etwas hilflos über den Rücken. »Immerhin weißt du jetzt, dass dein Großvater das kleine Mädchen, das deine Großmutter als ihre Tochter aufgezogen hat, noch einmal gesehen hat.«
»Er hat sie in einem der Todesmärsche gesehen, die aus Auschwitz kamen«, flüsterte Isabell.
Patrick räusperte sich wieder. Offenbar wusste er nichts zu sagen, das irgendwie tröstlich gewesen wäre.
Isabell fuhr heiser fort: »Mein Opa schreibt, wie die erschöpften Männer, Frauen und Kinder, die bei der Eiseskälte nicht mehr weitergehen konnten, von den SS-Wachen erschossen wurden.« Ihre Stimme brach. »Sie waren nur noch Haut und Knochen in gestreiften Lumpen, Patrick.«
»Ich weiß.« Ihr Freund atmete angespannt aus.
»Vielleicht … Vielleicht haben sie Tolla auch einfach erschossen, weil sie nicht mehr weiterlaufen konnte.«
»Ich weiß«, flüsterte Patrick wieder. »Ich weiß.«
Vorsichtig nahm Isabell das dünne Briefpapier und steckte es zurück in den verschmutzten Umschlag. Ein paar Regentropfen, Dreck. Die letzten Spuren des Krieges. Sie drehte ihn um. Er war im Februar 1945 abgestempelt worden. Vor mehr als fünfundfünfzig Jahren.
Aus dem Babyphone kam wieder ein leises Knistern. Vermutlich hatte sich ihre Tochter von einer Seite auf die andere gedreht. »Warum hat mein Großvater nicht einfach Tollas Hand genommen, sie aus der Menge gezogen und schnell weggebracht?«, fragte Isabell und blickte Patrick abwartend von der Seite an. Natürlich ahnte sie, was das bedeutet hätte. Aber ein Teil von ihr wollte glauben, dass Patrick so gehandelt hätte. Ihr Freund, der immer so unerschrocken und kämpferisch war.
Patrick senkte den Blick und betrachtete seine silbernen Nike Air Max mit den neuartigen Luftkammern. »Vermutlich hätten ihn die SS-Männer auch sofort erschossen. Er konnte sich ja nicht einfach von seiner Einheit entfernen. Das wäre Fahnenflucht gewesen.«
Isabell holte den Brief wieder aus dem Umschlag, faltete ihn erneut auseinander und las stockend: »Und als ich in die Menge hineinsah, blickte ich in das Gesicht eines hohlwangigen Mädchens mit rotem Haar. Ich glaube, sie war es, mein Klärchen. Was sollte ich tun?« Isabell atmete tief aus. »Dann hättest du Tolla auch weiterziehen lassen, in der Ahnung, dass sie direkt in ihren Tod hineinläuft?«
Patrick schüttelte fast unmerklich den Kopf. »Ich weiß es nicht.«
»Aber neulich hast du doch gesagt, du wärest unter den Nazis auf jeden Fall in den Widerstand gegangen.«
»In der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Aber als Wehrmachtssoldat das Mädchen aus der Menge zu ziehen, vor den Augen der SS-Wachen. Das wäre auf jeden Fall Selbstmord gewesen.«
Isabell steckte den Brief zurück in den Umschlag. Sie lehnte sich an Patricks Schulter. »Was muss Tolla wohl gedacht haben? Ob sie meinen Großvater in seiner Uniform erkannt hat?«
»Er hat Tolla doch auch erkannt, obwohl sie so abgemagert war.«
Isabell flüsterte: »Sie wäre jetzt einundsiebzig Jahre alt.«
Über ihnen flog eine Amsel zwitschernd der Nacht entgegen. Aus dem Babyphone kam leises Meckern. Patrick erhob sich von den Treppenstufen und hielt Isabell die Hand hin. »Komm, wir gehen hoch.«
Sie stand auf und drückte den Briefumschlag an ihre Brust. Im Licht der Haustür sah sie Patrick in die Augen. »Glaubst du, meine Großmutter hat sich von da an bis zu ihrem Tod gefragt, ob Tolla noch lebt?«
Ihr Freund ließ ihre Hand los und hob die beiden Pappeisbecher, die sie gerade leer gelöffelt hatten, von den Stufen auf. »Hättest du dich das nicht gefragt?«
»Natürlich hätte ich mich das gefragt. Ich frage es mich ja jetzt auch. Ich würde gerne wissen, ob Tolla noch lebt und wie es ihr geht.«
»Da hast du deine Antwort. Vielleicht hat deine Großmutter genau aus dem Grund diese hundert Kassetten mit ihren Lebenserinnerungen aufgenommen …«
»Es sind sogar mehr als hundertdreißig.«
»Sie wird irgendetwas damit vorgehabt haben. Vielleicht wollte sie auf diese Weise im Nachhinein überprüfen, ob die Entscheidungen, die sie im Laufe ihres Lebens getroffen hat, immer richtig waren oder ob sie sich auch anders hätte entscheiden können oder müssen.«
Isabell stieg mit Patrick die Eingangsstufen hinauf. Ihr Freund schloss die Haustür auf, und sie gingen langsam die knarrenden, mit einem roten Läufer bezogenen Holzstufen zu ihrer Wohnung in den 2. Stock hoch.
»Was ich nicht verstehe«, begann Isabell wieder, »ist, dass meine Großmutter Tolla bis zum Schluss vor ihren eigenen Kindern verheimlicht hat. Sie hätte ihnen doch einfach erzählen können, dass sie vor ihrer Geburt ein kleines jüdisches Waisenmädchen bei sich versteckt und schließlich weggegeben hat. Sie hätte ihre Töchter bitten können, nach Tolla zu suchen.«
»Und dann? Was, wenn deine Mutter oder ihre Schwestern herausgefunden hätten, dass Tolla auf diesem Marsch gestorben ist, was hätte das bedeutet? Dass ihre Eltern sich zweimal nicht getraut haben, ein Kind zu retten, das sie wie ihr eigenes geliebt haben?«
»Hätte ich nicht angefangen, mir die Kassetten anzuhören, wüsste niemand etwas von Tolla. Nun weiß ich von ihr, meine Mutter weiß von ihr, und dieses Wissen lässt uns keine Ruhe mehr. Ich will später keine Geheimnisse vor unserer Tilly haben.«
»Und ich will keine politischen Verhältnisse mehr haben, die wie der Faschismus derartige Unmenschlichkeit überhaupt möglich machen.«
Das Meckern im hellrosa Babyphone, das Isabell in der Hand hielt, wurde lauter. Sie und Patrick stiegen die letzten Stufen hinauf und schlossen die bunt verglaste Wohnungstür auf. Isabell war dankbar, dass ihr Freund durch den kurzen Flur gleich ins Schlafzimmer verschwand, um nach ihrer Tochter zu sehen, die inzwischen ziemlich laut weinte. Vermutlich hatte Tilly im Schlaf ihren Schnuller verloren, und er war durch die Stäbe ihres Gitterbettchens runter auf die Dielen gefallen. Das passierte mindestens dreimal pro Nacht. Dieses klackernde Geräusch machte einen fertig, wenn es einen aus dem Schlaf riss.
Isabell setzte sich in der Küche an den Holztisch und sah hinaus in die Dunkelheit. Sie spiegelte sich in dem Sprossenfenster. Vor zwei Wochen hatte sie ihre Oma Klara leblos in deren Garten auf dem Rasen gefunden. In ihrem dunkelblauen Wollmantel hatte sie bäuchlings auf dem Rasen gelegen, das Gras war noch ganz feucht von dem schweren Gewitter gewesen, das am Tag zuvor über die Reihenhaussiedlung hinweggetobt war. Ihre Großmutter hatte offenbar einen kleinen Ausflug zum rückwärtigen Gartenzaun unternehmen wollen. Dahin, wo sie früher mit Gustav auf einer Decke gesessen und er ihr aus den Klassikern der Weltliteratur vorgelesen hatte. Dort, wo die Blüten des Jelängerjelieber so herrlich dufteten. Doch mit über neunzig Jahren und blind war solch eine Unternehmung kein kleiner Ausflug, sondern ein großes Abenteuer.
Wahrscheinlich war Klara von dem Gewitter überrascht worden. Vielleicht war sie ausgerutscht, vielleicht hatte sie nicht zum Haus zurückgefunden. Das leer stehende Nachbarhaus wurde gerade renoviert, die Anwohner auf der anderen Seite waren in den Sommerurlaub gefahren. Niemand hätte ihre Hilferufe hören können. Aber ihre Großmutter war auch keine Frau gewesen, die jemals um Hilfe gerufen hätte. Irgendwie wurde Isabell das Gefühl nicht los, dass ihre Oma, als sie sich allein hinaus in den Garten gewagt hatte, geahnt hatte, dass dies ihr letzter Gang sein würde. Fast schien es, als hätte sie sich absichtlich in den hinteren Teil des Gartens aufgemacht. Als hätte sie nur noch zurück zu Gustav gewollt, der vor mehr als zwanzig Jahren gestorben war. Morgen war die Beisetzung ihrer Urne.
Patrick kam in die Küche und trug den Schnuller vor sich her. »Ist mal wieder in den Staub gefallen.« Er ging zur Spüle und hielt das hellrosa Plastikding unter den Wasserhahn.
»Vielleicht sollten wir mal einen zweiten Schnuller neben das Babyphone legen, damit wir gleich einen Ersatz haben«, schlug Isabell vor. Dafür war es jetzt allerdings schon zu spät.
Im Schlafzimmer schrie Tilly aus Leibeskräften, und Patrick verschwand eilig aus der Küche, um ihr den sauberen Schnuller in den Mund zu stecken. Isabell nahm sich fest vor, den Ersatzschnuller nicht wieder zu vergessen. Aber erst einmal hatte sie von ihrer Mutter den Auftrag bekommen, eine Rede für die Trauerfeier ihrer Großmutter vorzubereiten. Das wollte sie gerne tun. Auch wenn sie gar nicht wusste, was sie über Klara sagen oder nicht sagen sollte. Bis vor Kurzem hatte Isabell kein sonderlich inniges Verhältnis zu ihrer Großmutter gehabt. Als Kind war sie ihrer kühlen, strengen Art regelrecht ausgewichen. Kaum ein herzliches oder persönliches Wort war aus Klaras Mund gekommen. Meist hatte es nur strikte Anordnungen oder Ermahnungen gegeben: ordentlich bei Tisch sitzen, leise reden, nicht rennen, keine Widerworte geben, Hände waschen, als würde ihre Großmutter noch immer ihr ländliches Frauenbildungsheim leiten.
Doch zu Beginn des Sommers hatte sich Isabells Eindruck schlagartig geändert. Mit ihrer kleinen Familie war sie eher unfreiwillig von Berlin in die Nähe ihrer Großmutter gezogen. Patrick hatte ein Engagement als Chef-Bühnenbildner am Oldenburgischen Staatstheater bekommen. Und weil Isabell in dieser beschaulichen Universitätsstadt sonst niemanden kannte, hatte sie sich mit Tilly einmal in der Woche zu ihrer Großmutter aufgemacht, die in einem Reihenhaus am Stadtrand wohnte. In den letzten Wochen war bei der alten Dame mit dem silbergrauen Dutt im Nacken eine Weichheit durchgeschimmert, die Isabell zunehmend überrascht hatte. Nie hatte sie ihre Oma so liebevoll erlebt wie mit ihrer kleinen Urenkelin. Trotz ihrer Blindheit und körperlichen Zerbrechlichkeit hatte sie mit einem Mal eine lebendige, fast jugendliche Freude ausgestrahlt, die Isabell als Kind nie wahrgenommen hatte. Klara hatte im Wohnzimmer auf ihrem dunkelblauen Sessel gesessen, Tilly auf dem Schoß gehalten und interessiert nach ihren Entwicklungsfortschritten gefragt, während die Urenkelin fröhlich an der goldenen kleinen Uhr gezogen hatte, die sie an einer feinen Kette um den Hals trug. Klara hatte sich nach Patricks Arbeit als Bühnenbildner und nach Isabells Romanprojekt erkundigt. Ihren Wunsch, ein Buch zu schreiben, hatte ihre Großmutter sehr ernst genommen. Sie hatte immer gesagt: »Ich finde es schön, wie mutig du bist.« Vielleicht weil sie selbst so literaturbegeistert gewesen war oder weil in Gustavs altem Zimmer die Bücherregale bis unter die Decke gereicht hatten.
In der Kindheit hatten Isabell und ihre Geschwister bei jedem Oldenburg-Besuch von Klara ein Buch geschenkt bekommen. Damals hatten sie gedacht, das sei, damit sie sich oben im Gästezimmer still verhielten. Vielleicht hatte ihre Großmutter ihren Enkeln aber auch nur näherbringen wollen, wie schön es war, lesend in der Sprache zu versinken und sich in fremden Welten wiederzufinden. Und wirklich! Schon als Grundschülerin hatte Isabell fest vorgehabt, Schriftstellerin zu werden. Über ihr Schreiben wollte sie das Menschsein durchdringen. Das war auf jeden Fall ein Verdienst ihrer Großmutter. Mit ihren Kurzgeschichten und einem längeren Text hatte Isabell sogar schon ein paar Preise gewonnen; nun wagte sie sich an ihren ersten Roman. Dass sie stattdessen erst einmal die Trauerrede für ihre Großmutter verfassen sollte, damit hatte sie nicht gerechnet.
Seit ihrem Tod hatte Isabell viele Dinge über Klara erfahren, von denen sie nicht einmal im Ansatz eine Ahnung gehabt hatte. In einem Karton unter ihrem Flurtisch hatte Isabell mehr als hundertdreißig Tonbänder entdeckt. Verwundert hatte sie eine Kassettenhülle nach der anderen in die Hand genommen und gelesen, was ihre Großmutter blind auf die Einlageblätter gekritzelt hatte: Nationalpolitische Bildung undNS-Erziehung. Isabell hatte keine Idee gehabt, was das zu bedeuten hatte. Krieg. Frauenbildungsheim. Flucht, Gefangenschaft. Um zu erfahren, was es mit diesen Tonbändern auf sich hatte, hatte sie begonnen, die Kassetten anzuhören. Zu ihrer Überraschung waren darauf Klaras detaillierte Lebenserinnerungen gespeichert. Sie reichten von ihrer Kindheit in der Kaiserzeit über ihre Jugend in der Weimarer Republik und wie sie sich während der Weltwirtschaftskrise als emanzipierte junge Frau in ihren Beruf als Lehrerin gestürzt und mit dem Machtgewinn der Nationalsozialisten schon bald das erste ländliche Frauenbildungsheim im Dritten Reich geleitet hatte. Je näher sie in ihren Schilderungen dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam, desto mehr brach ihre Stimme, desto mehr rang sie nach Worten.
»Sie schläft.« Patrick kam zurück in die Küche und strich sich sein kinnlanges mittelblondes Haar hinter das Ohr. Auf seinem olivgrünen T-Shirt prangte an der Schulter ein feuchter Fleck von Tillys Tränen und Sabber. Er lehnte sich gegen den Küchentresen und sah Isabell abwartend an. »Was überlegst du?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Um was es in der Trauerrede gehen soll. Durch die Kassetten weiß ich inzwischen so viel über meine Großmutter. Dinge, von denen außer meiner Mutter und dir niemand etwas in der Familie ahnt.«
Patrick nickte verstehend.
Isabell fuhr fort: »Wenn ich erzähle, dass sie erfolgreich mehrere nationalsozialistische Erziehungsanstalten geleitet hat, vor deren Eingang die Hakenkreuzflagge im Wind wehte, wären alle schockiert. Darüber ist in unserer Familie ja nie geredet worden. Wenn ich aber erzähle, dass sie genau an diesem Ort ein kleines jüdisches Waisenmädchen über zehn Jahre als eigene Tochter aufgezogen und schließlich weggegeben hat, wären wieder alle schockiert, warum sie das Kind nicht gerettet hat. Um den Rahmen der Beisetzung nicht zu sprengen, kann ich eigentlich nur etwas darüber sagen, wie ich sie zuletzt erlebt habe.«
»Vielleicht reicht das. Es ist doch sehr friedvoll, wie ihr kurz vor ihrem Tod zueinandergefunden habt. Das sagt so viel mehr als all die Fakten und Daten aus der Vergangenheit.«
»Aber erst diese Daten und Fakten haben meine Oma zu dem Menschen gemacht, der sie war.«
Patrick nahm ein Glas aus dem Hängeschrank und hielt es unter den Wasserhahn. Dann stellte er es vor Isabell auf den Tisch. »Und doch existierte dahinter immer die Frau, die du zum Schluss kennengelernt hast. Liebevoll, warmherzig, mutig und nach Vergebung suchend.«
Isabell nickte nachdenklich. »Zumindest habe ich sie so wahrgenommen.«
Patrick rückte sich einen Stuhl zurecht und setzte sich neben Isabell. »Auf dein Gefühl für deine Großmutter kommt es an. Du kannst dafür sorgen, dass alle noch einmal zu ihr finden und vielleicht ein größeres Verständnis für ihre Härte und Strenge haben. Das ist doch ein Geschenk.«
2
September, 1944
Noch vor einiger Zeit hätte Klara gesagt: »Wir leben auf einer unberührten Insel.« Mit Insel war das ländliche Frauenbildungsheim gemeint, das eingebettet in ein idyllisches Tal des bewaldeten Löhberges am Rand des Städtchens Sandersleben lag. Hier bewohnte sie mit ihren vier kleinen Kindern das ehemalige Hausmeisterhäuschen, das sie vor fünf Jahren als Leiterin der Lehranstalt mit ihrem Mann Gustav bezogen hatte. Nur einen Steinwurf entfernt stand das große Hauptgebäude, in dem die Lehrerinnen, Erzieherinnen, die Schülerinnen und die Kurkinder untergebracht waren, die aus allen Teilen des Großdeutschen Reichs ihren Weg zu ihnen nach Anhalt suchten. Aus dem Rheinland, aus Ostpreußen, aus Schleswig-Holstein und sogar aus Österreich kamen sie, um hier für eine gewisse Zeit Heimat zu finden. Unerlässlich war allerdings, dass alle, die hier lebten, nachweislich arischer Abstammung waren. Ein schmaler Schotterpfad führte aus dem Ort zu ihnen herauf. Für die hohen Herren aus dem Staatsministerium in Dessau gab es natürlich auch eine gepflasterte Straße. In regelmäßigen Abständen ließen sie sich von ihren Chauffeuren in ihren großen schwarzen Limousinen herauffahren, um zu überprüfen, ob diese Bildungsanstalt auch anständig nach den nationalsozialistischen Prinzipien geführt wurde. Doch alle, die hier oben zu Hause waren, nahmen die steile Abkürzung durch den Wald hinunter ins Städtchen.
Klara stand ein Stück von ihrem Wohnhaus entfernt auf der Wiese neben dem Wasserbecken, in dem in den Sommermonaten eine Fontäne plätscherte und wo die Schülerinnen vom Tanzlehrer Walter Borschel im Volkstanz unterrichtet worden waren, bis er in den Krieg ziehen musste und bald darauf in Stalingrad gefallen war. Klara atmete tief ein. Sie alle hatten den feinsinnigen Walter Borschel in seinem knappen schwarzen Bolerojäckchen und seinen schwarzen Anzughosen gemocht; es waren immer besonders losgelöste Stunden gewesen, wenn er mit den Mädchen unter den Kirschbäumen die Schrittfolgen geübt hatte.
Der September neigte sich dem Ende zu und das Laub der Bäume färbte sich langsam gelblich. Die Sonne schickte ihre letzten warmen Sommerstrahlen zu Klara und ihren Kindern hinunter, die im Schutzgraben, der sich seit Kurzem wie eine klaffende Wunde durch den weitläufigen Garten zog, Fangen spielten. Klara sah vom Rand aus zu ihnen hinab. Es machte den Kleinen Spaß, da unten herumzulaufen und sich zu jagen. Der Graben war schmal und die Wände waren hoch; und ihr glucksendes Lachen schallte bis zu ihr herauf. Sie sah die rote Mütze von Hilli, die Georg-Friedrich immer dicht auf den Fersen war. Ihr Ältester war nun schon fünf Jahre alt. Inge wackelte tapfer hinterher, mit ihren knapp zwei Jahren war sie noch lange nicht so schnell wie ihre großen Geschwister. Aber sie war wild entschlossen mitzuspielen. Sie stolperte, fiel auf alle viere, rappelte sich wieder auf und wackelte weiter. Was für ein kleines, unverwüstliches Persönchen.
»Hab dich!«, rief Hilli triumphierend und klammerte sich an Georg-Friedrichs Arm. »Hab dich!«
Klara lächelte. Georg-Friedrich hatte sich wieder einmal erbarmt und von seiner vierjährigen Schwester fangen lassen. Es war gut, dass die Kinder sich hatten. Geschwister waren wichtig. Sie hielten einen ein Leben lang in der Welt. Klaras Blick glitt über die zu Wällen aufgeworfene Erde, die von jungen Rekruten beim Grabenbau hinaufbefördert worden war. Weiter über die Rasenfläche und die Kirschbäume hinweg, hinüber zum zweigeschossigen Hauptgebäude des Frauenbildungsheimes. Quer dazu lag das niedrige Schulgebäude aus Fachwerk, in dem sich die Werkräume und eine Lehrküche befanden. Versteckt dahinter gab es noch einen Viehstall mit zwei Kühen und einem Schwein. Hühner gackerten und im großen Gemüsegarten wiegten sich die hochstehenden violetten Kohlrabiblätter. Auf der Säuglingsstation lernten die Schülerinnen alles über Säuglingspflege. Das Jugendamt brachte ihnen kränkelnde und unterernährte Kinder jeden Alters, die von den Schülerinnen und Kinderschwestern gepäppelt wurden. Für alles gab es klare Anweisungen aus dem Dessauer Staatsministerium. Alles diente dem einzigen Zweck: dass aus den Schülerinnen erdverwurzelte, das Volk stützende Mütter wurden. Denn angeblich gab es keinen größeren Adel für die deutsche Frau, den sie sich überhaupt erwerben konnte. Der Propagandaminister Goebbels hatte kürzlich in einer seiner frenetischen Reden sogar gesagt: »Das Überleben des deutschen Volkes liegt in ihren Händen.«
Vor einem Jahr hatte Klara ihre Arbeit als Leiterin des Heimes aufgegeben, nachdem sie kurz hintereinander drei Kinder zur Welt gebracht hatte. Gustav, dessen Einheit sich inzwischen aus Weißrussland nach Südpolen zurückziehen musste, kam nur selten nach Hause. Die Doppelbelastung durch Haushalt, Mutterschaft und Heimleitung war kaum noch zu bewältigen gewesen. Doch eigentlich hatte Klara endlich nach einer klaren Linie leben wollen. Der Zwiespalt zwischen dem, was von ihr als Angestellte des Staates gefordert wurde, und dem, was sie menschlich für richtig hielt, war schließlich unüberwindbar geworden. Ihre Abscheu den Nazis gegenüber hatte sie vor ihren Vorgesetzten aus Dessau kaum noch verbergen können. Die ihr ans Herz gewachsenen Schülerinnen hatten ihre Abschlüsse gemacht und waren in alle Himmelsrichtungen entschwunden. Susanne, Klaras engste Vertraute, war nach Rom gegangen, in der Hoffnung, in Italien ungezwungener leben zu können. Denn dort hatte der Faschismus mit dem Sturz Mussolinis, wie es schien, bereits sein Ende gefunden. Fritzchen Trensinger, die gute Seele des Hauses, war geblieben, hatte kommissarisch die Leitung des Heimes übernommen und versuchte nun ihrerseits, den Spagat zwischen der eigenen und der nationalsozialistischen Weltanschauung unauffällig zu meistern.
Klara seufzte. Über ihr spannte sich der wolkenlose, tiefblaue Septemberhimmel, die Luft war noch warm, aber um ihre Waden schlich die erste herbstliche Kälte. Neben ihr stand der Kinderwagen, in dem ihre kleine Gudi warm eingepackt mit wachen Augen die Umgebung bestaunte. Vor drei Monaten war sie auf die Welt gekommen, ihren Vati hatte sie noch nie gesehen.
»Mama, dürfen wir hinauf zu den Obstgärten laufen und gucken, ob schon ein paar Äpfel von den Bäumen gefallen sind?«, rief Georg-Friedrich und sah aus dem Erdreich zu ihr hinauf.
Klara blickte zu ihren drei Kindern hinunter, deren helle Gesichter im dunklen Schacht schimmerten. Wie die Orgelpfeifen standen sie nebeneinander. Georg-Friedrich mit seinem weißblonden Haar, Hilli mit ihrer roten Häkelmütze und Inge mit ihrer dunkelblauen Mütze. »Macht nur«, rief Klara zurück und beobachtete, wie ihre Kinder eins nach dem anderen die hohe Leiter zu ihr heraufkletterten. Georg-Friedrich war so ein lieber, vernünftiger Junge. In seiner grauen Strumpfhose und seinem Mäntelchen stand er unten und wartete, bis seine jüngeren Schwestern die Sprossen erklommen hatten. Schließlich stieg er als Letzter hoch.
»Kommt!« Er nahm Inge an die Hand. Die beiden waren einander so nah, während Hilli sich überhaupt nicht vereinnahmen ließ. Als wäre sie allein unterwegs, lief sie zielstrebig die Wiese hügelaufwärts, direkt auf das Gatter zu, das auf die weiten Felder hinausführte. Hinter den gelb schimmernden Stoppeln lagen die Gärten des Obstgutes. Apfel- und Birnenbäume standen dort. Klara hatte mit dem alten Pächter vereinbart, dass die Kinder heruntergefallenes Obst auflesen durften. Vielleicht würde es heute genug sein, um daraus ein Kompott für den Nachtisch zu kochen.
Nun stand Klara allein neben dem rechteckigen Wasserbecken, mit ihrer Kleinsten im Wagen. Vor fast genau einem Jahr hatte sie hier mit Inge gestanden, die aus dem Kinderwagen in die für sie so unergründliche und neue Welt geschaut hatte, während Hilli sich von Georg-Friedrich im Holz-Lastwagen die breite Auffahrt hinauf und hinunter hatte schieben lassen.
Mit einem Mal hatte sie jemanden ihren Kosenamen rufen hören. »Klärchen!« Erstaunt hatte sie sich umgedreht. Gustav war vollkommen unerwartet aus dem Wäldchen auf sie zugekommen. Seine steingraue Uniform hing lose um seinen mageren Körper, sein sonst so fröhliches Gesicht war um Jahre gealtert. Fast hätte sie ihren Mann nicht erkannt. Sie war ihm entgegengelaufen, hatte ihn umarmt und auf seine unrasierte Wange geküsst. Zwei Tage war er mit dem Zug aus Weißrussland zu ihnen unterwegs gewesen. Vor lauter Glück und Überraschung hatte sie kein Wort herausgebracht. Sein sonst so offener Blick war verschleiert gewesen. »Ihr habt mir gefehlt«, hatte er mit brüchiger Stimme gesagt und dabei ganz fahrig gewirkt, als müsste er gleich wieder los. Sie hatte nach seiner rauen Hand gegriffen und geflüstert: »Du fehlst uns auch sehr.« Und so hatten sie, dicht nebeneinanderstehend, hinübergeschaut zu den mit ihrem Lastauto spielenden Kindern. Ganz leise hatte Gustav gesagt: »Der Krieg frisst auch am Leben der Lebenden.«
Ja, so war es wohl. Und der Krieg wurde immer gefräßiger. Er fraß und fraß am Leben der Lebenden, und doch entstand überall neues Leben, das beschützt werden musste, damit der Krieg nicht auch das noch fraß. Ihrer kleinen Tochter, die jetzt so ahnungslos im Kinderwagen saß und mit den Fäustchen wackelte, durfte nichts passieren. Keinem ihrer Kinder durfte etwas passieren. Ihre anderen drei liefen hintereinander den Weg zum Gatter hinauf. Georg-Friedrich war inzwischen an Hilli vorbeigesprintet. Er war so eine Sportskanone. Wild entschlossen wetzte Hilli hinterher. Sie krähte: »Ich hebe die Äpfel auf! Ich hebe die Äpfel auf!« Auf ihren kurzen Beinen gab sie alles, um ihren Bruder wieder einzuholen. »Warte, Gerg-Fiedlich!« So nannte sie ihn immer, »Gerg-Fiedlich«.
Inge, nicht weniger entschlossen, wackelte hinterher und rief mit ihrer zarten Stimme: »Wate! Waaate!«
Sofort blieb ihr großer Bruder stehen, lief zurück und hob sie auf seine Arme. Den Vorsprung nutzte Hilli, um an ihm vorbeizurennen und noch einmal zu rufen: »Ich hebe die Äpfel auf, Gerg-Fiedlich!«
Klara seufzte und strich Gudi über das Wollmützchen. Das kleine Mädchen blickte zu ihr hoch, und in ihren großen Augen spiegelte sich der herrlich blaue Himmel, der durchzogen war von feinen Wolkenschlieren. Die Blätter der Bäume, die die Wiese säumten, flirrten sacht in der Septemberbrise. Drüben im Heim standen einige Fenster zu den Unterrichtsräumen offen. Eine Gruppe von Kurkindern lief Hand in Hand, in weißen Kitteln zur Morgengymnastik auf der Wiese. Vom Kuhstall her kamen die Haushaltungsschülerinnen in ihren blau, rot oder grün karierten Dirndln mit farblich abgestimmten Schürzen. Sie hatten sich Kopftücher umgebunden, trugen Milchkannen und sangen Hoch auf dem gelben Wagen. Ein scheinbarer Friede legte sich so zärtlich über die Landschaft, die Heimgebäude und Klara. Ein Friede, in dem das Leben sich seiner selbst bewusst wurde, ein Friede, der alle Lebewesen auf wundersame Weise miteinander verband. Alles wirkte idyllisch, eben wie auf einer unberührten Insel.
Der Heulton der Sirene durchriss diesen sanftmütigen Frieden. Das Heulen schwoll immer weiter an. Klara schirmte ihre Augen mit der Hand ab und blickte suchend in den Himmel. Nichts war zu sehen außer dem wunderschönen tiefen Herbstblau. Sie ließ Gudi im Wagen stehen und rannte den Hang hinauf, um ihre Kinder vom Feld zu holen. Aber die drei kamen ihr schon durch das Gatter entgegengelaufen. Georg-Friedrich schleppte Inge. Hilli stolperte in ihrem roten Mäntelchen hinterher, in jeder Hand einen Apfel. Klara beschleunigte ihre Schritte. Sie hob Inge aus den Armen ihres Sohnes und griff nach Hillis Ärmel. »Los, schnell! Hinunter zum Graben!«
»Mein Apfel!«, jammerte Hilli. »Mein Apfel ist weg.« Das kleine Mädchen riss sich los, um ihren heruntergefallenen Apfel aufzulesen.
Verstand sie nicht, dass der Apfel jetzt nicht wichtig war? »Komm! Schnell!« Klara griff wieder nach ihrem Arm und zog ihre Tochter hinter sich her, die es gerade noch geschafft hatte, den Apfel aus dem Gras aufzuheben.
Drüben, aus dem Heim, kamen die Schülerinnen in ihren gestärkten Kochschürzen herangelaufen und trieben die Kurkinder in ihren weißen Kitteln, die gerade noch auf der Wiese Ringelreihe getanzt hatten, vor sich her. Sie versammelten sich am hinteren Ende des Grabens, wo eins nach dem anderen eilig die Leiter hinunterkletterte. Danach stiegen die Schülerinnen und Lehrerinnen hinterher. Klara rannte mit ihren Kindern zum vorderen Ende des tiefen Schachtes. Georg-Friedrich kletterte die Leiter hinunter, dann half Klara ihren Töchtern auf die Sprossen, wobei sie immer wieder unruhig hinüber zu ihrem Haus sah, in dem ihr vierzehnjähriges Pflichtjahrmädchen in der Waschküche die Wäsche machte. Wieso kam Helene nicht aus der Tür, um im Graben Schutz zu suchen? Das Mädchen war eigenwillig, aber war es auch lebensmüde? Klara konnte es nicht wissen, schließlich war Helene erst seit einer Woche bei ihnen. Vielleicht saß das Mädchen auch verängstigt irgendwo in einer Kellerecke und traute sich nicht mehr heraus. Was sollte Klara tun? Sie hatte Helene gesagt, dass der Graben mehr Schutz bot als der Keller. Seit Wochen wartete Klara auf den Architekten, der prüfen sollte, ob der Keller im Hauptgebäude, wie auch ihr Keller, extra Stützpfeiler brauchte. Sie konnte doch jetzt nicht zum Haus laufen, um das Mädchen zu holen. Die Sirene war schließlich nicht zu überhören.
Schweren Herzens kletterte sie mit Gudi auf dem Arm zu ihren Kindern hinunter. Reglos standen sie dicht gedrängt im Erdreich und blickten ihre Mutter fragend an. Als wollten sie wissen, ob auch dieses Mal alles gut gehen würde. Nun war es nicht mehr lustig, in dem Gang herumzulaufen. Wie bei jedem Fliegeralarm hockten sie sich auf den Boden: eine Mutter mit ihren Kindern. Das Heulen der Sirene erstarb. Es war still. Furchtbar still. Nur ihr leises, unterdrücktes Atmen war noch zu hören. Sogar Gudi war still. Ihre großen Augen guckten forschend in die Gesichter ihrer Geschwister, dann hob sie den Kopf und sah ihre Mutter an. Klara lächelte. Sie lächelte wie eine starke Mutter, die alles Unheil von ihren Kindern fernhalten konnte. »Alles ist gut. Sie wollen nicht zu uns. Sie fliegen über uns hinweg wie sanfte silberne Vögel.«
Ein Stück von ihnen entfernt hockten die Schülerinnen mit den Kurkindern, den Lehrerinnen und Erzieherinnen im Schutzgraben. So viele Leben, die nicht sterben wollten. So viele Leben, die zurückwollten in die Räume, in denen sie gerade noch gesungen, gespielt, gelernt, genäht, gekocht und gelacht hatten. Sie alle wollten nicht hier unten in der Erde kauern und darauf hoffen, dass es nicht sie, sondern andere traf. Unbekannte andere, deren Gesichter, deren Namen und Leben sie nicht kannten. Irgendwo mussten die Bomben abgeworfen werden. Nur nicht über ihnen. Sandersleben war doch uninteressant, nicht wahr? Bis auf das Eisenwerk, in dem wichtige Lokomotivteile für die Reichsbahn produziert wurden, und natürlich den Eisenbahnknotenpunkt mit seinem Güterbahnhof. Wenn der getroffen wurde, würde ein bedeutender Teil des Schienennetzes für den Transport militärischen Gerätes restlos zusammenbrechen. Der Bahnhof war mit dem Rad in wenigen Minuten zu erreichen. Wer sagte denn, dass die Bomber richtig zielten und trafen? Wer wusste denn, was für Männer da oben in den Maschinen saßen und ihre Sprengsätze abwarfen? Wussten sie überhaupt, was sie taten? Klaras Herz pochte nervös. Als wäre es nicht schon furchtbar genug, sich zu verkriechen, wanderten ihre Gedanken wieder zu dem Mädchen, das bei ihnen im Haus saß. Klara wünschte, es würde plötzlich doch noch die Leiter herunterklettern.
In diesem Augenblick hörten sie das gleichmäßige, leise Surren. Es kam näher und näher. Sie alle, die hier unten im Graben kauerten, lauschten schweigend. Sie atmeten flach, rührten sich nicht, waren gefangen in ihren Körpern, denen sie nicht entkommen konnten. Sie waren dazu verdammt, genau an diesem Punkt zu hocken und auf Glück zu hoffen. Kinder, junge Mädchen und Frauen, die unschuldig in diese Welt hineingeboren worden waren, damit sich ihr Leben in die unterschiedlichsten Richtungen wunderbar entfalten konnte. Klara drückte Gudi an sich. Oben am Grabenrand stand verwaist der Kinderwagen. Würden die Kampfpiloten ihn vom Himmel aus sehen können? Würden die Briten oder Amerikaner, oder welche Alliierten auch immer sie bombardierten, erkennen, dass hier unten Kinder lebten? Würde das ihre Feinde davon abhalten, Bomben zu werfen? Oder gerade dazu anhalten, alles zu zertrümmern? Aus einer tiefen, tiefen Verachtung heraus für das, was Deutschland der Welt antat?
Klara griff nach Inges kleiner Hand, die in ihrem hellen Wollmäntelchen neben ihr im Dreck hockte. Sie blickte zu Georg-Friedrich und Hilli, die sich ebenfalls an den Händen hielten, und flüsterte: »Ich habe euch lieb.« Dann schaute sie hinauf in den wunderschönen Septemberhimmel. Wie schwere silberne Vögel zogen die Flugzeuge geordnet im großen Verbund über sie hinweg. Unzählige Staffeln aus Fünferschwärmen, die sich wieder zu Fünfen formiert hatten. Es waren so viele silberne Flieger da oben am Himmel, dass es hier unten dunkel wurde. Die Sonne war nicht mehr zu sehen. Es war fürchterlich und gleichzeitig faszinierend, wie sie ruhig und glänzend dahinzogen, leise surrend, und doch nichts anderes wollten als Tod und Verderben bringen. Bestimmt würde das Geschwader nach Magdeburg oder Leuna fliegen, zu einem neuen Großangriff auf das Chemiewerk. In den letzten vierzehn Tagen waren über dem Werk schon zweitausend Bomben abgeworfen worden. Es hatte so viele Tote und Verletzte gegeben.
»Mutti«, flüsterte Hilli. »Darf ich meinen Apfel essen?«
Klara räusperte sich. »Natürlich.«
Genüsslich biss das kleine Mädchen hinein, als hätte es die Entscheidung getroffen, dass die Gefahr für sie nicht galt. Georg-Friedrich hielt sich mit starrem Blick an seinem Apfel fest. So, als könnte der Apfel in seiner Hand ihm helfen, all das zu überstehen. Als er aber nicht hineinbiss, nahm Inge ihm den Apfel kurzerhand ab und versenkte ihre kleinen weißen Milchzähne in seiner Schale. Hilli und Inge ließen sich von den Bombern längst nicht so in Unruhe versetzen wie Georg-Friedrich. Ihr großer Junge verstand leider schon viel besser, was vor sich ging und welcher Gefahr sie ausgesetzt waren. Auch wenn er vom Ausmaß des Krieges und von dem, was sich jenseits ihrer Insel abspielte, keine Ahnung hatte. Doch sicher spürte er Klaras Unruhe, und auf seiner klaren Stirn stand immer wieder die eine stumme Frage: Werden wir sterben?
Es gab einen gewaltigen Rumms. Ein Schlag, der den gesamten Garten erzittern ließ. Erde bröckelte zwischen den Holzlatten hindurch, mit denen die Grabenwände notdürftig befestigt waren. Wieder gab es einen entsetzlichen Rumms. Erde rieselte, die Kinder zogen ihre Köpfe ein, und Klara breitete ihren Mantelsaum über sie. »Es ist alles gut«, sagte sie mit fester Stimme. »Alles ist gut. Es ist weit weg.« Aber es war nicht weit weg. Die Einschläge mussten ganz in der Nähe gewesen sein. Ihr Blick glitt den Graben hinunter zu den Schülerinnen, die die Kurkinder mit ihren Armen umfingen und angstvoll in ihre Richtung schauten, als sähen sie in Klara noch immer die eigentliche Anführerin, die sie beschützen konnte. Aber Klara konnte niemanden beschützen. Nicht sich, nicht ihre Kinder, nicht ihr Pflichtjahrmädchen, die Kurkinder und auch nicht die Schülerinnen. Sie hatte nicht einmal ihr kleines Mädchen Tolla beschützen können, das sie vor fünf Jahren mit den Kindertransporten nach England hatte bringen wollen. Und sie hatte auch Gustav nicht beschützen können, dessen Truppe sich jetzt irgendwo im Süden Polens aufhielt und der tun musste, was ihm befohlen wurde. Jetzt war es wieder still. Stiller als still. Es schien, als hätte die Welt aufgehört zu atmen. Hilli wisperte: »Mutti, was war das?«
»Das war der Güterbahnhof«, antwortete Klara, ohne es wissen zu können. Und doch wusste sie es. »Nur der Güterbahnhof.«
»Aber dann kann Vati uns nicht mehr besuchen kommen«, flüsterte Georg-Friedrich entsetzt.
Klara lächelte beruhigend: »Mach dir keine Sorgen, dein Vati wird immer einen Weg zu uns zurückfinden.«
Als die Flieger endlich verschwunden und das letzte Surren verebbt war, warteten alle, ob nicht doch wieder Fluggeräusche zu hören wären. Nachdem die Sirene endlich Entwarnung gegeben hatte, erhoben sich im Schacht langsam die großen und kleinen Körper in ihren Mützen, Mänteln, Kleidern, Schürzen und Kitteln. Auch Klara und ihre Kinder richteten sich auf. Zuerst kletterte Georg-Friedrich die Leiter hinauf, als Nächstes Hilli, dann Inge und zuletzt Klara mit Gudi, die sie oben wieder in ihren Kinderwagen setzte. So machten sie es immer. Der große Bruder half seinen kleinen Schwestern, klopfte ihnen die Erde von den Kleidern und passte auf, dass sie nicht in ihrer Benommenheit einen falschen Schritt taten und rückwärts zurück in den Graben stürzten.
Ein Stück von ihnen entfernt auf der Wiese versammelten sich die Erzieherinnen und Lehrerinnen mit den Schülerinnen und Kurkindern, die sich nun in Zweierreihen aufstellten. Klara winkte Fritzchen Trensinger zu, die eine ihrer ersten Schülerinnen gewesen war und nun an ihrer statt das Heim leitete, bis das Staatsministerium sich für eine neue Leiterin entschieden hatte. Neben Fritzchen entdeckte sie das rundliche Fräulein Engler, die Haushaltungslehrerin, die ihren jüngeren Bruder vor zwei Jahren an der Front verloren hatte. Vor lauter Angst hatte der Siebenundzwanzigjährige einen Herzstillstand erlitten. Seitdem war Fräulein Engler nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Während das orange gefärbte Herbstlaub lieblich in der Sonne flackerte, beobachteten die Frauen, Mädchen und Kinder, wo sich am Horizont der Himmel bald gelb und rot färben würde. Schon hörten sie das Krachen der weit entfernten Einschläge und wussten, dass in diesem Augenblick Menschen starben. Es waren unzählige Einschläge, so, als würde es nie wieder still werden.
Schließlich, als es nach zwanzig Minuten endlich vorbei war, griff Klara nach Inges Hand und schob Gudi im Wagen hinauf zu ihrem Haus. Georg-Friedrich und Hilli folgten ihnen. Sie waren eine in sich gekehrte kleine Gruppe, die noch einmal mit dem Leben davongekommen war. Klara stellte den Kinderwagen neben der Treppe ab, nahm das Baby auf den Arm und stieg, umringt von ihren anderen drei Kindern, die Stufen zum Eingang hinauf. Sie drückte die Tür auf und erwartete, ihr Pflichtjahrmädchen irgendwo zu erblicken. Doch die Räume lagen wie ausgestorben da. In der Küche war das Geschirr vom Frühstück abgewaschen. Im Wohnzimmer waren die kleinen Matratzen sorgfältig gemacht, auf denen ihre Kinder nun schon so lange neben Klaras Unterbett schliefen. So konnten sie bei Alarm schnell in den Keller oder besser gleich über die Wiese zum Graben laufen. Vielleicht saß Helene noch immer im Schutzkeller, von dem man nicht wusste, ob er überhaupt Schutz bot?
Klara legte Gudi im Wohnzimmer ins Ställchen, half ihren beiden Töchtern aus den Mänteln und hängte sie an die Garderobenhaken. »Zieht eure Schuhe aus, stellt sie ordentlich hin und wascht euch die Hände. Ich bin gleich wieder da.«
Bevor eins ihrer Kinder fragen konnte, was sie vorhatte, öffnete Klara die Tür zur Kellertreppe, drehte das Licht an und stieg die Steinstufen hinunter in die Kälte. Sie ging den schmalen Gang mit dem unverputzten Mauerwerk entlang in den hinteren Kellerraum, den sie für sich und die Kinder wohnlich eingerichtet hatte. Auf dem Boden hatte sie alte Teppiche ausgebreitet, zwei Liegestühle und den großen Hörnerschlitten aufgestellt. Darauf lagen Decken, und in einem Regalfach, in dem sonst die Konserven aufgereiht gewesen waren, warteten jetzt ein paar Bilderbücher und Bauklötze auf den nächsten Alarm. Aber von Helene war nichts zu sehen. Klara ging hinüber in die Waschküche, doch auch dort war das Pflichtjahrmädchen nicht. Dafür quoll die schmutzige Kinderwäsche aus den Emaille-Eimern, die entlang der Kellerwand standen. Unter dem großen Kupferkessel brannte kein Feuer. Klara seufzte. Was hatte das zu bedeuten? Sie zog die Tür wieder zu, stieg die Treppe hinauf und bemerkte erst jetzt, dass Helenes Mantel und ihre Schuhe verschwunden waren. Also öffnete sie die Tür zu dem schmalen Gästezimmer neben der Toilette, in dem das vierzehnjährige Mädchen wohnte. Die Tagesdecke war ordentlich über das Bett gebreitet. Das Buch, in dem Helene gelesen hatte, lag nicht mehr auf dem Nachtschränkchen. Der Vorhang war aufgezogen, das Herbstlicht legte sich über den hübschen Teppich mit dem Rautenmuster und über die rotbraunen Kleiderschranktüren. Klara zog sie auf. Helenes Kleider hingen nicht mehr im Schrank. Es war, als hätte sich das Mädchen in Luft aufgelöst. Klara straffte sich. Sie brauchte nicht noch mehr Aufregung – jeder neue Tag brachte schon genug Unruhe. Seitdem der Krieg vor fünf Jahren ausgebrochen war, nahm die Gefahr stetig zu. Die schlimmen Nachrichten häuften sich, überall gab es Verluste und längst fielen Bomben auf deutsche Städte.
Klara schaute kurz ins Wohnzimmer. Inge und Hilli hockten auf dem Boden und spielten mit ihrer Puppe, Gudi war im Ställchen eingedöst. Georg-Friedrich war nach nebenan ins Esszimmer gegangen, wo die hohen Bücherregale standen. Klara hielt in der offenen Tür inne. Ihr Sohn saß am Esstisch und las in einem seiner Bilderbücher. Dort saß er gerne. Das blonde, etwas längere Deckhaar war ihm in die Stirn gerutscht, seine Beine in den Strumpfhosen baumelten hin und her, die Arme hatte er artig vor dem Buch verschränkt und vergaß die Welt um sich herum.
Natürlich hätte Klara jetzt in Aufruhr geraten müssen, aus Sorge um ihr Pflichtjahrmädchen. Doch sie vermutete längst, dass es nach Hause verschwunden war. Schon in den letzten Tagen hatte Klara gespürt, dass sich das Mädchen sehr nach den Eltern sehnte und nicht in dieser fremden Umgebung sein wollte. Das war nur allzu gut zu verstehen. Klara wäre es als Vierzehnjährige, unter diesen Umständen, bestimmt genauso gegangen. Sie konnte es Helene nicht verübeln, dass sie das Weite gesucht hatte – nur hätte Klara sich gewünscht, dass das Mädchen den Mut gefunden hätte, mit ihr zu sprechen, anstatt sie während des Bombenalarms mit vier Kindern und dem Haushalt sitzen zu lassen. War Helene mit dem Fahrrad über die Felder und durch den Wald nach Freckleben geradelt? Das arme Kind! Freckleben war mit dem Rad nur fünfzehn Minuten entfernt, doch das war ein weiter Weg, wenn das Heulen der Sirenen plötzlich erstarb und über einem die Flieger leise surrend hinwegzogen. Oder war Helene gar nicht mit dem Rad gefahren, sondern direkt zum Bahnhof gelaufen, wo die Bomben explodiert waren?
Klara stellte sich neben Georg-Friedrich an den Tisch. Er blickte auf, sie strich ihm nervös übers Haar. »Ich muss nach Helene suchen, sie ist über alle Berge.«
Ihr Sohn blickte erstaunt zu ihr auf. »Warum ist sie über alle Berge?«
Klara zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich hatte sie Heimweh. Pass gut auf deine Schwestern auf. Ich bin gleich zurück.«
Ihr Junge war noch keine sechs Jahre alt, sie durfte nicht lange wegbleiben. Das war zu viel Verantwortung für ihn allein. Es gab die Kellertreppe, es gab die hohen Bücherregale, den Eimer mit dem Gemüseabfall, die große Mehltüte; und es gab Hilli, die ständig auf abenteuerliche Ideen kam, bei denen man froh sein konnte, wenn sie gut ausgingen.
Georg-Friedrich sah wieder hinunter auf die Bilder in seinem Buch Hänschen im Blaubeerwald und murmelte: »Du kannst dich auf mich verlassen, Mutti.«
3
Klara zog sich im Flur ihren Mantel über, nahm einen Zettel mit einer Telefonnummer von der Briefablage und verschwand schnell aus der Haustür. Sie würde gleich zurück sein und das Mittagessen vorbereiten. Im herbstlichen Sonnenschein lief sie durch die letzte Wärme des vergehenden Jahres, die breite Auffahrt hinunter, auf der hier und da schon ein paar gelbe Birkenblättchen flatterten. Aus Richtung des Heimes kam ihr eine Traube aufgeregter Schülerinnen in karierten Dirndln entgegen, die leere Marmeladeneimer in den Händen schlenkerten. Obwohl sie Klara als ehemalige Leiterin normalerweise nur höflich grüßten, blieben sie dieses Mal kurz stehen und erklärten atemlos: »Unten am Güterbahnhof hat ein Waggon mit Zucker etwas abbekommen. Da holen sich jetzt alle was.«
Die Mädchen hasteten an Klara vorbei, in Richtung des Wäldchens. Klara sah ihnen verwundert nach, wie sie zwischen den Laubbäumen auf dem schmalen Schotterpfad, der zum Ort hinunterführte, verschwanden. Dann lief Klara in die entgegengesetzte Richtung, auf das zweistöckige Hauptgebäude zu. Sie stieg die Treppen zur breiten Terrasse hinauf und eilte in den Flur. Der Linoleumboden glänzte frisch gebohnert. Aus dem Spielsaal drang die etwas blecherne Stimme von Fräulein Ackermann, die, begleitet von zarten Kinderstimmen, einen Reim aufsagte: »Frau Holle, die guckt zu ihrem Haus heraus. Wie sieht die Welt so prächtig aus! Von ganzem Herzen dank ich dir. Du warst so gut, so gut zu mir.« Nun war es wieder friedlich hier oben auf ihrer Insel, so, als wäre gar nichts passiert, als wären keine Bomben gefallen. Das war ihr Alltag. Klara ging an der offenen Tür zur Schulküche vorbei. Die Schülerinnen, die normalerweise um diese Zeit an den großen Kochherden das Mittagessen für Groß und Klein zubereiteten, waren auf dem Weg zum zerstörten Güterbahnhof, um auch etwas von dem Zucker abzubekommen. Der war längst Mangelware. Mit viel Glück gab es mal welchen auf die Lebensmittelkarten. Schräg gegenüber war die Tür zum Büro geschlossen. Es war seltsam, an diese Tür zu klopfen, hinter der Klara so viele Jahre als Leiterin geschaltet und gewaltet hatte und die erste Ansprechpartnerin für all die wichtigen und weniger wichtigen Belange, für jeden Kummer, jedes Unglück und jede Idee gewesen war. Natürlich fehlte ihr die Arbeit, der Austausch mit den Kolleginnen und die Fürsorge für ihre Schülerinnen. Aber die Zeiten hatten sich nun einmal geändert. Jetzt war sie lediglich die Besucherin, die das Telefon benutzen wollte. Von drinnen hörte sie Fritzchens Stimme: »Herein.«
Klara drückte die Klinke herunter und trat ein. Ihre Nachfolgerin saß an ihrem ehemaligen Schreibtisch, die ehemalige Schreibmaschine vor sich, und beendete gerade ein Telefonat mit den Worten: »Ja, richtig. Und drei Flaschen Sagrotan.« Hinter der jungen Frau fiel das Herbstlicht durch das hohe Sprossenfenster. Rasch legte sie den Hörer auf die Gabel, stand auf und umrundete den Tisch, als hätte sie sich unerlaubt auf Klaras Platz gesetzt. Am Tisch gegenüber hatte früher Klaras beste Freundin Susanne gesessen und bei der Buchhaltung geholfen. Wie damals stapelten sich die grünen Pappordner mit gesammelten Belegen, Briefen und Anträgen ordentlich übereinander. Für den Bruchteil einer Sekunde war es so, als säße Susanne immer noch dort über die Listen gebeugt und würde nun interessiert mit ihrem verschmitzten Lächeln aufblicken und fragen: »Ist etwas passiert, Klara Erfurt?«