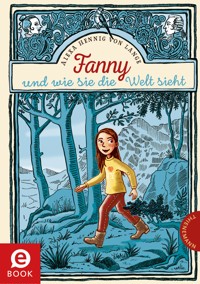9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heimkehr-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Als Klara mit über neunzig Jahren stirbt, entdeckt ihre Enkelin Isabell in ihrem Haus einen Karton mit Tonbandkassetten, auf die ihre Großmutter kurz vor ihrem Tod ihre Lebenserinnerungen gesprochen hat. Isabell taucht mit den Aufnahmen ein in das nationalsozialistische Deutschland, wo Klara in dem kleinen Ort Sandersleben ein linientreues Frauenbildungsheim leitet. Als der Krieg ausbricht und Gustav, ihre große Liebe, an die Front zieht, droht ihre scheinbar idyllische Welt zu zerbrechen. Isabell begegnet einer Frau, die, zerrissen zwischen Anpassung und Abneigung gegen das Regime, versucht, einen Weg durch das Dritte Reich zu finden – und die ihr dadurch nachbarer und zugleich fremder erscheint. Was hat es mit dem kleinen jüdischen Mädchen auf sich, das Klara als ihre eigene Tochter ausgegeben hat und das dennoch verloren ging? ›Zwischen den Sommern‹ ist nach ›Die karierten Mädchen‹ der zweite Teil der ›Heimkehr-Trilogie‹, die mit ›Vielleicht können wir glücklich sein‹ ihren Abschluss findet. Sie ist inspiriert von den Erinnerungen von Alexa Hennig von Langes Großmutter, die diese im hohen Alter auf mehr als einhundertdreißig Tonbandkassetten aufgenommen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Als Klara mit über neunzig Jahren stirbt, entdeckt ihre Enkelin Isabell in ihrem Haus einen Karton mit Tonbandkassetten, auf die ihre Großmutter kurz vor ihrem Tod ihre Lebenserinnerungen aufgesprochen hat. Isabell taucht in den Aufnahmen ein ins nationalsozialistische Deutschland, wo Klara in dem kleinen Ort Sandersleben ein linientreues Frauenbildungsheim leitet. Als der Krieg ausbricht und Gustav, ihre große Liebe, an die Front zieht, droht ihre scheinbar idyllische Welt zu zerbrechen. Isabell begegnet einer Frau, die, zerrissen zwischen Anpassung und Abneigung gegen das Regime, versucht, einen Weg durch das Dritte Reich zu finden – und ihr dadurch nahbarer und zugleich fremder erscheint. Was hat es mit dem kleinen jüdischen Mädchen auf sich, das Klara als ihre eigene Tochter ausgegeben hat und das dennoch verlorenging?
Zwischen den Sommern‹ ist nach ›Die karierten Mädchen‹ der zweite Band der ›Heimkehr-Trilogie‹, die vom Ende der Zwanziger bis in die Sechzigerjahre reicht. Sie ist inspiriert von den Erinnerungen von Alexa Hennig von Langes Großmutter, die diese im hohen Alter auf mehr als einhundertdreißig Tonbandkassetten aufgenommen hat.
»Alexa Hennig von Lange erzählt fesselnd und einfühlsam. Mehr davon.«
STERN
© Madlen Krippendorf
Alexa Hennig von Lange, geboren 1973, wurde mit ihrem Debütroman ›Relax‹ (1997) zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation. Seitdem hat sie mehr als 25Romane veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Bei DuMont erschienen ›Risiko‹ (2007), Peace‹ (2009), ›Kampfsterne‹ (2018), ›Die Weihnachtsgeschwister‹ (2019), ›Die Wahnsinnige‹ (2020) und ›Die karierten Mädchen‹ (2022). Die Schriftstellerin lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Berlin.
Alexa Hennigvon Lange
Zwischen den Sommern
ROMAN
Von Alexa Hennig von Lange sind bei DuMont außerdem erschienen:
Relax
Risiko
Peace
Kampfsterne
Die Weihnachtsgeschwister
Die Wahnsinnige
Die karierten Mädchen
Alexa Hennig von Lange 2023
Erste Auflage 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © isaemilee / iStockphoto, Mark Owen / Trevillion Images und Magdalena Russocka / Trevillion Images
Satz: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-6076-0
www.dumont-buchverlag.de
»Ich bin hier Krankenschwester bei den Kindern, und es ist schön, zu helfen und zu lindern. Nachts wache ich bei ihnen manches Mal, die kleine Lampe hellt nur schwach den Saal.«
Ilse Weber, 1903–1944 (Auschwitz)
»Die Frau sollte sich nicht nur um ihre eigenen Kinder kümmern, sondern auch um diejenigen, die ihre Hilfe als Mütter der Nation brauchen.«
Gertrud Scholtz-Klink, 1902–
1
1939
Klara stand vor dem Gemeindehaus in der Julisonne. In ihrer Tasche lag das Kleid aus hellblauer Seide, das sie gerade in der Stadt gekauft hatte. Sie würde es zu ihrer Hochzeit tragen. Das standesamtliche Aufgebot für ihre Eheschließung hing direkt vor ihr im Schaukasten: Gustav Erfurt und Klara Möbius. Die Gau-Frauenschaftsführerin hatte sogar ein grünes Myrtenkränzchen darumgesteckt. Diese besondere Ehre wurde nur ganz wenigen zuteil. Und genau auf diese Auszeichnung hätte Klara verzichten können. Es war ihr unangenehm, dass Frau Quade sie für eine solch glühende Nationalsozialistin hielt, wie sie selbst es war. Gleichzeitig war es genau das, was alle über Klara denken sollten.
Sie drehte sich um und überquerte in der Mittagsstille die ausgestorben daliegende Hauptstraße, ging zwischen den hell verputzten Bürgerhäusern hindurch, den steilen Hang hinauf. Rechts und links wuchsen Sträucher, hinter den hohen Bretterzäunen lagen die hübschen Gärten der Anwohner mit ihren Gemüsebeeten und Blumenstauden. Klara spürte die Schottersteinchen unter ihren Ledersohlen. Die Sonne stand jetzt über ihr und dem Wäldchen, in dessen kühlen Schatten sie verschwand. Als sie die Anhöhe erreicht hatte, erstreckte sich vor ihr der weitläufige Heimgarten mit seinen geschwungenen Wiesen und dem Wasserbecken, in dem eine kleine Fontäne plätscherte. Ein Stück entfernt sah sie ihre Schülerinnen mit Kopftüchern in gebeugter Haltung Salat und Kohlrabi in eine Schubkarre ernten. Geradeaus thronte das zweistöckige, moderne Hauptgebäude des Frauenbildungsheimes, quer dazu das niedrige Schulgebäude aus Fachwerk, in dem sich die Werkräume und eine Versuchsküche befanden. Versteckt dahinter gab es noch einen Viehstall mit zwei Kühen und einem Schwein. Und natürlich hatten sie Hühner. Klara war die Leiterin dieser nationalsozialistischen Erziehungsanstalt, in der junge Mädchen eine Ausbildung in Haushalt, Gesundheit und landwirtschaftlicher Arbeit erhielten, damit aus ihnen erdverwurzelte, das Volk stützende Mütter wurden. Sie hatten sogar eine eigene Säuglingsstation, in der die Schülerinnen alles über Säuglingspflege gezeigt bekamen. Das Jugendamt brachte ihnen kränkelnde und schlecht ernährte Kinder, die von den Kindergärtnerinnen und Schülerinnen eifrig gepäppelt wurden. Sowohl für den praktischen wie für den theoretischen Teil gab es aus dem Dessauer Staatsministerium klare Anweisungen. Trotzdem fanden sich für Klara immer Freiräume, dies unauffällig auf die eigene Art und Weise umzusetzen, das war viel wert. Unerlässlich war allerdings, dass alle, die hier lebten, rein arischer Abstammung waren.
Klara blieb stehen und blickte nachdenklich den Pfad hinunter, den sie gerade heraufgekommen war. Hier oben auf dem Hügel hatte sie vor zwei Monaten mit ihrer neunjährigen Tochter angespannt darauf gewartet, dass Gustav endlich mit seinem Rad auftauchte, um Tolla zum Zug nach Berlin zu bringen. Einerseits kam es Klara so vor, als läge ein ganzes Leben zwischen damals und heute, andererseits war es, als stünde ihr kleines Mädchen noch immer neben ihr, als würde Gustav wieder und wieder sein Rad in der Mittagshitze zu ihnen heraufschieben.
Eilig hatte sie Tollas Köfferchen hochgehoben und gerufen: »Hier sind wir!« Dabei hatte er sie längst gesehen. Ein letztes Mal hatte sie Tollas rote, geflochtene Zöpfe durch ihre Hände gleiten lassen. Sie hatte sich zu ihr hinuntergebeugt und mit fester Stimme gesagt: »Du bist mein Kind, vergiss das nicht.« Ihre Tochter hatte sich an sie geklammert und geweint. »Ich hab dich lieb, Mama.« Es half nichts. Der entsetzliche Moment war gekommen, an dem sie sich hatten verabschieden müssen. Klara war in Sandersleben geblieben, Tolla sollte in einem jüdischen Waisenhaus unterkommen und von dort so schnell wie möglich mit einem der Kindertransporte nach England gebracht werden. Hier im Frauenbildungsheim war sie nicht mehr sicher gewesen. Überall im Land hatten die Angriffe auf die jüdische Bevölkerung, auch auf Kinder, immer widerwärtigere Formen angenommen. Familien wurden aus ihren Wohnungen vertrieben, sie wurden weggebracht, und niemand wusste, wohin. Leute, die Juden versteckten, ihnen halfen oder sie mit Essen versorgten, wurden verraten, von der Gestapo verhört und verhaftet. Es war nicht auszudenken, was passieren würde, wenn herauskam, dass Klara, eine Staatsbeamtin, ein jüdisches Waisenkind im Heim über Jahre als eigene Tochter ausgegeben hatte.
Sie hatte Tolla beim Aufsteigen auf den Gepäckträger geholfen und den Saum ihres Sommerkleides unter die Oberschenkel gestopft, damit er nicht in die Speichen geriet. Gustav hatte das Köfferchen an die Lenkstange gehängt: »Dann wollen wir mal. Nicht, dass wir den Zug nach Berlin verpassen.« Zum Abschied hatte er Klara einen Kuss auf die Wange gegeben und leise versprochen: »Es wird alles gut.« Das zumindest hatten sie gehofft. Doch seit diesem Tag hatten sie nie wieder etwas von Tolla gehört. Es war quälend, nicht zu wissen, ob es ihr gut ging. Sie wollte doch nur ein leises Flüstern am Telefon. »Ich denke an dich und hab dich lieb.« Aber Klara konnte nicht in Berlin anrufen, niemand durfte etwas von ihrer Verbindung zu dem jüdischen Waisenhaus erfahren. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Es tat weh. Es tat furchtbar weh. Obwohl sie keinen anderen Ausweg gesehen hatte, kam ihr der Tag, an dem sie sich von Tolla verabschieden musste, noch immer falsch und unwirklich vor. Aber was hätte sie tun sollen? Das Risiko, ihr kleines Mädchen hierzubehalten, war zu groß gewesen. Ständig kamen hohe NS-Funktionäre in ihren schwarz glänzenden Dienstwagen vorgefahren, um sich von Klaras nationalsozialistischen Führungsqualitäten zu überzeugen. Was, wenn sich Frau Penöter, die Fürsorgerin von damals, plötzlich wieder daran erinnert hätte, dass sie dieses Kind einst als Baby in Klaras Obhut gegeben hatte? Wer sich gegen das Regime stellte, bezahlte mit seiner Existenz. Solche Geschichten hörte man nicht nur unten im Ort bei Albrechts im Laden. Alles, was Klara liebte, Beruf, Elternhaus und Familie, wäre sofort zerstört gewesen. Bei dem Gedanken daran wurde ihr kalt, trotz der sommerlichen Wärme. Sie zitterte, ohne dass sie irgendetwas dagegen hätte tun können.
»Fräulein Möbius!«
Sie drehte sich überrascht um. Agathe, eine ihrer Kinderpflegeschülerinnen kam im grün-weiß karierten Dirndl mit farblich passender Schürze die Wiese heruntergeeilt. »Fräulein Stettin sucht nach Ihnen. Im Tagesraum sitzt die neue Kindergärtnerin.«
»Jetzt schon?« Klara sah auf ihre schmale, goldene Armbanduhr. Die Zeit war schneller vergangen als gedacht.
Agathe nickte aufgeregt. »Schon seit einer Viertelstunde.«
»Ich komme. Sag ihr, dass ich gleich da bin.«
Agathe lief wieder über die Wiese hoch zum Hauptgebäude, der Rock ihrer Schülerinnentracht wehte. Klara beeilte sich nun auch, dorthin zu kommen. Nur laufen wollte sie nicht. Sie musste den Weg nutzen, um wieder zu ihrer antrainierten Autorität zu finden. Sie war die Leiterin einer Vorzeige-Bildungsanstalt, Heimat für mehrere Dutzend Kurkinder aus sozial schwachen Verhältnissen und ebenso viele Schülerinnen aus dem ganzen Deutschen Reich. Und als diese Führungskraft würde sie auch auftreten, wenn sie gleich die neue Kindergärtnerin einwies. Klara ging an den jätenden Schülerinnen im Gemüsegarten vorbei. Etwas oberhalb kauerte das Hausmeisterhäuschen mit dem roten Satteldach. Ihr zukünftiges Zuhause, vor dessen Eingang sich noch die Umzugskisten ihres Vormieters stapelten. Sie ging weiter die Auffahrt hinunter, über den sonnigen Vorplatz, die Stufen hoch, in den kühlen Flur. Aus dem Spielsaal hörte sie die fröhliche Stimme von Fräulein Stettin, die ihre Kindergruppe anleitete. »Die blauen Bauklötze in die eine Kiste, die roten in die andere. Und wohin kommen die gelben?« – »In die Kiste da!«, riefen die Kinderstimmen im Chor. – »So viele schlaue Jungen und Mädchen!« Susanne Stettin war Klaras beste Freundin und Verbündete. Mit ihr war sie vor fast einem Jahr aus Oranienbaum hierhergekommen. Neben Gustav und ihren Eltern war sie die Einzige, die über Tollas wahre Herkunft Bescheid wusste. Für alle anderen war Tolla einfach nur Klaras Tochter gewesen.
Sie bewegte sich den Flur entlang, bog ins Büro ab und hängte den Hut an die Garderobe. Dann ging sie hinüber in den Tagesraum. An den Wochenenden saßen hier die Schülerinnen an den Tischen, schrieben Briefe oder lasen Bücher. Auch die Gruppenabende, bei denen die Mädchen Kampflieder sangen und sich aus Blut und Boden, der Monatsschrift für wurzelstarkes Bauerntum und nationale Freiheit, vorlasen, fanden in diesem Raum statt. Das bewahrte sie davor, unten im Ort die Versammlungen vom Bund Deutscher Mädel besuchen zu müssen. Hinten am Fenster saß eine junge Frau, nicht älter als einundzwanzig. Als Klara hereinkam, stand sie rasch auf und strich sich den wadenlangen Rock glatt, den sie unter dem offenen Wollmantel trug. Das blonde Haar lag in sanften Wellen um das hübsche Gesicht. Die junge Frau lächelte freundlich. Neben ihr stand ein nigelnagelneuer Reisekoffer.
»Herzlich willkommen, Fräulein Römer.« Klara ging mit ausgestreckter Hand auf sie zu, so wie damals ihre Chefin Fräulein Martin auf sie zugegangen war, als sie ihre erste Stelle als Haushaltungslehrerin im Kinderkurheim in Oranienbaum angetreten hatte. Klara erkannte sich in dieser jungen Frau. Auch sie hatte damals trotz der sommerlichen Hitze einen Wollmantel getragen, um ordentlich auszusehen. Wie ihre frühere Leiterin machte Klara nun ein Respekt einflößendes Gesicht und sagte: »Ihnen muss ja furchtbar warm sein in Ihrem Mantel.«
Margarete antwortete höflich: »Es geht schon.«
Klara setzte sich zu ihr an den Tisch. »Legen Sie doch ab.«
Dankbar zog die junge Frau ihren Mantel aus und breitete ihn sich über die Knie. Sie wirkte ausgeglichen und frisch, als sei sie nicht den weiten Weg aus dem Ruhrgebiet hierhergekommen. Abwartend sah sie Klara an. Selbstverständlich war sie froh, hier sein zu dürfen, um einem Beruf nachzugehen, der Freude machte und ihr als Frau eine gewisse Unabhängigkeit bescherte. Zumindest war das für Klara immer das Wichtigste gewesen: unabhängig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen, in dieser Welt etwas Gutes zu leisten. Allerdings war sie nicht ganz sicher, ob dieses großstädtische Fräulein den Aufgaben gewachsen war, die hier auf sie warteten. Sie sah aus wie aus dem Ei gepellt. Mit ihren zarten gepflegten Händen und den Perlenohrringen hätte sie viel eher in einen eleganten Großbürgerhaushalt gepasst als aufs einfache Land. Besser, sie gab der jungen Frau gleich zu verstehen, dass sie hier womöglich nicht ganz richtig war. »Wie ich Ihnen bereits in meinem Einstellungsschreiben mitgeteilt habe, bestünde Ihre Tätigkeit darin, sich um die etwas verwilderten Kinder der Landarbeiter zu kümmern. Sie leben drüben auf der anderen Seite des Hügels, in einer Siedlung. Die Kleinen waren bisher sich selbst überlassen, weil ihre Eltern den ganzen Tag auf den Feldern arbeiten.«
Margarete nickte. In ihrer fein aufgebügelten Bluse saß sie kerzengerade auf dem Stuhl. »Wie schön.« Sie sagte es so, als hätte sie gar nicht zugehört.
»Wir haben dort einen einfachen Kindergarten in einem leer stehenden Arbeiterhaus eingerichtet. Mit ein paar Kindermöbeln und derbem Geschirr. Das war’s.«
»Das klingt gemütlich.« Sie lächelte.
Klara bezweifelte, dass dieses freundliche Wesen im Mindesten eine Vorstellung von den Herausforderungen hatte, denen sie sich würde stellen müssen. Also wurde sie noch deutlicher. »Sommer wie Winter, bei Wind und Wetter, im Hellen wie im Dunkeln werden Sie allein über die Felder dorthin gehen. Sie werden den Kleinen viel Grundsätzliches beibringen müssen. Die meisten von ihnen können zwar Kühe melken und Schweineställe ausmisten, aber haben noch nie einen Stift, ein Stück Papier oder ein Buch vor sich gehabt.«
Margarete wirkte ehrlich begeistert. »Das tue ich gerne.«
Bevor Klara fragen konnte, ob die junge Frau wirklich verstanden hatte, worauf sie sich einließ, erschien Fritzchen, ihr Mädchen für alles, in der Tür. »Von mir aus kann es mit der Hausführung losgehen.«
»Na gut.« Klara erhob sich von ihrem Stuhl. Sie war gespannt, wie lange Fräulein Römer durchhalten würde, bevor die Sehnsucht sie zurück in die Großstadt trieb. »In einer Woche geht es für Sie in der Arbeitersiedlung drüben in Roda los. Bis dahin möchte ich, dass Sie Fräulein Stettin im Spielsaal unterstützen. Fräulein Trensinger wird Ihnen jetzt das Haupt- und Nebengebäude und Ihr Zimmer im zweiten Stock zeigen.«
Fritzchen war eine ihrer ehemaligen Schülerinnen, und wie alle, die sie zum ersten Mal sahen, zuckte auch Margarete bei ihrem Anblick zusammen. Ihre Mutter hatte Fritzchen als Kind mit einem Feuerhaken die Nase zertrümmert, die nun im rechten Winkel in ihrem Gesicht stand. Doch anders als die meisten Menschen fing sich Margarete sofort wieder und grüßte höflich, so als wäre nichts Besonderes an Fritzchens Aussehen. »Das ist sehr freundlich. Vielen Dank!«
Als die beiden in den Flur verschwunden waren, nahm Klara ihre Tasche mit dem Hochzeitskleid. Bevor sie sich hier im Büro durch die tägliche Papierflut kämpfte, wollte sie in ihrem neuen Zuhause die Räume ausmessen. Die Einrichtung für Wohn- und Esszimmer – und natürlich für das Schlafzimmer – musste dringend bestellt werden. Möbel waren momentan Mangelware, weil nur noch wenig Holz eingeführt wurde. Alles Geld floss direkt in die Rüstungsindustrie. Es wurden Kasernen errichtet, Kampfflugzeuge und U-Boote gebaut. Das war jeden Tag in der Zeitung zu lesen und im Radio zu hören. Das ganze Land rüstete sich auf.
Klara ging durch die Sonne die Auffahrt hinunter zum Hausmeisterhäuschen, in das sie nach der Hochzeit mit Gustav einziehen würde. Als sie ankam, trugen gerade ein paar kräftige Möbelpacker die Stühle und Stehlampen ihres Vormieters aus der Vordertür und hievten sie auf einen kleinen Lastwagen. Sie überlegte, ob sie eintreten oder doch besser auf dem Treppenabsatz warten sollte, bis der ehemalige Bewohner, Herr Schütz, herauskam. Sie wollte nicht unverschämt wirken. Schließlich musste der Hausmeister sein Zuhause räumen, in dem er jahrelang mit seiner Familie gelebt hatte. Gleichzeitig wollte Klara keine Zeit verschwenden. Es stand noch so einiges auf ihrer Erledigungsliste.
Nach kurzem Zögern trat sie über die Schwelle und fand den Hausmeister im leeren Esszimmer. In seinem grauen Staubmantel stand er in der Mitte eines fadenscheinigen Teppichs. Für einen Moment sah er ihr ausdruckslos entgegen, so als wäre er mit seinen Gedanken ganz woanders. Tief in alten Erinnerungen an Ereignisse versunken, die er in diesen vier Wänden mit seiner Familie erlebt hatte. Klara gab sich Mühe, entspannt zu atmen, obwohl der Geruch hier drinnen reichlich abgestanden war. Als wäre nur äußerst selten gelüftet worden. Am liebsten hätte sie die großen Fenster sperrangelweit geöffnet, um frische Luft aus dem Gemüsegarten herein- und den Geist vergangener Tage hinauszulassen. In diesem Haus sollte etwas Neues beginnen. Der Muff und die dunklen Tapeten erzählten jedenfalls nicht von einer verheißungsvollen Zukunft, sondern von Müdigkeit und Zwangsläufigkeit. Plötzlich glitt ein schwaches Lächeln über das volle, rötliche Gesicht des Mannes. »Fräulein Möbius, was waren wir zuerst ärgerlich auf Sie, dass Sie in unser Haus ziehen wollten. Und wie sind wir jetzt froh!«
»Ach ja?« Klara machte eine freundliche Miene. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, dass die Familie Schütz für sie weichen musste. Aber als verheiratete Leiterin des Frauenbildungsheimes stand ihr dieses Häuschen nun einmal zu. Sie konnte doch nicht mit Gustav drüben im Haupthaus zwischen den Erzieherinnen, Schülerinnen und Kurkindern weiterhin in ihrer Zweizimmerwohnung leben. Ein wenig Intimität in all dem Trubel, ein wenig Rückzug am Abend aus dem täglichen Treiben war mehr als angebracht.
Herr Schütz nickte. »Wir haben ein eigenes Haus unten im Ort gefunden, schräg gegenüber vom Rathaus, mit Garten und kleinem Viehstall. Das freut besonders meine Frau. Nun muss sie die Einkäufe nicht mehr den Hang hinaufschleppen.«
Diese Nachricht erleichterte Klara. »Das ist natürlich eine große Verbesserung.« Nun würde sie in Zukunft die Einkäufe den Hang hinaufschleppen.
Der Hausmeister machte einen Schritt vom Teppich herunter, kniete sich auf die staubigen Dielen und rollte ihn zusammen. »Nach der Hochzeit kommen dann wohl noch ein paar Geschwister für Ihre Tochter hinterher?« Er warf Klara einen interessierten Blick zu. Sie stand im Durchgang zum zukünftigen Wohnzimmer, in das Gustavs Bücherregale einziehen würden. Für einen Augenblick herrschte angespannte Stille. Klara räusperte sich. Jetzt schien auch Herrn Schütz aufzugehen, dass er sich mit seiner Nachfrage auf unsicheres Terrain gewagt hatte. Seitdem Tolla nicht mehr hier war, hatten alle so getan, als hätte es das Mädchen an ihrer Seite nie gegeben. Die Erzieherinnen, die Kindergärtnerinnen und die Schülerinnen hatten ziemlich schnell gespürt, dass sich hinter Tollas Verschwinden mehr als ein Umzug zu ihren Großeltern verbarg. »Bei ihnen im Harz ist die Luft eben besser als bei uns«, hatte Klara damals nur knapp erklärt. Ihr strenger Tonfall hatte deutlich gemacht, dass sie sich jede weitere Nachfrage verbot. Es war ein Tonfall, von dem sie überrascht war, dass er ihr überhaupt zur Verfügung stand. Doch als sie sah, dass er wahre Wunder wirkte, hatte sie ihn trainiert und gefestigt. Er produzierte auf ewig geltende Gesetze und sorgte für reibungslose Abläufe. Der Hausmeister stand vom Boden auf und klemmte sich seinen zusammengerollten Teppich unter den Arm. Um die peinliche Stille zu durchbrechen, holte Klara ihr Maßband aus der Tasche und lächelte höflich. »Wir werden sehen.«
2
2000
Klara stand in Mantel und Hut auf dem Rasen in ihrem Garten, weit hinten am rückwärtigen Zaun, wo die Blüten des Jelängerjeliebers zu dieser Jahreszeit so herrlich dufteten. Es war ein kleines Abenteuer, das sie hier wagte. Ein unvernünftiger Ausflug an ihren Lieblingsort. Nur einmal noch wollte sie hier sein und diesen wunderbaren Duft einatmen. Im vergangenen Sommer hatte sie bereits vergeblich versucht, allein bis hierher zu kommen. Aber das war gar nicht so leicht, wenn man blind und über neunzig Jahre alt war. Nun hatte sie es endlich geschafft. Sie hatte sich am Gurren der Tauben in der Blutbuche orientiert, während sie sich mit ausgestrecktem Arm und mit tastenden Schritten über das weiche Gras bewegt hatte. Obwohl sie sich etwas wacklig fühlte, war sie entschlossen vorangetrippelt. Es war doch seltsam. Die mittägliche Stille war die gleiche wie vor dreißig Jahren, als sie hier mit Gustav auf der Decke gesessen und er ihr aus Adalbert Stifters Nachsommer vorgelesen hatte. Diese sanftmütige Stille, die sich so zärtlich über die Gärten, die Häuser, die Menschen und die restliche Schöpfung legte. Eine Stille, in der das Leben sich seiner selbst bewusst wurde, eine Stille, die alle Lebewesen auf wundersame Weise miteinander verband.
Niemand war da, der ihr zu Hilfe kommen könnte, wenn sie fiel. Die Familie, die auf der linken Seite wohnte, war in den Sommerurlaub gefahren. Frau Clasen, die Dame, die auf der rechten Seite bis vor ein paar Wochen gewohnt hatte, war von ihren Kindern in ein Seniorenheim verfrachtet worden. Was nicht weiter verwunderlich war. Als Klara sie im letzten Sommer besucht hatte, um sich von ihr einige alte Briefe von Gustav vorlesen zu lassen, war sie schon sehr schwach und antriebslos gewesen. Sie hatte sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht, aus dem Bett aufzustehen und ihr Nachthemd gegen eine Bluse einzutauschen. Gerade stand das Haus leer, die Familie, die dort einziehen wollte, renovierte noch fleißig, und hin und wieder hörte Klara es bohren und hämmern. Doch heute war es drüben still.
Ihre Hand berührte den Gartenzaun. Über ihr raschelten die Baumkronen. Es war, als würde sie das leise Umblättern der Buchseiten und Gustavs Stimme hören. Der Mensch ist nicht zuerst der menschlichen Gesellschaft wegen da, sondern seiner selbst willen. Und wenn jeder seiner selbst willen auf die beste Art da sei, so sei er es auch für die menschliche Gesellschaft. Nach dieser Überzeugung hatten Gustav und sie versucht, ein Leben lang zu handeln. Als Lehrerin hatte sie diese Überzeugung an ihre Schülerinnen weitergegeben. Immer auf die beste Art da zu sein. Dabei war sie selbst unbemerkt vom Weg abgekommen. Denn es war gar nicht so leicht zu erkennen, wann man nicht mehr allumfassend auf die beste Art da war. Das Sonnenlicht, das sich gerade noch warm auf ihren Handrücken gelegt hatte, schien auf einmal von einer mächtigen Wolke verschluckt worden zu sein. Klara legte den Kopf in den Nacken, auch auf ihrem Gesicht fühlte sie keine Wärme mehr. Stattdessen ruckelte nun eine Windböe an ihrer Hutkrempe. Sie zog den Mantelkragen enger um ihren Hals. Die Äste über ihr schaukelten knarrend stärker hin und her. Die Baumkronen raschelten heftiger. Der erste Regentropfen fiel. Von weit her war Donnergrollen zu hören.
Wie damals, als Gustav und sie als frisch vermähltes Paar die Kirche ihres Heimatstädtchens Lieberode verlassen hatten. Genau wie jetzt war plötzlich ein gewaltiges Grollen zu hören gewesen. Das Unwetter war direkt über sie hinweggetobt, in einer Geschwindigkeit und Heftigkeit, die Klara bis dahin noch nicht erlebt hatte.
Das Gurren der Tauben verstummte. Bis auf das Blätterrascheln und das unruhige Wiegen der Äste war es gespenstisch still. Ab und an fiel ein einziger dicker Tropfen auf ihren ausgestreckten Handrücken. Über ihr türmten sich bestimmt schon schwarze Gewitterwolken in den sommerlichen Himmel empor. Wieder landete ein dicker Regentropfen auf ihrer Hand. Dann auf ihrer Hutkrempe. Noch einer und noch einer. Auf ihren Schultern, auf ihrem Arm. Die Tropfen waren so schwer, dass der Aufprall durch den Wollstoff des Mantels zu fühlen war. Es war nicht besonders klug, sich so weit vom sicheren Haus wegzubewegen. Klara lächelte, als wollte sie ihre Hilflosigkeit vor der Welt verstecken. Als wollte sie ihrer Umgebung weismachen, dass sie die Situation unter Kontrolle hatte. Dieses Lächeln hatte sie als junge Frau bis zur Perfektion geübt, es entstand noch immer ganz selbstverständlich in ausweglosen Situationen. Es war ein leichtes, fürsorgliches Lächeln. Es war das Lächeln einer Anführerin, die alles Unheil von ihren Schützlingen abhalten konnte, die einzig und allein auf ihre Stärke vertrauten. Natürlich stimmte das längst nicht mehr. Und eigentlich hatte es damals schon nicht gestimmt. Aus Furcht vor den vorhersehbaren Folgen hatte sie ihr kleines Mädchen weggeschickt. War es nicht so? Doch zumindest hatte sie die Illusion, eine starke Frau zu sein, für die vielen Kurkinder, ihre Schülerinnen, Erzieherinnen und ihre eigenen Kinder aufrechterhalten. Immer mehr Tropfen prasselten herunter, fast so, als wollten sie sagen: »Siehst du! Siehst du, Klara Erfurt! Irgendwann erwischt es auch dich!«
Sie drehte sich mit ausgestrecktem Arm vorsichtig im Kreis, ging ein paar Schritte hierhin, dann dorthin, in der Hoffnung, den glatten Stamm der Blutbuche zu ertasten oder den Gartenzaun. Aber da war nichts. Nur das feuchte Gras unter ihren Füßen. Wieder donnerte es. War es besser, um Hilfe zu rufen? Aber wer sollte sie hören? Frau Clasen saß sicher aufgehoben in ihrem Seniorenheim. Die Familie auf der anderen Seite war im Badeurlaub in Spanien. Alle anderen Nachbarn waren zu weit weg, als dass ihr Rufen sie erreicht hätte. Und das Armband mit dem Alarmknopf, das ihre Töchter ihr vor Jahren besorgt hatten, lag in Originalverpackung in der Schublade des Küchentischs.
Die Bäume in den Nachbargärten rauschten wilder. Das Donnergrollen wälzte sich über sie hinweg. Die Luft war kalt. Der Regen peitschte mit immer größerer Leidenschaft auf sie ein. Sie hielt ihren Hut fest, den Kopf gesenkt, den anderen Arm ausgestreckt. Sie würde einfach weiter in diese Richtung gehen, bis sie auf die Hecken traf, die ihr Grundstück von dem der Nachbarn abtrennten, oder sie endlich den Stamm der Blutbuche fühlte oder den rückwärtigen Gartenzaun. Es war nur ein Gewitter über einer norddeutschen Reihenhaussiedlung. Aber so ein Gewitter war nicht ungefährlich, besonders wenn man blind war und es direkt über einem stand.
Klara ging Schrittchen für Schrittchen weiter. Von der Hutkrempe lief das Wasser in ihren Nacken. Sie schlug den Kragen nach oben. Ihr Gesicht war nass. Ihre Füße waren nass. Sie durfte nicht ausrutschen. Ihre Hände griffen immer wieder ins feuchte Nichts. Dafür spürte sie unter ihren Sohlen einen leichten Anstieg des Untergrunds. Das bedeutete, dass sie sich Richtung Haus bewegte. »Geh weiter«, beschwor sie sich. »Gleich bist du in Sicherheit.« Sie machte einen mutigen kleinen Schritt nach dem anderen. Es war schön und eigentümlich, hier draußen zu sein. Durchnässt, wie eine starke Frau, die sich nicht vor einer heftigen Erkältung fürchtete. Wie eine Frau, die sich vor gar nichts mehr fürchtete. Mit einem Mal fühlte sich Klara sehr lebendig. In jeder Zelle ihres zittrigen Körpers breitete sich dieses rauschhafte Glück eines unverwundbaren Menschen aus, der staunend eintrat in eine ihn erwartende, vollkommen unerklärliche, wunderbare Welt. Sie war hier um ihrer selbst willen. Auf die beste Art.
3
Sie sahen hübsch und feierlich aus, als sie in Lieberode vor dem Haus von Klaras Eltern warteten, die sich drinnen noch die Schuhe anzogen. Die Braut trug zu ihrem roten, hochgesteckten Haar ein hellblaues Seidenkleid mit zimtfarbener Schärpe, der Bräutigam seinen neuen schwarzen Anzug. Ihr kleiner Lehrer, wie sie ihn zärtlich nannte, machte einen außergewöhnlich adretten Eindruck. Trotzdem erkannte Klara noch immer den eigenwilligen Neunzehnjährigen in ihm, den sie vor zehn Jahren auf der Bahnfahrt von Oranienbaum nach Dessau kennengelernt hatte. Umwölkt von einer benebelnden Mischung aus Alkohol und Parfüm war er in den Waggon gekommen, hatte sich in seinem zerknitterten Mantel neben sie auf die Holzbank gesetzt und sofort fröhlich auf sie eingeredet. Eigentlich hatte sie sich überhaupt nicht mit ihm unterhalten wollen, derart unmöglich und ungehobelt war er ihr vorgekommen. Doch die enthusiastische Art, mit der er erzählt hatte, dass er ohne Abitur vom Gymnasium abgegangen sei, dafür aber mit Begeisterung die Klassiker der Weltliteratur verschlang, hatte ihr Interesse geweckt. Nie zuvor hatte sie jemanden getroffen, der so gerne und so viel las und mit dem sie sich so gut unterhalten konnte. Obwohl sie fest vorgehabt hatte, sich von ihren alltäglichen Pflichten und ihrem Lebensplan als unabhängige Frau nicht ablenken zu lassen und diesen Mann schnell wieder zu vergessen, hatte das Schicksal einen ganz anderen Plan für sie gehabt. Mehrere zufällige Begegnungen hatten sie beide immer wieder an den unterschiedlichsten Orten zusammengeführt, sodass Klara sich trotz aller guten Vorsätze in ihn verliebt hatte. Nun konnte sie sich ein Leben ohne ihren kleinen Lehrer nicht mehr vorstellen, der schallend lachte, wenn er den politischen Wahnsinn um sich herum nicht mehr ertrug, dem nach mehreren Anläufen doch noch das Abitur geglückt war und der selbstlos alles dafür getan hatte, Tolla in Sicherheit zu bringen.
Sie blickte hinüber zu den felsigen Gipfeln, die in der Julisonne strahlten. Wie ein mächtiger Schutzwall legte sich der Gebirgsrücken um ihre Heimatstadt Lieberode. Früher hatten ihre Eltern eine kleine Pension in ihrem Wohnhaus betrieben, für Sommerfrischler aus der Großstadt, die sich im Harz neue Spannkraft erwandern wollten. Doch solch einen Ausflug in die Natur hatten sich immer weniger Gäste leisten können. Nun wohnte in der ersten Etage ihr Untermieter Herr Ehrlich, der zwischen seinen Fenstern begeistert ein Hakenkreuzbanner gespannt hatte. Als Blockleiter war er auf Adolf Hitler vereidigt worden und überwachte fleißig den gesamten Straßenzug. Mit Vorliebe notierte er Unmutsbekundungen auf seinen Karteikarten und war bereitwilliger Ansprechpartner für Denunziationen aller Art. Was Klaras Eltern ganz und gar nicht behagte.
Oben, zwischen den verschiedenfarbigen Fachwerkhäusern, tauchte jetzt ihr sieben Jahre jüngerer Bruder Kurt auf und kam beschwingt im hellen Sommeranzug die gewundene Straße aus Richtung Bahnhof herunter. Für die Trauung seiner Schwester hatte er sich von seinem Fliegerhorst bei Magdeburg, wo er zum Unteroffizier der Luftwaffe ausgebildet wurde, beurlauben lassen. Im Gegensatz zum unsportlichen Gustav wirkte Kurt geradezu wie ein Hüne. Er lüftete seinen Hut und rief: »Der große Tag ist gekommen!«
Während Klara die Hände vor dem Körper fest zusammenhielt, winkte Gustav fröhlich, lief seinem Schwager entgegen und umarmte ihn überschwänglich. Die beiden waren gute Freunde, seitdem Kurt anstelle von Gustav die Schwimmprüfung abgelegt hatte, die dieser gebraucht hatte, um nach bestandenem Studium als Volksschullehrer in den Staatsdienst aufgenommen zu werden.
»Und? Wie fühlt es sich an, gleich verheiratet zu sein und für immer die eigene Unabhängigkeit aufzugeben?«, fragte Kurt, wobei er seine Schwester ansah.
»Ich gebe doch nicht meine Unabhängigkeit auf«, antwortete Gustav an ihrer Stelle und klopfte seinem Schwager auf die Schulter. »Mit deiner sportlichen Hilfe habe ich erst meine Unabhängigkeit erlangt. Jetzt bin ich Beamter und kann meine Frau und mich ernähren.«
Nun, fürs Erste brauchte Gustav sie nicht zu ernähren. Das schaffte Klara sehr gut allein. Aber es war immerhin erfreulich, dass sie ihn nicht länger miternähren musste. Was im Umkehrschluss allerdings nicht bedeutete, dass sie vorhatte, gleich ihre Arbeit aufzugeben und Mutter zu werden. Das war vielleicht politisch angestrebt, aber eben nur politisch und nicht privat. Sie war schon einmal Mutter gewesen und hatte ihr Kind weggeben müssen. Dieser Schmerz wütete in ihr, und jedes weitere Kind würde sie an ihren Verlust erinnern und ständig an diese klaffende Wunde rühren. Natürlich wünschte sie sich, genau wie Gustav, Kinder, doch bisher hatte sie ihm noch nichts von ihrem Zwiespalt erzählt.
Ihre Eltern traten in ihren guten Kleidern aus der Haustür. Ihr Vater in einem weißen Hemd, Weste und Jackett, ihre Mutter im schwarzen Kleid mit weißen Punkten darauf. Etwas ungelenk standen sie auf dem Bürgersteig und warteten auf Gustavs Vater, der schon am Vortag aus Dessau angereist war und im Gästezimmer übernachtet hatte. Kurt sah auf seine Armbanduhr. »Wir sollten bald losgehen. Nicht, dass ihr zu eurer eigenen Trauung zu spät kommt.«
Die Glocken der Stiftskirche schallten aus dem Tal über die Dächer der Fachwerkhäuser hinweg, hinauf zum Höhenzug des Bückebergs. Endlich erschien Gustavs Vater auf der Schwelle, ein stattlicher Herr mit Schnauzer, ehemaliger Militär, der nach dem Ersten Weltkrieg schwer verwundet, aber mit Auszeichnung für seinen Mut auf dem Schlachtfeld, entlassen worden war. Gustav war das absolute Gegenteil von ihm. Hätte Klara es nicht besser gewusst, wäre sie niemals auf die Idee gekommen, dass dieser Gehorsam fordernde Mann sein Vater war. Er zog sein steifes Bein nach, und es war für ihn mühsam, die Treppenstufen herunterzukommen. »Na, dann wollen wir mal«, seufzte er und stützte sich auf seinen Gehstock.
Zu sechst bewegten sie sich die abschüssige Straße hinunter. Die Glocken läuteten und läuteten, als wollten sie zur Eile mahnen. Doch die jungen Leute mussten sich an die gedrosselte Geschwindigkeit ihrer betagten Eltern anpassen. Klara blickte auf ihre neuen Schuhe, wie sie sich Schritt für Schritt der Kirche näherten, in der sie früher mit dem Schulchor gesungen hatte. Hier war sie als Baby getauft worden. Nun kam sie, um Gustav vor Gott das Jawort zu geben. Er hakte sich bei ihr unter. Wie immer machte er einen vergnügten Eindruck, so als hätte er den Hauptgewinn gezogen. Sie strich ihm über den Arm. Sie war gerne sein Hauptgewinn.
Er sagte leise: »Gleich bist du meine Frau.«
»Das bin ich doch jetzt schon«, flüsterte sie zurück.
»Aber noch nicht offiziell.« Als wäre ihm das Offizielle je wichtig gewesen.
Aus den Fenstern der Fachwerkhäuser, die sich an der Straße entlangzogen, winkten die Nachbarsfrauen. Sie riefen: »Viel Glück!« Über ihnen spannte sich der Julihimmel, blau und unendlich. Die Apfelbäume hinter den Gartenzäunen trugen die ersten kleinen Früchte, über die Zäune ragten mit prallroten Kirschen beladene Äste. Dies war der Tag, an dem Klara in die Ehe überging, eine neue, andere Daseinsform, für die sie bisher kein sonderlich mitreißendes Vorbild hatte.
Ihr Blick blieb an Mutter und Vater hängen, die nebeneinander durch das schmiedeeiserne Tor gingen und den sandigen, von hohen Büschen eingefassten Kirchvorplatz überquerten. Zwei vom Leben gebeugte Menschen. Mann und Frau, die sich im Lauf der Jahre ihrem Schicksal ergeben hatten, dass aus ihrer irdischen Existenz nicht mehr werden würde als genau das, was sie hatten. Immer Geldsorgen, kalte Räume, schmerzende Knochen und schlechte Augen. Klara liebte ihre Eltern über alles, sie hatte Achtung vor dem, was sie sich mit viel Kraft und Verschleiß aufgebaut hatten. Nur wollte sie ihre eigenen Lebensumstände und ihre Freiheit in größere, bedeutendere Bahnen lenken.
Klara und Gustav folgten ihnen in die tausendjährige Stiftskirche. Drinnen war es angenehm kühl. Die hinteren Bänke verschwanden im Dunkel des mächtigen Kirchenschiffs. Durch die bunten Mosaikfenster drang das sonnige Tageslicht, und die Staubpartikel tanzten sacht im Luftzug. Das Taufbecken war mit einem üppigen Blumenbouquet geschmückt. Vor dem Altar erwartete sie in seinem schwarzen Talar bereits Pastor Kinkel, der Klara als Dreizehnjährige konfirmiert hatte. Er hob leicht die Hände und wies die kleine Hochzeitsgesellschaft an, auf der vordersten Bank Platz zu nehmen. Dann erklärte er allen, warum sie hier waren, und schloss mit der Offenbarung des Johannes: »Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.« Das war schon Klaras Taufspruch gewesen, und sie wollte sich unbedingt daran halten. Sie warf Gustav einen flüchtigen Blick zu. Er starrte begeistert zum Pastor hinauf, der nun eine kurze Predigt zum Korintherbrief hielt. Ihr Täve konnte sich diesem feierlichen, wunderbaren Augenblick so viel mehr hingeben als sie. Er konnte ihn wirklich von ganzem Herzen spüren, während ihre innere Angespanntheit in den letzten Wochen stetig zugenommen hatte. Der Schock über den Abschied von Tolla saß so tief, dass sich jede Faser ihres Körpers dagegen zu wappnen schien, noch einmal einen solchen Verlustschmerz zu durchleben. Doch diesen Schmerz hatte sie selbst verursacht. Sie hatte das kleine jüdische Mädchen, um es zu beschützen, als ihre eigene Tochter ausgegeben, nachdem sich die Mutter aus Verzweiflung das Leben genommen hatte. Klara hatte es so liebgewonnen, dass sie in einem Anflug absoluten Leichtsinns seine Geburtsurkunde verbrannt und gedacht hatte, damit seien erst einmal alle offenen Fragen geklärt. Stattdessen war die Gefahr, enttarnt zu werden, mit dem Machtgewinn der Nationalsozialisten immer größer geworden, bis ihr nur der Ausweg geblieben war, Tolla ins sichere Ausland zu schicken. Das war doch keine Treue!
In jedem Augenblick spürte sie ihre Gegenwart. Auch jetzt saß ihr kleines Mädchen neben ihr. Klara fühlte Tollas Hand, die nach ihrer tastete. Sie fühlte das liebe Gesicht, das sich an ihre Schulter lehnte. Sie sah die roten, geflochtenen Zöpfe. Ihre dünnen Beine, die von der Bank herunterbaumelten, die frisch polierten Schuhe. Sie spürte, wie Tolla sich gefreut hätte, dass sie nun endlich eine Familie sein würden. Stattdessen war sie weit weg in ein Berliner Waisenhaus mit lauter bedrohten Kindern gekommen, die darauf hofften, in ein sicheres Land gebracht zu werden, um dort bei fremden Menschen zu leben, die eine fremde Sprache sprachen. »Mama, ich hab dich lieb.« Das waren Tollas letzte Worte gewesen. Ihre Arme umschlangen noch immer Klaras Körper. Ihr kleines Mädchen würde sie niemals loslassen. Sie hatte bleiben wollen. Und Klara hatte sie nicht loslassen wollen.
Von weit her hörte sie ihren Namen um die Säulen im Kirchenschiff hallen. »Klara Möbius.« Gustav stand schon und reichte ihr seine Hand. »Komm!« Sie hatte die gesamte Predigt verpasst. Sie hatte wirklich Mühe, ihre Gedanken in der Gegenwart zu halten. Ständig wanderten sie zurück zum Moment des Abschieds. So als wäre sie darin gefangen, als würde ihr Verstand sich weigern, anzuerkennen, dass dieser Augenblick unwiederbringlich vorbei und vergangen war.
Als sie Gustav vor dem Altar gegenüberstand, sah Klara im Augenwinkel die großen Kerzen brennen, die die Herrlichkeit Gottes symbolisierten, die aufgeschlagene Bibel mit den goldenen Schnittkanten und Jesus am Kreuz. Sein Leiden stand für all das irdische Leid, das hingenommen und überwunden werden musste. Wenn es denn zu überwinden war. Jesus hing noch immer mit durchlöcherten Händen und Füßen da, einen Dornenkranz auf der blutigen Stirn, und starb jeden Tag aufs Neue. Sie sprachen ihr Ehegelübde, tauschten die Ringe. Sie sagten: »Ja, ich will«, und waren Mann und Frau.
Gustav zog sie überschwänglich an sich. »Ich liebe dich!« Seine Augen glänzten vor Rührung. Klara liebte ihn auch. Wirklich, von ganzem Herzen. Sie konnte es ihm nur nicht sagen. Sie war sich selbst gerade so fremd. Und ihn in der Öffentlichkeit, vor den eigenen Eltern, zu küssen, fand sie noch viel schwieriger. Das war ihrem kleinen Lehrer herzlich egal. Er drückte ihr einen Kuss auf die Lippen, und aus seinen Augen strahlte das ganze Glück eines Menschen, der vollkommen überwältigt war von dem Schönen, das ihm widerfuhr.
Anschließend sangen sie noch mit Orgelbegleitung Geh aus, mein Herz, und suche Freud und Lobe den Herrn, den mächtigen König. Es donnerte über der Stiftskirche. Das Licht zog sich augenblicklich aus dem Innenraum zurück. Der Himmel verdunkelte sich hinter den farbigen Mosaikfenstern, und die zufriedenen Gesichter von Klaras Mutter, Vater, Schwiegervater und Bruder lagen plötzlich im kalten Schatten.
»Sie begehen Ihre Ehe ja gleich mit einem ordentlichen Donnerwetter«, bemerkte der Pastor bei der Verabschiedung in der offenen Kirchentür, als es über ihnen erneut kräftig rumste. Gustav hielt Klaras Hand und sah hinauf zu den sich in den Sommerhimmel türmenden schwarzen Wolken. »Ach, das zieht vorbei.«
Doch ihr Bruder als angehender Unteroffizier der Luftwaffe erkannte sofort: »Falsch! Es kommt direkt auf uns zu.« Und im nächsten Augenblick regnete es auch schon in Strömen über den Fachwerkhäusern, die sich gemächlich die Hangstraße hinauf staffelten. Klara fröstelte in ihrem Seidenkleid. Gustav lachte auf, als wäre Regen am Hochzeitstag die Erfüllung eines Traumes. Wie konnte er nur immer so fröhlich sein, als wäre die Welt mit all ihren Unwägbarkeiten nichts anderes als ein einfallsreicher Spielkamerad? Er maß den Dingen längst nicht so viel Bedeutung bei, wie sie das tat. Er brachte Leichtigkeit in ihr Leben, wo Pflichtbewusstsein war. Er brachte Liebe, wo Sachlichkeit war. Zuversicht, wo Zweifel waren. Wenn Klara doch nur ein wenig von diesen einzigartigen Eigenschaften ihres Mannes übernehmen könnte. War das nicht der Sinn einer Ehe, dass man durch den anderen jene Teile in sich zum Leben erweckte, die sonst verkümmern würden und durch die man aber erst vollkommen wurde? Der gesamte Vorplatz glänzte im Regen. Überall bildeten sich tiefe Pfützen, die Blätter der Sträucher und Büsche entlang des hohen schmiedeeisernen Zaunes zitterten in den herunterprasselnden Tropfen. Über ihnen hing eine schwere, graue Regendecke, irgendwo ging wieder ein Blitz nieder.
Die kleine Hochzeitsgesellschaft stand ratlos in der Tür. Gustav blickte Klara lächelnd an, dann griff er nach ihrer Hand. »Komm, meine geliebte Frau, wir rennen!« Bevor sie überhaupt zögern konnte, zog er sie im Slalom um die Pfützen herum, hüpfte darüber, und Klara sprang hinterher. Würde das nicht eine schöne Erinnerung für immer sein? Dieser wunderbar entrückte Augenblick in ihrer Heimatstadt Lieberode an diesem furchtbar verregneten Julitag 1939. Klara lachte. Gustav hielt sie fest, und von hinten, durch den niederprasselnden Schleier, zwischen fernem Donnergrollen hörte sie ihre Mutter rufen: »Wartet, wir kommen mit euch!«
Es war ein großer Spaß. So, als wären für einen Moment die Gesetze der Wirklichkeit aus den Angeln gehoben. Als wäre tatsächlich alles nur ein wunderbares Spiel ohne Konsequenzen. Klara hörte ihre Mutter hinter sich vor Freude jauchzen. Sogar ihr ständig bedrückter Vater lachte. Ihr Bruder, die Sportskanone, überholte sie alle und sprintete die nass glänzende Straße in seinem Anzug hinauf. Ihre feinen Kleider waren ordentlich durchweicht, als sie schließlich die Treppenstufen zum Haus ihrer Eltern hinaufeilten.
Um sich die feuchte Kleidung auszuziehen und schnell zu trocknen, verschwanden die frisch Vermählten in der kleinen Kammer, die sich Klara früher mit ihrem Bruder geteilt hatte. Seit ihrer Kindheit hatte sich in diesem Raum kaum etwas verändert. Die beiden schmalen Betten, der Kleiderschrank, der Schreibtisch – alles war noch da. Ihre Lieblingsbücher Der Trotzkopf, aber auch die Balladen von Friedrich Schiller und Robinson Crusoe standen im Regal. Über Kurtchens Schreibtisch hingen seine vielen Urkunden von den Reichsjugendwettkämpfen, das silberne SA-Sportabzeichen und die eindrucksvollen Fotos von ihm im weißen Trikot beim Kugelstoßen und Weitsprung. Diese Bilder und Auszeichnungen sprachen ihre eigene Sprache: Nur innerhalb des nationalsozialistischen Systems gab es Siege und Bedeutung. Alles war längst dieser Ordnung unterworfen. Die Familienplanung. Die Erziehung. Der Sport. Die Ausbildung. Die Wehrmacht. Der Erfolg. Wer konnte man überhaupt sein, wenn man da nicht miteiferte? Klara wollte doch auch nur etwas Schönes aus ihrem Leben machen. Was war falsch daran?
Gustav setzte sich auf die Kante von Kurtchens ehemaligem Bett, das früher immer durchwühlt gewesen war, jetzt sah es ordentlich aus. Er zog die nassen Schuhe und Strümpfe aus. Klara setzte sich neben ihn. Ihr Rock klebte an ihren Beinen. Ihr war kalt, und sie war so erschöpft. Genau wie damals vor fast zehn Jahren, als sie ihre Eltern besucht hatte, um sich ein wenig von der plötzlichen Doppelbelastung in Oranienbaum zu erholen. Am Tag war sie Lehrerin gewesen, in der Nacht hatte sie sich um das Baby Tolla gekümmert, das sich ausschließlich von ihr hatte füttern, auf den Arm nehmen oder wickeln lassen. So als hätte es von Anbeginn zwischen ihnen beiden ein ganz besonderes Band gegeben.
»Was ist mit dir?«, fragte Gustav. »Du bist schon den ganzen Tag so still. Wolltest du mich in Wahrheit gar nicht heiraten?«
Klara warf ihm einen kurzen Blick zu. »So ein Blödsinn.« Sie zitterte in dem durchnässten Seidenkostüm.
»Was ist es dann?«
Sie strich sich eine feuchte Haarsträhne von der Wange. »Manchmal denke ich, vielleicht habe ich Tolla nur weggegeben, damit ich nicht meine Stelle in Sandersleben verliere und wir beide heiraten und ein angenehmes Leben in unserem neuen Zuhause haben können.«
Gustav griff erschrocken nach ihrer Hand und zog sie auf seinen Schoß. »Das darfst du nicht einmal denken! Du hast Tolla nicht weggegeben. Du hast sie in Sicherheit gebracht. Das ist ein wichtiger Unterschied.«
Klara flüsterte mit belegter Stimme: »Aber ist sie denn überhaupt in Sicherheit? Seitdem du sie zum Bahnhof gebracht hast, gab es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Ich will doch nur ihre Stimme hören und ihr sagen, wie lieb ich sie habe.«
»Sobald Tolla kann, wird sie aus England eine Karte schicken. Mit einem Foto vom Buckingham-Palast oder einem Gardisten mit Bärenfellmütze. Wahrscheinlich hat sie gerade genug damit zu tun, sich an das britische Frühstück aus Bohnen und Speck zu gewöhnen.« Gustav lächelte. »Es ist alles gut.«
Klara sah auf ihre beiden Hände mit den schönen goldenen Eheringen. »Trotzdem habe ich einen großen Fehler gemacht.«
»Aber, Klärchen, was hättest du denn anderes tun sollen? Du weißt, welche Konsequenzen das für sie und dich gehabt hätte.« Gustav senkte seine Stimme. »Früher oder später wäre jemand hinter dein Geheimnis gekommen.«
Klara nickte. Es stimmte. Sie wären immer in Gefahr gewesen. Tolla, sie und damit auch Gustav, vielleicht sogar ihre Eltern als Mitwisser. Warum fühlte sie sich dann nur so schuldig? Gustav sah sie abwartend von der Seite an, ihr lieber Mann, der immer alles zum Guten wenden wollte.
»Du trägst Tolla in deinem Herzen. Das ist der sicherste Platz, den du ihr anbieten kannst.«
Es war ein schönes Bild, und Klara wollte daran festhalten. Aber sie war sich nicht sicher, wie lange diese tröstliche Vorstellung halten würde. Gleichzeitig war es ihre Verantwortung, zuversichtlich zu bleiben. Als Beschützerin und Behüterin all der Kinder und Mädchen, die in ihrem Heim auf dem Hügel Geborgenheit und Heimat gefunden hatten. Gustav würde als Lehrer an der Volksschule in Sandersleben anfangen. Sie würden in ihr neues Haus einziehen. Das Leben, das jedem nur einmal gegeben wurde, wartete nicht. Wer hatte das Recht, über sie zu richten?
4
Es regnete den ganzen Morgen, der Regen ging über in den Mittag. Erst am frühen Nachmittag klarte der Himmel über der norddeutschen Reihenhaussiedlung auf, und die Sonne brach durch die aufgerissene Wolkendecke. Sie ließ alles in unschuldigem Licht erscheinen, als läge im Ende des Regens ein großes Ereignis, als würde nun eine ganz neue Zeitrechnung beginnen. Lieblich und unschuldig. Es klingelte an der Haustür. Das Klingeln verhallte im Inneren des Hauses.
Isabell drückte wieder auf die Klingel. Ihre fünf Monate alte Tochter saß in der Babytrage vor ihrer Brust. Das rote Haarbüschel leuchtete auf ihrem Köpfchen. Seitdem Isabell Anfang des Sommers mit ihrer kleinen Familie eher unfreiwillig von Berlin in die Nähe ihrer Großmutter nach Oldenburg gezogen war, kamen Tilly und sie einmal in der Woche zu Besuch. Sie kannten ja sonst niemanden in dieser beschaulichen Universitätsstadt. Eigentlich kannte Isabell nicht einmal ihre Großmutter, obwohl sie früher mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern regelmäßig die Wochenenden bei ihr verbracht hatte. Als Kinder hatten sie sich regelrecht vor ihrer Strenge gefürchtet. Isabell konnte sich kaum an ein persönliches oder herzliches Wort aus dem Mund ihrer Großmutter erinnern. Immer hatte es nur strikte Anordnungen oder Ermahnungen gegeben, sodass ihr Vater lieber gleich zu Hause geblieben war. Doch in letzter Zeit schimmerte bei ihrer Großmutter eine Weichheit durch, die Isabell zunehmend überraschte. Nie hatte sie ihre Oma so liebevoll erlebt wie jetzt, wenn sie sich ihrer kleinen Enkelin zuwandte. Trotz ihrer Blindheit und körperlichen Zerbrechlichkeit wohnte ihr eine Lebensfreude inne, die Isabell als Kind gar nicht wahrgenommen hatte. Sie fragte nach Isabells Vorhaben, einen Roman zu schreiben, nach Tillys Entwicklungsfortschritten und nach Patricks Arbeit als Bühnenbildner am Oldenburger Staatstheater.
Dass es etwas dauerte, bis ihre Großmutter die Tür öffnete, war nicht ungewöhnlich. Sie war schon über neunzig Jahre alt und musste sich vorantasten. Aber so lange wie jetzt hatte es noch nie gedauert. Unruhig strich Isabell über Tillys Ärmchen und zählte bis dreißig. Sie wollte ihre Oma nicht hetzen. Dann drückte sie noch einmal auf die Klingel. Sie legte ihr Ohr an die Haustür und lauschte. Nichts war zu hören. Schließlich hockte sie sich vor den Briefschlitz, hob ihn an und sah nach drinnen. »Oma?« Weit konnte sie nicht sehen. Die Windfangtür mit der Milchglasscheibe war geschlossen. Isabell richtete sich wieder auf. Dann probierte sie es eben auf dem Telefon. Doch aus ihrem Handy war auch nur das Freizeichen zu hören und hinter der Tür das dazugehörige Klingeln.
Nach einer Weile stieg Isabell die Eingangsstufen hinunter und stellte sich auf Zehenspitzen vor das breite Küchenfenster. Drinnen war das Licht ausgeschaltet und ihre Großmutter nirgendwo zu entdecken. Obwohl sie um diese Uhrzeit immer die Töpfe vom Mittagessen abwusch. Ratlos blickte Isabell den Plattenweg hinunter. Links lagen die gepflegten Vorgärten der Reihenhaussiedung, in der ihre Großmutter seit den 60er-Jahren lebte. Rechts verschwanden die Nachbarsgärten hinter Jägerzäunen und dunklen Tannen. Irgendwie musste Isabell auf die Rückseite der Häuserreihe gelangen, um von der Terrasse aus durch die großen Fensterscheiben ins Wohnzimmer zu sehen. Dahin gelangte sie nur über den Garten des Nachbargrundstückes. Aber auch die Nachbarn reagierten nicht auf ihr Klingeln.
»Dies ist ein Notfall«, flüsterte Isabell, als würde sie sich von ihrer kleinen Tochter die Genehmigung abholen wollen, unerlaubt den angrenzenden Garten zu betreten. Zuerst zögernd, dann entschlossen öffnete sie die niedrige Pforte und lief über den Rasen am Sandkasten mit den bunten Plastikförmchen vorbei auf die hohe Hecke zu. Es war unmöglich, mit umgebundenem Baby darüberzuklettern. Sie sah sich um, überlegte, ob sie ihre Tochter auf dem Gras ablegen sollte. Aber das war noch nass. Gestern hatte es ein gewaltiges Gewitter gegeben. Also trug sie einen der weißen Plastikstühle von der Terrasse zur Hecke, stieg auf die Sitzfläche und blickte in den Garten ihrer Großmutter. Da lag sie. Mitten auf dem Rasen. Bäuchlings, in ihrem blauen Wollmantel. Die langen, grauen Haare zu einem strengen Dutt im Nacken gebunden. Der Hut neben ihr im Gras.
»Oma!« Isabell versuchte, das Gleichgewicht zu halten. Ihre Großmutter rührte sich nicht. Es war ein seltsamer, surrealer Anblick, sie dort im Mantel im Gras liegen zu sehen. Ihre Großmutter war so ein ordentlicher, ästhetischer Mensch, der sich nie irgendwo hinlegte, außer ins Bett. Sie ging immer in Mantel und Hut vor die Tür, auch wenn es nur ein kleiner Spaziergang über ihre Terrasse war. »Oma!«
Isabell stieg mit zitternden Knien wieder vom Gartenstuhl herunter. Es brauchte einige Versuche, bis sie auf ihrem Handy endlich die richtigen Tasten für den Notruf wählte. Nachdem sie einer freundlichen Frauenstimme erklärt hatte, was los war, ließ sie das Telefon sinken. In ihrem Kopf war nur noch Watte. Sie wollte nicht darüber nachdenken, was das hier bedeutete. Sie würde abwarten, bis Hilfe da war. So lange wollte sie nicht nachdenken. Nur warten. Sie starrte in den Garten der Nachbarn, über den sauber gemähten Rasen bis zum Spielhäuschen unter dem Kirschbaum. In der Trage wurde ihre Tochter unruhig. Vermutlich hatte sie Hunger. Isabell wippte hin und her, in der Hoffnung, dass Tilly von dem nervösen Geschaukel einschlief. Stattdessen wurde sie immer unruhiger, streckte ihren kleinen Körper durch und fing an zu krähen. »Oh, bitte nicht«, flüsterte Isabell. Sie hatte kein Breigläschen dabei. Eigentlich hatte Tilly drinnen ein paar zerdrückte Kartoffeln mit Blumenkohl bekommen sollen. »Sie werden die Tür aufbrechen, oder? Was meinst du, Tilly?« Das kleine Mädchen antwortete mit verzweifeltem Geschrei. Isabells Herz klopfte heftig. Sie holte ihr Handy wieder hervor, drückte die Kurzwahltaste und hörte sich wie von ferne auf die Mailbox ihres Freundes sprechen: »Patrick, kannst du bitte sofort kommen? Bitte. Ich bin bei meiner Oma, ihr geht es nicht gut. Und bring etwas zu essen für Tilly mit.«
Isabell verließ den Nachbarsgarten und stellte sich zurück vor die Haustür, damit die Rettungskräfte sie sofort sahen. Sie war ganz still. Sie versuchte zu spüren, ob sie Angst hatte. Aber da war keine Angst. Nur Aufmerksamkeit und Tillys Schreien. Schließlich hörte sie die Sirenen der Feuerwehr, am Ende des Weges tauchte der leuchtend rote Rettungswagen auf. Sie winkte und alles, was dann folgte, erschien ihr so unecht, fast wie im Traum. Die Sanitäter drängten mit einer Trage an ihr vorbei. Tilly brüllte vor Hunger. Die Haustür wurde aufgebrochen. Fremde Männer in roten Jacken liefen durch den Flur und das aufgeräumte Esszimmer, schoben die große Terrassentür auf und rannten weiter in den Garten. Isabell folgte ihnen mit Tilly, die sie inzwischen aus der Trage gehoben hatte. Aber es half nichts. Das kleine Mädchen war hungrig und wütend, und es war ihm vollkommen egal, dass hier gerade etwas sehr Schlimmes passierte. Von der Terrasse aus sah Isabell zu, wie die Rettungskräfte ihre Großmutter vorsichtig vom Bauch auf den Rücken drehten und der Notarzt ihren leblosen Körper untersuchte. Am liebsten wäre sie hingegangen, um zu sehen, was los war, aber mit dem schreienden Kind würde sie nur stören.
Plötzlich legte jemand den Arm um sie. »Isi, was ist los? Was ist mit deiner Oma?« Patrick stand in T-Shirt, Cargohose und Turnschuhen neben ihr und nahm ihr Tilly ab.
Isabell zuckte hilflos mit den Schultern, und die ersten Tränen liefen ihr über die Wangen. »Ich weiß es nicht. Als ich kam, lag sie einfach da, im Gras.«
»Ist sie gestürzt?«
Isabell zuckte wieder mit den Schultern. »Vielleicht wollte sie einen kleinen Spaziergang im Garten machen.« Es war egal, was sie hier redeten. Nichts davon würde irgendetwas an der Tatsache ändern können, dass ihre Großmutter tot war.
Tilly brüllte und forderte nun endgültig die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Obwohl Patrick noch etwas Tröstliches hatte sagen wollen, drehte er sich weg, sodass Isabell an seine umgehängte Tasche herankam. »Da drin ist ein Gläschen mit Möhrenbrei. Kannst du das rausholen?«, rief er über das Babyschreien hinweg.
Isabell kramte in seiner Tasche, in der Stoffproben, eine Schere, ein Skizzenbuch und Stifte lagen, und reichte ihm schließlich das Gläschen mit einem Löffel. »Danke, dass du gekommen bist.«
Tillys Schreien übertönte alles. Patrick gab Isabell einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. »Es tut mir leid, Isi.« Dann verschwand er eilig mit seiner Tochter nach drinnen ins Wohnzimmer, und Isabell stand verloren auf der Terrasse und versuchte zu verstehen, was hier passierte und was das für sie bedeutete. Gerade noch hatte sie sich auf den Besuch bei ihrer Großmutter gefreut, und nun gab es sie nicht mehr. Die Sanitäter hoben Klara mit der Trage hoch und trugen sie mit einem Tuch bedeckt an Isabell vorbei. Der Notarzt blieb bei ihr stehen und erklärte mit ruhiger Stimme, was seine Untersuchung ergeben hatte. Aber das bekam sie gar nicht richtig mit. Er legte ihr sogar die Hand auf den Arm und überreichte ihr schließlich den Totenschein. Es war für Isabell kaum zu begreifen, dass ihre Oma unter diesem Tuch lag und das Leben ihren Körper verlassen hatte. Ein ganzes gelebtes Leben von über neunzig Jahren. Isabell wusste nicht viel über dieses Leben, sie wusste eigentlich gar nichts. Nun war es vorbei, bevor ihre Großmutter und sie sich überhaupt hatten richtig kennenlernen können. Isabell taumelte durch die Räume bis zur Eingangstür. Sie hörte sich heiser rufen: »Warten Sie.«
Die Männer blieben auf dem Plattenweg zwischen den Vorgärten stehen. Freundliche, junge Männer in roten Jacken, die ihre Arbeit taten. »Ich möchte mich verabschieden.«
Einer der Sanitäter zog das Tuch zurück, und Isabell blickte in das fahle, leere Gesicht ihrer Großmutter. Die Augen waren geschlossen, und doch lag eine eigenartige Feierlichkeit auf ihren Lippen. Unter ihrem dunkelblauen Wollmantel trug sie ein hellblaues, feines Oberteil, das die Nässe des Regens in sich aufgesogen hatte. Isabell legte die kleine goldene Uhr, die an einer dünnen Kette um ihren Hals hing, ordentlich hin. Diese Frau war ihre Großmutter, ohne sie wäre sie nicht am Leben. Sie nahm ihre Hand, an der ihr Ehering und der ihres Großvaters steckten. So verschwand ein Leben, fast ein ganzes Jahrhundert. Sie streichelte über die Hand. »Ich hab dich lieb, Oma.« Irgendwo bellte ein Hund. Ein Rasenmäher brummte. Schließlich trat Isabell zurück und sagte kaum hörbar: »Danke.«
5
Klara begleitete ihre neue Erzieherin Margarete kurz nach Sonnenaufgang über die Obstwiesen hinauf zum neu eingerichteten Kindergarten, der jenseits der Felder in der Arbeitersiedlung lag. Der Nebel hing noch in den Halmen, und doch war die aufkommende Hitze des Tages schon zu spüren. Sie gingen schnell. Margarete atmete ruhig, als wäre sie zügiges Laufen gewöhnt. Das gefiel Klara. Sie mochte diese entschlossene, adrette Frau, die gut zehn Jahre jünger war als sie. Margarete strich sich ihr welliges Haar aus der Stirn. »Wie war Ihre Hochzeit?«
»Einfach und schön«, sagte Klara knapp. »Es hat ein ordentliches Gewitter gegeben, und wir waren alle bis auf die Knochen durchnässt.«
»Das werden Sie bestimmt nie vergessen.«
»Nein, das werde ich nie vergessen.« Klara sah sich für einen kurzen Moment mit Gustav in ihrem alten Kinderzimmer, wie sie in ihren feuchten Hochzeitskleidern nebeneinander auf der Bettkante gesessen und über Tolla geredet hatten. Doch bevor sie sich in dieser wehmütigen Erinnerung verlieren konnte, schob sie sie schnell zur Seite. Sie musste aufhören, sich mit dem zu beschäftigen, was vergangen und nicht mehr zu ändern war, wollte sie nicht auf ewig die Gefangene ihres schlechten Gewissens bleiben. Es hatte gute Gründe für ihre Entscheidung gegeben, und die galten immer noch, egal, wie sehr Tolla ihr fehlte. Außerdem wollte Klara in Gegenwart ihrer Angestellten nicht abwesend wirken. Das war einfach unpassend. Sie stiegen den Hang hinauf, der von dichten Brombeerhecken gesäumt war, und Klara fragte unvermittelt, um sich rasch auf andere Gedanken zu bringen: »Haben Sie einen Freund?« Für gewöhnlich stellte sie nicht solch persönliche Fragen, aber das war doch ein angenehmes Thema.
Margarete schüttelte den Kopf. »Es ist ja gar nicht so leicht, jemand Passendes zu finden. Ich beneide Sie, dass Sie so jemanden gefunden haben.«
Sie erreichten die Anhöhe, und Klara blickte den Feldweg hinunter, zu dessen beiden Seiten das reife Korn auf den Halmen stand und sich ein morgendlicher Glanz über die Landschaft bis zum Waldrand und zur Bernburger Allee ausbreitete. Ja, sie hatte wahrhaftig großes Glück, dass Gustav und sie sich gefunden hatten. Sie erkannten in den gleichen Dingen Sinn und Schönheit. Solch ein gegenseitiges tiefes Einverständnis war doch äußerst selten.
»Sie werden auch jemanden finden«, sagte Klara, obwohl sie das natürlich nicht wissen konnte. Andererseits war Margarete so hübsch anzusehen, und sie hatte ein so einnehmendes Wesen, dass es gar nicht anders sein konnte, als dass sie jemanden für sich begeisterte, der gut zu ihr passte. Sie liefen die breite Schotterstraße hinunter in die Siedlung hinein, an deren Ende die große Domäne mit ihren Scheunen und Ställen lag.
»Möchten Sie schon bald Kinder haben?«, fragte Margarete plötzlich, als sie die ersten niedrigen Arbeiterhäuser mit den Schindeldächern hinter sich gelassen hatten. Das hatte sie doch gefragt, oder? Klara warf ihr einen prüfenden Blick zu. Ihre neue Kindergärtnerin wusste nichts von Tolla. Also war ihre Frage völlig arglos. Klara antwortete nur mit einem Lächeln. So wie Frauen lächelten, die nicht alles über sich preisgeben wollten. Margarete lächelte etwas verwundert zurück. Es war ein seltsam intimes Gespräch, das sie beide führten, das musste Klara zugeben. Glücklicherweise hatten sie es nicht mehr weit, bis sie das letzte Arbeiterhaus, gegenüber der Domäne erreichten. Eine kleine getigerte Katze lief vor ihnen her und verschwand durch einen halb verrotteten Lattenzaun im Gebüsch. Klara schloss die Eingangstür auf, sie traten in einen dunklen, engen Hausflur, und von da aus gelangten sie in eine verwinkelte Wohnstube, die zu einem Spielraum umfunktioniert worden war. Die Wände waren frisch gestrichen, und an den Fenstern hingen neue Vorhänge, sodass alles einen recht freundlichen Eindruck machte. Es gab nicht viel Einrichtung. Ein paar Kindertische und Stühle, an den Wänden waren Regale angebracht für Bilderbücher und Holzkisten, in denen Spielzeug lag. Durch die Butzenfenster, die ihre Schülerinnen in der vorherigen Woche sorgfältig geputzt hatten, fiel das helle Augustlicht. Margarete sah sich um. »Schön.« Sie lächelte tapfer.
Klara hatte es geahnt. Diese junge Frau war für die ländliche Rauheit nicht geschaffen. Es würde nicht mehr als ein paar Tage oder Wochen dauern, dann würde sie sich wünschen, wieder mit der Tram durch ihre Heimatstadt Essen fahren zu können.
»Es ist einfach.« Klara öffnete die Fenster, um etwas Luft hereinzulassen. »Nebenan ist noch eine kleine Kochnische, um Milch und Wasser aufzukochen. Das Mittagessen bringen nachher zwei unserer Haushaltungsschülerinnen hierher.«
Margarete nickte. Und bevor sie noch etwas fragen konnte, kamen die ersten Kinder an. In zerschlissener Kleidung drängten sie schüchtern durch die Tür. Kleine Mädchen und Jungen mit erstaunten Augen, glatt gekämmtem oder verfilztem Haar. Einige hielten sich an den Händen und machten ein paar mutige Schritte herein, andere wurden von ihren Müttern vorwärtsgeschoben. Wie angewurzelt blieben sie dicht an der Wand stehen. Diese Kinder wussten ja nicht, was sie hier erwartete. Sie waren es gewohnt, sich von morgens bis abends um sich selbst zu kümmern, während ihre Eltern draußen auf den Feldern und Obstwiesen arbeiteten. Ein paar von ihnen kannte Klara vom Sehen, wenn Tolla und sie einen Spaziergang hinüber zum Wald gemacht oder auf der Domäne Milch geholt hatten. Klara kam ihnen mit offenem Gesichtsausdruck entgegen und beugte sich zu ihnen herunter. »Willkommen. Ich bin Tante Klara, und das ist eure Tante Margarete. Sie wird mit euch nun jeden Tag Bücher ansehen, singen, malen und spielen.«
Die Kinder nickten, und ihre Augen wurden immer größer, je länger sie ihre hübsche Tante Margarete mit den Perlenohrringen ansahen. Sie hatte sich ein Bilderbuch genommen und sich an einen der kleinen Tische gesetzt. »Holt euch einen Stuhl, und setzt euch zu mir.«
Auch die letzten Kinder ließen artig die Schürzen ihrer Mütter los und machten, was ihnen gesagt worden war. Stühle wurden hin und her gerückt, und als die Kleinen alle um ihre Tante Margarete saßen, legten sie ihre teilweise recht schmutzigen Hände in den Schoß und hielten sich kerzengerade, als wollten sie alles richtig machen. Nachdem ihre Mütter zurück zu ihrer Arbeit auf den Feldern verschwunden waren und Margarete die Situation im Griff zu haben schien, wandte sich nun auch Klara zum Gehen. Sie war schon beinahe aus der Tür, als sie hinter sich eins der Kinder wie aus dem Nichts fragen hörte: »Tante Klara, wo ist denn Ihre Tochter?«