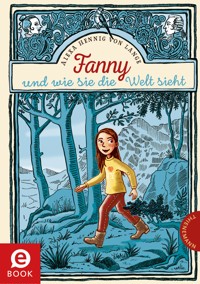11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet in einer psychiatrischen Klinik für Jugendliche will die 16-jährige Franzi ihr Schulpraktikum machen. Sie stellt sich das abenteuerlich und besonders vor – muss aber schnell erkennen, dass sie eine Welt betritt, in der die Normalität außer Kraft gesetzt ist. Hier trifft sie auf den 18-jährigen Tucker – und Tucker trifft sie voll ins Herz. Nach einem traumatischen Erlebnis spricht er nicht mehr. Tief in sich zurückgezogen, dreht er im Schwimmbad seine Runden, am liebsten unter Wasser, wo ihn keiner erreichen kann. Behutsam versucht Franzi, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Als ihr das gelingt, steht sie vor einer schweren Entscheidung: Soll sie wie geplant für eine Zeit ins Ausland gehen? Oder dem Herzen folgen, das gerade erst wieder zu sprechen begonnen hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alexa Hennig von Lange
Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage 2015
© 2015 cbt Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, Andrea Janas,
unter Verwendung von Motiven von
© Getty Images/Roberta Tocco und © Shutterstock/Willyam Bradberry
SK · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-14694-8
www.cbt-buecher.de
»Unsere Gefühle und unsere Körper sind wie Wasser, das in Wasser fließt. In den Energien der Sinne lernen wir schwimmen.«
– Tarthang Tulku
Eins
Der erste Tag meines neuen Lebens
Seit ich auf der Welt bin, versucht meine Mutter, mich von allem fernzuhalten, was mich auch nur im Ansatz traumatisieren könnte. Aber genau darum fühle ich mich traumatisiert. Wie ein Versuchskaninchen, das in einer künstlichen Welt ohne Risiko aufwächst. Damit ist jetzt Schluss. Nächste Woche werde mich in den zerklüfteten Grand Canyon des Lebens begeben. Und zwar mittenrein. Um mich herum werden nichts als schwindelerregende Abgründe klaffen, in die ich hinabsehen muss, um das Menschsein in all seiner Unerbittlichkeit zu erleben.
»Du ziehst die Sache also wirklich durch?« Meine Freundin Nelli schielt auf den Fragebogen, den ich für meine angehende Praktikumsstelle in einer psychiatrischen Klinik ausfüllen muss. Es geht um die Selbsteinschätzung meines Seelenzustandes.
Ich mache ein schwungvolles Häkchen hinter die Frage, ob ich starke Nerven habe, und sage: »Klar!«
Sie nimmt den Kopfhörer aus ihrem Ohr. Der andere steckt noch in meinem Ohr. Es ist Freitagmittag. Wir haben Schule aus und hören unsere Für-immer-beste-Freundinnen-Playliste auf Nellis Handy, während wir in der U-Bahn durch den Tunnel schießen. Sie sagt: »Ich verstehe es einfach nicht.«
Ich sage: »Was ist daran so schwer?« Eigentlich will ich in Ruhe den Fragebogen ausfüllen, bevor gleich meine Klavierstunde anfängt. Aber daraus wird nichts.
Nelli dreht den Ton ab, als wir in die überfüllte U-Bahn-Station einfahren, und sieht mich zweifelnd an. »Warum ausgerechnet in einer Klinik für psychisch angeschlagene Jugendliche und nicht in einem der Fernsehstudios in Babelsberg?«
Das sind die begehrtesten Praktikumsplätze, weil da angeblich Serienstars herumlaufen oder man selbst für eine Statistenrolle entdeckt werden könnte.
Ich ziehe den Kopfhörer aus meinem Ohr, der sich mit seinem Kabel in meinem rot gelockten Haar verfängt, um es ihr noch einmal zu erklären. Aber bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe, unterbricht sie mich schon wieder.
»Mach mal Platz!« Sie rutscht näher an mich heran, weil sich neben sie ein abgerissener Typ mit fleckigen Jogginghosen fallen lässt. Sie murmelt, wobei sich kaum ihre Lippen bewegen: »Genau das meine ich: Was bitte ist aufregend an kaputten Typen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen? Guck dich mal um! Nur Verlierer.«
Immer mehr Leute drängen herein. Die Luft ist stickig. Und nachdem sich die Türen geschlossen haben, schießen wir wieder in den schwarzen Tunnel hinein. Hinter den Fenstern fliegen ein paar grelle Lichtsignale vorbei. Einige der Mitfahrenden sind tatsächlich ein bisschen still und starren müde vor sich hin, sodass man denken könnte, sie hätten wirklich irgendwie Pech gehabt. Zumindest, wenn man die Welt mit Nellis Augen sieht.
»Vielleicht haben die alle nur einen schlechten Tag«, sage ich, um bei Nelli für etwas Mitgefühl zu werben.
»Wer hat das nicht?« Meine beste Freundin gehört allerdings zu den Leuten, die Mitgefühl für überflüssig halten, seitdem ihr Vater vorletzte Weihnachten ohne Vorwarnung zu seiner neuen, jungen Freundin gezogen ist. Um nicht an diesem Verrat zu zerbrechen, meint Nelli, die Lösung sei, gefühllos zu sein. Sie lehnt sich zurück und seufzt: »Wie du weißt, bin auch ich schon durchs schwarze Tal des Lebens geschritten. Das gibt mir aber noch lange nicht das Recht, miese Stimmung zu verbreiten und alle anderen mit runterzuziehen. Meine Aufgabe ist es, trotzdem gute Laune zu haben. Wenn ich das nicht schaffe, kann ich mich gleich umbringen. Ich meine, würdest du bei irgendjemandem hier sagen, er hat Spaß am Leben? Was soll dann das Ganze?«
Ich sehe mich um und muss sagen: Nelli-Eiserne-Lady übertreibt total. Die Mama mit dem süßen umgebundenen Baby, die in Lichtgeschwindigkeit Nachrichten in ihr Smartphone tippt, kichert zum Beispiel die ganze Zeit vor sich hin, und weiter vorne haut sich eine Gruppe Grundschüler fröhlich mit ihren Sportbeuteln in die Kniekehlen. Nur der Typ neben uns startet plötzlich ein abgedrehtes Selbstgespräch, in dem es darum geht, dass er von einer imaginären Person für dumm gehalten wird. Er brüllt, voll in der Rolle dieser anderen Person: »Hast du wieder deine Mathehausaufgaben nicht auf die Reihe gebracht? Guck dir das an! Alles rot! Fehler! Fehler! Fehler!« Dabei gestikuliert er wild mit seinen Händen herum, als würde er sich selbst ohrfeigen wollen. Da kann man echt Angst kriegen.
»Ich sage dir …« Nelli senkt ihre Stimme ab, damit der Mann neben ihr sie nicht hören kann. »Mit genau solchen Freaks wirst du es in der Klapse zu tun bekommen. Mit psychotischen Existenzen, die richtig einen an der Waffel haben. Warum willst du dir das antun?«
»Weil ich so behütet aufwachse«, sage ich. Wobei das fast wie eine Beschwerde klingt. So ist es aber gar nicht gemeint. Ich will nur nicht blauäugig durchs Leben rennen, weil in meinem eigenen bisher noch nie wirklich etwas schiefgelaufen ist. Also zumindest nicht so, dass ich deswegen seelische Probleme hätte. Zwar waren letzten Sommer ein paar kriminelle Jungs ziemlich sauer auf meinen Vater, der Oberstaatsanwalt ist. Wegen seiner Ermittlungen wollten sie ihm und meiner Familie einen echt heftigen Denkzettel verpassen. Aber wir sind noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Wofür ich natürlich einerseits dankbar bin. Auf der anderen Seite …
»Und was gibt’s an einem behüteten Leben bitte auszusetzen?« Nelli lächelt irritiert und bindet sich ihr langes, nussbraunes Haar zu einem Pferdeschwanz. »Du hast das große Los gezogen! Du wohnst mit deiner Familie in einem schönen Haus, dein Vater hat einen Super-Job, du kannst toll Klavier spielen, dein Haar sitzt meistens einigermaßen gut, und deine feste Zahnspange bist du auch los. Und dank deiner Mutter und ihrem Diätplan hast du fast dein Wunschgewicht erreicht.«
»Ihr Wunschgewicht.«
»Wie auch immer. Das Einzige, was dir noch fehlt, ist ein Typ, mit dem du endlich mal Sex haben kannst.« Sie schlägt ihre sonnengebräunten Beine übereinander, die in knappen Jeans-Hotpants stecken.
Nur, weil Nelli schon mit Jungs schläft, muss das noch lange nicht heißen, dass ich das auch brauche. Ich sage: »Ich liebe meine Unschuld.« Zumindest rede ich mir das seit einiger Zeit mehr oder weniger erfolgreich ein. Ist fast so was wie ein Mantra von mir geworden, um nicht nervös zu werden.
Sie sieht mich mitleidig an. »Ich bitte dich, Miss Franziska! Du weißt nicht, was dir Lebenswichtiges entgeht! Jedes siebzehnjährige Mädchen denkt an nichts anderes, als daran, endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, sollte sie die nicht schon vor hundert Jahren verloren haben. Willst du ewig keusch bleiben? Oder stehst du auf Psychopaten und hoffst, dass du dir einen in der Klinik anlachen kannst? Wäre typisch für dich. Nur ja nichts Durchschnittliches! Immer schön gegen den Strom schwimmen.«
»Nichts von beidem.« Ich versuche, nicht genervt zu klingen, obwohl mich Nellis Verdrängungspotenzial echt bestürzt. Als würde das Leben nur aus Sex, gut sitzenden Haaren und gerichteten Zähnen bestehen. Außerdem werde ich erst im September siebzehn. Ich seufze und sage: »Ich will einfach nur diesen Jugendlichen helfen.«
»Denen ist nicht zu helfen. Die haben sich dazu entschlossen, sich von ihrem Unglück in den Abgrund ziehen zu lassen und nichts aus ihrem Leben zu machen. Die verzichten auf deine Hilfe. Glaub mir.«
»Wenn sie keine Hilfe haben wollen würden, hätten sie sich wohl kaum in eine Klinik einweisen lassen.« Mit zweideutigem Blick gebe ich Nelli ihren Kopfhörer zurück, hänge mir meine Tasche mit den Schulheftern über die Schulter und stehe auf.
An der nächsten Station muss ich aussteigen. Nelli fährt noch ein paar Stationen weiter, bis zum Wasserbettengeschäft ihrer Mutter, wo sie dreimal die Woche nach der Schule aushilft. Ich kann nicht verstehen, wie man so hart drauf sein kann. Früher war Nelli viel verständnisvoller. In der Grundschule hat sie sogar mal ein Vogelbaby mit nach Hause genommen, das aus dem Nest gefallen war, und es mit der Pipette großgezogen. Ihr Schmerz muss wirklich schlimm sein.
»Falsch!« Nelli starrt mich mit ihren durchdringend blauen Augen an. »Die wollen sich besonders fühlen, weil es ihnen angeblich so mies geht. Aber ich kann Wichtigtuer und Drückeberger nicht ausstehen, die sich auf ihrer schlechten Laune ausruhen und sie zum Kult erheben. Mir wird auch nichts geschenkt. Alles klar? Seit mein Vater vorletzte Weihnachten beschlossen hat, dass er ohne meine Ma und mich glücklicher ist, müssen wir sehen, dass wir zurechtkommen. Soll ich mich darum gleich in eine Klinik einweisen lassen?«
»Es sind eben nicht alle solche Meister im Verdrängen wie du!« Vor mir muss Nelli nicht die Unzerstörbare spielen. Warum gibt sie nicht einfach zu, dass es wehtut? Es würde ihr guttun, sich mal auszuweinen. Also ich wäre für sie da, um die Sache aufzuarbeiten! Stattdessen macht sie ihr zweiwöchiges Schulpraktikum bei meinem Vater in der Abteilung für jugendliche Straftaten und Bandenkriminalität. Um schon mal Kontakte für ihren späteren Werdegang als Juristin zu knüpfen. Es ist jetzt schon sicher: Sie wird eine der Unerbittlichsten werden.
Sie meint: »Ich werde auf diesem Planeten für Gerechtigkeit sorgen.« Viel Spaß! Hauptsache, sie verliert dabei die Menschen nicht aus dem Blick.
»Bis dann!« Ich lasse die Haltestange los und schlängele mich zwischen den Fahrgästen in Richtung Tür.
Hinter mir höre ich Nelli rufen: »Bis dann? Ich dachte, wir legen uns morgen Abend wieder auf die Brücke? Flugzeuge beobachten und Gummibärchen mampfen?«
Ohne dass ich darüber nachdenke, drehe ich mich zu ihr um und höre mich zu meinem Erstaunen sagen: »Diesen Samstag kann ich nicht.« Keine Ahnung, warum ich diese plötzliche Entscheidung treffe. Anscheinend brauche ich gerade etwas Abstand.
»Aber ich habe schon Gummibärchen gekauft …« Nelli zwinkert überrascht. Sie ist es nicht gewohnt, dass ich sie hängen lasse. Am Samstagabend legen wir uns immer auf die Brücke. Ist seit König der Löwen unser heiliges Freundschaftsritual, das bis jetzt – mal abgesehen von den Ferien – noch nie ausgesetzt wurde.
»Ich muss mich aufs Klaviervorspiel vorbereiten«, murmele ich und drücke ein paar Male auf den Türöffner, als die Bahn in die Station einfährt. Über die Schulter sage ich: »Tut mir leid. Ich rufe dich an. Vielleicht können wir ja am Nachmittag kurz auf den Flohmarkt.«
»Mal sehen!« Nelli steckt sich ihre Ohrstöpsel in die Ohren und guckt grimmig an mir vorbei. Sie kann ganz schlecht mit Planänderungen umgehen. Liegt vermutlich an ihrem Vater und seiner plötzlichen Planänderung in Sachen Familie. Über Nacht ist er abgehauen. Doch im Gegensatz zu ihm werde ich mir keinen Ersatz für Nelli suchen. Sie ist und bleibt der wichtigste Mensch in meinem Leben. Niemand, mal abgesehen von meiner großen Schwester, kennt mich so gut wie sie. Und ich weiß: Irgendwann wird die alte Nelli wiederkommen.
»Bis dann!« Ich winke kurz, auch wenn sie mich nicht mehr ansieht. Die Türen klappen auf, und ich dränge mit den anderen Fahrgästen auf die stickige Station, in der es nach verschmortem Gummi riecht. Als sich die Station geleert hat, suche ich in meiner Hosentasche nach Kleingeld und werfe es dem Mann mit den Cowboystiefeln in den Hut, der hier immer im zugigen Durchgang E-Gitarre spielt und dazu singt.
Wie jedes Mal lächelt er mich an. »Danke, Sweety!«
Er ist bestimmt über fünfzig. Er hat ein zerfurchtes Gesicht und trägt einen rötlichen Bart. Seine Arme, die unter den hochgekrempelten Ärmeln seines karierten Holzfällerhemdes hervorgucken, sind mit einem Adler, der amerikanischen Flagge und einem brennenden Herzen volltätowiert, und ich schätze, Nelli würde ihn ebenfalls für einen »Verlierer« halten. Ich weiß nichts über ihn, aber ich stelle mir vor, dass er als junger Mann kurz davor stand, ein weltberühmter Countrystar zu werden. Doch dann hat das Schicksal unbarmherzig zugeschlagen und aus seinem Traum ist nichts geworden. Seine Stimme ist unglaublich. Sanft und rau zugleich. Und seine Augen blinzeln freundlich, als sei für ihn alles in Ordnung. Dabei steht er in einer muffigen U-Bahn-Station und singt für Menschen in Eile, von denen kaum einer auf die Idee kommt, ihm etwas in seinen alten Cowboyhut zu werfen.
Aber es ist okay für ihn.
Das bewundere ich. Anscheinend ist er mit der Planänderung, die das Schicksal bei ihm vorgenommen hat, klargekommen. Ohne gefühllos zu werden.
Ich lächele zurück und im Klang seiner Musik steige ich die Treppe hinauf in die drückende Hitze des Nachmittags. Ich gehe quer über die Straße und in das Gebäude der Musikschule, in deren kleinstem, muffigsten Raum unter dem Dach ich den restlichen Tag verbringen und unter der strengen Aufsicht meines Klavierlehrers Roman die Revolutionsetüde von Chopin üben werde. Das Stück muss so rasant und übermenschlich virtuos gespielt werden, dass ich mir jedes Mal die Finger verknote. Ich habe keine Ahnung, wie mein Klavierlehrer je glauben konnte, dass ich das Stück bis Ende nächster Woche halbwegs werde spielen können. Da habe ich dieses Vorspiel, mit dem ich mich um ein Auslandsjahr an einem australischen Musikcollege bewerbe.
Seit ich sieben Jahre alt bin, spiele ich Klavier. Mein Opa hat es mir beigebracht. Dabei hat er immer Karamellbonbons gelutscht und eins vor mich hingelegt. Das durfte ich erst lutschen, wenn ich das Stück fehlerfrei spielen konnte. So hat er es mit jedem Stück gemacht. Bis zu seinem Tod vor zwei Jahren haben wir Unmengen von Bonbons aufgelutscht. Nur eines ist noch übrig. Das letzte Karamellbonbon liegt noch immer auf unserem Flügel, als Symbol für alle Stücke, die ich noch nicht spielen kann. Ganz vorne mit dabei: die Revolutionsetüde. Beim Vorspiel werde ich also gnadenlos versagen. Und das wird nicht in Ordnung für mich sein. Denn ich wünsche mir nichts sehnlicher, als in ein paar Wochen, mit Beginn der großen Sommerferien, für ein Jahr nach Australien zu gehen, um zu erfahren, wie es ist, auf eigenen Beinen zu stehen.
Zwei
Der vierte Tag meines neuen Lebens
»Bist du sicher, dass du so gehen willst?«
Am nächsten Morgen taucht meine Mutter wie ein Geist hinter mir im Badezimmer auf und guckt sich mit mir unser Spiegelbild an. Ich in Kapuzenjacke mit offenen Haaren. Sie mit kinnlangen, blonden Haaren, in sportlichem Polokleid und ihren Perlenohrringen, ohne die sie nie vor die Tür gehen würde. Ihr Blick ist voller Zweifel. Meiner war bis eben noch irgendwie zuversichtlich. Voller Neugier und Vorfreude auf meinen ersten Praktikumstag.
Ich atme tief ein. »Ja, warum nicht?«
»Die … die … Insassen könnten …« Meine Mutter stockt und sucht nach dem passenden Wort, während sie von meiner Schulter eine imaginäre Fussel entfernt. »Sie könnten …«
»Ja?« Ich ziehe die Augenbrauen hoch und verschränke die Arme vor der Brust. »Was könnten dieInsassen?«
»Sie könnten dich für eine … na ja … eine von ihnen halten. In diesen Leggings und dem großen Kapuzenpullover.« Meine Mutter lächelt entschuldigend, weil sie ahnt, dass ihre Sorgen irgendwie übertrieben sind.
»Na und? Umso besser. Dann werden sie mir gleich vertrauen.« Ich reiße mich vom Spiegel los und gehe an ihr vorbei, in mein angrenzendes Zimmer, wo Klamottenberge verstreut auf dem Boden liegen und sich meine Schulbücher und Notenhefte auf dem Schreibtisch neben einem leblosen Gummibaum stapeln. Es ist ja nicht so, dass ich mir keine Gedanken über mein Äußeres mache. Ich stehe eben nur auf einen etwas lässigeren Stil als meine Mutter.
Ich greife nach meiner Tasche, die auf dem Bett liegt, und verschwinde raus in den Flur. Meine Mutter folgt mir die Treppe in die lichtdurchflutete Diele hinunter, wo auf dem runden Tisch ein üppiger Blumenstrauß aus unserem Garten prangt. Das Hobby meiner Mutter, die den grünen Daumen hat: üppige Blumensträuße selbst binden, die aussehen wie explodierte Silvesterknaller. Stehen hier überall herum. In der Küche. Im Bücherzimmer. Im Wohnzimmer und im Wintergarten, den sie zu einer Art Gewächshaus umfunktioniert hat.
Ich bleibe neben dem duftenden Blumenwahnsinn stehen, um in der Tasche nach meinem Handy zu suchen. Aus dem Augenwinkel beobachte ich, wie meine Mutter ein heruntergefallenes Blütenblatt von der Tischplatte nimmt und nervös zwischen ihren Fingerspitzen rollt. Dabei sieht sie mich abwartend an, als würde sie hoffen, dass ich doch noch mal nach oben gehe und mich umziehe. Was ich natürlich nicht tun werde. Ich sehe die Welt einfach weniger bedrohlich als meine Mutter.
Als ich mein Handy herausgefischt habe, gucke ich aufs Display. Es ist kurz vor halb acht. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange und erkläre: »Ich muss los.«
»Und was ist mit deinen Haaren? Willst du dir nicht lieber einen Pferdeschwanz machen? Du siehst so wild aus.«
»Ist doch gut«, sage ich.
Meine Mutter lächelt kläglich, als befürchte sie, dass die Leute mich gleich in der Einrichtung behalten und mit Elektroschocks behandeln würden, bis ich nur noch Pudding im Kopf habe. »Na ja. Du musst es ja wissen.« Sie schielt hinüber zur angelehnten Arbeitszimmertür.
Um diese Uhrzeit sitzt mein Vater meistens schon seit zwei Stunden hinter seinem Schreibtisch und checkt Mails, bevor er in sein Büro aufbricht. Im Gegensatz zu meiner Mutter würde er nicht mal merken, wenn ich im Schlafanzug und in Puschen losziehe. Trotzdem scheint sie zu hoffen, dass er jetzt da rauskommt und ein Machtwort spricht, weil ich so nicht am ersten Tag bei meiner Praktikumsstelle auftauchen kann. Und als hätte sie telepathische Fähigkeiten, geht die Arbeitszimmertür auf, und er kommt heraus. Frisch rasiert, im Anzug und mit Augenringen bis zu den Knien.
»Guten Morgen, meine Hübschen!«
Mein Vater ist der Prototyp eines Staatsanwalts. Total überarbeitet und nonstop mit seinen Fällen beschäftigt. Und meine Mutter ist der Prototyp einer Staatsanwaltsfrau, die nach der Hochzeit Hausfrau geworden ist, um ihm zauberhafte Kinder zu gebären und ein anheimelndes Zuhause zu bescheren.
Sie legt die Handflächen aneinander und fleht: »Bernhard, bitte sag Franziska, dass sie so nicht das Haus verlassen kann.«
»Du siehst hinreißend aus.« Er gibt mir einen Kuss auf die Stirn und geht weiter in die Küche. So, als hätte er meine Mutter nicht gehört. Über die Schulter ruft er: »Heute fängt Nelli bei uns in der Abteilung ihr Praktikum an, was?«
»Ja, sie ist schon ziemlich aufgeregt. Sie hofft, dass sie gleich einen heftigen Fall bearbeiten kann, um möglichst …«, lege ich los.
Weiter komme ich allerdings nicht, weil meine Mutter schon wieder dazwischenredet. »Franziska fängt heute auch ihr Praktikum an!« Sie läuft hinter meinem Vater her in die Küche. »Zwei Wochen wird sie in einer psychiatrischen Klinik für Kinder und Jugendliche verbringen. Sie sollte sich etwas von ihnen abheben, damit klar ist, dass sie die Praktikantin ist.«
Ich kann nicht verstehen, was mein Vater sagt, weil in diesem Moment die Espressomaschine losbrummt. Seitdem meine Schwester Sina, die gerade ihr Abitur gemacht hat, mehr oder weniger bei ihrem Freund Noah eingezogen ist, richtet sich die geballte Aufmerksamkeit meiner Mutter auf mich. Manchmal kommt es mir so vor, als würde sie sich regelrecht an mich klammern, damit ihr der Lebenssinn nicht verloren geht. Das ist ziemlich belastend, weil ich sie ständig wegstoßen muss, obwohl ich sie liebe.
Mein Ausweg heißt: Australien!
Bevor die Espressomaschine wieder verstummt, schleiche ich zur Haustür, ziehe sie auf und lasse sie hinter mir leise ins Schloss klicken. Mein Klassiker. Um zu entkommen, bleibt mir oft nichts anderes übrig, als mich wegzuschleichen.
Vor mir erstreckt sich unser Vorgarten mit dem gemähten Rasen, den kugeligen Buchsbäumen und gepflegten Rabatten. Obwohl das alles hübsch aussieht, bin ich von dieser Gleichförmigkeit genervt. Nichts darf hier wachsen, wie es will. Alles muss in Form gebracht werden. Das gilt auch für die Nachbargärten in unserem Viertel, in dem sich ein Wohnhaus neben das andere reiht.
Ich atme tief durch und krieche unter den beiden Küchenfenstern entlang bis zur Garage. Ich stemme das Tor hoch und schiebe schnell den einzigen zerdellten Gegenstand in unserem Besitz raus auf die Straße: die an mich vererbte Vespa meiner Schwester. Bevor meine Mutter merkt, dass ich ihr entkommen bin, setze ich meinen Helm auf und brause die menschenleere Straße hinunter.
Das Klinikgebäude liegt einmal quer durch die Stadt, mitten in einem Park, in dem riesige Rhododendronbüsche wachsen, die mit pinken Blüten verziert sind. Eine lange Lindenallee führt von der Straße auf das Herrenhaus mit den Säulen zu, von dem an einigen Stellen der Putz abblättert. Nebelschwaden ziehen dicht über die Wiesen dahin und bleiben wie glitzernde Zuckerwatte zwischen den Stämmen der Linden hängen. Alles sieht verwunschen und verwildert aus. Alles darf wachsen, wie es will. Hier bin ich richtig! Ehrlich! Ich komme mir vor wie Alice im Wunderland.
Dieser Ort ist ziemlich romantisch. Ideal für verträumte Spaziergänge mit einem Jungen, der Sinn fürs Schöne hat. Ich kenne nur keinen. Ehrlich. Die Jungs aus meinem Jahrgang zocken lieber an der Xbox, als mit einem Mädchen was allein zu machen. Kaum jemand ist weiter von der Romantik entfernt als die Jugendlichen dort in dieser Klinik und ich. Vielleicht hat meine Mutter recht: Ich gehöre mehr zu denen, als mir klar ist.
Langsam rolle ich unter den Linden hindurch, die sich mit ihren Zweigen über mir umarmen. Ihre Schatten streifen über mich, unterbrochen von hellen Lichtreflexen. Die Sonne brennt vom Himmel herunter und mir ist viel zu warm in meiner übergroßen schwarzen Kapuzenjacke. Warum habe ich nicht doch einen Sommerrock mit Top angezogen? Aus Bockigkeit? Um mir und meiner Mutter zu beweisen, dass ich selbst am besten weiß, was gut für mich ist?
Auf dem Vorplatz steige ich ab, schiebe meine Vespa am Gebäude vorbei und stelle sie dahinter auf dem Parkplatz unter einer hohen Birke ab. Dann gehe ich wieder ums Haus herum, über dessen alter Fassade sich der Efeu rankt und sich mit anderen blühenden Kletterpflanzen ineinander verschlingt. Die stille Schönheit hier ist vollkommen.
Ich ziehe vorne den Reißverschluss auf und steige die helle Steintreppe hinauf zum Eingang. Erst jetzt begreife ich wirklich, dass ich drauf und dran bin, mich in eine fremde Welt hineinzubegeben, die mit meiner nichts zu tun hat. Die Jugendlichen und Kinder, die hier untergebracht sind, sind anders. Leide ich unter Selbstüberschätzung, dass ich einfach so in ihr Leben eindringe? Ein Praktikum als Kabelträgerin beim Fernsehen wäre vermutlich normaler gewesen.
In meiner Umhängetasche piepst mein Handy. Ich ziehe es heraus und schalte den Ton ab. Eine Nachricht von Nelli. »Viel Spaß bei den Durchgeknallten, sweet-crazy Miss Franziska!«
Ich grinse und tippe zurück. »Dir auch viel Spaß. Bin gerade angekommen.«
Irgendwie tut es gut, dass meine beste Freundin in Gedanken bei mir ist, obwohl sie nicht versteht, warum ich ausgerechnet in dieser Klinik mein Praktikum machen will. Gerade kommt es mir selbst so vor, als hätte ich mich freiwillig zu einer Reise in eine fremde Galaxie gemeldet, ohne darüber nachzudenken, was das für mich in Wahrheit bedeuten wird. Ich werde Dinge sehen und erleben, die jenseits meines gut kontrollierten Lebens liegen. Fürchte ich. Hoffe ich.
Bevor ich die Glastür aufziehen kann, wird sie schon von innen aufgedrückt. Durch die Scheibe sehe ich eine rundliche Krankenschwester in strahlend weißem Kittel. Ich trete zur Seite, damit sie die Tür richtig aufmachen kann.
»Guten Morgen. Du bist sicher Franziska, unsere neue Praktikantin.« Sie reicht mir mit hochgezogenen Augenbrauen die Hand. »Komm rein. Ich bin Schwester Maggie.« Ihr Scan-Blick gleitet an mir herunter bis zu meinen Vans, dann wieder rauf. Ich meine, ein leichtes Kopfschütteln zu bemerken. Hat sie etwas gegen mein saloppes Outfit? »Folge mir.«
»Danke.«
Wir gehen durch eine kühle Halle. Hinter dem Empfangstresen sitzen zwei Schwestern, die sich leise miteinander unterhalten und nur kurz den Blick heben, als wir vorbeilaufen. Dann gehen wir rechts einen Gang hinunter, von dem aus der riesige Park mit seinen Hecken und Rhododendren bis zur Lindenallee zu überblicken ist. Weiter hinten tuckert ein Gärtner auf einem roten Rasenmäher rund um eine gewaltige Eiche, an deren Ast eine einsame Schaukel baumelt. Und noch weiter hinten meine ich das Glitzern eines Sees zu erkennen, in dessen Wasseroberfläche die Sonne reflektiert. Meine Gummisohlen quietschen über den Linoleumboden, was mir einigermaßen peinlich ist. Ich gebe alles, um das Quietschen zu vermeiden, und trippele auf Zehenspitzen hinter Schwester Maggie her. Ziemlich anstrengendes Unterfangen. Der Gang scheint endlos zu sein. Eine Zimmertür reiht sich an die nächste.
Schwester Maggie redet, ohne sich zu mir umzudrehen. »In diesem Trakt sind ein Teil der Patientenzimmer und das Büro von unserem Chefarzt Doktor Weinberg untergebracht. Ihn wirst du später noch kennenlernen. Am Ende des Ganges ist der Aufenthaltsraum, wo die Patienten zwischen ihren Behandlungen fernsehen, Kicker spielen und sich austauschen können. Und hier …« Sie zieht die vorletzte Tür auf. »Und hier ist das Schwesternzimmer.«
»Aha.« Ich trete hinter ihr in einen hellen Raum ein, in dem sich drei Schreibtische befinden. Entlang der Wände stehen Metallschränke mit Etiketten auf den Türen. »Akten«, lese ich dort zum Beispiel, »Medikamente«, »Spritzen« und so weiter. Unter dem Fenster steht eine Liege.
»Hier ist dein Spind.« Sie zieht eine Schranktür auf und reicht mir einen Bügel. »Dir ist sicherlich warm. Wenn du also deine Jacke aufhängen möchtest?« Sie sagt es so, als würde sie keinen Widerspruch dulden. Ich kann froh sein, wenn sie mir keinen frisch gestärkten Kittel gibt, damit ich ordentlich gekleidet bin. »Du darfst allerdings nicht den Schlüssel verlieren. Wir haben nur den einen.«
»Okay.« Ich greife nach dem Bügel. »Danke.«
Jetzt stehe ich in T-Shirt und Leggings da und zupfe nervös an meinem zu kurzen Saum herum. Hier drinnen sieht alles so adrett aus, dass es definitiv eine bessere Idee gewesen wäre, mich etwas weniger leger anzuziehen. KönnendieLeutehierja nicht wissen, dass ich verbissen gegen die gut gemeinten Ratschläge meiner Mutter ankämpfe, in dem Versuch, ein abgründiges Leben zu führen.
»Gut.« Schwester Maggie atmet ein und über ihr Gesicht huscht ein Lächeln. »Die Schwestern und Therapeuten sind gerade mit unserem Chefarzt auf Visite. Danach finden diverse Therapien statt. Einzelsitzungen. Beschäftigungstherapie, Musiktherapie, Physiotherapie und Gymnastik. Außerdem Themenzentrierte Interaktion und vor dem Mittagessen Autogenes Training. Danach hast du eine halbe Stunde Pause. Ich bin deine Ansprechpartnerin für alle Fragen, die aufkommen sollten. Außerdem wirst du von der Klinikleitung dazu aufgefordert, dich nicht mit den Patienten anzufreunden. Zwischen euch soll keine zu enge Bindung entstehen. Du wirst in zwei Wochen wieder gehen. Von daher …«
Ich nicke. »Verstehe.« Kein Problem für mich. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, mich mit einem der Patienten anzufreunden. Was sollte uns verbinden, mal abgesehen von der fehlenden Romantik im Leben? Ich bin da, um zu helfen, denke ich. Aber gerade bin ich mir nicht mal sicher, ob ich das überhaupt kann. Als ich Schwester Maggie meinen ausgefüllten Fragebogen überreiche, ist aus dem Flur Geschrei zu hören.
»Entschuldige mich einen Augenblick.« Sie eilt an mir vorbei auf den Gang.
Ich folge ihr bis zum Türrahmen und blinzele um die Ecke. Ein spindeldürres Mädchen sitzt in Röhrenjeans und T-Shirt auf dem Boden und reißt sich aufgebracht an den langen Haaren, als hätte sich ein riesiger Kaugummiklumpen darin verfangen. Eine andere Schwester versucht bereits, sie zu beruhigen, während im Hintergrund ein paar verschreckte Mädchen dicht beieinanderstehen. »Es ist alles gut, Natascha.«
Doch Natascha wird immer wilder. Gemeinsam ziehen SchwesterMaggie und die andere Schwester schließlich das um sich schlagende Mädchen hoch und bringen es zurück in eins der Zimmer. Alles klar. Schätze, ich muss mir ein dickes Fell zulegen, wenn ich hier nicht selbst die Nerven verlieren will.
Ich ziehe mich ins Schwesternzimmer zurück und warte mit vor der Brust verschränkten Armen auf Schwester Maggie. Plötzlich ist mir kalt. Noch nie habe ich mich so fehl am Platz gefühlt wie in diesem Augenblick. Offenbar war es eine dumme Idee, hierherzukommen. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich das den Leuten an? Ich tauche hier auf und bilde mir ein, dass ich heilende Kräfte habe. Nur, weil meine große Schwester irgendwann mal meinte, dass ich gut zuhören und Ratschläge geben kann. Dabei habe ich in Wahrheit gar keine Ahnung von den Problemen, die diese Welt so mit sich bringen kann.
»Hey, alles klar?« Schwester Maggie kommt wieder rein und streicht sich eine lose Haarsträhne hinters Ohr.
»Ja, klar.« Leider klingt es wie »überhaupt nicht«.
»Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Die Mädchen und Jungen hier haben zum Teil schwer mit sich zu kämpfen. Sie verlieren schnell die Fassung. Sie haben oft schlimme Dinge erlebt. Entweder in Wirklichkeit oder in ihrer Fantasie.«
»In ihrer Fantasie?« Ich lasse die Arme hängen. Was soll das denn heißen?
Schwester Maggie verschwindet hinter einem der Schreibtische und sieht die Aktenstapel durch. Schließlich zieht sie eine rote Mappe hervor und macht ein paar Notizen. Dann klappt sie die Mappe wieder zu und sieht mich von ihrem Platz aus an. »Sie leiden an Depressionen oder Angstzuständen. Und manche von ihnen haben Schwierigkeiten, die Realität von ihrer Einbildung zu unterscheiden. Sie wissen nicht, was wahr und was unwahr ist. Sie deuten die Dinge falsch. Sie fühlen sich schnell eingeschüchtert oder bedroht.«
»Aha.« Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht mal die Hälfte von dem, was Schwester Maggie mir da gerade erklärt. Ich frage vorsichtig: »Und wie äußert sich das konkret?«
Sie steht von ihrem Stuhl auf und zuckt mit den Schultern. »Manche von ihnen greifen dich plötzlich an, weil du versehentlich eine ihrer unsichtbaren Grenzen überschritten hast. Andere geraten in Panik oder versuchen, sich selbst etwas anzutun, um den inneren Schmerz loszuwerden.«
»Aha.«
»Wir haben aber auch traumatisierte Jugendliche hier, die sich in einem permanent apathischen Zustand befinden und für niemanden zu erreichen sind. Sie sind vollkommen in sich versunken. Dieses Verhalten ist eine automatisch antrainierte Schutzreaktion, um erneute Traumatisierungen zu vermeiden.«
»Wodurch? Ich meine, hier kann ihnen doch nichts mehr passieren.« Mir schwirrt der Kopf. Das alles klingt nach einem heftigen Albtraum. Nicht zu vergleichen mit meinen Schwierigkeiten, mir meine überfürsorgliche Mutter vom Leib zu halten.
»Winzige Schlüsselreize wie Gerüche oder Geräusche, die an das Schockerlebnis erinnern, können bei ihnen für einen Flashback sorgen und ihr Trauma noch verstärken.«
»Okay.«
»Bei bestimmten Patienten solltest du also besser vorsichtig sein. Du wirst aber schnell herausfinden, welche das sind.«
»Prima …« Ich versuche ein Lächeln, obwohl mir gar nicht danach zumute ist. Ich hätte nie gedacht, dass es Jugendliche gibt, die so heftig von ihrer Psyche gequält werden. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich gedacht habe. Schätze, Nelli hat erschreckenderweise recht: Ich wollte nichts Durchschnittliches. Sondern etwas Abenteuerliches, was sich sonst keiner zutraut.
Schwester Maggie marschiert an mir vorbei, wieder hinaus in den Flur. »Na, dann komm. Du kriegst einen exklusiven Rundgang von mir spendiert. Solange die Visite läuft, ist es relativ ruhig, weil die Patienten eigentlich alle in ihren Zimmern bleiben sollen.«
»Eigentlich?«
Ich laufe hinter ihr her, den Gang hinunter, an der Medikamentenausgabe vorbei. Selten habe ich einen Menschen getroffen, der so selbstbewusst und konzentriert ist. Aber vermutlich muss man so sein, wenn man andere Menschen vor dem Durchdrehen bewahren will.
Von der Empfangshalle geht es eine breite Treppe hinauf. Schwester Maggie redet ununterbrochen, als würde sie mir den Klinikkomplex verkaufen wollen. »In der ersten Etage befinden sich unser frisch renovierter Raum für Autogenes Training und der Gymnastikraum für unsere Patientinnen mit Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie, in dem ihnen ein gesundes Körpergefühl vermittelt werden soll. Und direkt gegenüber ist der helle Speisesaal mit seinem fantastischen Panoramablick …«
… über den in der Sonne glitzernden See, der sich bis in die Ewigkeit hinzuziehen scheint.
»Boah!«, entfährt es mir.
Schwester Maggie und ich bleiben zwischen zwei langen Tischen stehen und blicken durch das riesige Panoramafenster. Der See sieht aus, als wäre er aus Quecksilber, und rund um sein Ufer wehen schillernde Weiden, deren lange Äste wie feine Fangarme um sich greifen, als wollten sie das Sonnenlicht einsammeln und sich davon ernähren. Darüber steht der wolkenlos blaue Himmel, der die Unendlichkeit preisgibt, in der wir winzigen Kreaturen unser eigenartiges Dasein fristen.
»Nicht wahr? Das ist ein Ausblick! Unglaublich. So viel Raum. So viel Ruhe. So viel Heiligkeit. Am Abend komme ich manchmal hierher. Dann ist es hier oben ganz still. Der Speisesaal ist leer und dort hinten am Horizont geht langsam und leuchtend rot die Sonne unter und versinkt schließlich im See.«
Schwester Maggie seufzt, und ich denke, dass ich sie sehr mag. Sie ist zwar irgendwie streng, aber gleichzeitig hat sie definitiv einen Sinn fürs Schöne. Außerdem strahlt sie eine seltsame Ruhe aus, sodass man sich in ihrer Gegenwart einfach wohlfühlt. Wir stehen noch eine Weile still da. Was komisch ist. Für gewöhnlich stehe ich nie mit irgendwelchen Menschen still da. Schon gar nicht mit fremden. Aber für Schwester Maggie scheint das normal.
Schließlich kickt sie mich mit dem Ellenbogen an. »Na los. Wir gehen runter zu den Physiotherapieräumen und der Schwimmhalle, wo unser unnahbarster Fall gerade seine Bahnen schwimmt.«
Drei
Der vierte Tag meines neuen Lebens
»Siehst du ihn da unten?« Schwester Maggie zeigt auf einen hellrosa Schatten in Badehose, der unter Wasser dicht über den gekachelten Boden des Schwimmbeckens hinweggleitet. »Das ist Tucker. Er hat eine Ausnahmegenehmigung.«
»Er hat was?« Wir stehen am Beckenrand und gucken in das blaue Wasser hinunter. Inzwischen fühle ich mich nicht mehr ganz so fehl am Platz, was eindeutig an der offenen Art von Schwester Maggie liegt.
»Eine Ausnahmegenehmigung.« Sie sieht mich vielsagend an. »Unser Tucker ist der Einzige, der während der Visite nicht auf seinem Zimmer sein muss.«
»Muss er nicht?« Mit den Augen folge ich dem schwimmenden Jungen bis zum Ende des Beckens. Er taucht kurz auf, holt Luft und verschwindet wieder unter Wasser.
»Er schwimmt fast den ganzen Tag.« Schwester Maggie lächelt und ruft dann hinunter ins Becken: »Tucker! Hier ist jemand, der dich gerne kennenlernen möchte.«
Möchte ich diesen Tucker gerne kennenlernen? Ich weiß nichts von ihm, außer, dass er der unnahbarste Fall der Klinik ist und fast den ganzen Tag schwimmt. Von mir aus muss er sich nicht von uns ablenken lassen. Ich persönlich stehe nicht so auf Wasser. Um ehrlich zu sein: Ich kann gar nicht schwimmen. Als ich fünf Jahre alt war, wollte mein Vater es mir im Sommerurlaub beibringen. Aber ich habe wild um mich getreten und geschlagen und ihn aus Versehen mit voller Wucht zwischen den Beinen getroffen. Da hat er sofort aufgegeben und zu meiner Mutter gemeint: »Diesem widerspenstigen Mädchen das Schwimmen beizubringen, ist lebensgefährlich.«
Mein Schwimmlehrer in der Schule hat mich sogar freiwillig am Beckenrand sitzen lassen, weil er mein Angstgeschrei nicht mehr ertragen konnte. Seitdem hat es niemand mehr versucht.
Tucker scheint nichts zu hören. Mit gleichmäßigen Zügen durchquert er das Becken, taucht am Rand auf, holt Luft und taucht wieder ab. Wie soll ich ihn überhauptkennenlernen,wennernonstopunterWasser ist?