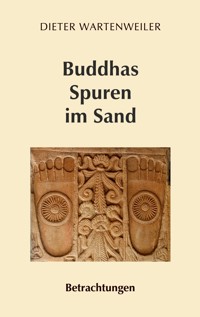8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der unerwartete Aufenthalt in der weissen Klause verändert das Leben des Erzählers innerhalb weniger Tage. In der Begegnung mit dem Eremiten Jeduschin macht er tiefe Erfahrungen und lernt, grundsätzliche Lebensaspekte neu zu verstehen. Von zwei Frauen herausgefordert kommen seine Erkenntnisse auf den Prüfstand der Realität, was ihn veranlasst, sich den Lebenskräften auch in ihrer konkreten Gestalt hinzugeben. In allem wirkt die Kraft und Spiritualität dieses besonderen Ortes. Eine Erzählung voller Weisheit und stiller Menschlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Viele lange Jahre war ich ein Sucher gewesen, aber eines Tages hatte ich die Suche aufgegeben. Es war die Suche nach tiefer spiritueller Wahrheit, nach einer Erkenntnis, welche das übliche Wissen übersteigt. Vielleicht war es eine Suche nach der „Wahrheit“ schlechthin – was immer das sei. Aber gewonnen hatte ich sie auf diesem langen Wege nicht, wenngleich es natürlich Momente gab, die etwas Befreiendes an sich hatten. Aber diese Ereignisse verflogen wieder, und ich fand mich erneut in den Mühen des suchenden Menschen. Und weil eben diese Mühen kein Ende zu nehmen schienen, ließ ich es irgendwann bleiben, und ich nahm mir vor, einfach nur noch meinen Weg zu gehen, ohne die Besonderheit, die allem Suchen anhaftet. Dieser nun freie Weg gestaltete sich oft in Form von Wanderungen durch unbekannte Gegenden – vielfach auch im Süden – wo ich mich spontan wohl fühlte im hellen Licht, in der Wärme des Daseins, und gelegentlich im Wasser, wenn es denn am Wege lag.
Auf einer meiner Wanderungen in südlichen Gefilden – es war vorsommerlich warm und das Meer glänzte durch die Büsche von weit her – da bemerkte ich etwas abseits des Weges ein Gebäude, das in heller Farbe durch die Bäume schimmerte. Solche Bauten sind auf Wanderungen immer wieder anzutreffen, und meistens geht man an ihnen vorbei. Es mag ein Stall sein, oder ein zum Ferienhaus umgebautes kleines Anwesen, und man beachtet es nicht weiter. Aber dieses leuchtende Gemäuer zog mich in unerklärlicher Weise an, und so trat ich näher, wenngleich ich niemanden stören wollte, denn es war mir ein Anliegen, die Privatsphäre der Menschen zu achten. Aber in diesem besonderen Falle war abzuwägen, was nun wichtiger sei – die Ungestörtheit der Menschen dort, oder mein tiefes Bedürfnis zu sehen, was denn hier sei. Ich entschied mich für einen Kompromiss: mich sorgfältig und unauffällig zu nähern, um zu erkennen, was mich anzog.
Zu meinem Erstaunen war es eine kleine Kirche, die weiß in den Bäumen stand. Der Hof davor war erstaunlich gut gepflegt für die verlassene Gegend, in die mich mein Weg diesmal geführt hatte. Neben der Kapelle stand ein Haus, und ich traute mich kaum näherzutreten, da die Anlage offenbar bewohnt war. Nun ist es aber so, das Kapellen auch einen gewissen öffentlichen Charakter haben, und es war nicht eindeutig, ob es sich hier um ein privates Grundstück handelte, oder um eine Kapelle am Wegrand, für die vielleicht jemand zuständig war. Weil der Ort weiterhin eine merkwürdige Anziehung auf mich ausübte, trat ich vorsichtig in den Hof. Dabei entwickelte sich eine eigenartige Gefühlslage, so wie sie einem entgegentritt, wenn etwas Unbestimmtes bevorsteht. Es gab da eine große Stille – nichts war zu hören außer dem Zirpen einiger Grillen. Und diese Stille war erfüllt von etwas, das ich nicht benennen konnte – irgendwie erschien sie mir angespannt, aber das mochte mit meiner eigenen Scheu und Erwartung zu tun haben. So legte ich dieses Gefühl wieder beiseite und ging zur Kapelle. Die Türe stand offen, und ich erlaubte mir auch einzutreten.
Die Kapelle bestand aus einfach gehauenen Natursteinen und war von harmonischer Proportion, vorne mit einer runden Apsis. Zu meinem Erstaunen war sie leer, bis auf eine Schale, die in der Apsis stand, sowie einem sorgfältig zusammengelegten Tuch am Boden. Der Raum war von einem wunderbaren Licht erfüllt, das sein Zentrum vorne in dieser Apsis zu haben schien. Von keinem der kleinen Fenster gelangte das Licht aber direkt dorthin, und so blieb mir rätselhaft, was es mit dieser Helle auf sich hatte.
Ein sonderbares Gefühl erfasste mich, das kaum zu beschreiben ist. Ich sah die kleine Kirche auf andere Weise, als ich zu sehen gewohnt war; da war eine Präsenz, ein tiefer Friede und Gehalt in allem, doch dieses Gefühl ging nicht von etwas Bestimmtem aus, nicht von der Apsis, nicht von den Fenstern mit den teilweise farbigen Gläsern, und auch nicht vom Eingang unter dem schön gehauenen Torbogen. Diese Präsenz war nicht lokalisiert, und es war mir, als würden das Licht, die farbigen Fenster und der Torbogen mit mir selbst zusammenfallen. Es war, als wäre ich selbst das Licht, die Fenster, die Apsis und der Torbogen, und es herrschte eine unglaubliche Stille. Diese Atmosphäre durchflutete mich tief.
Die Stimmung in diesem Raum war, als wäre jemand da, den ich doch nicht sehen konnte. Die Kapelle war leer und voll zugleich, aber im Grunde konnte ich nicht einordnen, was da geschah. Es war nicht zu erklären, doch das war auch nicht notwendig. Etwas ereignete sich mit mir an diesem Ort, das ich noch nie erlebt hatte. So viel Intensität kannte ich nicht. Nachdem ich einige Zeit so verharrte – ich weiß nicht wie lange; es können eine Stunde oder auch nur fünf Minuten gewesen sein – da ließ die Stimmung mit ihrem überwältigenden Eindruck etwas nach. Schließlich wandte ich mich dem Ausgang zu, und ich erschrak ziemlich, als ich da einen Mann im Türrahmen stehen sah. Ich hatte niemanden mehr erwartet, und seine stattliche Figur erschien mir abgründig. Er begrüßte mich zu meinem Erstaunen aber auf sehr liebenswürdige Weise. Ich spürte, die Stimmung im Raum hatte auch mit ihm zu tun. So wie ich in der Kapelle etwas erfahren hatte, das meinen Verstand und meine bisherige Welterfahrung überstieg, so erlebte ich diesen Mann als herzlich und mächtig-bedrohlich zugleich, obwohl keine Gefahr von ihm ausging. Es war vielmehr eine Kraft, der ich mich nicht gewachsen fühlte. Wer mochte nur dieser Mensch sein?
Nach der Atmosphäre in der Kapelle erschütterte mich dieser Mann nun nochmals in meinen Grundfesten – und es geschah, ohne dass er sichtbar etwas tat. Da war eine Kraft, wie sie mir bisher noch in keinem Menschen begegnet war. Ich fühlte, dass ich diesen Menschen zugleich liebte und fürchtete, bevor ich ihn kannte, ja bevor ich auch nur einige Worte mit ihm gewechselt hatte. „Du bist hier in einer besonderen Kapelle“, sagte er zu mir, ohne mich explizit zu begrüßen, „es ist ein Ort, der niemandem geweiht ist. Hier ist einfach das, was ‚alles‘ ist.“ Daraufhin schwieg er. Er schien keine Antwort zu erwarten – es war einfach eine Feststellung. Was ich damit machen würde, war vollständig mir überlassen. In diesem Moment fühlte ich zweierlei: die eine Seite wollte sich entschuldigen, dass ich einfach in das Anwesen eingedrungen war und die Kapelle betreten hatte, und die andere Seite fühlte sich in Resonanz mit diesem Menschen und hielt es für völlig unangebracht, auf konventionelle Art zu reagieren. Lange schwieg ich, und schließlich sagte ich: „In dieser Kapelle habe ich ein besonderes Licht und eine große Kraft wahrgenommen. Dasselbe spüre ich auch bei Ihnen, und ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Ich bin einfach erschüttert.“ Er blickte mich wohlwollend an und meinte, ich sollte ihn doch per Du ansprechen, sein Name wäre Jeduschin, und es gäbe an diesem Ort und auch an ähnlichen Orten keine Unterschiede zwischen den Menschen, denn sie würden alle aus der gleichen Quelle schöpfen. Etwas verlegen nannte ich ihm meinen Namen Micha und wusste nicht, was ich weiter sagen sollte.
Jeduschin führte mich zu einer Steinbank auf dem Hof, die hinter einem grob behauenen Steintisch stand, und mit einer Handbewegung bedeutete er mir, mich niederzusetzen. Lange schwieg er, und ich mit ihm. Dabei ließen wir den Blick über die Landschaft gleiten, die sich still vor uns ausbreitete. Aus der Ferne waren Klänge zu hören, wie Glockenklänge – vielleicht stammten sie von einem Metallstück, das Kinder irgendwo schlugen, oder vielleicht waren es auch einfach die Bienen, die einen derartigen Klang erzeugten. Wie alles in dieser Klause erschien es mir seltsam und zugleich bedeutungsvoll. Schließlich fragte ich: „Lebst du alleine hier, bist du ein Einsiedler?“ Er schwieg etwas und antwortete dann: „Einsiedler sind Leute, die sich für eine längere Zeit, ja vielleicht für ihr ganzes Leben zurückgezogen haben. Aber aus was ziehen sie sich zurück?“ Verwundert schaute ich ihn an, und dann glitt mein Blick wieder über die Landschaft, die in den schönsten Farben leuchtete. Der Himmel war blau, und die Luft des frühen Sommers flirrte schon über den Pflanzen und dem Gras, das sich in erster Dürre neigte. Es war mir, als käme seine Antwort aus der Landschaft um uns her. „Das Einzige, woraus Einsiedler sich zurückziehen können, sind die Ablenkungen eines unablässig tätigen Lebens. Eines Lebens, das stets auf etwas ausgerichtet ist, das Ziele verfolgt, die bei näherem Zusehen stets selbst gemacht sind und nichts mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Ja sie lenken vom Leben ab, das gerade stattfindet. Einsiedler scheinen auf diese Ablenkungen zu verzichten.“
Wieder schwieg er, und wieder glitt mein Blick von ihm weg in die Gegend hinaus. Die Eigenart dieses Menschen schien zu sein, nur wenige Dinge zu sagen, und dann öffnete sich der Raum wieder – als ob genug gesagt wäre. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er mit dieser Redeweise etwas bezweckte, etwa dass er mich zum Nachdenken anregen wollte, sondern es war einfach er selbst, der sich so zeigte, wie er war. Da er vielleicht auch lange Zeit ohne Kontakt zu anderen lebte, mochte er nicht gewohnt sein, längere Zeit zu sprechen. Auch schien mir, dass ihm das Reden keine Freude machte. Er war einfach mir zugewandt und sprach, wie es sich ergab, oder eher noch dachte er laut nach. Ja eigentlich konnte man nicht einmal von Denken sprechen. Vielleicht war es einfach das Leben selbst, das sich in dieser Weise äußerte. Sein Leben – oder das Leben schlechthin, das wir alle sind.
Im Zuge solcher Erwägungen kam mir die Idee, dass das Entscheidende am Einsiedler vielleicht gar nicht das Alleinleben war, sondern vielmehr ein tiefes Schweigen, das den Belangen der Welt nicht verpflichtet ist, und ein natürliches Leben, das sich in nichts verzettelt. Jeduschin hätte auch mit anderen zusammen wohnen können, und es wäre wohl nicht anders gewesen. Es wird ja von manchen Einsiedlern berichtet, die andere Menschen anzogen, und um die sich später ganze Ortschaften bildeten. Dann waren sie zwar keine Einsiedler mehr, aber im Geiste mussten sie doch unverändert geblieben sein, denn sonst wären die Menschen wohl wieder von ihnen weggegangen.
So war es aber bei Jeduschin nicht, jedenfalls nicht nach meinem ersten Eindruck. Er hatte keine Leute um sich herum – so ruhig war es an diesem Ort. Ich war der Einzige, der gekommen war und mit ihm sprach. Oder war es umgekehrt – sprach er mit mir? „Die Frage ist nicht, auf was man im Einzelnen verzichtet, sondern was man hat“, fügte er seinen vorherigen Erwägungen an, „und weißt du, ich habe hier alles.“ Nach einer Pause ergänzte er: „Hier ist die ganze Welt, und hier ist das ganze Leben. Oder glaubst du, dass an einem anderen Ort ‚mehr Welt’ sei, oder ‚mehr Leben’? Wichtig ist zu sehen, dass das Leben immer ist, und dass es überall ist. Und dass es nicht an einem Ort mehr ist als an einem anderen. Wenn das klar geworden ist, brauchst du nirgends mehr hinzugehen.“
Nun war ich schon viel gereist, hatte lange gesucht, um herauszufinden, wer ich bin, was das Leben ist, wie ich große Spiritualität erlangen könnte, und nun sagte mir dieser Mann, der nicht einmal ein Einsiedler sein wollte, dass ich nirgends hinzugehen brauchte. Allerdings war ich auf meiner Wanderung absichtslos an diesen Ort gekommen, denn ich hatte ja aufgehört, etwas Bestimmtes zu suchen. Es schien mir nun, dass der Unterschied zwischen dem Mann und mir vielleicht gar nicht so groß war – auch er suchte nichts mehr und war damit offensichtlich im Reinen.
„Viele Menschen sind auf einer inneren Suche und wissen dabei oft nicht, was sie suchen“, führte er weiter aus, „und manchmal hören sie einfach damit auf.“ Es war mir dabei, als würde er sich auf meine innere Lage beziehen. Vielleicht war es auch einfach ein Feld, das sich zwischen uns ausbreitete, wie die Fäden eines leichten Spinnennetzes, das ihn meine Situation spüren ließ und etwas Gemeinsamens zwischen uns in der Schwebe hielt. Und in diesem Feld gäbe es nichts zu erraten, sondern es wäre einfach Rede und Gegenrede, die sich darin frei entfalten.
„Also bist du kein Einsiedler“, stellte ich nun fest. – „Keiner, wie man ihn sich vorstellen mag“, bestätigte Jeduschin. „Ich lebe zwar oft allein, aber ich bin nie allein. Das ist vielleicht das Besondere an meiner Lebensform. Viele Menschen sind allein, obwohl sie mit anderen Menschen zusammen sind, ja täglich zusammenleben oder miteinander arbeiten. Und andere sind eben nicht allein, trotzdem sie wenige Menschen sehen. Es ist nicht eine Frage der Anzahl Personen, die zusammen sind, und auch nicht eine solche der Intensität oder gar der Tiefe des Austausches. Im Grund ist es viel einfacher. Es geht nur darum, ob du wirklich da bist.“
Jeduschin war offenbar nicht so schweigsam, wie ich zunächst dachte, und nun sprach er mich direkt an. Darauf erwiderte ich: „Aber ich bin doch da.“ – „Ja, so siehst du das“, meinte er daraufhin, „übrigens wie die meisten Menschen. Sie glauben da zu sein, wenn sie sich im Äußeren wahrnehmen.“ Wieder hörte er auf zu sprechen, und wieder war ich genötigt, mir Gedanken zum Unausgesprochenen zu machen. „Also im Umkehrschluss: ich bin im Äußeren da und deshalb nicht wirklich da?“ fragte ich ihn. „Nicht deshalb, sondern überhaupt“, meinte er dazu. „Also, ich bin überhaupt nicht da?“ – „Genau“, antwortete er. Eine Bemerkung, die ich als beleidigend hätte empfinden können. Aber etwas hielt mich von einer derartigen Einschätzung zurück. Ich spürte, dass er mir damit etwas sagte; dass er mich auf etwas hinwies, das mit Worten nicht leicht zu benennen war. „Was heißt den ‚da sein’?“, fragte ich ihn. „Genau“, sagte er wieder. Das war zwar keine Antwort auf meine Frage, aber es wirkte, als hätte er einen Nagel in ein hartes Stück Holz eingeschlagen. Sein Wort und der Klang der Stimme verrieten äußerste Präsenz. Kein Zweifel, er war ‚da’. So also fühlte es sich an, da zu sein. Es hatte nichts mit äußerer Selbstwahrnehmung zu tun. Vielmehr schien es eine Lebenshaltung zu sein. Diese mochte auch nicht von ‚Achtsamkeit‘ abhängen, wie ich sie einmal geübt hatte. In einer Gruppe hatten wir uns bemüht, jede Minute, ja jeden Augenblick ‚achtsam’ zu sein und alle Aufgaben bewusst zu erfüllen, doch niemand konnte über längere Zeit so aufmerksam sein. Das war aber nicht, wovon Jeduschin sprach. Viel unmittelbarer war, was mir von Jeduschin in jenem Moment entgegenkam. ‚Genau‘. Ein Schlag. Was wollte ich dazu noch sagen?
Seine Worte und die ganze erste Begegnung mit Jeduschin hinterließen unauslöschliche Spuren in mir. Es war eine Mischung aus Irritation und Bewunderung, aus dem Gefühl, einem Menschen von tiefem Wissen begegnet zu sein. Er verunsicherte mich ebenso, wie er mich forderte, und beides bedingte sich wohl gegenseitig. Damit brachte er mein Selbstverständnis ins Wanken und stieß mich zugleich in eine Wahrnehmung, die mir bisher fremd war. Ich hätte nicht sagen können, dass ich früher genau das gesucht hätte, und doch fühlte ich, dass nur eine solch radikale Infragestellung und Veränderung meiner bisherigen Wahrnehmung zu etwas wirklich Neuem führen konnte. Alles, was ich schon ausprobiert hatte, lag innerhalb meiner bisherigen Weltsicht, und es brachte mich nicht wirklich weiter – und auch nicht an die Grenzen meines Selbst- und Weltbildes. Wie sollte man diesen Rahmen auch mit jenem Verständnis brechen können, das genau für diese Bilder verantwortlich war? Es musste alles von jemandem aufgerüttelt werden, der jenseits davon stand. Was mir jetzt geschah, das passierte mir ‚wider Willen‘ – wider mein bisheriges Denken und meine bisherige Wahrnehmung. Das war schmerzlich. Und zugleich gab es in mir eine Seite, die wusste, dass dies notwendig war. ‚Genau‘.
Ich fühlte, dass das Gespräch beendet war, und ich dachte auch, meine Wanderung jetzt fortzusetzen. Aber in mir sträubte sich zugleich alles, diesen gesegneten Ort zu verlassen. So standen zwei innere Stimmen gegeneinander – die angepasste, die Jeduschin nicht länger stören wollte, und die faszinierte, die nichts lieber mochte, als hier zu bleiben. Als hätte Jeduschin, der in kurzer Zeit gleichermaßen zu meinem Herausforderer und zum meinem Lehrer geworden war, meine Gedanken und auch meinen Zwiespalt wahrgenommen, sagte er kurz: „Es ist spät geworden. Solltest du hierbleiben wollen, hat es im Nebenhaus ein kleines Zimmer, in dem du übernachten kannst.“ Am liebsten hätte ich ihn umarmt, aber mein Respekt untersagte mir dies. So antwortete ich einfach: „Ja, gerne. Wenn ich mich erkenntlich zeigen kann, werde ich morgen bei der Gartenarbeit oder anderen Aufgaben helfen.“ Jeduschin sagte nichts weiter dazu und zeigte mir den Weg zum Eingang seines kleinen Gästehauses. Und dann meinte er: „In einer Stunde gibt es drüben bei mir etwas Einfaches zu essen.“ Ich bedankte mich für das Zimmer und das angebotene Essen, und im Gästehaus legte ich mich ermattet aufs Bett. Etwas verwundert war ich, dass das Bett frisch bereitet war, als würde jemand erwartet – obwohl doch meistens keine Gäste hier zu sein schienen. War Jeduschin einfach immer bereit für das Unerwartete? Aber war es denn noch unerwartet, wenn er sich für einen Eventualfall vorbereitete? Und so hatte ich mich wieder in Gedankengängen verloren, von denen ich doch wusste, dass sie zu nichts führten.
Für kurze Zeit schlief ich ein, und ich war froh, vor der Essenszeit wieder aufgewacht zu sein. Es gab selbstgebackenes Brot und eingelegtes Gemüse, das Jeduschin im Olivenöl aufgewärmt hatte. Zum Nachtisch brachte er einige Feigen, die offensichtlich in seinem Garten wuchsen. Er schien alles zu sein – spiritueller Mensch, Gärtner, Hauswart, Koch, Gastgeber, und wie mir schien, war nichts voneinander getrennt. Die Arbeiten gestaltete und erledigte er scheinbar einfach so, wie sie zu tun waren – ohne Aufsehen, aber mit viel Hingabe.
Lange und ganz traumlos schlief ich nach dem Nachtessen, das wir weitgehend schweigend eingenommen hatten. Nachdem ich an diesem Morgen aufgewacht war und mich hergerichtet hatte, wusste ich nicht, was tun, und ich wollte mich Jeduschin nicht aufdrängen. So ging ich einfach in die Kapelle, die ich am Vortag zuerst betreten hatte, und worin ich mich jetzt aufzuhalten traute. Eigenartigerweise dachte ich, dass sie leer sei – es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass Jeduschin hier sein könnte. Aber genau das war der Fall. Zuerst hatte ich ihn gar nicht bemerkt, denn er saß ganz hinten neben der Eingangstür, doch dann spürte ich seitlich hinter mir eine große Kraft. Als ich mich umdrehte, erschrak ich erneut über die Macht und Kraft, die von diesem Berg eines Mannes ausging. Ich setzte mich dann weiter vorne an die Seitenwand der Kapelle, in der es keine Bänke gab. Vom Boden stieg die Kühle des Morgens auf, und ich fühlte mich auch deshalb nicht sonderlich wohl. Auf was hatte ich mich da nur eingelassen? ‚Es ist nichts als eine Kapelle und ein Mensch‘, sagte mein Verstand zu mir, ‚mach dir keine Sorgen!‘ – ‚Dies ist die ultimative Begegnung deines Lebens, die dein Weltbild zerreißt und dich für immer verändert‘, sagte eine andere Stimme in mir.
Trotz meiner Emotion geschah nichts, und Jeduschin fragte nach einer Weile einfach: „Wollen wir zum Frühstück gehen – ich habe auf dich gewartet.“ Da fiel die vorherige Spannung von mir ab, und ich fühlte mich entlastet. Wir traten ins Freie und ich atmete die frische Luft ein. Das tat mir gut, und wir gingen zusammen zur Küche, wo wir das Frühstück wiederum schweigend einnahmen. Jeduschin schien während des Essens nicht reden zu wollen, und wenn ich eine scheue Frage stellte, überhörte er sie einfach. Nicht unhöflich, nicht zurückweisend. Es war einfach keine Energie da, die hätte antworten können, und so zerrannen auch meine Fragen wie Wasser, das zwischen Fliesen versickert.
Nach dem Morgenessen wollte ich nicht von Jeduschin weggehen. So blieb ich am Tisch sitzen, und auch er machte keine Anstalten, sich zu erheben. Es kam mir vor, als würde er dem Lauf des Lebens einfach allen Raum lassen, sodass geschehen konnte, was wollte. Er förderte nichts, und er hinderte nichts. Aber wahrscheinlich waren das zu viele Überlegungen von mir. Er war einfach da. Und gerade darin lag etwas Besonderes. Er faszinierte mich in seinem Schweigen ebenso wie in der oft rätselhaften Redeweise, die mich herausforderte. In unserem Schweigen kamen mir seine Worte über den Einsiedler wieder in den Sinn, seine Antworten auf meine Frage. Es war eigenartig: unser Gespräch vom Vorabend bestand im Grunde aus Fragen von mir und Antworten von ihm. Und dennoch schien es, dass der Verlauf des Gespräches ganz von ihm bestimmt wurde. In der Art, wie er sich gab, lag eine vollständige Unabhängigkeit. Auch hatte er bisher nie nach mir gefragt, und ich war unsicher darüber, ob er es je tun würde. Er fühlte ja, was ich dachte, und wohl waren ihm meine äußeren Lebensumstände auch nicht wichtig genug, um darüber zu sprechen. Es hätte ja auch nichts an ihnen geändert.
Die Frage nach dem Einsiedler hatte er mir noch nicht umfassend beantwortet, und so dachte ich, dass ich vielleicht mehr erfahren und verstehen würde, wenn ich mich nach dem mönchischen Element erkundigen würde, das er auch irgendwie an sich hatte. Und bevor ich meine Fragen weiter stellen konnte, merkte ich, dass es bei all meinen Erkundigungen im Grunde gar nicht um ihn ging, sondern vielmehr um mich selbst. Mit meinen Fragen wollte ich herausfinden, was es denn eigentlich mit mir und dem Leben allgemein auf sich hatte, und Jeduschin war mir ein guter Spiegel dafür. Natürlich spürte er dies, und vielleicht lag darin der Grund, dass ich mir in der Rolle des Fragenden etwas beschämt vorkam. Aber so war das Verhältnis nun einmal zwischen uns, und ich fragte nun weiter, ob Jeduschin eine Art von Mönch sei. Ob er sich wie die Mönche an etwas hingebe, das grösser sei als er. „Ich bin kein Mönch“, antwortete er mir daraufhin, „selbst wenn ich etwas Mönchisches an mir haben mag.“ Während er sprach, erhob er sich vom Küchentisch und bedeutete mir, mit ihm nach draußen zu kommen. Offenbar fühlte er sich dort wohler als in den Räumen – die Kapelle mochte eine Ausnahme sein. Wir setzten uns wieder an den Steintisch, und sein Blick glitt über die unter uns liegende Landschaft. Es war, als würde er seine Antworten aus der Weite der Landschaft holen, oder aus der Tiefe seiner Seele und seines Lebens.
„Ich gehöre keinem Kloster an, keiner Klostergemeinschaft; nicht einmal einer Religion“, sagte er daraufhin, und dann hing er seinen Gedanken nach. Seine Erwägungen schienen einem inneren Fluss zu folgen, der über ihn hinausging. „Was ist das, ein Mönch? Eine Lebensform? Einer, der sucht?“ fragte er, und ich wusste nicht, ob er von mir eine Antwort erwartete, oder ob die Frage einfach zwischen uns lag und es unwichtig war, wer weiter sprach. Zugleich schien mir, als würde er mich auf etwas hinweisen, das jenseits aller Worte lag. Jeduschin kam mir vor wie ein Mönch ohne Glaubenssystem – als Mensch, der religiös war, und der sich doch nicht an die Inhalte einer bestimmten Religion band. Und es ging mir durch den Kopf, dass es doch überall auf der Welt Mönche gab, unabhängig von einer bestimmten Kultur oder ihrem jeweiligen Glauben. Das Mönchstum scheint eine menschliche Lebensform zu sein, und wenn es auf die Religion letztlich nicht ankommt, so konnte Jeduschin einfach ein Mensch von mönchischem Charakter sein.
Wie ich so neben diesem beeindruckenden Mann saß, durchzog mich eine Ahnung von der Tiefe und Weite des menschlichen Seins, die jedem Menschen zugehören, und doch, ich verstand es nicht. Schwerfällig versuchte ich, das Empfundene in Worte zu fassen: „Mir scheint, ein Mönch ist einer, der sucht, der glaubt – vielleicht an etwas Umfassendes. Von einem inneren Feuer getrieben geht er einen Weg, den er nicht kennt, und vielleicht wird er von jenen Kräften gefordert, welche unsere Welt gestalten. Auch hat er der Welt entsagt, nicht weil er sie nicht mag, wohl aber zugunsten seiner inneren Freiheit. Er hat ihr nur in jener Form entsagt, die anderen Menschen wichtig ist, der äußeren, materiellen Seite, um die Welt in einer tieferen Form wiederzugewinnen.“ Meine Sätze gestalteten sich holprig, und sie konnten nicht dem gerecht werden, was ich von Jeduschin spürte.